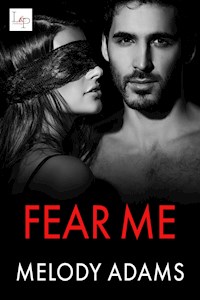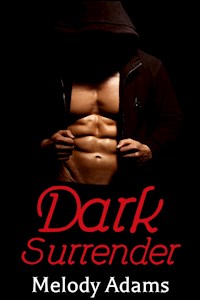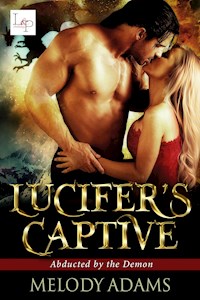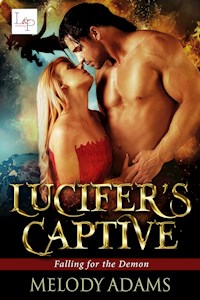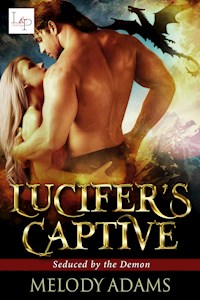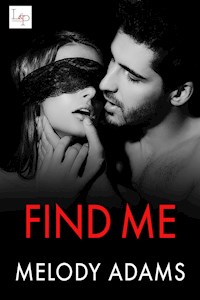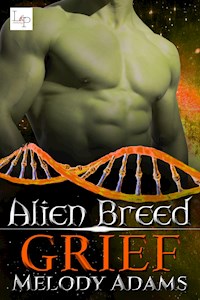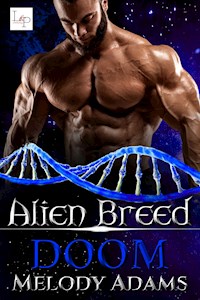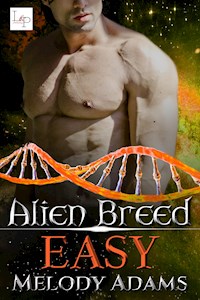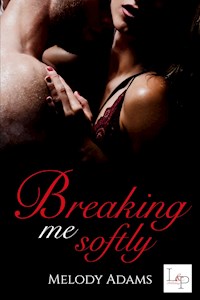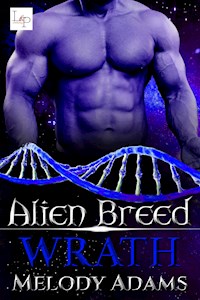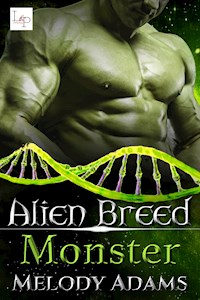
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alien Breed Series
- Sprache: Deutsch
Monster hat keine Ahnung, seit wann er sich in der Sicherheitsverwahrung befand. Nachdem man ihn und seine Brüder aus dem Labor befreit hatte, hatte man sie einfach hierher verfrachtet und offenbar vergessen. Von einem Gefängnis ins Nächste. Die Zustände waren im Laufe der Zeit immer schlimmer geworden, bis Monster und die anderen beschließen, dass sie etwas unternehmen müssen. Doch nach dem erfolgreichen Ausbruch trennen sie sich, um bessere Chancen zu haben, unbemerkt zu bleiben. Auf der Flucht gelangt Monster auf eine einsam gelegene Ranch, wo eine junge Frau allein mit ihrem bettlägerigen Vater lebt. Monsters Biest will die junge Frau besitzen, doch Monster weiß, dass es ihr Leben kosten könnte, wenn er die Kontrolle verlor. Doch je länger er sich in der Gegenwart von Max befindet, desto schwerer fällt es ihm, sein Biest zu unterdrücken. *********** Nach einer gescheiterten Ehe ist Max zufrieden mit der Einsamkeit auf der Ranch ihres Vaters. Sie braucht nichts anderes als die harte Arbeit mit den Tieren, ihren bettlägerigen Vater und Ranger, ihren Hund. Eines Nachts taucht ein seltsames Wesen auf der Ranch auf. Max weiß nur, dass die Kreatur weder Mensch noch Tier ist. Wie sich herausstellt, ist Monster ein Alien und er ist auf der Flucht. Der riesige Alien jagt Max Angst ein, doch da ist auch eine seltsame Anziehung zwischen ihnen. Eine Anziehung, der sie laut Monsters Aussage nicht nachgeben dürfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contents
Titel
Copyright
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Epilog
Monster
Alien Breed Series Buch 38
Melody Adams
Science Fiction Romance
Monster
Alien Breed Series Buch 38
Melody Adams
Deutsche Erstausgabe 2021
Love & Passion Publishing
www.lpbookspublishing.com
copyright © 2021 by Melody Adams
© Cover Art by CMA Cover Designs
Alle Rechte vorbehalten.
Alle Personen und Gegebenheiten in diesem Buch sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit noch lebenden oder bereits verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Monster hat keine Ahnung, seit wann er sich in der Sicherheitsverwahrung befand. Nachdem man ihn und seine Brüder aus dem Labor befreit hatte, hatte man sie einfach hierher verfrachtet und offenbar vergessen. Von einem Gefängnis ins Nächste. Die Zustände waren im Laufe der Zeit immer schlimmer geworden, bis Monster und die anderen beschließen, dass sie etwas unternehmen müssen. Doch nach dem erfolgreichen Ausbruch trennen sie sich, um bessere Chancen zu haben, unbemerkt zu bleiben. Auf der Flucht gelangt Monster auf eine einsam gelegene Ranch, wo eine junge Frau allein mit ihrem bettlägerigen Vater lebt. Monsters Biest will die junge Frau besitzen, doch Monster weiß, dass es ihr Leben kosten könnte, wenn er die Kontrolle verlor. Doch je länger er sich in der Gegenwart von Max befindet, desto schwerer fällt es ihm, sein Biest zu unterdrücken.
Nach einer gescheiterten Ehe ist Max zufrieden mit der Einsamkeit auf der Ranch ihres Vaters. Sie braucht nichts anderes als die harte Arbeit mit den Tieren, ihren bettlägerigen Vater und Ranger, ihren Hund. Eines Nachts taucht ein seltsames Wesen auf der Ranch auf. Max weiß nur, dass die Kreatur weder Mensch noch Tier ist. Wie sich herausstellt, ist Monster ein Alien und er ist auf der Flucht. Der riesige Alien jagt Max Angst ein, doch da ist auch eine seltsame Anziehung zwischen ihnen. Eine Anziehung, der sie laut Monsters Aussage nicht nachgeben dürfen.
Prolog
Monster
Adrenalin raste durch meine Blutbahnen, als ich darauf wartete, dass die Wache das Gas in meine Zelle leiten würde, um mich auszuschalten, damit die wöchentliche Reinigung meiner Zelle stattfinden konnte. Würde der Plan gelingen? Nach sechs Minuten würden die Ventilatoren das Gas wieder aus meiner Zelle heraussaugen. Erst dann würden die Menschen meine Zelle betreten. Seit Wochen hatte ich geübt, meinen Atem zu halten. Seit ein paar Tagen hatte ich es geschafft, die sechs Minuten Grenze zu überwinden. Doch es war wirklich die Grenze. Wenn es auch nur ein wenig länger als sechs Minuten dauerte, bis das Gas verschwand, würde ich es nicht schaffen. Dann müsste ich es die Woche darauf erneut versuchen. Wenn notwendig, dann würde ich es so lange versuchen, bis es klappte. Ich konnte nicht länger hier eingesperrt bleiben. Ich wurde verrückt in dieser Zelle. Allein. Als man unser Labor gefunden hatte, hatte man uns Freiheit versprochen. Einer von uns, der als Kind aus dem Labor geflohen war, hatte die Alien Breeds auf unsere Spur geführt. Wir sollten auf einen anderen Planeten gebracht werden, wo wir mit den Alien Breeds und ein paar wenigen Menschen leben sollten. Doch dazu war es nie gekommen. Nachdem Dread ausgerastet war und zwei Wachen getötet hatte, hatte man uns als zu gefährlich eingestuft. Man hatte uns in diese neue Anlage verschafft. Am Anfang war es nicht so schlecht gewesen. Wir hatten einen großen Garten und Gemeinschaftsräume, Pool und Sportmöglichkeiten. Doch dann hatte sich die Leitung der Anlage geändert, nachdem Madeline, unsere vorherige Leiterin, an einem Infarkt gestorben war. Der neue Leiter, Mr. Brown, hatte uns alle Freiheiten genommen. Wir durften unsere Zellen nicht mehr verlassen. Ich hatte seit Monaten keinen Kontakt mehr mit meinen Brüdern gehabt. Ich wusste nicht einmal, ob sie noch lebten.
Ein Zischen riss mich aus meinen Gedanken. Das Gas. Ich hielt die Luft an, dabei mein Gesicht von der Kamera fernhaltend. Ich wollte nicht, dass die Menschen wussten, was ich tat. Nach etwa drei Minuten tat ich so, als wenn das Gas mich ausgeschaltet hatte und sank auf meinem Bett zusammen. Ich hatte alle meine Körperfunktionen runter gefahren. Es war die einzige Möglichkeit, wie ich so lange den Atem anhalten konnte. Das Zischen verklang. Dann sprangen die Ventilatoren an. Ich spürte, wie ich meine Grenze erreichte, doch ich wusste nicht, ob es schon sicher war zu atmen oder nicht. Das Einzige, was ich wusste, war die Länge der Gaszufuhr. Zwei Wachen hatten darüber diskutiert, ob die sechs Minuten ausreichend war, um sicherzustellen, dass wir wirklich ausgeschaltet waren. Eine der Wachen hatte Angst, dass wir lernten, den Atem lange genug anzuhalten. Das Gespräch hatte mir erst die Idee gegeben, genau das zu versuchen. Als ich spürte, dass ich jeden Moment ohnmächtig werden würde, holte ich langsam ein wenig Luft. Mir war ein wenig schwindelig, doch das kam hoffentlich von der langen Atemnot und nicht von Resten des Gases. Ich atmete so flach wie möglich, damit niemand bemerken würde, dass ich nicht bewusstlos war. Dann hörte ich endlich, wie die Tür sich öffnete.
„Hör endlich auf zu jammern, Teddy“, sagte eine der Wachen. „Du und deine Angst, dass die Viecher lernen könnten, den Atem lange genug anzuhalten. Niemand kann sechs Minuten den Atem anhalten. Glaub mir.“
„Aber, diese...“
„Da! Siehst du? Der ist ausgeschaltet. Nun komm und hilf mir, ihn ins Labor zu schaffen. Der neue Doktor kann es nicht erwarten, seine Hände an diesen hier zu legen.“
„Ich verstehe nicht, warum man immer noch versuchen will, mehr von den Viechern zu schaffen“, jammerte die andere Wache, die Teddy genannt wurde. „Ich hab Albträume, seit ich diesen verdammten Job angefangen hab.“
„Du bist ein Angsthase“, schnaubte die andere Wache.
Jemand boxte mir hart in die Seite. Ich schaffte es, keinen Laut von mir zu geben, obwohl ich nichts lieber getan hätte, als dem Bastard die Kehle auszureißen.
„Siehst du?“, sagte der Mann mit einem Lachen. „Der ist vollkommen weg. Also komm! Fass mit an!“
Ich wurde an Armen und Beinen gepackt und auf etwas Hartes gelegt. Dann bewegte sich die Unterlage, auf der ich lag. Ich hörte das leise Quietschen der Rollen, als man mich aus meiner Zelle rollte. Ich stellte mich noch immer bewusstlos. Ich wollte sehen, wohin sie mich brachten. Ich hatte nicht gewusst, dass man offenbar noch immer an uns herum experimentierte. Alles, was ich gewusst hatte, war, dass man uns ausknockte, um unsere Zellen zu reinigen. Offenbar war das nur die halbe Wahrheit gewesen. Ärger kochte in mir, doch ich zwang mich reglos dazuliegen, während dieser Teddy jammerte, was für Albträume wir ihm gaben. Ich grinste in mich hinein, als ich daran dachte, wie seine Albträume schon sehr bald Wirklichkeit werden würden.
Kapitel 1
Maya
Mit einem unangenehmen Magengrimmen drückte Maya den Knopf, um die Verbindung nach Eden herzustellen. Es dauerte eine Weile, bis das Gesicht von Darkness auf dem Bildschirm erschien.
„Hallo, Maya. Was gibt es? Sag mir nicht, ihr habt ein neues Labor entdeckt?“
„Nein“, erwiderte Maya seufzend. „Ich wünschte, es wäre das.“
„Was ist es denn?“
„Es gab einen Ausbruch.“
„Einen Ausbruch? Ich verstehe nicht.“
„Erinnerst du dich an die Vollblutaliens, die wir in der Hochsicherheitseinrichtung gelassen haben, weil sie selbst für das Camp zu gefährlich waren?“
„Fuck. Ja, ich erinnere mich. Bitte sag mir nicht, dass wir einen gefährlichen Alien auf der Flucht haben.“
„Nein, Darkness. Nicht einen. Alle.“
„WAS?“
„Das Task Team ist bereits dabei, sie zu jagen, doch wir brauchen dringend Unterstützung.“
„Okay. Ich werde mich in einer Stunde zurückmelden, um zu sehen, wen ich dir schicken kann.“ Darkness fuhr sich mit der Hand durch die Haare. „Fuck! Was für eine Katastrophe.“
„Das kannst du laut sagen“, seufzte Maya.
„Beim Ausbruch...“, sagte Darkness. „Gab es...?“
„Zwei Wachen tot, sechs verletzt, davon zwei kritisch.“
„Fuck! Fuck! Fuck! Okay, ich melde mich zurück.“
Darkness unterbrach die Verbindung und Maya lehnte sich in ihrem Sessel zurück und seufzte. Ja, Darkness hatte recht. Der Ausbruch war eine Katastrophe. Sie konnten nur hoffen, dass sie die geflohenen Aliens einfangen konnten, bevor sie mehr Schaden anrichten konnten.
Darkness
Für einen Moment saß Darkness reglos in seinem Sessel, als er die Neuigkeiten zu verarbeiten versuchte. Drei Vollblutaliens auf der Flucht. Zwar lag die Hochsicherheitsanlage fern von allen Siedlungen, doch früher oder später würden die Aliens auf Menschen treffen. Es war nur eine Frage der Zeit. Zu seiner Schande musste Darkness sich eingestehen, dass er seit einer Weile keinen Gedanken mehr an die Aliens verschwendet hatte. Vielleicht hätte der Ausbruch verhindert werden können, wenn die ABU ein besseres Auge auf sie gehabt hätte. Stattdessen hatten sie die Aufsicht und Betreuung Menschen überlassen. Dies war offensichtlich ein Fehler gewesen. Ein Fehler, der das Leben von zwei Menschen gekostet hatte und vielleicht noch mehr Leben fordern würde, wenn sie die Aliens nicht schnell wieder einfangen konnten. Darkness fluchte leise, dann drückte er den Knopf der Sprechanlage.
„Tiny?“
„Ja?“, kam die Antwort seiner Gefährtin.
„Ich brauche Hunter, Ice und Tohopka in meinem Büro ASAP!“
„Okay. Ich seh was ich tun kann, doch ich kann nicht garantieren, wie schnell ich dir Ice und Tohopka liefern kann.“
„Warum?“
„Sie sind zum Camp geflogen, um einen der SPs abzuholen. Holly hat Ravage das okay für den Transfer gegeben. Er hat alle psychologischen Tests bestanden.“
„Okay, aber schick sie zu mir, sobald sie zurück sind“, sagte Darkness mit einem Seufzen.
„Okay. Ich versuche, ob ich herausfinden kann, wo sie sich im Moment befinden. Sie könnten schon auf dem Rückflug sein.“
„Okay, danke, Baby.“
„Was ist geschehen?“, fragte seine Gefährtin. „Du brauchst einen Fährtenleser und den Alien. Das scheint mir nichts Gutes zu bedeuten.“
„Du hast recht“, seufzte Darkness. „Ich hab gerade mit dem Task Force gesprochen. Die drei Aliens auf der Erde sind ausgebrochen.“
Tiny stieß einen erschrockenen Schrei aus.
„Oh nein. Das klingt nicht gut.“
„Ja, das kannst du laut sagen“, sagte Darkness. „Es ist eine Katastrophe. Zwei Wachen sind tot, mehrere in kritischer Verfassung. Ganz zu schweigen von den möglichen Opfern, wenn die drei auf Menschen treffen. Besonders Dread. Er ist extrem aggressiv. Grief wird sich wahrscheinlich eher irgendwo verstecken. Und Monster. Er ist etwas besonnener als Dread, doch auch weit davon entfernt, als zivilisiert zu gelten.“
„Okay“, sagte Tiny, nachdem ein Piepsen durch die Verbindung zu hören war. „Hunter ist auf dem Weg. Ich kontaktiere jetzt das Camp. Ich melde mich, wenn ich was weiß.“
„Danke, Baby. Ich hab dich lieb.“
„Ich dich auch.“
Tohopka
Der neue Aufseher der Anlage gefiel Tohopka gar nicht. Etwas war faul an diesem Kerl. Auch die Erklärung, warum seltsamerweise alle Überwachungsvideos vom Tag des Ausbruchs zerstört waren, klang mehr als unglaubwürdig. Mr. Brown verbarg etwas. Er wollte nicht, dass sie herausfanden, was an dem Tag tatsächlich geschehen war.
„Etwas stinkt hier zum Himmel“, sprach Hunter seine eigenen Gedanken laut aus.
„Ja, das Gefühl habe ich auch“, stimmte Ice zu.
„Wir werden herausfinden, was hier gelaufen ist. Doch zuerst müssen wir versuchen, die drei Aliens wieder einzufangen“, sagte Tohopka.
„Wenn wir Brown allein lassen, wird er nur alle Beweise zerstören“, gab Ice zu bedenken.
„Wir werden die gesamte Anlage unter Bewachung stellen, und Brown und der Rest des Personals werden keinen Zutritt haben, bis wir die Sache aufgeklärt haben“, sagte Tohopka grimmig. „Informiere das Task Team. Sie sollen sich drum kümmern.“
Monster
Ich stand im Schutz der Bäume als ich auf das Haus vor mir starrte. Seit ich aus meinem Gefängnis ausgebrochen war, war ich vier Tage durch die Wildnis gewandert, ohne auch nur eine Seele zu sehen. Bis ich Lichter in der Dunkelheit ausgemacht hatte und ihnen bis hierher gefolgt war. Dies war das erste Anzeichen von Zivilisation. Okay, Zivilisation war vielleicht ein wenig übertrieben, denn das Haus schien das Einzige in der Gegend zu sein. Es gab zwei Gebäude, doch von dem, was ich riechen konnte, gab es nur in dem Haus vor mir Menschen. In dem anderen Gebäude befanden sich irgendwelche Biester, die einen strengen Geruch abgaben. Ich hatte Filme gesehen von den verschiedenen Biestern, die Menschen sich als Nahrung oder als Familienmitglied hielten, doch auch wenn ich wusste, wie diese Biester aussahen, so hatte der Fernseher mir nicht gezeigt, wie sie rochen. Somit konnte ich die Biester in dem Nebengebäude nicht benennen. Doch sie mussten zu der Kategorie Biester für Nahrung gehören, da sie nicht mit den Menschen im Haus lebten. Ein lautes Geräusch kam plötzlich aus dem Haus. Und drohendes Knurren. Ich kramte in meinem Kopf nach dem Namen der Kreatur, die solchen Lärm machte. Dann fiel es mir ein. Es war ein Hund. Hunde lebten mit Menschen im Haus, denn sie waren die andere Kategorie von Biestern. Die, welche die Menschen als Familienmitglied hielten. Eine Stimme war zu hören, die Stimme eines Weibchens.
„Was ist es, Ranger? Ist jemand da draußen?“
Die Tür öffnete sich und eine Frau stand im Lichtschein, suchend in die Dunkelheit starrend, doch ich wusste, dass sie mich nicht sehen konnte. Die Augen der Menschen waren nicht gut für die Dunkelheit. Doch das Biest – Korrektur: der Hund – konnte mich sowohl sehen als auch riechen. Er schoss bellend und knurrend aus dem Haus auf mich zu.
„Ranger!“, rief das Weibchen besorgt.
Ich knurrte, als der Hund näher kam. Der Hund verharrte und winselte, als er den Schwanz zwischen seine Hinterbeine einkniff. Er hatte erkannt, wer von uns hier das gefährlichere Biest war.
„Ranger!“, rief das Weibchen erneut. „Komm zurück. Ich hole mein Gewehr.“
Max
Ranger war bellend und knurrend aus dem Haus gerannt und in der Dunkelheit verschwunden. Ich fragte mich, was er gerochen haben könnte. Ich bereute es, dass ich die Tür geöffnet hatte, ohne zuerst mein Jagdgewehr zu holen. Und ich bereute, dass ich Ranger nicht festgehalten hatte. Als ein Knurren erklang, welches eindeutig nicht zu Ranger gehörte, und Ranger winselte, spürte ich echte Angst in meine Glieder kriechen. Angst um meinen Hund. Ranger mochte das Herz eines Pitt-Bulls haben, doch er war nur ein kleiner Jack Russel. Falls sich ein Kojote dort draußen befand, wäre Ranger klar im Nachteil.
„Ranger!“, rief ich erneut. „Komm zurück. Ich hole mein Gewehr.“
Ranger blieb stumm. Dass er nicht kläffte, war kein gutes Zeichen und ich machte mir jetzt wirklich Sorgen. Das Winseln war das Letzte gewesen, was ich gehört hatte. Es war kein Schmerzenslaut gewesen, nur ein Winseln der Angst. Wenn ihm was geschehen wäre, hätte ich sicher ein Jaulen hören müssen, oder nicht?
„RANGER!“, rief ich schärfer.
Ranger kam aus dem Gebüsch. Er hatte den Schwanz eingekniffen. Doch zu meiner Erleichterung schien er unverletzt.
„Komm her, Ranger. Komm!“