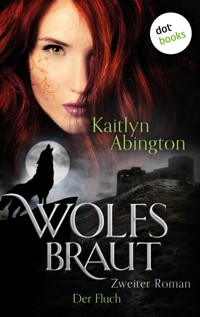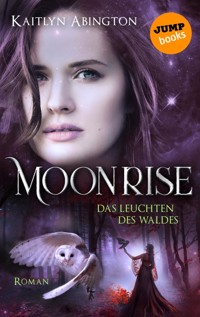Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Übernatürlich schön! Der Romantic-Fantasy-Sammelband »Moonlight« von Bestseller-Autorin Kaitlyn Abington jetzt als eBook bei dotbooks. Umgeben von tiefen Wäldern wächst Prinzessin Lynn von Alba im Landschloss ihrer Familie auf. Bald soll sie ihre große Liebe, Lord Duncan, heiraten. Doch jede Nacht wird sie von demselben Albtraum heimgesucht. Als eine der grauenhaften Bestien aus ihrem Traum auf dem Schloss sein Unwesen treibt, flieht sie Hals über Kopf in den Wald und läuft einem Fremden mit wunderschönen Wolfsaugen in die Arme. Und obwohl sie Duncan von Herzen liebt, fühlt Lynn sich schon bald zu ihrem geheimnisvollen Begleiter hingezogen. Nach und nach muss Lynn erkennen, dass ihr bisheriges Leben ein einziges Lügengebilde ist. Selbst ihren eigenen Erinnerungen kann sie nicht mehr trauen. Doch wird sie ihrer wahren Bestimmung gewachsen sein? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Romantic-Fantasy-Sammelband »Moonlight – Ein Flüstern in der Finsternis« von Kaitlyn Abington. Dieses eBook ist auch unter dem Titel »Wolfsbraut« bekannt. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1241
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Umgeben von tiefen Wäldern wächst Prinzessin Lynn von Alba im Landschloss ihrer Familie auf. Bald soll sie ihre große Liebe, Lord Duncan, heiraten. Doch jede Nacht wird sie von demselben Albtraum heimgesucht. Als eine der grauenhaften Bestien aus ihrem Traum auf dem Schloss sein Unwesen treibt, flieht sie Hals über Kopf in den Wald und läuft einem Fremden mit wunderschönen Wolfsaugen in die Arme. Und obwohl sie Duncan von Herzen liebt, fühlt Lynn sich schon bald zu ihrem geheimnisvollen Begleiter hingezogen. Nach und nach muss Lynn erkennen, dass ihr bisheriges Leben ein einziges Lügengebilde ist. Selbst ihren eigenen Erinnerungen kann sie nicht mehr trauen. Doch wird sie ihrer wahren Bestimmung gewachsen sein?
Dieses eBook ist auch unter dem Titel »Wolfsbraut« bekannt.
Über die Autorin:
Kaitlyn Abington ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin. Nach ihrem Studium der Germanistik, Pädagogik, Theologie und Kunstgeschichte hat sie unter ihrem Klarnamen mehrere erfolgreiche Krimis, historische Romane und Kinderbücher veröffentlicht.
***
eBook-Sammelband-Originalausgabe Juni 2019
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Copyright © sämtlicher Originalausgaben 2015, 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut, Atelier für Gestaltung, Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © Shutterstock / Ase / justdd und © Pixabay / Pradasgarcia
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ca)
ISBN 978-3-96148-712-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Moonlight« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Kaitlyn Abington
Moonlight – Ein Flüstern in der Dunkelheit
Fünf Romane in einem Band
dotbooks.
Band 1: Der Traum
Kapitel 1
Lynn
Mein Puls hämmerte. Ich starrte in die Finsternis.
Mein Atem ging flach, während mir das Blut in den Ohren rauschte.
Was hatte mich geweckt?
Diese verdammte Stille!
Was war mit der Funzel auf meinem Nachttisch passiert? War sie von allein erloschen? Oder hatte sie jemand gelöscht? Kaum denkbar. Aber dann schoss mir eine wirre Erinnerung ins Bewusstsein, eigentlich war es nicht viel mehr als der Nachklang eines komischen Gefühls, als ob ein Fremder mitten in der Nacht hier in meinem Zimmer gewesen wäre. Eine irritierende Vorstellung: Ich fühlte, dass da jemand war, der nicht hergehörte, und im nächsten Augenblick – bin ich wohl wieder eingeschlafen. Aber – war das in dieser Nacht gewesen? Ich war mir nicht sicher, ich war mir absolut nicht sicher.
Vielleicht war es nur ein Albtraum. Schließlich konnte niemand so ohne weiteres bei mir eindringen.
Irgendwie beruhigten mich diese Überlegungen nicht. Im Gegenteil. Auf einmal stieg die Erinnerung an eine furchtbare Angst in mir auf und mir wurde siedend heiß.
Warum konnte ich mich nicht genauer erinnern?
Die Dunkelheit lastete wie eine zentnerschwere Decke auf mir, presste mich aufs Bett und hielt mich umklammert.
Jetzt war es nicht mehr ganz so still. Irgendetwas tat sich draußen auf dem Flur. Es hörte sich wie ein Scharren an, das sich langsam näherte. Es stoppte genau vor meiner Tür. Aus dem Scharren wurde ein Kratzen. Und dann folgte ein rasselndes Keuchen.
Mir wurde eiskalt.
Von draußen drang ein Knurren herein, tief, kehlig – nein, nicht von draußen, der Laut kam von hier, hier aus meinem Zimmer. Das war kein Albtraum. Ich war wach, ich war bestimmt wach und da knurrte es neben meinem Bett ...
Mein Verstand setzte aus. Die Angst überlief mich wie loderndes Feuer und versengte mir den Atem. Ich wollte schreien, aber es war, als drückte mir die Dunkelheit die Kehle zu. Ich konnte nur leise wimmern, dann schwanden mir die Sinne. Ich merkte kaum, wie mein Bewusstsein in einer Ohnmacht davonglitt.
Als ich das nächste Mal erwachte, kroch grau die Morgendämmerung durch einen Spalt zwischen den Vorhängen ins Zimmer. Ich fühlte mich, als wäre ich die ganze Nacht gerannt und gerannt – genauer gesagt, vor etwas davongerannt. Jeder Muskel tat weh, sogar mein Nacken schmerzte, als ich zu dem Tischchen neben meinem Bett spähte. Ein halbes Jahr zuvor hatte ich das hübsche Kirschholztischchen auf dem Dachboden entdeckt und war direkt stolz darauf gewesen, es in mein Zimmer geschleppt zu haben. Allerdings hatte ich mir damit zwei Tage Zimmerarrest eingehandelt, weil ich unerlaubt auf dem Dachboden herumgestöbert hatte. Ich wusste bis dahin nicht, dass der Dachboden eine Art Sperrzone darstellte.
Auf der Platte stand das Glas mit meinem gewohnten Abenddrink, der einen eigenartigen Grünschimmer angenommen hatte. Eklig.
Ich starrte das Glas an und konnte dabei kaum einen klaren Gedanken fassen. Eadha würde ihr übliches Geschrei machen, wenn sie entdeckte, dass ich die Milch nicht getrunken hatte. Das kam bei meiner Schusseligkeit alle paar Monate mal vor. Schon deshalb streckte ich halbherzig die Hand nach dem Glas aus – und zuckte zurück.
Neben dem Glas entdeckte ich das erloschene Nachtlicht. Ich liebte diese kleine Funzel, die dazu diente, meine Albträume in Schach zu halten.
Ich nahm das Lämpchen vom Tisch und schüttelte es sacht. Es war noch Öl darin, ich hörte es gluckern. Von allein konnte es nicht erloschen sein.
Ich stellte die Lampe zurück und strich mir über die schweißnasse Stirn.
Ohne mir ganz klar zu sein, was ich tat, griff ich nach dem Glas. Gerade, als das Getränk meine Lippen benetzte, stieg mir ein leicht modriger Geruch in die Nase. Dennoch war mein Durst so groß, dass ich einen kleinen Schluck nahm, einen sehr kleinen Schluck, den ich sofort bereute, dabei schmeckte das Zeug beinahe wie sonst, das hieß, es lief brennend die Kehle hinunter. Aber der Ekel war nicht mehr zu bremsen. Nicht mal das Aroma von frischen Erdbeeren, mit denen Eadha das Getränk versetzt hatte, vertrieb die faulige Unternote.
Ich schüttelte mich und stellte das Glas zurück auf das Tischchen neben die erloschene Lampe.
Was für ein scheußlicher Tagesanfang.
Dabei war es kein Tag wie jeder andere. Als mein Blick auf das Kleid fiel, das mir gegenüber am Schrank hing – ein Möbel, in dem sich ein Dutzend Einbrecher hätte verstecken können –, fiel mir ein, welch besondere Bedeutung dieser Tag für mich hatte.
Es handelte sich um ein Ballkleid aus himmelblauer Seide, über und über mit seltenen kleinen Perlen bestickt. Die Taille war tief angesetzt und darunter bauschte sich der Rock über sehr viel Tüll. Das enge Oberteil war so tief ausgeschnitten, dass der Ansatz des Busens enthüllt wurde – eines allerdings nicht gerade aufregenden Busens. Ich hätte gern mehr gehabt: genug, um die Blicke von meinem runden Puddinggesicht abzulenken.
Auf einmal durchströmte mich ein Glücksgefühl.
Wenn ich überhaupt einen Wunsch hatte – außer dem, nicht mehr von Albträumen heimgesucht zu werden –, dann den, mit Duncan am Abend den Ball zu eröffnen.
Vor lauter Sehnsucht seufzte ich seinen Namen. Ich wusste, dass er bereits eingetroffen sein musste, wenn auch zu spät, um ihn noch zu begrüßen. Außerdem bezweifelte ich, dass er mitten in der Nacht Wert auf meine Begrüßung gelegt hätte. Wahrscheinlich war er von Dùn Èideann bis hierher gehetzt und sofort todmüde ins Bett gefallen.
Genüsslich stellte ich mir vor, wie sich seine Augen vor Bewunderung weiteten, wenn ich in meinem Kleid die Treppe herabschwebte, die von einer Galerie im ersten Stock direkt in den über zwei Stockwerke reichenden Ballsaal hinabführte. Sehr viel wahrscheinlicher war aber, dass ich in meinen neuen Schuhen mit den hohen Hacken stolperte und die halbe Treppe hinabfiel.
Lord Duncan war der schönste Mann, den ich in meinem Leben gesehen habe. Bei jeder Begegnung wurden mir die Knie weich und das Herz tat weh. Trotz der irrsinnigen Verliebtheit machte ich mir nichts vor. Ein wohlbekannter Schmerz meldete sich in meiner Brust. Man musste uns ja nur zusammen sehen. Und außerdem: Duncan war elf Jahre älter als ich. Gegen ihn war ich bloß ein Kind, zumindest gab mir hier jeder dieses Gefühl – und er leider auch.
Aber jetzt betrug der Altersabstand rein rechnerisch nur noch zehn Jahre, fiel mir ein, denn heute war mein sechzehnter Geburtstag. War das wirklich der sechzehnte? Hatte ich den nicht letztes Jahr schon gefeiert?
Irgendwie trat ich altersmäßig auf der Stelle. Oder nicht? Zumindest kam es mir so vor.
Was das nicht völliger Blödsinn? Aber wieso beschäftigte mich dann so etwas?
»Dacht’ ich’s mir, du bist wach«, unterbrach Eadhas Stimme meine Gedanken.
Rasch schloss ich die Augen und drehte den Kopf zur Seite, um das Gegenteil zu beweisen. Ich hatte sie nicht hereinkommen gehört.
»Hier ist dein Frühtrank«, fuhr Eadha unbeirrt fort. »Setz dich auf und plempere nicht damit rum wie gestern Morgen.«
Unwillig beäugte ich das Glas in ihrer Hand. Die Flüssigkeit schimmerte bläulich, und ich tippte auf Blaubeeren als Geschmackszutat. Ich mochte Blaubeeren, aber nicht jeden zweiten Morgen. Irgendwann musste mal Schluss damit sein. Warum nicht heute?
»Ich will Kaffee«, krächzte ich. »Schwarz, ohne Milch und Zucker. Ich hab nachgerechnet, ich bin sechzehn. Seit heute.«
Eadha beäugte mich verblüfft, dann lachte sie kehlig auf. Inzwischen hatte sie das Bett erreicht und hielt mir gebieterisch das Glas entgegen. »Solange ich für dich verantwortlich bin, trinkst du das hier. Kaffee ist was für Erwachsene. Ich hab dich letzte Nacht nicht schreien gehört.«
Eadhas Blick wurde lauernd. Für mich war sie, seit ich mich erinnern konnte, sowohl Kindermädchen als auch persönliche Dienerin. Sie schlief immer noch im Nebenzimmer, und die Verbindungstür blieb nachts angelehnt. Diese Angewohnheit aus Kindertagen sollte ich endlich abschaffen, bloß war ich bisher zu träge dazu gewesen. Ich konnte mich einfach nicht dazu aufraffen, nachdrücklicher zu erklären, dass ich nicht mehr wie eine Fünfjährige behandelt werden wollte.
Ich wusste nicht, was an diesem Tag mit mir los war. Normalerweise dachte ich nicht so viel nach. Längere Zeit nachzudenken, machte mich hundemüde. Und dann erst erfasste ich Eadhas letzte Bemerkung so richtig.
Mit einem leisen Ausruf des Erstaunens legte ich die Hand an die Kehle. »Jetzt weiß ich’s. Ich hatte ...« Ich suchte nach den passenden Worten. Allein schon die Erinnerung ließ Panik aufkommen, die ich aber notdürftig unterdrückte. »Es ist vorbei«, sagte ich schließlich gefasst. »Mit sechzehn hat man keine Albträume mehr.« Wieder so eine dumme Bemerkung.
Eadha hatte die Augen zu Schlitzen zusammengekniffen, hielt den Kopf schräg und betrachtete mich forschend. In den letzten Jahren war sie ganz schön dick geworden. Sie hatte ein breiteres Gesicht als ich. Sein meist gutmütiger Ausdruck flößte Vertrauen ein und täuschte glatt darüber hinweg, dass sie mich liebend gern herumkommandierte.
»Keine Albträume mehr«, wiederholte ich nüchtern. »Das hoffe ich wenigstens«, schob ich zögernd nach. Mit einem Schaudern drängte ich die Erinnerung an die letzte Nacht noch tiefer in die Schatten des Vergessens.
Eadhas Blick wurde stechend. »Du hast nicht von riesigen Wölfen geträumt, die dich durchs Schloss jagen und am Ende kriegen und zerreißen?«
Unversehens sah ich es deutlich vor mir:Gelb glühende Augen über mir, ein mächtiger, weit aufgerissener Kiefer, blutige Lefzen, Geifer, der aus der Schnauze auf mein Gesicht tropft, und dieses Knurren …
Meine Augen hatten sich geschlossen, ich riss sie aber wieder auf, um den grauenhaften Bildern zu entgehen. Ein unkontrollierbares Zittern befiel mich.
»Nein, hab ich nicht«, krächzte ich entsetzt.
»Trink!« Resolut hielt mir Eadha wieder das Glas entgegen.
»Und was ist das da?« Eadha hatte das fast volle Glas vom Abend auf dem Tisch entdeckt. Anklagend wies sie mit der freien Hand darauf. »Wie oft habe ich dir gesagt, dass dieses Getränk wichtig für deine schwache Gesundheit ist? Na? Ist das zu viel verlangt, morgens und abends ein Glas davon zu trinken, damit du gesund und bei Verstand bleibst?«
Ich hörte gar nicht richtig zu, so oft hatte sie das schon zu mir gesagt. Aber auf einmal erstarrte ich.
»Was ist?« Eadha betrachtete mich misstrauisch.
»Der Schuh der Glücksfee ist nicht mehr da«, flüsterte ich und strich mir über die Kehle, tastete sogar mehrmals den Hals bis zur Brust ab.
Zu meiner Verblüffung schwankte Eadhas Hand, die das Glas hielt. Etwas Flüssigkeit schwappte heraus und ergoss sich auf meine Bettdecke. Eadha hatte den Kopf gesenkt, als ob sie verbergen wollte, was in ihr vorging. Aber dann hob sie ihn und runzelte die Stirn.
»Na, und? Wahrscheinlich ist das Band gerissen, als du dich die ganze Nacht im Bett herumgewälzt hast. Du wirst deinen Anhänger wiederfinden, und wenn nicht, ist es auch egal. Mach dich nicht lächerlich. Ein Schuh der Glücksfee! So was gehört zur Kindheit, und deine ist ab heute vorbei. Sagst du ja selbst.« Ein leichter Anflug von Hinterhältigkeit huschte über ihr Gesicht, so rasch, dass ich ihn für Einbildung halten konnte. Leider war es fast immer schwierig für mich, Einbildung und Wirklichkeit auseinander zu halten. Sobald ich anfing, über die Wirklichkeit nachzugrübeln, entglitt sie mir wie in einem Zauberspiegel. Und längeres Nachdenken weckte in mir Ängste und vage Erinnerungen, über die ich lieber nichts Genaues wissen wollte.
Meine Stimme zitterte, als ich wieder sprach. »Du hast recht. Na, dann her mit dem Glas.« Ich wollte es hinter mich bringen. Heute Morgen mit Eadha zu streiten, machte noch weniger Sinn als sonst, denn meistens zog ich doch den Kürzeren.
Ich trank das Glas in einem Zug leer. Nach dem letzten Schluck stellte sich Ekel ein, wie seit Wochen schon. Ich konnte mir diese Reaktion nicht erklären und versuchte, sie sofort zu vergessen. Das hieß, ich würde am folgenden Tag noch einmal um Kaffee bitten – bloß energischer. Wenn ich mich nicht endlich wenigstens bei solchen Lächerlichkeiten wie dem täglichen Zwangsgesöff zur Gegenwehr aufraffte, würde sich nie etwas ändern.
»Ich werde dir jetzt dein Bad bereiten«, sagte Eadha zufrieden, griff nach dem leeren Glas, nahm auch das andere mit und strebte zur Tür. Bevor sie sie erreichte, wandte sie sich um und lächelte mich warmherzig an. »Und was ich noch sagen wollte: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Zu deinem sechzehnten.«
Vermutlich meinte sie es aufrichtig. Das brachte mich dazu, einer weiteren kindlichen Anwandlung nachzugeben.
»Danke, Eadha. Und – der Anhänger war doch nicht wirklich ein Schuh der Glücksfee, oder? Du hast gesagt, es ist einer, aber das war ein Scherz, nicht wahr?« Schließlich sah der Anhänger nicht einmal wie ein Schuh aus, sondern wie ein formloser Klumpen geschmolzenes Blei. Und Glücksfeen gehörten ins Märchenland. Tatsächlich standen mir zum Lesen seit Jahren nur Märchen- und ein paar Erbauungsbücher zur Verfügung, ich kannte sie alle in- und auswendig. Ich war fit in Sachen Märchen und Legenden, zeitweise regelrecht fixiert darauf. Aber dass ich nun diese Frage stellte, musste Eadha davon überzeugen, dass mich die übliche Dummheit gepackt hatte und ich den restlichen Tag leicht zu lenken sein würde.
Dennoch: Dieser Klumpen hatte etwas mit meiner Vergangenheit zu tun, mit jener, an die ich mich nicht genau erinnern konnte.
Statt zu antworten, schielte Eadha zum Fenster hinaus. »Es wird ein schöner Tag«, murmelte sie, »und es wird einen klaren Abend und eine Nacht voller Sterne geben. Eine wundervolle Ballnacht.« Ihre Stimme nahm einen drängenden Ton an. »Pass auf, dass du nichts Falsches tust oder sagst, bevor es Nacht wird.« Ohne sich noch einmal umzuwenden, ging sie hinaus und ließ mich ratlos zurück. Was sollte denn diese Drohung bedeuten? War das nur einer ihrer üblichen Einschüchterungsversuche oder war mehr daran?
Sobald ich allein war, begann ich meine Kissen zu durchwühlen auf der Suche nach etwas, das mir auf einmal wieder wichtig und kostbar erschien. Ein kleines Ding, das nicht an einen Schuh erinnerte und das beim Zubettgehen noch dagewesen war.
Was war in der vergangenen Nacht geschehen? Dunkel und unscharf stellte sich eine Erinnerung ein und entglitt mir wieder. Alles, was blieb, war erstaunlicherweise eine vage Vorstellung von Mondlicht und Kühle.
Tatsächlich strich frische Luft durch das angelehnte Fenster herein und fesselte schließlich meine Aufmerksamkeit. Ich glitt aus dem Bett, lief hinüber, riss die Vorhänge zur Seite, stieß die beiden Fensterflügel weit auf und begann gierig die Luft einzuatmen, die mir über das erhitzte Gesicht strich und schließlich unter mein dünnes Nachthemd fuhr. Für einen Moment schloss ich die Augen, um die Erfrischung in vollen Zügen zu genießen. Als ich die Augen wieder öffnete, glitt mein Blick über den weitläufigen Schlossgarten. Rasenflächen bestimmten ihn und hohe alte Bäume, die ihre mächtigen Kronen in den Himmel reckten. Es war ein schönes vertrautes Bild in satten Grüntönen.
Ich meinte, mal etwas von üppigen Rosenbeeten gehört zu haben, die es früher gegeben hatte, von denen aber keine Spur mehr vorhanden war. Es gab nichts Blühendes, nicht einmal das Rhododendrongehölz am Ende des Gartens trieb Blüten. Lediglich ein fahles Gewächs, das sich kriechend am Fuß der Schlossmauern ausbreitete, direkt unterhalb der Fenster, produzierte Rispen giftgelber, scheußlich riechender Blüten, und ich wünschte mir nicht zum ersten Mal, dass die Gärtner das widerliche Zeug endlich ausreißen würden.
Ich starrte hinunter und fing ungläubig an zu blinzeln. Vom taubenetzten Rasen her zog sich eine Spur durch das Gewächs, die direkt unter meinem Fenster endete. Am Abend zuvor hatte es dort keine Spur gegeben, da war ich mir ziemlich sicher. Ich beugte mich weit hinaus. Die Mauern unseres verwinkelten Schlosses bestanden in diesem Trakt aus grauen Natursteinen, zwischen denen breite Mörtelfugen klafften. Für einen geschickten Fassadenkletterer bildeten diese Fugen geradezu eine Einladung. Warum war mir das nicht früher aufgefallen?
Weil ich bisher noch keinen unbekannten nächtlichen Besucher im Schlafzimmer gehabt hatte!
In den Sommernächten standen meine Fenster offen, obwohl Eadha sie jeden Abend sorgfältig schloss. Aber sobald sie das Zimmer verlassen hatte und ich ihr Schnarchen aus dem Nebenraum hörte, riss ich die Fenster trotz der Mückenplage wieder auf und schloss sie erst im Morgengrauen, möglichst bevor Eadha zu mir hereinkam. Im Hochsommer konnte es im Zimmer ganz schön stickig werden.
Jetzt musste ich mich der Frage stellen, ob jemand in der Nacht zwei Stockwerke hochgeklettert und bei mir eingestiegen war.
Der springende Punkt für mich war, ob das Keuchen neben meinem Bett Teil eines Albtraums oder Wirklichkeit gewesen war.
Aufgeschreckt rannte ich zu der Tür, die auf den Flur hinausging, und prüfte, ob sie abgeschlossen war. Ja, diese Tür war verriegelt. Von dort war niemand bei mir eingedrungen. Langsam schloss ich sie auf, drehte mich wieder um und lehnte mich gegen die Tür. Plötzlich meldete sich die Erinnerung mit Macht und löschte jeden Zweifel aus. Jemand war bei mir im Zimmer gewesen, mitten in der Nacht, aber er war vom Garten hereingekommen, nicht vom Flur.
War so etwas möglich, ohne mich zu wecken?
Aber ich war doch wach geworden, oder?
Und was war mit diesen Geräuschen, die vom Flur hereingedrungen waren? Kratzen an der Tür, Knurren.
Einbildung oder Traum?
Meine Erinnerung, die gerade noch so klar gewesen war, verwischte, machte der nur allzu vertrauten Verwirrung und Hilflosigkeit Platz. Halluzinationen, Albträume. Ich hätte einen schwachen Verstand, erklärte mir Eadha immer wieder und oft genug glaubte ich ihr. Aber die Fußspuren draußen waren doch real!
Ich rannte zurück zum Fenster.
Da waren sie, die Spuren, die sich vom Rasen durch das Kraut zogen, klar und deutlich erkennbar.
Die Kühle auf meiner Haut war nicht mehr angenehm und ließ mich schaudern.
Eadha rief.
Wahrscheinlich wollte sie mich mahnen, endlich ins Badezimmer zu kommen. Die Hand auf mein wild pochendes Herz gepresst, versuchte ich, mich zu beruhigen. Schließlich war mir vergangene Nacht ja nichts passiert.
Eadha rief wieder, diesmal eindeutig ärgerlich.
Zitternd und frierend schloss ich das Fenster und nahm mir fest vor, es nie wieder für die Nacht zu öffnen, selbst wenn mich Erstickungsanfälle befielen. Solange sie mich nicht umbrachten, würde ich damit fertig werden. Ich dachte wieder über den Eindringling nach. Was hatte er gewollt?
Auf einer Kommode stand ein hübsches Kästchen mit silbernen Beschlägen, die meine paar Schmuckstücke enthielt. Ich klappte es auf und sah hinein. Es war alles noch da. Ich raffte meinen Morgenrock vom Sessel neben der Kommode und streifte ihn achtlos über. Während ich ihn zuband, fiel mir der verschwundene Talisman wieder ein. Aber wegen dieses wertlosen Dings würde kein Dieb ein Risiko auf sich nehmen. Und außerdem hätte er dann erst mal von der Existenz dieses Anhängers wissen müssen. Hatte mir jemand einen Streich gespielt, der wusste, wie leicht ich in Panik geriet und dass mir der Anhänger etwas bedeutete?
Aber war denn wirklich jemand eingestiegen? Das Parkett schimmerte überall gleichmäßig. Hätte jemand, der von draußen eingedrungen wäre, nicht eine Schmutzspur hinterlassen: etwas Staub, Reste zertretener Blätter und gelber Blüten?
»Das Badewasser wird kalt. Bist du wieder eingeschlafen?« Eadha war in der Tür erschienen.
Ich hatte mich neben dem Kleid an den Schrank gelehnt und antwortete nicht sogleich.
»Was ist? Was trödelst du hier herum?«
»Ich hab ...« Ich schluckte, setzte neu an und versuchte, nicht zu angespannt zu klingen. »Ich hab nur überall nach dem Talisman gesucht, blöd, nicht?«
»Du kriegst ihn wieder«, meinte Eadha, »nichts geht wirklich verloren in dieser Welt.«
Ich zuckte zusammen. Nichts geht wirklich verloren in dieser Welt, klang wie ein Echo, aber es war eine andere Stimme als die Eadhas, die ich innerlich hörte. Eine zärtliche, warme Stimme aus einer tiefen Vergangenheit, die wie durch dichten Nebel zu mir drang. Das war nicht das erste Mal, dass da etwas in mir emporstieg. Bilder, Gesichter, Stimmen, Klänge. Mein Blick verschleierte sich, heftete sich auf den Boden, auf den nun der erste Lichtstrahl der Sonne fiel, und in dieser glänzenden Sonnenbahn meinte ich, den schwachen, kaum erkennbaren Abdruck einer riesigen Pfote wahrzunehmen.
Ein seltsames Schwindelgefühl ergriff von mir Besitz, die Wirklichkeit entglitt mir, Finsternis breitete sich aus und schließlich hörte ich einen furchtbaren Schrei. Meinen eigenen Schrei.
»Trink, trink, Herzchen, gleich geht es dir besser.«
Eadha hielt mir ein Glas an die Lippen und ich trank durstig. Wieder dieses in der Kehle brennende Zeug, diesmal mit einem deutlich bitteren Beigeschmack.
»Danke.« Ich setzte das Glas ab und stellte fest, dass Eadha mich ins Badezimmer geführt und mir bereits aus dem Morgenmantel geholfen hatte. Ich ärgerte mich über mich selbst. Immer diese Schwäche! Aber ich wollte keine Schwäche zeigen, nicht heute, nicht an diesem besonderen Tag. Ich presste eine Hand zur Faust zusammen und grub mir die Nägel ins Fleisch. Der Schmerz sollte mir dabei helfen, einigermaßen beherrscht zu bleiben.
»Kein Albtraum in der Nacht, aber dafür dieser lästiger Schwindel. Wieso überkommt der mich immer wieder? Bin ich krank?«, fragte ich halbwegs gefasst.
»Ich hab’s dir schon oft gesagt, und sag es dir noch mal: Das passiert jungen Leuten, die noch im Wachstum sind. Kein Grund zur Beunruhigung.« Es war großherzig von ihr, dass sie diesmal nicht auf meinen schwachen Verstand hinwies.
Ich sah skeptisch an mir hinunter. »Zehn Zentimeter mehr würden mir schon gefallen. Ich will nicht mein Leben lang so ein Zwerg bleiben.« Das Getränk half wie immer. Ein wenig spürte ich noch das Grauen, aber es begann sich zu verflüchtigen, zusammen mit den verstörenden Erinnerungen. Dankbar glitt ich in das warme Wasser der Wanne.
Als ich eine Stunde später, fertig angezogen für einen kleinen Ausritt, die große Eingangshalle durchquerte, begegnete mir Sir Cormac. Er war ein großer hagerer Mann, stets in Schwarz gekleidet, das durch den strengen Schnitt seines Anzugs umso finsterer wirkte.
Sobald er mich bemerkte, blickte er mich von oben herab an und näselte: »Guten Morgen. Wie ich sehe, wollen Sie ausreiten. In Hosen.« Ein leichter Tadel schwang in seiner Stimme mit, der mich augenblicklich verdross.
Cormac hatte die Oberaufsicht über den Haushalt, mehr aber auch nicht. Mir hatte er eigentlich nichts zu sagen. Versuchte es aber trotzdem immer wieder. Auf seine ganz eigene Weise verstand er es, mir jede Handhabe zu nehmen, mich dagegen zu wehren. Sein leichenfahles, schmales Gesicht zog sich noch mehr in die Länge und die Brauen, die wie ein halbiertes O nach oben geschwungen waren, unterstrichen das zusätzlich. Ich ging dem Mann gern aus dem Weg.
»Ja, Sir Cormac, ein kleiner Ausritt stählt den Körper, wie mein Vater immer sagt. Ist er schon auf?«
»Es ist ja auch noch recht früh.« Cormac stockte, als würde er gewaltsam eine Erinnerung zurückdrängen. Dann fuhr er gelassener fort: »Ich wünsche Ihnen einen schönen Ausritt und ...«, wieder machte er eine Pause, aber diesmal verneigte er sich gemessen, »... und ich wünsche alles Gute zum Geburtstag – wenn ich mir das erlauben darf.«
»Aber natürlich, Sie dürfen.« Ich nickte dem alten Widerling knapp zu und wollte davoneilen, blieb aber, einem plötzlichen Impuls nachgebend, stehen.
»Ist«, ich stockte, »ist Lord Duncan schon hier?« Warum fiel es mir so schwer, seinen Namen vor anderen auszusprechen? Wahrscheinlich, weil ich fürchtete, dass es mir nicht gelang, meiner Stimme einen unbeteiligten Klang zu geben.
Cormac schüttelte bedauernd den Kopf. »Er müsste aber jeden Augenblick eintreffen, das ist sicher.«
»Ganz sicher«, mischte sich eine melodische Stimme ein. »Ich weiß es, er ist lange vor dem Mittagessen da.«
Ich schaute zur Treppe.
Mit unnachahmlich lässiger Grazie kam Fiona, eine Cousine dritten oder vierten Grades von mir die Stufen herab. Wie genau es sich mit unserer Verwandtschaft verhielt, wusste ich nicht und es interessierte mich auch nicht. Es genügte mir vollauf, ein bis zweimal im Jahr ihrem umwerfenden Charme ausgesetzt zu sein.
Ihr Aussehen sprach ganz klar dafür, dass wir nur entfernt verwandt waren. Wir waren uns kein bisschen ähnlich. Fionas Figur wies Kurven an genau den richtigen Stellen auf, dabei war sie beneidenswert groß und sehr, sehr schlank. Gegen ihre aufreizend langen, schönen Beine wirkten meine wie Kartoffelstampfer und mein kupferrotes, unordentliches Lockenhaar neben Fionas glatter, schimmernder schwarzer Haarpracht ähnlich attraktiv wie ein Wischmopp.
Fiona hatte die unterste Stufe erreicht und kam zu mir herüber. Sie trug ein enges dunkelrotes Kleid, das sich wie eine Schlangenhaut an ihre Figur schmiegte.
»Wieso weißt du es?«, fragte ich.
Cormac starrte Fiona unverhohlen bewundernd an, selbst diesen Stockfisch brachte ihr Anblick in Wallung.
»Weil wir uns hier verabredet haben. Heute findet doch dein erster Ball statt, deshalb kommen wir alle.« Fiona bedeutete Cormac mit einem beiläufigen Wink, uns allein zu lassen, und er gehorchte augenblicklich. Mir würde das nie gelingen, selbst wenn ich täglich bis zum Umfallen übte.
Doch was mir im Moment auf der Seele brannte, war etwas ganz anderes: Wie war das mit der Verabredung zu verstehen?
Fiona beugte sich zu mir herab. »Sicher siehst du in deinem Ballkleid entzückend aus. Es ist so ...«
Sie machte eine weit ausholende Handbewegung, um den Umfang des Kleides zu beschreiben, und in dieser Geste lag alles, was mir bisher entgangen war.
Es war ein Kinderkleid, eine blaue Zuckerwattewolke und Fiona selbst hatte mir zu diesem Rüschen- und Tüllunsinn geraten. Es war ihre Idee gewesen, meine pummelige Figur in ungefähr tausend Metern Stoff noch dicker und kindlicher erscheinen zu lassen, während sie ein schlichtes Kleid aus einem glänzenden anschmiegsamen Stoff trug, das allen zeigte, dass sie eine höchst attraktive, erwachsene Frau von zweiundzwanzig Jahren war. Es war überhaupt keine Frage, wem Duncan den Vorzug geben würde.
»Ein weiter Rock ist genau richtig für dich«, fuhr Fiona mit verschwörerischer Miene fort. »Besser als diese Hose, die zeigt, dass du ein bisschen zu viel Speck auf den Hüften hast. Du solltest keine Hosen tragen, glaub mir. Du reitest aus? Vielleicht sollte ich mitkommen?«
Bloß nicht, dachte ich betäubt.
»Aber nein«, beantwortete sie selbst die Frage. »Ich möchte Duncans Ankunft nicht verpassen. Das würde er mir übelnehmen.« Sie senkte den Blick und säuselte: »Und ich möchte ihn nicht gerade heute verärgern.«
Was du mir weismachen willst, stimmt einfach nicht, dachte ich. Mit Sicherheit war es nur einer der üblichen Versuche, mich zu verunsichern und die Oberhand über mich zu gewinnen – was ihr meistens gelang.
Wenn Duncan dich wollte, dachte ich wütend, wärt ihr längst verlobt, schließlich bist du schon über zwanzig. Zweiundzwanzig galt für Frauen aus unseren Kreisen als ziemlich alt für eine Verlobung.
Fiona trug einen auffallenden Ring am Finger, einen breiten goldenen Ring mit einem der höchst seltenen kostbaren Mondsteine. Jetzt drehte sie die Hand so, dass der Stein im Licht, das durch die hohen Fenster der Halle fiel, dunkel aufschimmerte. Sicher erwartete sie, dass ich sie fragte, von wem der Ring stammte.
Aber ich brauchte sie gar nicht zu fragen. Ihre selbstzufriedene Miene sprach Bände.
Duncan hatte Fiona einen Mondsteinring geschenkt? Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Es war ein wunderschöner Stein. Niemand verschenkte einen derartigen Stein ohne besondere Absichten, in diesem Fall Heiratsabsichten.
»Hübscher Ring, ich hoffe, er passt zu deinem Ballkleid«, stieß ich nicht sehr gewitzt hervor. »Verlier ihn bloß nicht, so einen bekommst du nie wieder.« Ich drehte mich um und rannte aus der Halle. All meine Vorfreude auf den Ball war erloschen.
Der Stallhof lag an einer der Schmalseiten des Schlosses hinter einer Mauer, die ihn vom Garten trennte. Ich schlüpfte durch das Tor und blieb stehen. Obwohl es so früh war, herrschte bereits rege Geschäftigkeit. Pferde wurden aus den Ställen geführt, um auf umliegende Weiden gebracht zu werden. Es waren fremde Pferde, die den Besuchern gehörten, die der weiten Anreise wegen einige Tage vor dem Ball eingetroffen waren und im Schloss übernachteten. Entfernte Verwandte wie Fiona. Viele von ihnen kannte ich nicht näher und war froh, keinem von ihnen hier zu begegnen. Diese Leute hatten etwas Einschüchterndes, nicht nur wegen ihrer Größe. Ich war es mehr als leid, dass beinahe jeder auf mich herabsehen konnte. Ich wusste nicht einmal, von woher die Einzelnen angereist waren. Nur wo Fiona am Vortag noch gewesen war, war mir bewusst. Im gleichen Ort wie Duncan. In Dún Èideann.
Nicht allzu weit davon entfernt, in Glenkinchie, hatte ich einige Zeit eine Klosterschule besucht. Die Nonnen waren nett, aber ich war so lange allein gewesen, dass es mir schwer fiel, Anschluss zu finden. Wahrscheinlich hielt mein Rang die anderen Schülerinnen davon ab, sich näher mit mir zu befassen. Sie blieben auf Distanz. Anfangs machte mir das nichts aus, ich hatte so viel nachzuholen, ich saugte das Wissen nur so in mich auf, denn endlich hatte ich einen Unterricht, der diesen Namen auch verdiente. Bis dahin hatte mich ein Hauslehrer unterrichtet, der es teuflisch gut verstand, mich regelmäßig einschlafen zu lassen. Er wusste nicht viel, kaschierte das aber durch endlos lange Sermone mit tausend Wiederholungen, die er in perfekt leierndem Ton vortrug.
Als ich es im dritten Jahr endlich geschafft hatte, mich mit zwei älteren Schülerinnen anzufreunden, war es auf einmal mit dem Unterricht im Kloster vorbei. Damals hatte ich mehr denn je unter Albträumen gelitten. An einem Tag hatte ich mit meinen beiden neuen Freundinnen eine Unterhaltung geführt, an deren Inhalt ich mich bis heute nicht erinnern kann. Nur daran, dass ich angefangen hatte zu schreien, bis eine der Nonnen herbeigerannt kam. Einige Tage später fand ein unangenehmes Gespräch mit dem Lordkanzler persönlich statt, der mir erklärte, dass ich leider in schlechten Umgang geraten wäre. Es wäre unverzeihlich, dass die mit meiner Sicherheit betrauten Personen nicht sorgfältiger auf mich geachtet hätten. Seitdem plagte mich die Frage, auf was für ein schreckliches Geheimnis ich damals gestoßen war.
Das lag über ein Jahr zurück. Einige Wochen hatte ich danach im Stadtschloss von Dún Èideann zugebracht, einem von Türmen und Zinnen gekrönten Bau mit schieferblau schimmernden Dächern, der auf einer Erhebung über der Stadt thronte und der in mir eine nicht zu bekämpfende Beklemmung auslöste. Ich war heilfroh gewesen, als ich in das Landschloss bei Tullibardine, das eigentlich nur eine Sommerresidenz war, zurückkehren durfte, wo ich bereits meine Kinderjahre verbracht hatte.
Woher kam der Albtraum, der sich Nacht für Nacht mit nur geringen Abweichungen wiederholte? Warum träumte ich von einem riesigen Wolf mit blutigen Lefzen? Mein Blick, mehr und mehr nach innen gerichtet, verschwamm, weil sich meine Augen mit Tränen füllten. Um Halt zu finden, war ich einen Schritt zurückgewichen und hatte eine Hand an den Torpfosten gelegt. Der raue Stein war kühl und seltsam tröstlich. Mein verschleierter Blick glitt nach oben. In die Torwölbung war ein Wappen eingemeißelt. Verwittert und grau war es kaum noch zu erkennen. Nur wenn ich mich stark konzentrierte, meinte ich, eine Blume zu sehen, eine Distelblüte.
Ein Ruf ließ mich zusammenschrecken.
»Ich hab dir gesagt, dass sie vor dem zweiten Hahnenschrei auftaucht«, rief eine fröhliche Stimme. »Die Wette hab ich gewonnen.«
Tatsächlich krähte wie zur Bestätigung laut und gellend ein Hahn.
»Du hast ihn abgerichtet, den dämlichen Hahn«, sagte eine andere Stimme kampflustig.
Zwei junge Stallburschen schauten mir entgegen und verneigten sich, als ich rasch in den Hof trat.
»Und um was habt ihr gewettet?«, fragte ich neugierig.
Die beiden schwiegen verlegen.
»Ich kann’s mir denken.« Ich winkte den einen, Gort, der meine Stute Meara am Zügel hielt, näher. »Aber daraus wird nichts. Ich reite allein aus.« Den Entschluss hatte ich eben erst gefasst. Und schon stieß ich damit auf heftigen Widerstand.
»Das, das ... dürfen Sie nicht.« Gort stotterte vor Aufregung. »Das geht auf gar keinen Fall.«
Ich mochte ihn lieber als Iogh, den anderen Stallburschen. Die beiden wechselten sich als meine Begleiter ab. Wir wussten alle drei, dass es mir strengstens untersagt war, allein auszureiten. Das Verbot gehörte zu den vielen Regeln, die alle dazu gedacht waren, mich vor Gefahren zu schützen. Aber was sollte mir in dieser durch und durch ländlichen und friedlichen Gegend schon groß passieren?
»Du kannst gehen, ich brauch dich nicht.« Ich nickte Iogh knapp zu und diesem blieb nichts anderes übrig, als sich zurückzuziehen. Wenigstens hier konnte ich mich durchsetzen. Ob sich auch Gort meinen Wünschen fügen würde, stand noch nicht fest. An und für sich hatte ich an den Ausritten mit ihm noch die größte Freude. Er war ein hübscher achtzehnjähriger Junge von kräftiger, aber nicht allzu großer Statur mit weizenfarbenem, strubbeligem Blondhaar. Früher, bevor ich ins Kloster geschickt wurde, war unser Umgang miteinander lockerer gewesen. Aber seit meiner Rückkehr war unser Verhältnis ein anderes geworden, und er sah mich nur selten mit der alten treuherzigen Offenheit an.
Manchmal dachte ich daran, ihm zu sagen, wie albern er sich nun verhielt. Solange mir niemand eine Krone aufs Haupt drückte, waren wir immer noch die Gleichen wie früher. Aber wahrscheinlich handelte er auf Anweisung von oben, und ich würde ihn nur in Konflikte stürzen, wenn ich auf einer Rückkehr zum alten, legeren Umgangston bestünde.
»Aber mich«, sagte Gort leise und etwas von der alten Vertrautheit schwang in der Stimme.
»Nein!«, entgegnete ich und mied seinen Blick. »Heute nicht.«
»Warum nicht?« Gort musterte mich nachdenklich von der Seite, aber auf einmal huschte ein Grinsen über sein hübsches Gesicht. »Und warum nicht – wenn ich fragen darf?« Urplötzlich hatte sich sein Ton gewandelt, statt ehrerbietig war seine Frage eindeutig herausfordernd, und gleichzeitig verschlang er mich mit den Augen. Ich wusste nur zu gut, was in ihm vorging. Sobald er sich von mir unbeobachtet glaubte, glühte sein Gesicht hoffnungslos vor Verliebtheit.
Ich dachte an die Unterredung mit Fiona zurück und tat etwas Unverzeihliches.
»Gort?«, fragte ich vorsichtig.
»Ja?«
»Findest du mich hübsch?«
Erst einmal verschlug es ihm den Atem.
»Fragst du im Ernst?«, erkundigte er sich schließlich und vergaß völlig die förmliche Anrede. Dafür hätte ich ihn umarmen können. Es klang so normal.
»Heute findet doch mir zu Ehren ein Ball statt, und ich finde mich nämlich überhaupt nicht hübsch und hab Angst, dass mich niemand zwischen all meinen gutaussehenden Verwandten bemerkt! Also, bin ich hübsch?«
»O, Lynn!« Gort verdrehte die Augen, unübersehbar überkam ihn Verlegenheit, aber schließlich gewann eine gewisse Kühnheit die Oberhand. Er betrachtete mich prüfend. Ich wusste nicht, ob mir das so gut gefiel.
»Doch, du bist ganz hübsch«, sagte er ausdruckslos, fast widerwillig.
Das war nicht ganz die Antwort, auf die ich gehofft hatte. Meine Laune sank. Nicht mal Gort fand mich schön. Spätestens jetzt hätte ich aus reinem Selbstschutz das Thema wechseln sollen, aber irgendein Teufel zwang mich, das Gespräch fortzusetzen.
»Und findest du, dass ich ein bisschen mollig bin?«
»Mollig?«, wiederholte Gort ratlos und wand sich vor Verlegenheit.
»Dick, zu dick«, half ich selbstmörderisch nach, »vor allem um die Hüften herum.«
Nun glitt Gorts Blick nachdenklich über meine Figur. Eigentlich eine Frechheit.
»Nö, ich finde alles richtig so.«
Ich verstand nicht, warum ich die Peinlichkeit, in die ich ihn und mich gestürzt hatte, nicht endlich beendete. Dabei meldeten sich gerade Kopfschmerzen bei mir und eine Mattigkeit, die ich nur zu gut kannte. Es war, als breitete sich Watte in meinem Hirn aus. Wenn ich mich nicht dagegen wehrte, würde mir bald alles egal sein.
»Meine Cousine Fiona findet mich zu dick«, brachte ich aber noch heraus.
Gort nickte weise. »Kann ich verstehen.«
»Was?« Ich schrie beinahe, nun war ich wieder hellwach. »Also bin ich zu dick!«
Gort trat einen Schritt zurück und rückte gleich wieder ein wenig näher an mich heran. Seine Augen begannen zu funkeln.
»Ah, ich weiß, wen du meinst. Lady Fiona, die Essig-Gräfin. Wir nennen sie so, weil sie immer so saure Bemerkungen uns gegenüber macht. Keiner von uns kann ihr irgendwas recht machen.« Sein Ton wurde unversehens heftig. »Wieso glaubst du, was diese dürre Ziege sagt? Von der lässt du dir einreden, dass du zu mollig bist? An dir«, er schluckte und sein Blick wanderte verlangend zu meinen Hüften, »ist alles genau richtig.« Er rang nach Worten, während seine Hände sich öffneten und schlossen, als hätte er nur zu gern meine Hüften gestreichelt und könnte sich nur noch mit Mühe zurückhalten. So weit hatte ich ihn also gebracht. Eigentlich sollte ich mich schämen.
»Du bist zum Anbeten schön, und du weißt es genau«, brach es plötzlich aus ihm heraus. »In deinen Haaren blitzen im Sonnenlicht rote Funken auf, und es glänzt wie Gold und gegen deine Augen sind Smaragde lumpige Kieselsteine.«
Wen meinte er bloß?
»O, Lynn!«, fuhr er ungebremst fort. »Du bist schön wie eine Feenkönigin, wenn du mich fragst. Aber du fragst mich nur, um mich zu quälen, gib es zu. Du bist die schönste, die wundervollste ...«
»Hör auf!«, stieß ich hervor. Jetzt tat er mir richtig leid. Irgendwann musste er aus seinem Traum aufwachen und dann war da bloß ich, und ich erkannte mich in seiner Beschreibung nicht wieder. Smaragdaugen! Außer mir kannte ich niemanden mit grünen Augen, grüne Augen waren abartig. Ich wünschte mir sehnlichst die silbergrauen Fionas und Duncans, die von echtem Adel zeugten. Nicht nur wegen dieser Augen kam ich mir in meiner Familie wie ein Kuckuckskind vor.
Gort zuckte zusammen, als hätte ich ihn geschlagen, und blickte mich verletzt an. »Wusste ich’s doch. Du machst dich über mich lustig«, sagte er dumpf und schlug die Augen nieder. »Du kannst dir’s ja leisten, Hoheit.«
Ich seufzte.
»Wenn du nur wüsstest! Ach, Gort, ich fühl mich beschissen. Heute läuft alles schief. Von wegen Hoheit. Ich bin bloß ein Fußabtreter, auf dem jeder herumtrampeln darf.«
Einen Augenblick schwieg ich und gab mich dem unsäglich wehleidigen Gefühl hin, für die Leute, auf die es ankam, ein kleines dummes Nichts zu sein. Meara schnaubte, gedankenverloren tätschelte ich ihr das Maul. Gort wagte nicht, noch etwas zu sagen. Mir war klar, dass ich mich unverantwortlich hatte gehen lassen und ihn endlich aus dieser peinigenden Situation erlösen musste.
»Halt mir den Steigbügel – bitte, es wird Zeit, dass ich losreite und ein bisschen allein für mich bin.«
»Du willst wirklich nicht, dass ich mitkomme?« Gort straffte sich, dabei hatte er noch sichtlich mit Verwirrung zu kämpfen. »Warum? Warum Lynn? Nimmst du mir übel, was ich gesagt habe? Dann entschuldige, ich vergesse halt manchmal, wer du bist. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mitkäme. Jemand muss doch auf dich achten. Bitte!«
Fast hätte ich seinem Flehen nachgegeben. Behutsam nahm ich ihm mit einer Hand die Zügel ab, die andere legte ich ihm auf den Arm. Durch das schlichte Leinenhemd, das er trug, spürte ich seine kräftigen, glatten Muskeln.
»Es hat nichts mit dir zu tun oder mit dem, was du gesagt hast, sondern nur mit mir. Es ist wegen des Balls heute Abend, das sagte ich doch schon. Ich werde den ganzen Tag keine ruhige Minute haben, und ich fühle mich nicht besonders gut. Diese vielen Menschen, an die ich nicht gewöhnt bin, machen mir jetzt schon Kopfschmerzen. Dabei erwarten sie von mir, dass ich heiter bin und vor guter Laune nur so sprühe. Findest du, ich sprühe vor guter Laune?«
Staunend sah Gort mich an.
»Na ja, ich freu mich schon auf den Ball«, fuhr ich lahm fort. »Aber ich habe das Gefühl, dass sich heute in meinem Leben etwas ändern wird, seit Tagen spüre ich eine Unruhe, die mich verrückt macht. Ach, Gort, ich weiß eigentlich gar nicht, was mit mir los ist.«
Gort nickte weise. »Doch, das kenne ich. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Mir ging es genauso, aber das ist schon eine Weile her. Jetzt weiß ich, was ich will und ich weiß«, seine Augen verschatteten sich und die Stimme klang wehmütig, »dass ich es nie bekommen werde.« Sein Blick sagte eindeutig, was oder besser wen er meinte.
Ein entsagungsvolles Lächeln huschte über seine Miene. »Du wirst sicher mehr Glück haben als ich im Leben. Und ...«, er kramte in seiner Tasche und holte einen kleinen, in ein feines Leinentuch eingewickelten Gegenstand hervor, »... ich dachte, ich schenke dir das zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch übrigens.«
Ich wollte nach dem Geschenk greifen, um endlich von ihm wegzukommen, aber er hielt es außer Reichweite.
»Erst reiten wir aus. Wir beide.«
Meine Stute hatte begonnen, mir ins Haar zu schnobern und unruhig von einem Bein aufs andere zu wechseln. Außerdem wurde ich mir der neugierigen Blicke der anderen Stallburschen bewusst, die noch immer Pferde in den Hof führten, von den Befehlen eines Stallmeisters angetrieben, der unsichtbar blieb. Zum Glück, fand ich. Der Mann hätte der vertraulichen Unterhaltung mit Gort rasch ein Ende gesetzt.
Mein Blick wurde hart. »Nein, Gort, du bleibst hier, das ist ein Befehl. Ich reite allein aus.«
»Dann werde ich Ärger bekommen.« Gorts Hand krampfte sich um das Geschenk.
»Wenn jemand Ärger bekommt, bin ich das. Für das, was ich tue, stehe ich schon selbst ein«, entgegnete ich bestimmt. Um ihm zu zeigen, dass ich es ernst meinte, trat ich einen Schritt zurück, setzte den Fuß in den Steigbügel und schwang mich ohne Hilfe in den Sattel. Mit einem leichten Schenkeldruck setzte ich das Pferd in Bewegung.
Kurz bevor ich im Trab den Torbogen erreichte, spähte ich über die Schulter in den Hof zurück. Gort stand noch an derselben Stelle und hielt die Hand mit dem Geschenk an die Brust gedrückt. Er dachte nicht daran, mir nachzukommen. Ich weiß nicht, warum ich gleichzeitig Befriedigung und Bedauern verspürte.
Ich war nicht sehr nett zu ihm gewesen. Denn er war ein Freund – eigentlich mein einziger Freund – und hatte es nicht verdient, von mir zu Geständnissen verleitet zu werden, die einer Liebeserklärung sehr nahe kamen. O, Gort, es tut mir leid, es war unverzeihlich, dachte ich reuevoll. Du musst wirklich glauben, ich weide mich an den Qualen eines hoffnungslos Verliebten. Aber so war es nicht, ich war nicht wie Fiona.
Kapitel 2
Eadha
Ich hielt den Kopf gesenkt, das war besser so. Nicht zum ersten Mal stand ich mitten in einer engen, düsteren Kammer und versuchte, möglichst gefasst zu bleiben und meine Gedanken in Zaum zu halten. Ich achtete auf das laute Atmen der beiden anderen, die mit mir in der Kammer waren, um zu erraten, wo sie waren und wann sich einer von ihnen mir näherte. Keinesfalls durfte ich mir mein Zittern anmerken lassen.
Die beiden ließen mich absichtlich auf die Eröffnung der Befragung warten, um mich schon im Vorhinein zu zermürben. Das kannte ich bestens.
»Es geht der Prinzessin gut?«, fragte schließlich einer.
»Sie hat heute Nacht nicht von Wölfen geträumt«, antwortete ich rasch.
»Das hat sie dir erzählt?«
»Ja, natürlich, sie erzählt mir alles.« Bleib bei der Wahrheit, ermahnte ich mich, das ist am sichersten.
Übelkeit stieg in mir auf. Ich schluckte krampfhaft.
»Gut, sehr gut.« Die Stimme des anderen war tiefer und rauer als die des ersten und fast etwas besänftigend. Aber ich wusste, dass er der Gefährlichere von den beiden war.
»Was soll gut sein? Dass sie nicht geträumt hat?«, widersprach der andere. »Gefällt mir nicht, jegliche Veränderung bei ihr gefällt mir nicht, vor allem solange wir nicht wissen, was dahinter steckt. Wir können nicht wachsam genug sein, denn wir sind die Verantwortlichen. Was sonst noch?«
In meinem Nacken spürte ich heißen Atem. Unwillkürlich erstarrte ich, jeden Muskel angespannt.
»Was meinen Sie? Ich verstehe Sie nicht«, stieß ich keuchend hervor.
»Ich frage, ob sonst etwas vorgefallen ist, was du uns zu berichten hast.« Der fremde Atem rasselte, es war ein unheimliches Geräusch.
Ich widerstand der Versuchung, einen Schritt nach vorn zu machen, raus aus der beängstigenden Nähe. Die Furcht krampfte mir den Magen zusammen, ich spürte bittere Galle die Kehle aufsteigen.
»Hast du Angst zu antworten? Du hast Angst! Leugne es nicht. Du hast etwas zu verbergen, sonst hättest du diese Angst nicht.« In der Stimme schwang etwas mit, das mich in Panik versetzte.
Nicht denken, nicht denken, nicht denken, befahl ich mir. Denk nicht an ...
Der fremde Atem brannte auf meiner Haut.
»Du willst nicht antworten.« Die Stimme ging in ein Knurren über.
»Doch!«, schrie ich entsetzt auf. »Ja, doch, es gibt etwas zu berichten. Ihr war wieder schwindelig, sie hat sogar das Bewusstsein verloren. Aber es war rasch vorbei – ich hab ihr eine Extraportion von dem Mittel gegeben.«
»Was hat den Schwindel ausgelöst? Weißt du es? Hat sie sich darüber geäußert?«, fragte der andere.
Schwarze, blank gewienerte Stiefel erschienen in meinem Blickfeld und verschwanden wieder. Der andere hatte begonnen, mich lautlos zu umkreisen. Das machte mich fast irre. Schwierig, unter diesen Umständen zu antworten.
»Ich hab sie nicht gefragt und sie hat nichts gesagt.«
Erst einen Tag zuvor hatte ich gehört, dass wieder jemand von den Dienstboten verschwunden war. Es hieß, er habe sich etwas zuschulden kommen lassen oder über zu viel Arbeit geklagt. Niemand wusste Genaueres, aber wir alle waren uns sicher, dass wir nie wieder etwas von ihm hören oder sehen würden.
»Wie? Du bist ihre Vertraute, aber sie erzählt dir nicht, was in ihr vorgeht? Junge Mädchen wollen sich mitteilen, sie haben Fantasien. Hat sie etwas gesehen oder sich an etwas erinnert, als ihr schwindelig wurde? Sag die Wahrheit! Sei nicht so verstockt, ich erwarte Aufrichtigkeit ...«
Meine Knie begannen nachzugeben. Immer stärker wurde mein Verlangen, aufzugeben, nicht weiterzukämpfen, mich fallen zu lassen. Mit größter Anstrengung riss ich mich noch einmal zusammen und blieb aufrecht stehen.
»Ich hatte keine Zeit, mit ihr zu reden. Ich hab sie schnell in die Wanne gesteckt, das war das Beste für sie. Sie ist zart, empfindlich, ich weiß manchmal gar nicht, wie ich mit ihr umgehen soll, dabei gebe ich mir solche Mühe, sie vor Schaden zu bewahren«, sprudelte ich hervor. Ich musste ihnen etwas anbieten, was sie beschäftigte und von mir ablenkte. »Sie ist immer so rasch müde und dann kaum noch zu irgendetwas zu bewegen. Dann ist sie wieder launisch oder weinerlich. Ein Mädchen in einem schwierigen Alter.«
Eigentlich ist sie inzwischen aus diesem Alter heraus, dachte ich bei mir und versuchte, mir nichts anmerken zu lassen.
»Das hat sie bald hinter sich.« Das war der andere, der sich wieder einmischte. »Du hast sie im Griff«, fuhr er nachdenklich fort. »Du vergisst keinen Tag, sie unter Kontrolle zu halten.« Es war weder eine Frage noch eine Feststellung, sondern ein Befehl und zugleich eine unterschwellige Drohung. Wehe, dir entgleitet die Kontrolle! Bitte, Gott, flehte ich verzweifelt, lass mich das hier durchstehen und bitte behüte ...
»Was?«, schrie der Peiniger hinter mir. »Was wolltest du sagen?«
Nichts, nichts. Ich war zusammengezuckt und versuchte krampfhaft, jeden verräterischen Gedanken aus meinem Kopf zu verbannen. »Ich habe nichts sagen wollen.« Ich riss mich zusammen. »Das heißt, doch: Sie freut sich auf den Ball heute Abend. Seit Tagen denkt sie an nichts anderes. Der bevorstehende Ball gibt ihr Auftrieb. Vielleicht hatte sie deshalb heute Nacht keinen Albtraum.«
Lachen erklang. Ein tiefes kehliges Lachen, bei dem es mir grauste. »Kann sein. Auch wir freuen uns auf den Ball. Es wird ein großartiges Fest.« Die Stimme wurde unversehens beinahe liebenswürdig. »Ja, sie soll ihre Freude an diesem Ball haben und nichts soll die Freude trüben.«
»Genug!«, sagte der andere nüchtern. »Ich sehe keinen Sinn mehr in dieser Unterhaltung. Es gibt nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssten. Es geht ihr gut, sie ist folgsam und nichts wird dem geplanten Verlauf der Dinge im Weg stehen. Das Mädchen wird eine wunderbare«, er lachte trocken auf, »Schattenkönigin.«
Die beiden verließen den Raum, aber ich blieb stehen, ohne auch nur den Kopf zu heben, denn ich brauchte einen Moment, um die Starre, die meinen Körper bis in den Nacken versteifte, zu überwinden und mich wieder normal bewegen zu können.
Sie würden aus Lynn eine Schattenkönigin machen, und ich tat nichts anderes, als ihnen dabei in die Hände zu spielen. Dafür verachtete ich mich. Aber was hätte ich tun sollen, ohne selbst in Gefahr zu geraten?
Wie blind taumelte ich zur Wand und lehnte mich mit dem Rücken dagegen. Es tat gut, die solide Wand zu spüren.
Sie haben heute Abend etwas Besonderes mit Lynn vor. Nur was?, grübelte ich und seufzte auf. Lynn war nicht meine einzige Sorge, da gab es eine viel größere und quälendere. Bitte, Gott, lass sie nicht entdecken, dass ich einen Sohn habe. Beschütze meinen Gort.
Die Tür flog wieder auf und schlug krachend gegen die Wand. Mit einem Schreckenslaut sank ich auf die Knie. Mein Herzschlag setzte einen Moment aus und dann überaus schmerzhaft wieder ein. Es war, als würde mir ein Dolch in die Brust gestoßen. Ich ertrage diese Schrecken nicht länger, dachte ich.
»Denk daran«, sagte die tiefe Stimme des Älteren, der sich nur wenig an der Unterhaltung beteiligt hatte, »dass hier niemandem etwas Böses geschieht, solange er seine Pflicht tut.«
Schluchzend nickte ich.
Kapitel 3
Lynn
Mit jeder Minute, die ich allein unterwegs war, genoss ich die ungewohnte Freiheit mehr. Es machte mich geradezu übermütig. Nach und nach fielen alle Sorgen von mir ab, die Missstimmung verflog. Heute stand mir die ganze Welt offen, auch wenn sie tatsächlich nur aus hügeligem Bauernland mit ein paar Weilern inmitten von Wiesen, Äckern und Wald bestand, das ich in- und auswendig kannte. Und doch erschien es mir an diesem Morgen anders. Frischer, fremder, reizvoller. Das alte Schloss und der Garten lagen eingebettet in eine hügelige Landschaft, die sich bis zu einem Gebirgszug in weiter Ferne erstreckte, den ich nur vom Hörensagen und von einer Landkarte her kannte. Es war eine Schande, aber ich war noch nie in die Nähe der Highlands gelangt. Alles, was ich von den Bergen wusste, war, dass sich dort irgendwo wertvolle Minen befanden, auf die sich der Reichtum des Landes, meines Landes gründete. Vor allem Silber wurde abgebaut, daneben Eisenerz, Kupfer und Edelsteine. Seit einigen Jahren schon lagen die Felder mehr und mehr brach, denn in den Minen wurden so viele Arbeiter benötigt, dass in den Lowlands kaum noch Kräfte für die Feldbestellung übrig blieben. Und an einigen Orten waren Fabriken entstanden, in denen riesige Dampfturbinen liefen, für die auch Leute gebraucht wurden, sehr viele Leute. In den Bauernhäusern wohnten fast nur noch alte Menschen. Einige davon arbeiteten auf ihren fast abgeernteten Äckern.
In mäßigem Tempo ritt ich an einem schmalen Feld entlang, auf dem Korn und Wildblumen in einer bunten Mischung durcheinander wuchsen. Es sah hübsch aus. Blau, rot und gelb, das Gelb stammte hauptsächlich von dem Kriechgewächs, das auch am Schloss wucherte. Also auch hier breitete es sich aus. Dagegen, dachte ich zerstreut, sollte man wirklich mal etwas unternehmen. Auf einer Weide neben dem Feld tobten sich übermütig ein paar junge Pferde aus, wahrscheinlich stammten sie aus den königlichen Ställen. Eine Weile sah ich ihnen voller Freude zu. Ein großer Kastenwagen schwankte auf dem Weg zwischen Feld und Weide vorbei und bog auf einen der Hauptwege zum Schloss ein und wenig später zockelte ein Eseltreiber mit seinem schwer beladenen Tier hinterher und grüßte mich, indem er mit einer ausladenden Geste seinen Hut schwenkte. Lässig grüßte ich zurück.
Es war Spätsommer, eine milde Wärme drang durch meine samtene Reitjacke. Ich hatte die allergrößte Lust, mich einfach nur treiben zu lassen und das wunderbare Gefühl zu genießen, keinen Aufpasser im Nacken zu haben, nicht mal Gort, einfach niemanden, der argwöhnisch alles, was ich tat, beobachtete. Ich hatte nicht geahnt, wieviel mir dieses Alleinsein bedeutete. Sorglos überließ ich es Meara, den Weg fortzusetzen. Nach einer Weile kamen wir an einen Teich, den Erlen, Weiden und sehr viel Schilf säumten.
Hier hatte ich in meinem ersten Jahr in der Klosterschule in den Sommerferien Elfen gesehen. An einem nebligen Morgen hatten sie sich tanzend über dem Wasser gedreht, ein zauberhafter, schwindelerregender Anblick. Iogh war ein Stück hinter mir geritten, und als er mich eingeholt hatte, waren die Elfen verschwunden. Der Nebel allerdings auch.
»Elfen?«, hatte Eadha später spöttisch gefragt, nachdem ich mein Erlebnis dummerweise erwähnt hatte. Unnötig, dass sie auch noch hinzufügte: »Die gibt’s nicht.« Da war ich bereits zu alt gewesen, um an Märchen zu glauben. Das wusste ich natürlich. Es musste an den Büchern liegen, die ich so oft gelesen hatte, dass mir meine Fantasie Elfen vorgegaukelt hatte. Eine sehr naheliegende Erklärung.
Mit einem Schenkeldruck lenkte ich Meara über einen breiten Grasstreifen an zwei Bäumen vorbei zum Teich und glitt einige Meter vom Ufer entfernt aus dem Sattel. Hier gab es eine große Lücke im Schilfgürtel, sodass ich ans Wasser gelangte. Ich ließ die Stute trinken, führte sie ein Stück zurück und band sie so an einem tiefhängenden Ast an, dass sie noch grasen konnte. Danach lief ich zurück zum Ufer, ließ mich ins Gras nieder, zog die Beine an und umschlang sie mit meinen Armen.
Über der Wasseroberfläche schwebten zarte Dunstschleier, es schien eine Eigenart dieses Teichs zu sein. Mit viel Fantasie konnte man sich schon einbilden, tanzende Gestalten zu sehen. Die Elfen waren nicht das Einzige, was ich mir im Laufe der Zeit eingebildet hatte. Ich meinte, mal ein grau getigertes Kätzchen gehabt zu haben, und ich erinnerte mich an Spiele mit gleichaltrigen Freundinnen, da war ich noch sehr klein, nicht älter als vier oder fünf. Immer wieder stiegen Fetzen der Erinnerung aus einer frühen und scheinbar sehr sonnigen Kindheit empor, die sich als Trug-, Traum- oder Wunschbilder entpuppten, sobald ich Eadha danach gefragt hatte. Sie lösten unausweichlich ein tiefes Gefühl von Verlust aus. Ein Ziehen in der Magengrube warnte mich. Wenn ich mich zu sehr in diese eingebildeten Erinnerungen vertiefte, würde meine Stimmung unweigerlich umschlagen. Manchmal kam es mir so vor, als sei ich eigentlich jemand anders oder zweigeteilt in die Lynn, die ich und alle kannten, und eine andere, geheime. Aber konnte man sich selbst so fremd sein?
Und warum träumte ich Nacht für Nacht von Wölfen? Ich wusste doch, dass es seit langem im ganzen Land keinen einzigen Wolf mehr gab, der letzte war schon vor Jahren erlegt worden. Manchmal fragte ich mich, woher ich überhaupt wusste, dass die Kreaturen in meinen Albträumen Wölfe waren. Am besten dachte ich nicht länger darüber nach, denn gerade setzten die Kopfschmerzen wieder ein.
Ich wollte an etwas anderes denken und ich wusste auch gleich, an was.
An Duncan! Ich brauchte mir nur sein Bild zu vergegenwärtigen, sein schönes, schmales, aristokratisches Gesicht und seine Stimme, deren samtener Klang mir mit jedem Ton eine Gänsehaut verursachte. Schade, dass er ein Regierungsamt innehatte, das machte ihn mir in fast allem haushoch überlegen, vom Rang abgesehen. Er galt als rechte Hand des Lordkanzlers und war ein wichtiges Mitglied des Kronrats. Ein Mann, auf dem bereits viel Verantwortung lastete, das kehrte er aber mir gegenüber nie heraus. Manchmal wirkte er angespannt und müde, dann war er weniger freundlich. Aber jedes Mal, wenn er hier auftauchte, nahm er sich Zeit für mich. Am liebsten ritt er mit mir aus, und manchmal schaffte er es, mir das Gefühl zu geben, geliebt zu werden – wenn auch nicht auf die Art, die ich erhoffte.
Ich ließ mich ins Gras sinken, gab mich ganz meinen wunderbaren, verrückten Träumen von Duncan hin und dämmerte schließlich weg.
Etwas ließ mich aufschrecken. Im ersten Moment wusste ich nicht, wo ich mich befand. Hastig setzte ich mich auf, erkannte aber sofort, dass es für Befürchtungen keinen Anlass gab. Vor mir schimmerte sanft und unbewegt der Elfenteich. Was war ich nur für ein ängstliches Huhn! Da war ich mal allein unterwegs, und schon erschreckte mich jeder Vogelschrei und jedes Rascheln im Schilf.
Hinter mir schnaubte Meara und scharrte ungeduldig mit dem Huf. Da ging mir auf, dass ich eingedöst war, und ich fragte mich, für wie lange.
Wie spät war es? Ich spähte zur Sonne, die in Dunstschleiern fast verborgen war. Dem Sonnenstand nach musste es gegen Mittag sein. O Gott, ich hatte stundenlang fest geschlafen. Wahrscheinlich dachte Gort inzwischen, ich hätte die Gelegenheit genutzt und wäre mal eben nach Dún Èideann geritten oder hätte mich im Wald verirrt.
Meara schnaubte wieder aufgeregt, es klang nicht nach Langeweile, und daher schaute ich mich nach ihr um. Erleichtert stellte ich fest, dass dort nichts und niemand war, nicht einmal ein Fuchs oder Dachs.
Ich schaute zurück zum Teich und ließ meinen Blick prüfend über das Schilf am Ufer gleiten.
Ringsherum herrschte immer noch verträumte Stille und Einsamkeit. Nicht mal Elfen zeigten sich über dem Wasser. Ich grinste. Wahrscheinlich hatte eine Bremse Meara gestochen und sie in Unruhe versetzt.
Bremse oder nicht, Meara zerrte wiehernd am Zügel.
Ich stand auf. Es wurde ja auch höchste Zeit zurückzureiten, aber ich nahm mir fest vor, diesen Ausflug ohne Begleitung zu wiederholen. Es lohnte sich, schon wegen dieses Gefühls von Freiheit.
Nicht weit von mir entfernt geriet das Schilf in Bewegung. Es sah nicht so aus, als ob der Wind darüber hinwegwehte, sondern, als ob ein Tier hindurchschlich. Eine Weile verfolgte ich diese Bewegung mit einiger Besorgnis, aber dann erinnerte ich mich, dass Schwäne hier brüteten, sie mussten ihre Jungen fast großgezogen haben. Nur, warum hatte ich nicht einen einzigen gesehen, als ich hergekommen war?
Um die Vögel aufzuscheuchen, klatschte ich laut in die Hände. Nichts geschah, jedenfalls nicht das, was ich erwartet hatte.
Die Bewegung hielt nämlich unvermindert an. Eine Kreatur, die mindestens die Größe eines ausgewachsenen Schwans hatte, glitt außer Sicht durch das Schilf und eindeutig auf mich zu. Die Schwäne waren alles andere als zahm und der hier – falls es sich um einen handelte – verhielt sich ungewöhnlich.
Ohne mir die aufkommende Furcht anmerken zu lassen, verließ ich das Ufer. Meara hatte die Ohren nervös nach hinten gedreht.
Ich begann schneller zu gehen und konnte nicht verhindern, dass sich mir die Haare im Nacken sträubten. Dennoch widerstand ich heldenhaft dem Impuls, mich umzuschauen. Schließlich hatte ich nur noch ein paar Meter zurückzulegen, vorbei an einem alten Baum, von dessen Ästen Moos hing und der von filzigem dunklem Gebüsch umgeben war, einer Schattenzone, in der nicht viel zu erkennen war. Ich wollte diese Stelle schnell hinter mich bringen.
Hinter dem Baum raschelte es, da war etwas ganz nah an mich herangekommen. Die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag. Da lauerte etwas Großes und vielleicht Gefährliches, und hatte es eindeutig auf mich abgesehen.
Ich stolperte, streckte eine Hand haltsuchend nach dem Baum aus, fing mich wieder und starrte in das finstere Gebüsch, in dem zwei Irrlichter aufleuchteten – nicht länger als einen Wimpernschlag.
Bevor ich mir darüber klar werden konnte, was genau ich gesehen hatte, trat hinter dem Baum in geduckter Haltung ein Mann hervor.