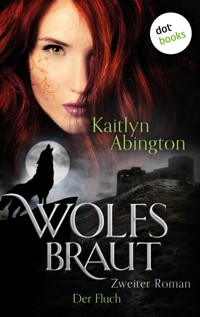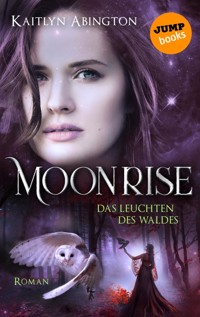
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: jumpbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Moonrise – Das Leuchten des Waldes«, der neue Fantasy-Bestseller von »Moonlight«-Autorin Kaitlyn Abington jetzt als eBook bei jumpbooks! Ein verwunschener Wald, der sich immer weiter ausbreitet, und dunkle Mächte, die ihr Unwesen darin treiben … Schon lange fühlt sich die Grafentochter Yolanda von rätselhaften Schatten auf ihrer Burg verfolgt. Als ihr Bruder im Verfluchten Wald verschwindet, bricht Yolanda auf, um ihn zu retten – doch auf einmal machen finstere Wesen aus der Unterwelt Jagd auf sie! Im letzten Moment entkommt sie mit der Hilfe eines starken und geheimnisvollen Waldbewohners, der sie fortan beschützt. Yolanda spürt, dass ihr Schicksal mit seinem Volk, den Alben, und dem Wald verbunden ist. Aber wie soll sie es mit den Bestien aus der Unterwelt aufnehmen – und wird sie ihren Bruder jemals wiedersehen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Romantic-Fantasy- Roman »Moonrise – Das Leuchten des Waldes« von Kaitlyn Abington. Wer liest, hat mehr vom Leben: jumpbooks – der eBook-Verlag für junge Leser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein verwunschener Wald, der sich immer weiter ausbreitet, und dunkle Mächte, die ihr Unwesen darin treiben … Schon lange fühlt sich die Grafentochter Yolanda von rätselhaften Schatten auf ihrer Burg verfolgt. Als ihr Bruder im Verfluchten Wald verschwindet, bricht Yolanda auf, um ihn zu retten – doch auf einmal machen finstere Wesen aus der Unterwelt Jagd auf sie! Im letzten Moment entkommt sie mit der Hilfe eines starken und geheimnisvollen Waldbewohners, der sie fortan beschützt. Yolanda spürt, dass ihr Schicksal mit seinem Volk, den Alben, und dem Wald verbunden ist. Aber wie soll sie es mit den Bestien aus der Unterwelt aufnehmen – und wird sie ihren Bruder jemals wiedersehen?
Über die Autorin:
Kaitlyn Abington ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin. Nach ihrem Studium der Germanistik, Pädagogik, Theologie und Kunstgeschichte hat sie unter ihrem Klarnamen mehrere erfolgreiche Krimis, historische Romane und Kinderbücher veröffentlicht.
Von Kaitlyn Abington erschien bei jumpbooks bereits:
»Moonlight – Ein Flüstern in der Dunkelheit«
***
Originalausgabe August 2020
Ein eBook des jumpbooks-Verlags. jumpbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Copyright © der Originalausgabe 2020 jumpbooks Verlag. jumpbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Michelle Landau
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / MillaF / Ironika / DZiegler / scooperdigital / justdd
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96053-273-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Du Dich für dieses eBook entschieden hast. Bitte beachte, dass Du damit ausschließlich ein Leserecht erworben hast: Du darfst dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Du Dich strafbar machst und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügst. Bei Fragen kannst Du Dich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des jumpbooks-Verlags
***
Wenn Dir dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Dir gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schick einfach eine eMail mit dem Stichwort »Moonrise« an: [email protected] (Wir nutzen Deine an uns übermittelten Daten nur, um Deine Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuch uns im Internet:
www.jumpbooks.de
Kaitlyn Abington
Moonrise – Das Leuchten des Waldes
Roman
jumpbooks
Kapitel 1
Auf der Burg:Iks
Mein Vater Albert war der ehrenwerte 12. Landgraf von Allt-A-Bainne. Lange hatte es so ausgesehen, als wäre er der letzte männliche Spross unserer erlauchten und sehr alten Familie, deren Herrschaft mit ihm enden würde, doch nun sah es eher so aus, als würde unsere ganze Grafschaft nicht mehr allzu lange existieren. Und daran war nicht mein Vater, sondern der wandernde Wald schuld. Zumindest behauptete mein Vater das. Jeden Abend stieg er auf den höchsten Turm unserer Burg, um die Sterne zu erforschen, die sich bekanntermaßen nur bei klarem Nachthimmel zeigen. Aber selbst bei Nieselregen, Sturm und Hagel beäugte er den Himmel und wagte erste Prognosen über das Wetter der nächsten Tage, die er am frühen Morgen dann vervollständigte. Denn von der Genauigkeit dieser Voraussagen hing mehr für unsere Familie ab, als sich viele hätten vorstellen können.
Irgendwann im Morgengrauen senkte er aber unweigerlich den Blick, ließ ihn hinüber zum Waldrand schweifen und überprüfte mit einem Entfernungsmesser, wo genau an diesem Tag, zu dieser Stunde die Trennlinie zwischen dem Wald und Allt-A-Bainne verlief. Die deprimierenden Ergebnisse dieser Messung hielt er schriftlich fest, und möglicherweise lag es an dieser Tätigkeit, dass er von Jahr zu Jahr mehr Haare verlor und sich die Furchen in seinem Gesicht vertieften. Vielleicht lag das aber auch nur am Alter. Es gelang mir nicht, mir diesen müden, melancholischen Vater als jungen, lebensprühenden Mann vorzustellen, und noch weniger, rasend vor Wut.
Ich glaubte auch gar nicht an den Familienfluch. Daher lohnte es sich nicht, darüber nachzudenken, schon gar nicht an einem Tag wie diesem, einem der letzten Spätsommertage voller Wärme und Sonnenschein. Was mich aber vor allem vom Nachdenken über drohendes Unglück oder Verhängnis abhielt, war die Aussicht auf ein rauschendes Fest. Über den Fluch wusste ich ja auch viel zu wenig.
Ich lief in einem der unbewohnbaren Teile der Burg einen Flur entlang, den wir gelegentlich und heimlich als Abkürzung in den von uns bewohnten Flügel nutzten. Man konnte den Flur kaum betreten, ohne sich hinterher staubig zu fühlen, das Haar voll klebrigem Zeug. Selbst fette Spinnen in den Haaren erschreckten uns längst nicht mehr. Natürlich hing der Flur wegen der unebenen Wände, der halb aus den Angeln hängenden morschen Fenster, der vielen Vorkragungen und Windungen voller Schatten.
Meiner Ansicht nach adelten Schatten, vor allem bewegliche Schatten, eine alte Burg. Nur Dummköpfe fürchteten sich davor. Dummköpfe wie Yo.
Nach ihr suchte ich gerade, wahrscheinlich war sie es, die den Saum unseres grünen Seidenkleides aus lauter Unachtsamkeit heruntergetreten hatte, dabei hatten wir längst ausgemacht, dass ich es heute tragen würde.
Dass unser Bruder Zett dahintersteckte, konnte ich mir nicht vorstellen. Allerdings hatte ich ihn vor drei Tagen dabei erwischt, wie er versuchte, sich einen von Yos alten Leinenkitteln überzustreifen. Yo und er waren beinahe gleich groß, aber in den Schultern und über der Brust war ihm der Kittel eindeutig zu eng gewesen. Ein gut gewachsener junger Mann von beinahe 17 im Kleid! Die Späße der Zwillinge gingen mir seit jeher auf den Geist. Yo und Zett waren genau auf den Tag, auf die Stunde, ein Jahr jünger als ich. Ein Ärgernis. Denn wir alle drei hatten am selben Tag Geburtstag. Bis zum nächsten war es nicht mehr lange hin. Aber volle Aufmerksamkeit und halbwegs passable Geschenke würde es nur für einen von uns geben.
Gerade als ich mich wegen des Kleids in die Wut auf meine Schwester Yo ordentlich hineingesteigert hatte, entdeckte ich unseren Vater, der sonst nie diesen Teil der Burg aufsuchte. Er stand an einem der Fenster, schon in die Festtagshose aus schiefergrauem Satin gekleidet, die über seinem Bauch leicht spannte. Ein Hosenträger war ihm über die Schulter gerutscht, in seinem Haar glitzerte ein Spinnenfaden. Wie so häufig, wenn er sich unbeobachtet wähnte, führte er ein Selbstgespräch.
»Zwei Herzogswappen an den Kutschen, … nein, drei, das letzte ist das von Ardnamurchan, die waren vergangenes Jahr nicht da, ich erinnere mich, dass sie mit einer faulen Ausrede abgesagt haben, weiß aber nicht mehr genau, was sie … Na, wenigstens dieses Jahr sind sie da, vielleicht wegen des Geburtstags, wahrscheinlich wollen sie bis dahin bleiben. Aber die Einladung dazu überlege ich mir noch, die überlege ich mir gründlich.«
Aus seiner Stimme klang eine seltsame Mischung aus Nörgelei und Triumph. Ein Hauch von Rührung überkam mich. Mein armer, alter Vater, war immer – und oft vergeblich – auf Anerkennung, Respekt und seine Würde bedacht.
Als auch ich einen Blick aus dem Fenster warf, sah ich, dass unsere ungeliebte Verwandtschaft sich bereits auf die Burg zubewegte. Die ersten Kutschen mussten bald schon die Vorburg erreicht haben, auf der es rasch eng werden würde.
»Die Herren von Bladnoch«, flüsterte Vater, »Fettercairne …, Glen Keith …, Wolfburn.« Auf einmal seufzte er aus tiefstem Herzen auf. »Der Geburtstag, auf den wir … hoffentlich geht …, wenn ich doch … Wann hört der Fluch …«
Das Letzte stieß er lauter hervor, aber der Rest ging in Gemurmel unter; was er damit meinte, war mir auch egal. Für mich war es Fluch genug, Prinzessin dieser elend kleinen Grafschaft und unbedeutendes und weitgehend unbeachtetes Mitglied einer elend verarmten Familie zu sein. Der vom früheren Reichtum übrig gebliebene Besitz umfasste nur noch eine marode Burg samt trockenem Burgraben und zwei verpachtete Bauernhöfe, die für eine große Familie wie unsere kaum mehr als die nötigsten finanziellen Mittel abwarfen. Zur direkten Selbstversorgung hielten wir auf der Vorburg drei Kühe, zwei Ziegen und eine Gänseherde und beackerten ein großes Gemüsefeld im ehemaligen Schlossgarten. Im Rest des Gartens graste eine Herde Schafe. Früher gehörten zu unseren Reichtümern ein Kohlebergwerk und eine Silbermine. Alles längst verschwunden. Von der ehemals vielköpfigen Dienstbotenschar war lediglich Donas für sämtliche Ämter vom Haushofmeister bis zum Stallknecht übrig geblieben. Nur für Zofendienste ließ er sich nicht gebrauchen, und in der Küche taugte er auch nicht viel. Bei den in unserer Familie regelmäßig stattfindenden Hochzeiten halfen ein paar Mädchen und junge Burschen aus dem Dorf als Handlanger aus, hauptsächlich aus unersättlicher Neugier.
Plötzlich strich etwas Weiches um meine Beine. Kater. Selbst er fand bei uns kaum noch sein Auskommen. Er hatte, seit er vor einiger Zeit bei uns aufgetaucht war, die Burg von Mäusen und Ratten weitgehend leer gejagt. Anders war nicht zu erklären, dass sein rot gestromtes Fell wirkte, als sei es ein bisschen zu groß für ihn geworden. Das braune Lederhalsband, das wir ihm aufgenötigt hatten, um ihn von einem vogelfreien Streuner zu unterscheiden, würde er bald verlieren, wenn er noch weiter abmagerte.
Als ich mich gerade bücken wollte, um ihm über den knochigen Rücken zu streichen, klang lautes Rufen von draußen herein und ein furchtbares Geschnatter. Ich nahm an, dass mein nichtsnutziger Bruder es versäumt hatte, die Gänse aus dem Burggraben heraus und in den Stall zu scheuchen. Es wäre seine Aufgabe gewesen, das hatten wir abgemacht. Es musste nicht jeder unserer Gäste gleich bemerken, dass wir zu Bauern herabgesunken waren.
Etwas verdunkelte höchstens einen Wimpernschlag lang das Licht, das durch das Spitzbogenfenster hereinfiel. Beinahe hätte ich nicht darauf geachtet, wenn nicht gleichzeitig der Kater erbärmlich aufgeschrien hätte. Im selben Augenblick sprang er an mir vorbei auf einen Steinsockel mitten im Gang – der letzte Überrest eines nicht mehr rekonstruierbaren Umbaus – und machte einen Buckel. Ich fuhr herum. In meiner Drehbewegung erhaschte ich aus den Augenwinkeln heraus einen großen Schatten an der Wand schräg gegenüber dem Fenster. Ein unangenehm kalter Hauch fuhr mir trotz der Sommerhitze in den Nacken und ließ mich schaudern.
Oder warum schauderte ich sonst?
»Was machst du denn hier, Iksa?«, rief mein Vater ausgerechnet in diesem kritischen Augenblick.
Es war zu dumm! Durch den Ruf sah ich mich nämlich veranlasst, mich wieder ihm zuzuwenden – was mich beinahe aus dem Gleichgewicht brachte. Wäre das nicht geschehen, hätte ich vielleicht mehr von diesem Schatten erhaschen können. Halt suchend wankte ich einen halben Schritt auf meinen Vater zu. Die Luft war dicker geworden, wahrscheinlich wegen des aufgewirbelten Staubs, ich hatte auf einmal Mühe zu atmen, eine Art Beklemmung legte sich mir auf die Lunge.
Was war falsch an diesem Schatten?
Jämmerlich wimmernd sprang Kater zurück auf den Boden und suchte Schutz bei mir. Ich nahm ihn auf und drückte ihn an mich.
Hastig blickte ich über die Schulter zurück zur Wand. Nur ein großer, dunkler, an den Rändern seltsam verschwommener Fleck war von dem Schatten geblieben, und auch der verblasste nun vor meinen Augen, bis nichts mehr übrig war. Das Licht, das den Flur erfüllte, schien schwächer zu werden, vermutlich kamen gerade Wolken am Himmel auf, daher diese kurzfristige Düsternis.
Ich schüttelte mich unmerklich und wandte mich meinem Vater zu. »Und was tust du hier, Vater?«
»Wo ist Zett?«, gab er statt einer Antwort zurück.
»Das wüsste ich auch gern.« Ich spähte in den Burggraben hinunter. Wie ich vermutet hatte, waren die Gänse noch dort und hatten sich kampfbereit versammelt. Sie hassten Besucher. »Die Gänse sind noch frei.«
Über Vaters Gesicht glitt ein Schmunzeln. Ich wusste genau, woran er dachte. Vor zwei Jahren hatte unser Gänserich einen besonders aufgeblasenen, angeheirateten Verwandten ins Bein gebissen.
»Such Zett und sag ihm, ich erwarte, dass er uns die Gäste, nein, die Gänse vom Hals …«, er stockte und fuhr dann strenger fort: »Und dass er mit mir die Gäste begrüßt.« Er streckte die Hände aus. »Und gib mir den Kater. Er kann bei mir bleiben.«
Kater aber fauchte ihn an, weshalb ich ihn mir unter den Arm klemmte.
»Besser ich nehme ihn mit, sonst kratzt er dich noch, das gibt unschöne Blutflecken auf deinem Hemd. Und Vater – vielleicht solltest du dir ein Jackett überziehen und die Haare bürsten. Du hast Spinnweben darin.«
Verlegen sah Vater an sich herab und strich sich mit einer Hand erst behutsam über das Haar und betrachtete dann verwundert seine Handfläche. Ich ließ ihn allein mit seiner Selbstinspektion und machte mich mit Kater davon.
Es war erstaunlich, dass wir dem Tier keinen Namen gegeben hatten, so versessen auf Namen, wie unsere Familie war. Wir drei, Yo, Zett und ich, hatten uns gegen eine Namensgebung gesträubt, indem wir konsequent, aber ohne uns groß abzusprechen, den Kater nur Kater nannten und riefen, auch wenn die anderen versuchten, ihm einen Namen anzuhängen. So blieb es schließlich bei Kater. Namen haben ja Bedeutung.
Yo stand mit einem undeutbaren Ausdruck im Gesicht in der offenen Galerie, die mit ihren zierlichen Doppelsäulen und Rundbögen zum schönsten und besser erhaltenen Teil der Burg gehörte, und spähte hinunter in einen großen, malerischen Innenhof, der uns im Sommer als Festsaal diente. Weinreben rankten sich hier die Wände hoch und zogen sich über eine Pergola, die Kühle und Schatten spendete. In einigen großen Kübeln leuchteten zwischen farbenfrohen Blumen ein paar hübsche Kürbisse, die wir in ein paar Wochen ernten würden. Bänke und Tische, weiß eingedeckt mit frisch gebügelten Tischtüchern und Bettlaken aus Damast, standen unten für die Gäste bereit. Am Vorabend hatten wir bis in die Nacht hinein gearbeitet, selbst Vater hatte mit angefasst. Daher hatte eins der Bettlaken nun einen Brandfleck.
Yo lehnte an einer Säule und bewegte sich einen Schritt zurück in die Galerie, sobald sie mich bemerkte.
Ich setzte Kater auf den Boden. Statt wegzulaufen, blieb er bei mir, an mein Bein geschmiegt. Er hatte seinen Schreck wohl noch nicht ganz überwunden.
»Was ist los mit ihm?«, fragte Yo bedächtig.
Es überraschte mich immer wieder, wie Yo es fertigbrachte, Stimmungen, egal ob von Mensch oder Tier, in einem flüchtigen Moment oder aus dem Augenwinkel zu erfassen.
»Ein Schatten an der Wand hat ihn erschreckt.«
Yo kam etwas näher zu mir heran.
Von unten klang verhaltenes Gelächter herauf.
»Wie groß?«
»Na ja, ziemlich groß«, erwiderte ich zögernd. Was ich verschwieg, war: Der Schatten hatte nicht ganz zu Kater, mir, Vater oder zum Sockel gepasst. Nicht einmal die Größe hatte gestimmt, wie ich mir jetzt im Stillen eingestand. Nichts hatte gestimmt.
»Wo?«
Widerstrebend sagte ich es ihr. Über Schatten redeten wir im Allgemeinen nicht viel. Yo schüttelte abwägend, mit einem lauernden Blick auf mich, den Kopf. Bei dieser langsamen Bewegung sträubten sich mir ganz sacht die Haare im Nacken.
»Das ist schlecht«, kommentierte sie und verstärkte damit mein Unbehagen. »Gab es sonst noch etwas Bemerkenswertes an diesem Schatten?« Ihr Blick wurde verhangen.
Mich überlief es kalt. Wie machte Yo das? Woher wusste sie, dass es etwas Besonderes an diesem Schatten gegeben hatte?
Manchmal, argwöhnte ich, manipulierte sie hinterlistig die Stimmungen der Menschen um sich herum, ohne dass es jemand bewusst wahrnahm.
Ich schob sie beiseite, denn sie versperrte mir die Sicht in den Hof.
»Da war nichts, glaub mir. Kater hat nur durchgedreht, wahrscheinlich vor Hunger, weil ihm die Mäuse ausgegangen sind. Aber Vater schien über irgendetwas besorgt zu sein.« Über Vater hatte ich gar nicht reden wollen, die Bemerkung war mir herausgerutscht.
Yo trat wieder vor mich. »Das ist er schon seit einer ganzen Weile.«
Plötzlich wurde mir klar, dass sie recht hatte. Er war noch zerstreuter und fahriger als sonst, und das sollte schon etwas heißen. Zu den vielen Beinamen meines Vaters gehörte auch Professor. Den Zusatz zerstreut sparte man sich, weil er sich von selbst verstand. Wieso hatte Yo die Veränderung bemerkt und ich nicht? Über seine Eltern machte man sich in unserem Alter nicht allzu viele Gedanken, man nahm sie einfach hin – zuweilen bloß als notwendiges Übel.
Endlich linste ich an Yo vorbei nach unten in den Hof, was ich schon die ganze Zeit vorgehabt hatte.
Dort spielten ein paar Kinder, lauter Neffen und Nichten, irgendein neues Spiel an den Sitzbänken, das ich nicht durchschaute. Ein Junge richtete sich gerade auf und schwenkte etwas in der Hand. Es sah aus wie ein breiter, großer Pinsel. Mehrere andere Kinder waren an der Bank daneben beschäftigt, aber ihr Spiel schien gerade zu Ende zu sein. Ich war immer froh, wenn ich mal nicht den Aufpasser für die Kleinen abgeben musste, deshalb wollte ich mich nicht allzu sehr für ihr Tun interessieren. Besser, ich wusste nicht, was sie ausheckten.
»Was machen die da?«, fragte ich idiotischerweise dennoch. Ich hatte mich heute sehr schlecht in der Hand.
Beiläufig schaute Yo über ihre Schulter in den Hof hinunter und zuckte die Achseln. »Sie wischen noch einmal über die Bänke.«
Das hatten wir doch schon in der Nacht erledigt.
»Mit einem Pinsel?« Ein kleiner Henkeltopf in der Hand eines Mädchens zog meine Aufmerksamkeit auf sich, und ich wollte gerade auch dazu eine Bemerkung machen, als die Turmuhr zu schlagen begann. Zwölf Uhr, in einer guten Stunde würden wir uns alle im Zeremoniensaal zur Trauung versammeln. Wieder wurde eine unserer Schwestern verheiratet, es war die letzte vor Yo und mir. Als Nächste war ich an der Reihe. Und mein Festgewand hatte einen losen Saum. Mit diesem Gedanken war mit einem Schlag auch die fast vergessene Wut auf meine Schwester wieder da.
»Näh gefälligst den Saum wieder fest«, herrschte ich Yo an. »Ich weiß, dass du ihn abgerissen hast. Den Saum am grünen Seidenkleid.« Das Kleid war mir wichtig, denn von diesem Fest erhoffte ich mir einiges: eine grundlegende und erfreuliche Wendung meines Schicksals.
Die Wahrheit war, dass viele der Kleider unserer älteren Schwestern, die wir seit Jahren auftrugen – neue konnten wir uns nicht leisten –, Yo besser passten und standen als mir. Ich kam, was die Figur betraf, eher nach unserer kompakt gebauten Mutter, das hieß auch, dass ich einen halben Kopf kleiner war als Yo, die die schlanke, hochgewachsene Statur unseres Vaters geerbt hatte, so wie alle anderen unserer Schwestern. Zumindest war Vater früher einmal schlank gewesen.
Zu meinem Glück waren auch schon vor ein paar Jahren, als noch Geld für die Ausstattung meiner älteren Schwestern vorhanden gewesen war, recht locker sitzende Kleider modern gewesen. So passten sie mir trotzdem, auch wenn sie bei mir ein bisschen zu eng saßen. Vor allem obenherum. Aber ich fühlte mich wohl darin. Es war eben meine Mode, viel Eigenes hatten wir ja sonst nicht.
Yo lachte mich aus. »Näh doch selbst. Ich geh jetzt die Gänse …«
Ich fiel ihr ins Wort. »Und wo ist Zett? Er sollte sich um die Gänse kümmern.« Auf einmal wurde mir bewusst, wie knapp die Zeit inzwischen war. Mutter erwartete mich längst in der Küche, und umziehen musste ich mich auch noch. Aber erst wollte ich rasch den Saum annähen. Yo dazu zu bringen, dauerte viel zu lange, die würde sich ewig winden wie ein Aal. Und wo stand gerade der Nähkorb? Er wanderte nämlich von Hand zu Hand und Zimmer zu Zimmer. Hatten wir überhaupt passendes Garn? Vor Sorge wurde mir flau im Magen, denn ich wollte unbedingt einen guten Eindruck bei einigen der Gäste machen. Bei den jüngeren, männlichen, um genau zu sein. Letztes Jahr hatte ich mich bereits unter ihnen umgeschaut und sie ein bisschen vorsortiert.
»Was weiß ich. Wahrscheinlich schon bei Vater. Wie genau sah denn der Schatten aus? War da was mit einem Fuß nicht in Ordnung?«
Einen winzigen Augenblick war ich kurz davor, die Fassung zu verlieren. Die Beziehungen zwischen Schwestern sind ja oft sehr komplex und nicht gut zu durchschauen. Gefühle unterschiedlichster Art poltern unerwartet durcheinander, in Zuneigung mischt sich Abscheu, wenn man es gerade gar nicht erwartet.
»Du spinnst, Yo, du spinnst wie immer.« Ich drehte mich um und begann zu rennen.
»Und halte dich in Zukunft vom Nordflügel fern«, schrie sie mir hinterher.
Das könnte dir so passen, dachte ich im Weiterrennen. Schon vor vielen Jahren hatte ich entdeckt, dass sich Yo und Zett zu geheimen Treffen in den Nordflügel zurückzogen, der als der älteste, verwinkeltste und leider auch marodeste Teil der Burg galt. Dort stöberte sie so leicht niemand auf, da es uns streng verboten war, den baufälligen Teil zu betreten. In einem der Räume, in den ich kurz hineingesehen hatte, hatte an diesem Morgen neben einer alten gepolsterten Bank ein Rucksack gelegen, der Yo gehörte. Bei der Erinnerung daran fiel mir Vater wieder ein. Was hatte er heute im Nordflügel gewollt, und warum hatte er mich nicht gerügt, als er mich dort angetroffen hatte?
Gekocht wurde bei uns nur noch in der alten Gesindeküche in der Vorburg. Die Küche in der Hauptburg war nicht mehr benutzbar, weil ihr Kamin wie der in der großen Halle von Dohlen besetzt war und unser Diener Donas es seit Jahren ablehnte, aufs Dach zu klettern und die Nester auszuheben. Er war einfach zu alt dafür.
Einen Herd mit verstopftem Kamin zu befeuern, konnte lebensgefährlich sein, also hatte meine Mutter beschlossen, die alte, riesige Gesindeküche wieder zu nutzen, in der wir nun unter der Woche an einem großen Buchenholztisch auch unsere Mahlzeiten einnahmen. Trotz ihrer Größe und der vielen, vielen Schatten an den Wänden fanden wir die Küche gemütlich, allein schon wegen des stets brennenden Feuers unten den Kochstellen – denn im Winter verwandelte sich die Burg in einen Eispalast.
Im Hof vor der Küche angelangt, musterte ich die Kutschen derjenigen, die bereits eingetroffen waren. Ich sah das Wappen von Ardnamurchan, also war Artemisia, unsere älteste Schwester mit ihrem Gatten, dem Herzog, bereits eingetroffen. Sie und ihr Anhang würden auch die Ersten sein, die wieder abreisten. Bisher war das immer so gewesen. Aber vielleicht blieben sie diesmal bis zum Geburtstag. Ich betete kurz darum. Der Herzog hatte zwei ganz gut aussehende und wohlhabende Neffen, einen davon würde ich sehr gern wiedersehen, auch wenn er schon knapp 30 war. Hoffentlich hatten sie ihn mitgebracht. Besser ihn nehmen als noch ein paar Jahre auf der Burg ausharren.
Livrierte Diener wuselten herum, es gab bereits ein kleines Gedränge. Ich vermied jeden Augenkontakt, um nicht angesprochen zu werden, schlängelte mich an allen Menschen vorbei, ließ die halb offen stehende Küchentür links liegen und ging weiter bis in den Torgang der Vorburg. Hier herrschte Ruhe. Aufatmend lehnte ich mich an die kühle Steinwand und schloss die Augen.
Das war dumm von mir. Denn auf einmal holte mich der Schrecken wieder ein, die Furcht angesichts dieses Schattens, den ich nicht deuten konnte oder wollte. Hatte Yo das bewirkt? Dass ich mich auf einmal so seltsam schwach und ja – ängstlich fühlte? Nur ungern gestand ich mir ein, dass die beiden Jüngsten von uns zuweilen unheimlich waren.
Einen Schatten ohne Ursprung, ohne ein Ding oder ein Lebewesen, das ihn auslöste, gab es nicht, darüber hatte mich unser in den Wissenschaften bewanderter Vater schon frühzeitig belehrt, was in einer schattenreichen Burg wie unserer von hohem Nutzen war. Naturgesetze waren unumstößliche Gewissheiten im Gefüge der Welt.
Hatte der Schatten tatsächlich einen Pferdefuß gehabt?
Plötzlich räusperte sich jemand. Ich schüttelte mich, um die Beklemmung loszuwerden, und verbannte jeden Gedanken an verhängnisvolle Schatten aus meinem Kopf.
Vom Tor näherte sich einer der Bauern aus dem Dorf. »Euer gräfliche Gnaden«, dienerte er unterwürfig, warf mir aber einen berechnenden Blick dabei zu.
Trotz meines graubraunen, sackartigen Kittels, der hervorragend zu meinen hellbraunen Haaren, aber nicht zu meiner gesellschaftlichen Stellung passte, hatte er mich als Mitglied der Herrschaftsfamilie erkannt. Dass er mich falsch anredete, spielte für mich keine Rolle. Yo, Zett und ich, wir ließen unsere Titel nur ungern heraushängen.
Von einem Schatten ohne reale stoffliche Entsprechung in der wirklichen Welt kann doch keine Bedrohung ausgehen?
Warum kam ich immer wieder auf den Schatten zurück? Lag es an meiner Müdigkeit, die sich gerade meldete? Ich hatte in der Nacht nur ein paar Stunden geschlafen.
»Was willst du?«, fragte ich nicht übermäßig freundlich.
»Es hängt kein Wetterzettel am Tor.«
»Dann hat ihn schon jemand mitgenommen. Ich kann dir auch sagen, wie das Wetter wird: warm, bei mäßigem Wind, kein Regen auf drei Tage. Gut für eine letzte Heuernte.«
»Kann Erlaucht, Ihr Herr Vater, nicht noch einen Zettel schreiben?«, flehte er.
»Dazu hat er heute keine Zeit«, beschied ich ihm ungnädig.
Immer dieser Aberglaube. Normalerweise ließen wir uns herab, den Wetterzettel in wenigstens drei Ausfertigungen bereitzuhalten. Sobald ein Zettel mit den Wetterprognosen vom Tor abgerissen wurde, hefteten wir den nächsten an den Nagel. Wir wussten natürlich, dass die Zettel als Fruchtbarkeitszauber bei den Bauern begehrt waren. Entweder vergruben sie sie in den eigenen Feldern, gaben Schnipsel davon dem Vieh zu fressen oder verkauften sie weiter. Wichtig war, dass sie nicht den Glauben verloren, dass Vater die Wetternotizen eigenhändig verfasste. Ein Mann, davon waren alle überzeugt, der es auf 26 Kinder gebracht hatte, die alle vor Gesundheit strotzten, musste über eine besondere Gabe verfügen. Großzügig wurde darüber hinweggesehen, dass von den 26 Kindern 25 nur Töchter waren.
In der Küche schlug mir eine köstliche Duftmischung von Gebackenem und kross am Spieß Gebratenem entgegen. An gewöhnlichen Tagen waren wir schon froh über einen Bohneneintopf mit ein paar gerösteten Speckstückchen darin. Heute reiften auf einer Seite des gemauerten Herds, direkt unter der gewaltigen Esse, an Drehspießen ein ganzes Spanferkel und eine Rinderkeule über sacht geschürtem Feuer zu kulinarischen Köstlichkeiten heran. Ein Junge drehte einen der Spieße, einen Moment sah ich ihm dabei zu, es war eine ebenso eintönige wie einschläfernde Bewegung. Ich blinzelte gegen die Wirkung an.
Mutter schob gerade nacheinander drei Kuchen in den alten, gemauerten Backofen neben dem Herd und gab nebenbei den Dorfmädchen, die zur Aushilfe gekommen waren, ein paar Anweisungen. Ich war an der Tür stehen geblieben und beobachtete sie eine Weile.
Als Vater unsere Mutter heiratete, war sie bereits 40 Jahre alt und er seit zwei Jahren Witwer. Möglicherweise heiratete er sie nur deshalb, weil sie Berta hieß, und natürlich, weil sie unsere Köchin und die letzte Angestellte war, die er sich noch leisten konnte. Nach der Heirat bekam sie als neues Familienmitglied selbstverständlich keinen Lohn mehr. Lange hatte ich mich geweigert, auch dieses Detail als wesentlich für die eheliche Verbindung in Betracht zu ziehen, bis mein Vater selbst einmal eine Bemerkung darüber machte. War er tatsächlich so berechnend gewesen? Dennoch mochten sich die beiden.
Mutter liebte das Hauswirtschaften und Kochen über alles, und die Arbeit füllte ihre Zeit beinahe vollständig aus. Die Zwillinge und mich bekam sie nebenbei, und um die vielen Stieftöchter machte sie kein Aufhebens. Die Ältesten, die noch unverheiratet auf der Burg lebten, waren ihrer Ansicht nach alt genug, sich um die Jüngeren zu kümmern.
Sobald ich in verständlichen Sätzen sprechen konnte, hatten mir meine älteren Halbschwestern die Aufgabe übertragen, auf die Zwillinge aufzupassen. Sie hatten alle viel Wichtigeres zu tun, und vor allem hatte keine Lust, sich länger als unumgänglich nötig mit Zett zu befassen. Vielleicht lag das daran, dass es bei der letzten Geburt in dieser Burg zu einem verstörenden Vorfall gekommen sein sollte. Jedenfalls blieb seitdem ein Raum im Westflügel verschlossen.
»Iksa! Wo bist du mit deinen Gedanken? Warum stehst du nur herum?«, holte mich meine Mutter in die Gegenwart zurück.
Ich zuckte die Schultern. »Ich weiß es nicht, Mutter, ich weiß es ehrlich nicht.«
Feuchte Strähnen hingen ihr ins Gesicht, das heute etwas röter und fleckiger aussah als gewöhnlich. Selbst bei wohlwollendster Betrachtung konnte niemand leugnen, dass man ihr die Abstammung von Bauern ansah, davon zeugte auch ihre kräftige, robuste Gestalt, die jegliche elfenhafte Eleganz vermissen ließ. Die erste Frau unseres Vaters hatte dagegen einen adeligen Stammbaum vorweisen können, der zwei Generationen weiter zurückreichte als sein eigener – einer der Gründe für seine verbissene Ahnenforschung, wie ich vermutete.
Mutter strich sich das Haar aus der Stirn und musterte mich ungläubig. »Du bist die Vernünftigste von allen, also benimm dich entsprechend. Und schneide das Brot auf, dünn, wenn’s geht, es hat jetzt lange genug ausgekühlt. Und danach den Schinken …«
»Wem verdanken wir den?«
Auf einem der Seitentische standen ein paar hübsch zurechtgemachte Körbe voller Köstlichkeiten. Seit einigen Jahren – genau genommen, seit es bei einer Hochzeit hauptsächlich Kohlsuppe gegeben hatte – brachten unsere Hochzeitsgäste solche Körbe als Geschenke mit. Wahrscheinlich stammte der Schinken aus einem von diesen.
»Dem Wetter …«, antwortete Mutter überraschend. »Die Kartoffeln sollen dieses Jahr besonders gut stehen. Genau rechtzeitig gepflanzt, es wird eine reiche Ernte geben. Ein Bauer hat den Schinken gestern vorbeigebracht.«
Die Erforschung unserer langen Familiengeschichte bis in alle Verästelungen und Namensgebungen beanspruchte mittlerweile beinahe die ganze Zeit meines Vaters – brachte uns aber im Gegensatz zu den Wetterprophezeiungen nichts ein. Früher einmal hatte ich geglaubt, er wollte mit diesen Erforschungen irgendetwas wiedergutmachen oder das Schicksal bezwingen. Nun dachte ich eher, dass es eine altersbedingte Spleenigkeit sei. Er war bereits alt gewesen, als ich geboren wurde.
Einige Stunden nach der Trauung konnte das eigentliche Fest beginnen. Zett war noch rechtzeitig zur offiziellen Begrüßung aufgetaucht und machte einen gelassenen Eindruck, geradezu souverän spielte er seine Rolle als Kronprinz und zukünftiger 13. Landgraf, auf dem alle Hoffnungen und Erwartungen der Familie ruhten.
Er stand neben Vater, während dieser eine kleine Ansprache hielt. Da es bei jeder Hochzeit genau dieselbe war, hörte ich nicht hin, sondern betrachtete stattdessen meinen Bruder.
Zetts Haut war dunkler als Yos, was bei seinen rostroten Haaren seltsam wirkte. Von der Stirn bis zum Hinterkopf zog sich außerdem wie ein gezackter Blitz eine dunklere Partie über sein Haupt, über die wir uns schon als kleine Kinder lustig gemacht hatten. Mir fiel auf, dass jemand seine Haare sorgsam geschnitten hatte. So kurz sahen sie ungewohnt ordentlich und gepflegt aus, allerdings kam der dunkle Strich stärker zur Geltung. Und kaum erwähnenswert war selbstverständlich, dass sich das warme Goldbraun seiner Augen bei Wutanfällen zu reinem Schwarz wandelte. Insgesamt bot mein schöner Bruder ein prächtiges natürliches Farbenspiel. Zu diesem Fest hatte er sich in einen blitzsauberen Anzug gezwängt. Und außerdem sah es so aus, als hätte er tatsächlich gebadet. Derart sauber hatte ich ihn seit Jahren nicht gesehen, überhaupt noch nicht, soweit ich mich erinnern konnte. War er krank im Kopf? Ich begann, mir ernsthaft Sorgen zu machen.
Direkt nach der Rede trugen unsere Helferinnen aus der Küche das Essen auf. Auch der Schinken, den ich aufgeschnitten hatte, war dabei, appetitlich arrangiert auf einer großen, kaum angeschlagenen Porzellanplatte. Begierig sog ich den wunderbaren Duft ein, bei dem mir das Wasser im Mund zusammenlief. Allerdings roch ich auch noch etwas anderes, als ich mich leicht über die Bank beugte. Die Sitzfläche glänzte ungewöhnlich, fiel mir auf.
»Komm da weg.« Yo war plötzlich neben mir aufgetaucht und zog mich ein Stück zurück. »Es ist besser, du wartest noch ein bisschen und setzt dich nicht sofort.«
»Wieso?«, fragte ich und beobachtete voller Wohlgefallen, wie sich Platte an Platte und Schüssel an Schüssel reihte.
»Es ist höflicher, den Gästen den Vortritt zu lassen, oder nicht? Und überhaupt …«
»Ja, was denn?«
»Ach, nichts, pass auf dein Kleid auf.«
Das Letzte hätte mir zu denken geben müssen, tat es aber dämlicherweise nicht, ich freute mich viel zu sehr aufs Essen. Noch dazu hatte in diesem Moment etwas anderes meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Denn von der anderen Seite näherte sich mir der Mann, auf den ich gehofft hatte, mit einem Glas Wein in der Hand und lächelte mich an. Ich war verblüfft. Das Lächeln galt tatsächlich mir? Aus der Nähe betrachtet, sah er beinahe schon gut aus, jedenfalls fand ich nichts allzu Abstoßendes an ihm. Und teuer gekleidet war er sowieso, das waren alle Gäste, sie überboten sich geradezu an Chic und Stil, worüber Yo und ich lange nach Mitternacht noch lästern würden, während wir uns übermüdet und mit übervollen Mägen aus unseren abgetragenen Festkleidern schälten. Leider hing der Saum meines Kleids immer noch an einer Seite herab, aber ich tröstete mich damit, dass das im Festgedränge wahrscheinlich niemandem auffiele. Für gewöhnlich fiel ich niemandem auf.
Doch nun kam Artemisias angeheirateter Neffe Barnet genau auf mich zu! Mit einem einschmeichelnden Lächeln, das allein mir galt. Dessen war ich mir jetzt sicher. Was hatte meine Schwester mir über ihn erzählt? Ich erinnerte mich nicht mehr, ich sah nur noch ihn und überlegte fieberhaft, was ich Geistreiches zu ihm sagen könnte. Mir musste ganz rasch etwas einfallen, oder die Chance war vertan.
Rings um uns standen die erwachsenen Gäste in Gruppen zusammen. Strahlender Mittelpunkt jeder Gruppe war eine meiner bezaubernden Halbschwestern. Geradezu überirdisch schön, lagen ihnen die anwesenden Männer zwischen 18 und 80 quasi zu Füßen.
»Das Kleid habe ich vor fünf Jahren getragen, da hielten noch alle Nähte. Auch der Saum.« Unbemerkt war meine Schwester Uuh, eigentlich Undine, an mich herangetreten. Ich hatte etwas Mühe, mich auf sie zu konzentrieren, hätte ihr aber gern einen Tritt gegen das Schienbein verpasst.
Hinter ihr witschte Yo wie ein Geist davon, und in dem Blick, den sie mir noch zuwarf, lag eine bange Erwartung und dann, im letzten Augenblick, bevor sie verschwand – ganz eindeutig Angst.
Angst?
»Entzückend«, säuselte Barnet, der sich in diesem Augenblick zu mir und Uuh gesellte, und reichte mir mit einer galanten Geste den Wein. Hoffentlich war das nicht das fuselige Zeug, das die Dörfler kelterten. »Und du bist?«
Er wusste es nicht mehr! War ich ihm nicht vorletztes Jahr vorgestellt worden? Hatte ich mich etwa so sehr verändert, dass er mich nicht wiedererkannte?
»Nummer 24«, antwortete Undine für mich mit kühler Stimme.
Barnet verzog nachdenklich das Gesicht, ohne den Blick von mir abzuwenden, als hätte er Uuh gar nicht bemerkt. Auch das war neu für mich; niemand, der noch über seine volle Sehkraft verfügte, konnte Uuh übersehen. Eine Zofe hatte ihre Goldlocken zu einer wunderbaren Frisur aufgetürmt, in der ein Diadem glitzerte, dessen Saphire mit dem strahlenden Mitternachtsblau ihrer Augen wetteiferten. Dazu trug meine Schwester eine Seidenrobe, die unter dem Busen mit einem goldfarbenen Gürtel gerafft war. Darunter bauschte sich der Rock kleidsam über ihrem vorgewölbten Bauch, sichtbares Zeichen, dass auch ihre Ehe mit Nachkommenschaft gesegnet war. Sie – die Nummer 21 – hatte vor zwei Jahren geheiratet; Nummer 23, Weh, eigentlich Wibranda, hatte gerade die Trauung hinter sich. Undines Anwesenheit störte mich gewaltig.
»X?«, fragte Artemisias Neffe, aber es klang wie ein Schluckauf.
»Iksa«, antwortete ich leicht angewidert.
»Das klingt nicht richtig«, beklagte er sich.
Mein Name lautete Xenia, aber niemand nannte mich so, und die Abkürzung Iksa war sozusagen schon die Luxusausführung von Iks.
Gern, sehr gern hätte ich mich weiter mit Barnet unterhalten, aber nun ertönte eine Glocke, und damit wurde das Zeichen gegeben, dass wir zu unserem Festmahl Platz nehmen sollten. Im Handumdrehen lösten sich die Gruppen auf, jeder war bestrebt, einen guten Platz vor einer der vollen Platten zu ergattern.
In dem ausbrechenden Gedränge verlor sich Barnet leider von meiner Seite. Und als wäre das noch nicht genug, wurde ich angerempelt, sodass der Rotwein sich über mein einziges gutes, mein grünes Seidenkleid ergoss. Daher blieb ich stehen, beschämt bis auf die Knochen, während sich alle setzten. An Yos Warnung dachte ich natürlich nicht mehr.
Erst ein schrilles Quieken, das durch das allgemeine Geplauder drang, weckte mich aus meiner selbstmitleidigen Trance. Eine Frau auf der Bank vor mir versuchte aufzustehen, was ihr aber nicht gelang. Der Mann neben ihr bemühte sich, ihr zu helfen, scheiterte aber selbst daran, hochzukommen, und sank peinlich berührt in sich zusammen. Hinter mir schrie jemand auf. Und während ich wie blöd stehen blieb, brach um mich herum ein Chaos aus. Immer mehr Damen kreischten, die Dorfmädchen kicherten, schlugen die Hände vors Gesicht und wichen von den Tischen zurück, an denen sie Wein nachschenken sollten. Eine meiner Schwestern vor mir sprang auf. Ich hörte, wie Stoff zerriss, wie sie vor Wut schnaubte, und ich sah, dass an ihrem Kleid hinten ein großes Stoffstück fehlte, das vermutlich noch genau an der Stelle auf der Bank klebte, wo sie gesessen hatte. Immer mehr von den Gästen kamen auf die Beine, ich sah wenigstens drei blanke Hintern aufblitzen und eine rosa Unterhose.
Dann nahm der Irrsinn erst richtig Fahrt auf, denn auf einmal watschelten die Gänse laut schnatternd in den Hof. Im Handumdrehen schnappten sie nach all den Beinen, die sich ihnen in den Weg stellten. Das Geschrei steigerte sich noch, als ich Mutter erspähte. Sie drückte Vater die Glocke in die Hand, die dieser dann heftig schwenkte. Wie zu erwarten, verschärfte das Geläut nur den allgemeinen Krach und richtete sonst gar nichts aus.
Unbeachtet wich ich weiter und weiter zurück und begann, nach Yo und Zett Ausschau zu halten. Als Kronprinz wäre sein Platz an der Tafel zwischen unseren Eltern gewesen, doch ich konnte ihn dort nirgendwo entdecken. Langsam näherte ich mich einer der Türen, die in die Burg führten, ich war mir fast sicher, dass ich Yo und Zett nicht hier draußen finden würde. Barnet rannte an mir vorbei, unsern Gänserich auf den Fersen, und plötzlich fiel mir wieder ein, dass er der Mann gewesen war, den der Ganter vor zwei Jahren schon einmal gebissen hatte. Gänse können sich unliebsame Personen besser merken, als man denkt. Aber zu mir war unser Gast ja sehr nett gewesen, das wiederum musste ich mir unbedingt merken. Ich würde ihn mögen, ich mochte ihn jetzt schon.
Endlich hatte ich die Tür erreicht. Mein nasses Kleid raffend, stürmte ich ins Innere der Burg.
Yo
Unser Plan hatte beinahe schon zu gut geklappt. Einige Male dachte ich, Iks wäre uns auf die Schliche gekommen, aber das stellte sich zum Glück jedes Mal als Irrtum heraus. Dumme, langsame Iks, bevor sie etwas merkte, konnte die Burg schon längst in Schutt und Asche liegen. Aber nein, so abfällig durfte ich nicht über sie urteilen. Iks war in Ordnung. Sie hielt immer zu uns, ihre Rolle als große Schwester nahm sie sehr ernst, und wir beließen es dabei. Warum sollten wir sie auch verunsichern? Ihr einziger Fehler war, dass sie nicht mehr wahrnahm als die sicht- und greifbare Welt, und dafür konnte sie nichts.
Umso erstaunlicher war es, dass sie diesmal den Schatten bemerkt hatte. Zett und mir war er natürlich längst vertraut, wir waren ja unter seiner ständigen Bedrohung aufgewachsen. Früher, als wir noch klein waren, suchte er uns nur selten heim; nachdem wir das Alter von 12, 13 Jahren erreicht hatten, zunehmend öfter. Jetzt konnte Zett den Dämon in sich kaum noch beherrschen. Die Fassade von Wohlanständigkeit und Besonnenheit aufrechtzuerhalten, fiel ihm von Tag zu Tag schwerer. Ich fürchtete, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis er seinen eigenen Willen verlor. Das Gerede über Zetts Wutausbrüche machte schon länger in unserer Familie die Runde, aber im Grunde genommen waren diese Anfälle harmlos gegenüber den Untaten, die er unentdeckt im Verborgenen beging. Nur ich wusste davon, und das belastete mich sehr.
Uns beiden war klar, dass das verhängnisvolle Schicksal, das sich all die Jahre mit zunehmender Unausweichlichkeit angebahnt hatte, Zett bald ereilen würde. Es gab nichts, was wir noch dagegen tun konnten.
Doch dann, vor drei Tagen fiel uns etwas ein, von dem wir allerdings nicht wussten, ob es uns überhaupt nützen würde. Alles, absolut alles war ungewiss, aber tatenlos dem Schicksal in den Rachen fallen, war nicht unsere Art. Ja, auch ich spürte diesen einen besonderen Schatten, zuweilen merkte ich, wie er selbst Iks streifte, aber ihre Blindheit hatte sich bis jetzt als wirksamster Schutz für sie erwiesen. Wir Schwestern sprachen nur selten über all die Schatten in der Burg, mit denen wir ja leben mussten.
Weit nach Mitternacht, nachdem alle todmüde von den Festvorbereitungen schlafen gegangen waren, hatte ich mich mit Zett im verbotenen Flügel der Burg getroffen, um ein letztes Mal den Plan in allen Einzelheiten durchzugehen. Wir hatten eine Öllampe auf den Steinboden zwischen uns gestellt, die im Luftzug, der durch die Fenster hereindrang, leicht rußte. Draußen schrie ein Käuzchen. Leichtgläubige hielten seinen Schrei für die Ankündigung von Unheil und Tod. Wir wussten es besser.
»Hoffentlich tun wir das Richtige«, bemerkte ich zögernd.
Zett grinste anzüglich. »Zumindest die Kinder werden ihren Spaß haben, da bin ich mir sicher.«
Es war seine verrückte Idee gewesen, die Bänke mit einer Mischung aus Leim und Kleister zu bestreichen, um für größtmögliche und lang anhaltende Verwirrung zu sorgen. Leim und Kleister waren bei uns stets vorrätig, da es immer etwas gab, das kurz vor dem Auseinanderfallen war und kostengünstig repariert werden musste. Dank dieser jahrelangen Erfahrung wussten wir auch, welche Mischung das beste Ergebnis erzielte.
Unter unseren vielen jüngeren Neffen und Nichten würden sich mit Sicherheit einige finden, die diesen Teil des Plans herzlich gern erledigten. Denn Kinder unter zwölf Jahren waren an der Festtafel nicht erwünscht, sie wurden mit den Kutschern und den anderen Dienstboten in der Küche abgespeist. Das sorgte bei ihnen zuverlässig für Ärger. Die Idee mit den Gänsen hatte ich im letzten Moment beigesteuert, sie waren in unserem ursprünglichen Plan nicht vorgesehen gewesen.
Zetts Grinsen, das er mir über die kleine Flamme hinweg zuwarf, konnte mich nicht täuschen; er nahm das, was wir im Begriff waren, zu tun, keineswegs so leicht, wie er vorgab. Obwohl es ihm schon immer Freude gemacht hatte, Unruhe zu stiften.
Das Käuzchen schrie wieder – ein Warnruf – und gleichzeitig glitt ein knisternder Funke über Zetts Haar.
Sofort wechselte er das Thema und lachte rau auf. »Was hat das Spaß gemacht, die Scheune von diesem fetten Bauern abzubrennen.«
Seine Augen leuchteten in einem irren Glanz kohlschwarz im Lampenlicht. Mich schauderte, weil ich in letzter Zeit oft nicht mehr zu unterscheiden vermochte, was gespielt war an so einem Auftritt und was echt. Die Scheune, von der er sprach, hatte vor vier Wochen lichterloh gebrannt.
Wir sahen uns nicht nach dem Schatten um. Wir wussten, dass er da war.
Ich stand leise auf, öffnete das Fenster und wartete, bis das Käuzchen zu uns hereinflog. Lautlos, mit ausgebreiteten Schwingen drehte es über uns eine Runde.
»Das hättest du niemals tun dürfen«, wies ich Zett nachdrücklich zurecht, »das war Unrecht.«
Der Schatten, mutmaßten wir, war mindestens halb blind, aber keineswegs taub. Wie genau er Witterung aufnahm, was ihn eigentlich anzog, erahnten wir zuweilen, Gewissheit erlangten wir aber nie. Auch das zeigte uns überdeutlich unsere niederschmetternde Ohnmacht. Er spielte mit Zett, er quälte ihn vor meinen Augen, demonstrierte seine zunehmende Macht über ihn. Bald würde es nicht mehr beim Scheunen abbrennen bleiben.
Den inneren Widerstand aufrecht zu halten, ging allmählich über die Kraft meines Bruders.
Unvermittelt straffte er sich und hob den Arm. Das Käuzchen glitt, ohne zu zögern, zu ihm herab und setzte sich auf seine dargebotene Hand.
»Mag schon sein«, sagte Zett mit öliger Stimme, »aber es hat uns doch was eingebracht. Vater hat dem Bauern unsere Scheune auf der Vorburg vermietet, jetzt kommt endlich wieder ein wenig Geld rein. Und von dem Heu etwas für unser eigenes Vieh abzuzweigen, ist auch nicht schwer. Ist das etwa nichts?«
So hatte ich das noch nicht gesehen. War das Zetts ehrliche Meinung? Mehr und mehr spürte ich eine lähmende Verunsicherung. Vielleicht war es längst zu spät für jede Hilfe.
»Jetzt«, sagte Zett leise, während wieder ein Funke über sein Haar zischte. Wir hielten den Atem an.
Flügelschlagend fuhr das Käuzchen auf, krächzte lauthals und fuhr Zett dann mit dem Schnabel durchs Haar. Auf einmal roch es ein wenig verbrannt, und das Licht der Lampe flackerte heftig. Ein Schatten fuhr über uns dahin und zum Fenster hinaus, gefolgt von unserem Käuzchen.
Als wir wieder Luft holten und uns vorsichtig umschauten, um sicherzugehen, dass der Spuk vorbei war, bemerkte ich Kater, der sich zu uns gesellt hatte. Und ich bemerkte, dass Zett zitterte, es war also doch noch nicht alles verloren. Mein Bruder ließ den Kopf in seine Hände sinken.
»Tut’s sehr weh?«, fragte ich mitfühlend.
Zett schüttelte hinter den vorgehaltenen Händen den Kopf. »Ich bin nur wütend.«
Ich nahm an, dass er damit seine Wut auf unseren Vater meinte, der uns das Ganze überhaupt eingebrockt hatte, in der Nacht, als wir geboren wurden. Es stand alles in dem Buch, das er so sorgsam vor uns versteckte. Nur ein einziges Mal hatte ich es aufgespürt, und gelesen, was Vater auf die Innenseite des Buchdeckels geschrieben hatte: sein Schuldbekenntnis. Gern hätte ich mich noch weiter in das Buch vertieft, die Gelegenheit, sich über Dämonen zu informieren, bot sich nicht häufig. Doch Vater hätte mich beinahe in seinem Studierzimmer erwischt, und ich musste das Buch zurücklassen. Als ich das nächste Mal durchs Fenster einstieg, war es verschwunden. Er musste es an einem anderen Ort vor uns in Sicherheit gebracht haben.
»Hast du die Schere dabei?«, murmelte Zett nun.
»Soll ich das etwa jetzt tun?«, entgegnete ich.
»Wann denn sonst?«, brauste er auf.
Während ich ihm die Haare schnitt, breitete sich ein taubes Gefühl in meinen Fingerspitzen aus, dennoch gelang es mir, einen einigermaßen gleichmäßigen Schnitt zustande zu bringen.
Einige Male knurrte Zett, besonders als ich mich an die schwierige Partie mit den dunkleren Haaren machte. Die Taubheit wich mir aus den Fingern. Stattdessen hatte ich den Eindruck, die Schere begann allmählich zu glühen, Hitze spürte ich bestimmt.
Als das Werk getan war, atmete ich verhalten auf.
»Du hast fast nichts übrig gelassen«, bemerkte Zett übellaunig. »Aber vielleicht …« Er strich sich grübelnd über den Kopf. »Wie sehe ich aus?«
»Gar nicht so übel. Männlicher«, antwortete ich gutmütig, stellte aber fest, dass ich damit tatsächlich recht hatte.
Ich schob mit der Schuhspitze die abgeschnittenen Locken hin und her. Das erregte Katers Aufmerksamkeit, und er fing an, mit den abgeschnittenen Haaren zu spielen, die so gut zu seinem Fell passten. Eigenartigerweise ging mir sein Tun gegen den Strich. Ich ging in die Hocke und sammelte die Haare auf, denn ich wollte an diesem Ort keine Spuren hinterlassen, ich wusste zu gut, dass uns Iks unentwegt nachspionierte. Das Einsammeln brachte mich auf eine dieser wichtigen spontanen, anscheinend nebensächlichen Ideen, die aber unseren Plan erst richtig reifen ließen.
»Du bist wirklich fest entschlossen, durchzuhalten?«, fing Zett wieder an.
Ich nickte nur, ich war zu müde zum Reden.
Auf einmal griff er mir unter die Arme und zog mich zu sich hoch. Sein Blick wirkte unergründlich. »Es geht um Leben oder Tod, das weißt du? Ich will nämlich nicht so weiterleben.«
Wir sahen uns an.
Wir waren in wenigen Minuten Abstand geboren, und die Verbindung zwischen uns hätte nicht enger sein können. Ich gebe gern zu, dass das oft genug einer Heimsuchung gleichkam, bei einem Bruder wie Zett. Aber es gab auch die anderen Momente, in denen wir uns getröstet und geborgen in der Gegenwart des anderen fühlten. Eigentlich hätte die Zeit stillstehen müssen, als wir uns so ansahen, das Gefühl unserer schicksalhaften Verbundenheit hätte uns überwältigen müssen – ein Moment der Erhabenheit, festgehalten für die Ewigkeit.
Aber es war wohl einer jener Augenblicke, dessen hohe Bedeutung einem erst später klar wird; mir in diesem Fall einige Stunden später, aber da auch nur nach und nach.
Jedenfalls spürte ich bloß Widerborstigkeit in mir, eine ähnliche wie die, die ich bei Zett erahnte, daran war unsere grundsätzliche Unsicherheit schuld. Es war fraglich, ob wir dem, was wir uns vorgenommen hatten, gewachsen waren. Wir wussten zu wenig über unseren Gegner, nur dass er täglich mehr Macht gewann.
Es war, kurz gesagt, zum Verzweifeln.
Ich ließ mich von Zett umarmen, einen Beutel mit abgeschnittenen Haaren in der Hand, den Kater mit gesträubtem Fell an meine Beine geschmiegt.
»Mach’s gut, Schwester«, sagte Zett recht zärtlich und schob mich von sich. »Und wenn wir uns in diesem Leben nicht wiedersehen, mach was aus deinem.« Er lachte auf und verschwand im Dunkeln, ehe ich ihn aufhalten konnte.
Seitdem hatten wir uns nicht mehr allein gesprochen.
Mir war klar, dass Iks nach mir suchen würde, sobald der Streich mit den mit Leim bestrichenen Bänken seine Wirkung entfaltet hatte, denn es gehörte kein besonderer Scharfsinn dazu, darauf zu kommen, wer dafür verantwortlich war. Ich hatte sie ja sogar gegen jede Vernunft gewarnt, nur weil es mir leidgetan hätte, wenn ihr Festkleid ruiniert worden wäre.
Sie fand mich auch diesmal wieder auf der Galerie und ging sofort auf mich los.
»Schau dir das an!« Sie schwenkte den nassen, fleckigen Rock des grünen Kleids, das uns beiden gehörte. »Das verdanke ich euch! Und was soll das Ganze? Seid ihr nicht langsam zu alt für solche dämlichen Streiche?«
Was unser Streich mit den Flecken auf ihrem Kleid zu tun hatte, verstand ich nicht. Einen direkten Zusammenhang konnte ich nicht erkennen. Aber vielleicht wollte Iks nur ihre Wut an jemandem auslassen, und wer eignete sich dafür besser als ich?
Mit theatralischer Geste deutete sie in den Hof hinunter, in dem noch immer lautstarkes Chaos herrschte. Einige unserer Gäste fingen an, sich zu prügeln, andere machten sich über die Weinflaschen her, die die Mägde auf die Tische gestellt hatten, ein paar der männlichen Gäste lästerten über die ruinierte Garderobe einiger der Damen. Einer unserer Schwager riss sich mit Schwung ein paar Stofffetzen von seiner Kehrseite und schien Spaß daran zu haben. Sein Lachen drang durch den Lärm bis zu uns herauf. Vater war ja schon immer der Meinung, die ganze angeheiratete Verwandtschaft sei unserer nicht würdig. Sie hatten, was wir nicht hatten, nämlich viel Geld, und wir hatten, was sie nicht hatten, nämlich Haltung – meistens jedenfalls – und einen viel edleren Stammbaum.
Natürlich war jede Hochzeit, die wir feierten, auch eine Art Heiratsmarkt für die noch unvermählten Schwestern. Iks sah sich schon seit ein paar Jahren nicht gerade unauffällig um, aber bisher mit keinem vorzeigbaren Ergebnis. Sie konnte es nicht mehr erwarten, ein Leben weit von der Burg entfernt zu beginnen.
Und ich? Ich hatte mir bis voriges Jahr keine derartigen Gedanken über meine Zukunft gemacht. Mir die Freiheit durch eine Vernunftheirat zu erkaufen, kam mir lächerlich vor. Darauf würde ich mich nie einlassen.
Aber bei der letzten Hochzeitsfeier hatte ich mich einige Male mit einem jungen Mann unterhalten, er war der Trauzeuge des Bräutigams, in keiner Weise mit uns verwandt, nicht einmal angeheiratet, und schon deshalb eine Ausnahmeerscheinung. Er gefiel mir sofort. Es war so leicht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, er schnitt weder auf, noch protzte er mit einer übertrieben teuren Garderobe. Er war so angenehm, so freundlich und wusste mich mit witzigen Bemerkungen zu unterhalten wie kein anderer. Vor allem aber hörte er mir zu! Wie sehr er mir gefiel, verstand ich erst, als er wieder abgereist war und ich ihn zu vermissen begann, mit einem seltsamen, ziehenden Gefühl in der Brust. War ich etwa verliebt?
Ich hatte Iks nichts davon erzählt und verlor mich nur ab und zu in Tagträumen.
Er war auch dieses Mal gekommen, er hatte es so eingerichtet, eine Einladung zu erhalten, das konnte nicht leicht gewesen sein. Vater handhabte die Einladungen, was junge Männer und den Heiratsmarkt betraf, sehr strikt. Ich bezweifelte, dass Andris einen Stammbaum vorzuweisen hatte, der Gnade vor seinen Augen fand.
Wir hatten uns nur kurz gesehen, Andris und ich, als er eingetroffen war, aber ich hatte sofort begriffen, dass er meinetwegen da war. Nur meinetwegen. Wie wunderbar das war! Ich war betört vor Glücksgefühlen.
Und wie furchtbar erschien das, was mir nur zu bald bevorstand.
Jetzt stand Andris unter einer Weinrebe im Hof und ließ amüsiert seinen Blick schweifen, vielleicht war er auf der Suche nach mir. Dass er sich an dem Trubel nicht beteiligte, sondern die Ruhe behielt, sprach sehr für ihn.
Ich musste an mich halten, mich nicht über die Balustrade zu beugen und ihn zu rufen oder wenigstens durch Winken auf mich aufmerksam zu machen: einerseits wegen Iks, sie sollte ja nichts von mir und Andris wissen, aber vor allem aus lauter Angst, dass mich der Mut verließ. Die Aufgabe, die ich übernommen hatte, erschien mir immer weniger lösbar, viel zu schwer, unberechenbar und gefährlich, und eigentlich war ich auch schon viel zu lange hier oben stehen geblieben.
»Ich rede mit dir! Und sieh mich wenigstens an, damit ich weiß, dass du mich hörst«, forderte Iks lautstark.
So gut ich sie verstand, ging ich immer noch nicht auf sie ein, denn in dem Moment entdeckte ich unsere Eltern. Mutter zog Vater auf eine der Türen zu, um ihn aus dem Gedränge zu führen. Er wirkte ein bisschen benommen, als könne sein Verstand nicht fassen, was da vor sich ging. Aber bevor sie die Tür erreichten, wurden sie von Artemisia, unserer ältesten Schwester, und deren Mann aufgehalten. Unser Schwager gestikulierte außer sich vor Wut, ich konnte jedoch nicht hören, was er sagte, aber wahrscheinlich würden sie vorzeitig abreisen.
So wie es aussah, klappte unser Streich sogar besser als gedacht. Die restliche Festgesellschaft würde sicher noch eine Weile mit sich selbst beschäftigt sein.
»Was hast du gesagt?«, wandte ich mich endlich Iks zu und machte ein dummes Gesicht, aber davon ließ sie sich nicht täuschen.
»Wo hat sich unser Bruder verkrochen? Sag’s mir sofort!«, forderte sie.
»Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.« Was zumindest beinahe stimmte.
Iks machte Anstalten, nach mir zu greifen, doch ich kam ihr zuvor, drehte mich um und rannte davon.
Dummerweise spürte sie mich zwei Stunden später wieder auf. Im Hof war es ruhig geworden, jedenfalls drang kein Lärm mehr bis zu mir in den abgeschiedenen Flügel der Burg. Ich hockte auf dem Boden an der Wand, den Rucksack, den ich am Vorabend hierhergebracht hatte, an mich gedrückt und Kater neben mir, der mir schon eine geraume Weile nicht mehr von den Fersen wich. Ich hatte mir ein großes Tuch um den Kopf geschlungen.
Neben mir lag die Schere, mit der ich Zett die Haare geschnitten hatte. Ich war bedrückt. Lief wirklich noch alles nach Plan? Ich bezweifelte es.
»Hör auf, vor mir davonzulaufen«, herrschte Iks mich im Näherkommen an.
Ich starrte vor mich hin und rührte mich nicht. Ich wusste, wohin sie schaute.
»Yo?« Ihre Stimme klang ein wenig belegt. »Was ist das? Was hast du getan?« Jetzt eindeutig entsetzt.
Mit einem Ruck zog sie mir das Tuch vom Kopf und schrie auf.
»Nach was sieht es denn aus?«, fragte ich matt zurück.
Meine Schwester sog scharf die Luft ein. »Bist du jetzt gänzlich irregeworden?«, rief sie.
Ich schlang die Arme um meine Knie. Rings um mich herum auf dem verstaubten Steinboden ringelte sich mein langes, hellblondes Lockenhaar, ein sichtbares Merkmal, das mich mit meinen vielen, bildschönen Halbschwestern verband. »Mir ist jetzt leichter um den Kopf. Kurze Haare sind so viel praktischer.«
»Du siehst aus wie ein Pudel«, bemerkte Iks aufgebracht. »Wie ein ziemlich schlecht getrimmter übrigens.«
Ich brach in Tränen aus.
»Das wächst nach«, beschwichtigte sie mich, aber das wollte ich nicht hören.
Iks setzte sich neben mich, legte mir schweigend den Arm um die Schultern und wartete, bis meine Tränen versiegten. Manchmal tat sie genau das Richtige.
»Ist das ein Akt der Reue oder der Selbstbestrafung?«, fragte sie sanft.
Bedrückt dachte ich an Andris und daran, ob seine Großmut wohl so weit gehen würde, eine Halbirre mit geschorenem Kopf noch attraktiv zu finden. Und würde ich jemals Gelegenheit haben, ihm zu erklären, warum ich im Begriff stand, ein ungeheures Wagnis auf mich zu nehmen? Und verrückte Dinge tat? Es fühlte sich jetzt schon so an, als hätte ich etwas verloren, das ich eigentlich erst noch gewinnen musste.
Eine Zukunft mit Andris? Mein Leben überhaupt?
Ich wurde erst wieder aus meinen Gedanken gerissen, als ich merkte, wie Iks versuchte, mir den Rucksack zu entwinden.
»Du willst doch wohl nicht abhauen, weil du so viel angestellt hast?«, fragte sie. »Und wo ist Zett, verdammt noch mal? Die halbe Verwandtschaft ist schon auf der Suche nach ihm. Besser, du machst dir klar, dass ihr dem Familiengericht ja doch nicht entgeht. Wir wissen, dass er die Kinder überredet hat, die Bänke mit Leim zu bestreichen, aber ihr habt das alles gemeinsam ausgeheckt, nicht wahr? Ihr seid längst überführt, Leugnen bringt gar nichts.«
Auf einmal fühlte ich mich nur noch müde und erschöpft und von furchtbaren Zweifeln geschüttelt. Ich machte mich so klein wie möglich, ich kroch geradezu in mich zusammen. Ich stand im Begriff, sehr viel aufzugeben, und wusste nicht, ob ich das Richtige tat. Wie gern wäre ich jetzt an Iks’ Stelle gewesen!
»Yo, wo ist Zett?«
Langsam hob ich den Kopf. »Weg, Iks, er ist weg.«
Meine Schwester zog den Rucksack näher zu sich heran und beäugte ihn. Ich merkte, wie es in ihr arbeitete.
»Und du willst ihn suchen gehen, sehe ich das richtig?«
Mit einer Hand zupfte sie an der Hose, die ich trug, es war eine alte, ungewaschene von Zett, aus sehr strapazierfähigem Stoff. Ich musste den Saum an den Beinen nur einmal umkrempeln und brauchte einen Gürtel, der die Hose in der Taille hielt. Ich trug auch ein altes Hemd von Zett, was nicht ungewöhnlich war, seine Sachen waren fürs Ziegen hüten oder Stall ausmisten praktischer als Röcke oder Kleider.
»Du bist ja sogar schon richtig für eine Reise gekleidet. Er ist also nicht mehr in der Burg«, fuhr Iks mit vollendeter Logik fort. »Hast du gesehen, wie er sie verlassen hat? Und wann?«
Iks begann, in meinem Rucksack zu wühlen, und zog einen großen grauen Wollumhang hervor, aber bevor sie noch mehr erwischen konnte, riss ich ihr den Rucksack aus der Hand.
»Na, und wennschon! Wer außer mir kann Zett suchen und ihn auch noch finden?«
»Schlag dir das aus dem Kopf, Yo. Es ist schon blöd genug, dass er weggelaufen ist. Hör auf, dich wie ein verzogenes Kind zu benehmen. Irgendwann ist sowieso Gras über die Sache gewachsen, das war bisher immer so.«
Über diese nicht, hätte ich antworten können. Denn die nimmt gerade erst richtig Fahrt auf.
Langsam besann ich mich auf Vernunft, gute Argumente und gut gemeinte Hinterlist, die nicht sofort ins Auge fiel. »Hör zu, beruhige du die Verwandtschaft, und ich suche Zett, ich kenne schließlich alle seine Verstecke inner- und außerhalb der Burg. Lass uns die Aufgaben teilen wie immer, Schwester.«
Iks betrachtete mich abwägend. »Vielleicht nicht mal die schlechteste Idee des Tages.«
Sie stand auf und reichte mir die Hand. »Dann komm mal auf die Beine, Schwester.«
Iks
Für wie dämlich hielt sie mich? Ich brauchte nicht lange, um alles, was mir nötig schien – zur Vorsicht packte ich noch etwas mehr ein –, in einen Mantelsack zu stopfen. Eigentlich war mir klar, dass wir die Suche kaum über die ganze Nacht ausdehnen würden, aber bei Yo und Zett musste man stets auf Ungewöhnliches und Überraschendes gefasst sein.
Über Hintertreppen stahl ich mich aus dem Haus. An der Sache musste mehr dran sein, als die beiden uns allen weismachen wollten. Der Streich mit den klebrigen Bänken war normalerweise etwas, das unter ihrer Würde war. Aus dem albernen Alter waren die Zwillinge heraus.
Im Hof der Vorburg zwischen den abgestellten Kutschen traf ich auf keine menschliche Seele, dagegen drang aus der Küche, als ich an ihr vorbeischlich, lautes Gelächter, und ich konnte mir denken, worüber dort geklatscht wurde. Diese Hochzeitsfeier hatte Legendenwert. So kam heute zumindest doch noch etwas Gutes zustande, wenn auch nicht für unsere Familie.
Sehr gern hätte ich Barnet, Artemisias attraktivem Neffen, einen Hinweis gegeben, dass ich dabei war, diese kleine, üble Familienangelegenheit auf ebenso souveräne wie verständige Art zu lösen. Schade, dass ich darauf verzichten musste, aber vielleicht hätten wir ja später Gelegenheit, darüber und über lästige jüngere Geschwister zu reden. Hoffentlich hatte unser Ganter ihn diesmal nicht erwischt und in schlechte Stimmung versetzt.
Die Tür zum Stall stand weit offen, gewohnheitsmäßig wollte ich sie schließen, lugte dann, einer plötzlichen Eingebung folgend, aber dennoch hinein. Im Inneren war Yo gerade dabei, sich, sentimental, wie sie war, von den Kühen, den Ziegen und unserem einzigen Pferd zu verabschieden. Wozu dieser Aufwand? Aber das traf sich, fand ich, gar nicht so schlecht.
»Also gut, dann satteln wir das Pferd und nehmen es mit.«
Wie erwartet, zuckte Yo zusammen. »Was willst du hier?«
»Vaters Pferd satteln und mitnehmen, es kann uns und das Gepäck tragen. Wir kommen viel rascher voran und auch wieder zurück.«
»Ich glaube nicht.«
Unser einziges Pferd war ein riesiger Rappe von königlicher Abstammung, und er benahm sich entsprechend unberechenbar. Vater ritt ihn schon lange nicht mehr, unser Diener bewegte ihn ab und zu unter Lebensgefahr, und nur Zett kam ganz gut mit ihm zurecht. Er hatte offensichtlich nicht daran gedacht, auf ihm das Weite zu suchen. Vielleicht war das ein Grund, wieso Yo nicht auf meinen Vorschlag eingehen wollte.
»Wieso nicht? Weißt du am Ende doch, wo er steckt, und dass uns ein Pferd nicht zu ihm führen kann?«