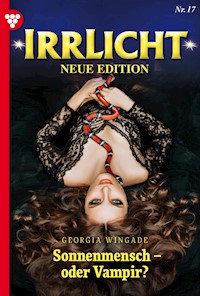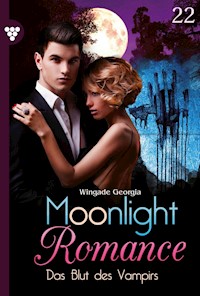Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Moonlight Romance
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Es ist der ganz besondere Liebesroman, der unter die Haut geht. Alles ist zugleich so unheimlich und so romantisch wie nirgendwo sonst. Werwölfe, Geisterladies, Spukschlösser, Hexen, Vampire und andere unfassbare Gestalten und Erscheinungen ziehen uns wie magisch in ihren Bann. Moonlight Romance bietet wohlige Schaudergefühle mit Gänsehauteffekt, geeignet, begeisternd für alle, deren Herz für Spannung, Spuk und Liebe schlägt. Immer wieder stellt sich die bange Frage: Gibt es für diese Phänomene eine natürliche Erklärung? Oder haben wir es wirklich mit Geistern und Gespenstern zu tun? Die Antworten darauf sind von Roman zu Roman unterschiedlich, manchmal auch mehrdeutig. Eben das macht die Lektüre so fantastisch... Kaum aus der Tür, empfing ihn ein greller, die Augen blendender Sonnenschein, der so gar nicht zu dem mit an Emil Nolde erinnernden Kumuluswolken bedeckten Himmel passte. Er glaubte, alle Nachbarn bestens zu kennen, doch die Frau in ihrer Friesentracht, die da vor ihm stand, war ihm unbekannt. Sie schien in dem grellen Sonnenglast an Gestalt zu verlieren, jedenfalls sah er sie nicht ganz scharf, wie durch einen leichten Nebel. »Rettet die gelbe Königin!« rief die Unbekannte ihm entgegen und deutete über das Haus hinweg Richtung Wyk, etwa dorthin, wo sich die Fußgängerzone mit dem historischen Glockenturm befand. »Die Königin ist in Gefahr. Ohne sie droht der Insel der Untergang im großen Sturm! Nur sie kann das Unheil aufhalten.« Die aktuelle Sturmwarnung klang ernst. Anfang bis Mitte Mai war ein grönländischer Sturmausläufer, der die norddeutsche, insbesondere die holsteinische, Küste heimsuchte, nicht unbedingt die Regel, aber auch nichts Außergewöhnliches. Dann wühlten Böen bis zu einhundertfünfzig Stundenkilometern und mehr das Wasser auf und schlugen die Wellen mit der Kraft gigantischer Stahlhämmer gegen die Riffs und über die Sandbänke, so dass im schlimmsten Fall ganze Teile einer Hallig oder Insel verloren gingen. Föhr, das geschützter lag, – im Norden von Sylt, im Westen von Amrum und der Hallig Langeness gedeckt – musste sich eigentlich wegen eines solchen Sturmes von allen nordfriesischen Eilanden am wenigsten Sorgen machen. Anders als bei der zweiten »Groten Mandränke«, als die Insel schwer beschädigt wurde. Trotzdem, die Warnung der Meteorologen klang ernst und war auch ernst gemeint. Insbesondere an der Westseite und der Nordwestecke Föhrs musste mit eventuell sogar starken Schäden gerechnet werden. Und sei es nur, dass der Sturm einen Teil des aufgespülten Sandstrandes zwischen Nieblum und Utersum wieder ins Meer zurückholte. Die Unruhe der Bevölkerung hielt sich immerhin in Grenzen, war die Insel doch zuletzt vor langen Jahren regelrecht überschwemmt worden. Selbst bei der verheerenden Sturmflut von 1962, von der insbesondere die Hansestadt Hamburg in Mitleidenschaft gezogen worden war, war die Insel weitgehend verschont geblieben. Ein drohender Deichbruch bei Dunsum, nicht vorhersehbar und deswegen umso gefährlicher, konnte in letzter Sekunde durch die vereinten Anstrengungen von Feuerwehr und zahlreichen freiwilligen Helfern verhindert werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Moonlight Romance – 13 –
Die Bernsteinhexe
Göttin des Meeresgoldes, rette die Insel!
Georgia Wingade
Kaum aus der Tür, empfing ihn ein greller, die Augen blendender Sonnenschein, der so gar nicht zu dem mit an Emil Nolde erinnernden Kumuluswolken bedeckten Himmel passte. Er glaubte, alle Nachbarn bestens zu kennen, doch die Frau in ihrer Friesentracht, die da vor ihm stand, war ihm unbekannt. Sie schien in dem grellen Sonnenglast an Gestalt zu verlieren, jedenfalls sah er sie nicht ganz scharf, wie durch einen leichten Nebel. »Rettet die gelbe Königin!« rief die Unbekannte ihm entgegen und deutete über das Haus hinweg Richtung Wyk, etwa dorthin, wo sich die Fußgängerzone mit dem historischen Glockenturm befand. »Die Königin ist in Gefahr. Ohne sie droht der Insel der Untergang im großen Sturm! Nur sie kann das Unheil aufhalten.«
Die aktuelle Sturmwarnung klang ernst. Anfang bis Mitte Mai war ein grönländischer Sturmausläufer, der die norddeutsche, insbesondere die holsteinische, Küste heimsuchte, nicht unbedingt die Regel, aber auch nichts Außergewöhnliches. Dann wühlten Böen bis zu einhundertfünfzig Stundenkilometern und mehr das Wasser auf und schlugen die Wellen mit der Kraft gigantischer Stahlhämmer gegen die Riffs und über die Sandbänke, so dass im schlimmsten Fall ganze Teile einer Hallig oder Insel verloren gingen. Föhr, das geschützter lag, – im Norden von Sylt, im Westen von Amrum und der Hallig Langeness gedeckt – musste sich eigentlich wegen eines solchen Sturmes von allen nordfriesischen Eilanden am wenigsten Sorgen machen. Anders als bei der zweiten »Groten Mandränke«, als die Insel schwer beschädigt wurde.
Trotzdem, die Warnung der Meteorologen klang ernst und war auch ernst gemeint. Insbesondere an der Westseite und der Nordwestecke Föhrs musste mit eventuell sogar starken Schäden gerechnet werden. Und sei es nur, dass der Sturm einen Teil des aufgespülten Sandstrandes zwischen Nieblum und Utersum wieder ins Meer zurückholte.
Die Unruhe der Bevölkerung hielt sich immerhin in Grenzen, war die Insel doch zuletzt vor langen Jahren regelrecht überschwemmt worden. Selbst bei der verheerenden Sturmflut von 1962, von der insbesondere die Hansestadt Hamburg in Mitleidenschaft gezogen worden war, war die Insel weitgehend verschont geblieben. Ein drohender Deichbruch bei Dunsum, nicht vorhersehbar und deswegen umso gefährlicher, konnte in letzter Sekunde durch die vereinten Anstrengungen von Feuerwehr und zahlreichen freiwilligen Helfern verhindert werden.
Indes hatte der aktuell aufkommende Sturm auch Folgen, die für die Bewohner so gut wie unbemerkbar blieben. In Oevenum, mitten in der Insel, tat sich etwas. Unter der sogenannten Pfarrwarft, hier hatten die Nieblumer Pastoren seit Mitte des 17. Jahrhunderts ihren langjährigen Wohnsitz, rührte sich etwas. Schemenhaft drückte sich gegen Abend ein undefinierbares Etwas aus einem Hohlraum unter dem Wohngebäude, verdichtete sich an der frischen, bereits sturmgepeitschten Luft zu fester Form und wurde zu einer Frauengestalt, die sich aufmachte, ihren seit Jahrhunderten gewohnten Kontrollgang über die Insel anzutreten.
Unbemerkt blieb das, denn die Pfarrwarft lag am Rande des Inseldorfes und der reichlich verwilderte Garten bot darüber hinaus ausreichend Deckung, um sich vom Haus zu entfernen. Auch der Besitzer des historischen Bauwerks, ein Verleger und erfolgreicher Unterhaltungsschriftsteller, hatte keine Ahnung, was sich da tat.
Die Dinge nahmen ihren Lauf.
*
Nachts war sie mehrmals vom Heulen des Sturmes aufgewacht. Der Regen war gegen die Fenster geschlagen und eine nicht gesicherte Tür am Gartenhaus des Nachbargrundstückes hatte in kurzen Abständen gegen die Mauer geschlagen, bis das »Tock! Tock!« schließlich verstummt war. Entweder war der Nachbar aufgestanden, um den Lärm zu beenden, oder der Sturm hatte die unverschlossene Tür ausgehebelt. Dann würde die Tür eventuell in einiger Entfernung wieder aufzufinden sein.
Jetzt herrschte fast gespenstische Stille am Berliner Ring, einem der besseren Wohnbezirke von Wyk. Ein Blick aus dem Fenster zeigte Leni, dass die Tür des Gartenhauses nebenan von der Wucht des Unwetters abgebrochen worden war. Die junge Frau lehnte sich weit aus dem Fenster und atmete die frische kühle Luft ein, ganz tief bis auf den Grund der Lunge. Das tat gut, denn in Offenbach, ihrer Heimatstadt, gab es keine solche Köstlichkeit für die Bronchien; zwar gab es so gut wie keine Lederindustrie mehr vor Ort, aber die Industrieabgase und der Mief in der Luft waren geblieben.
Helena Zurnieden, genannt Leni, war vorgestern auf die Insel Föhr gekommen, hatte in Dagebüll die 15 Uhr-Fähre bekommen, obwohl sie erst die darauf folgende um 16 Uhr 30 gebucht hatte. Der nette Kassierer hatte sogar an der Anlegestelle Bescheid gesagt, dass man einen Augenblick warten möge. So hatte sie die »Uthlande« problemlos erreicht und war etwa 45 Minuten später in Wyk von Bord gefahren.
Mit ihrem kleinen Japaner hatte sie nur wenige Minuten bis zum Berliner Ring gebraucht, wo sie die Familie ihrer Freundin Gerrit antraf, die mit einem starken Friesentee auf sie wartete. Gerrit selbst arbeitete auf der Sparkasse und gesellte sich erst nach 18 Uhr zu ihnen.
Ganz im Gegensatz zur gängigen Meinung (insbesondere im Süden der Republik) über die Norddeutschen waren die Asmussens ein sehr aufgeschlossenes, kommunikatives Völkchen. Allesamt geboren auf Föhr, bewiesen sie, dass Nordfriesen nicht notgedrungen wortkarg und abweisend sein mussten. Inklusive Großmutter war das ein Drei-Generationen-Haus: Die Eltern, Knut und Ingrid, bewohnten das Erdgeschoss zusammen mit der leicht gehbehinderten Großmutter, die zu ihrem kleinen Appartement einen separaten Eingang hatte.
Die bis dato – zum Leidwesen ihrer Großmutter – noch ledige Gerrit teilte sich mit etwaigen Feriengästen den ersten Stock des Hauses – für Leni blieb reichlich Platz. Neben einer sehr geräumigen Wohnküche war da noch ein schmaleres Schlafzimmer mit einem einladenden Bett, dessen Matratze zu Lenis Zufriedenheit ausreichend hart war. Mit Gerrit teilte sie sich den Fernseher, der in einem extra Raum aufgestellt war.
Zum Abendessen, zu dem sich alle Familienmitglieder am runden Esstisch einfanden, gab es gebratene Heringsfilets mit Bratkartoffeln und zum Nachtisch selbstgemachte rote Grütze mit sahniger Vanillesauce. Für Leni waren die Bratkartoffeln mit den ausgelassenen Speckwürfeln gewöhnungsbedürftig, denn bei ihr zu Hause kannte man eine andere Zubereitungsart. Aber zu den leckeren Heringsfilets passten sie genau, und da die frische Meeresluft, insbesondere auf der »Uthlande« ihren Appetit angeregt hatte, war ihr Teller im Handumdrehen leer. Den angebotenen Nachschlag lehnte sie ab, nicht weil es ihr nicht ausreichend geschmeckt hatte, sondern weil sie die Entstehung von Speckröllchen an Bauch und Hüfte nicht unbedingt unterstützen wollte. Diese kamen, zu ihrem Leidwesen, von ganz allein.
Ihr Angebot, beim Abwasch zu helfen, wurde entrüstet abgelehnt, dafür habe man schließlich eine Geschirrspülmaschine. Daher war Leni sofort einverstanden, als sie von Gerrit eingeladen wurde, einen kleinen Spaziergang zu machen, um erste Eindrücke zu sammeln. Außerdem half das, die Speckwürfel der sinnreichen Verwendung als Brennstoff für Bewegung zuzuführen.
Vom Berliner Ring konnten die beiden jungen Frauen direkt in den sogenannten Grünstreifen gelangen, einen Waldgürtel, der sich
von Wyk über die ganze Insel erstreckte und der um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert von dem Badearzt Carl Häberlin initiiert worden war. Damals eher verlacht oder scheel angesehen, war man heute froh über diese Pionierarbeit, von der nicht nur die Touristen, sondern vor allem in den Wintermonaten auch die Einheimischen profitierten. Ein derartiges Waldgebiet hatte nicht einmal das mondäne Sylt, Föhr nach Norden vorgelagert, aufzuweisen.
War der Wind auf der Fähre noch relativ gering gewesen, so merkte Leni beim Verlassen des Asmussen-Hauses sofort, dass es auffrischte. Wie Gerrit ihr erzählte, hatte es eine Sturmwarnung gegeben, im Verlaufe der Nacht rechnete man mit einer Sturmflut, die insbesondere den vorgelagerten Halligen Überschwemmungen bringen würde. Allerdings war dies, wie Gerrit trocken anmerkte, keineswegs etwas Ungewöhnliches: »Ohne diese Sturmbedrohungen gäbe es heutzutage die Halligen wahrscheinlich gar nicht mehr. Eigentlich rechnen sie sich nicht, wenn man das Ganze rein wirtschaftlich betrachtet. Zu teuer ist das Leben auf diesen menschlichen Stützpunkten im großen Wasser. Lediglich unter dem Gesichtspunkt des Küstenschutzes behalten die Halligen ihre Daseinsberechtigung – sie bieten dem Sturm und der Flut die Stirn und teilen dessen Wucht, so dass sie erheblich weniger gefährlich auf die Westküste Föhrs prallen. Deswegen wird jeder Hof bzw. jede Warft – das sind die Landaufschüttungen, auf denen die Hallighäuser stehen – von der Landesregierung bezuschusst.«
Der Waldstreifen bot mit seinen hohen Bäume im Wechsel mit eingesprengtem Unterholz hervorragenden Schutz gegen den allmählich an Stärke zunehmenden Sturm und die in immer kürzeren Abständen auftretenden Böen. Als die beiden am Südstrand von Wyk aus dem Schutz der sich unter der Wucht des Sturmes verbeugenden Bäume traten, wurden sie fast umgeweht. Die Kraft der Naturgewalten war so stark, dass auf dem Deich bereits kein Spazieren mehr möglich war. Leni sah einen jungen Burschen, der gegen die Sturmgewalt anrennen wollte. Er wurde umgeweht und konnte sich mit allergrößter Anstrengung nur auf allen Vieren in Sicherheit bringen.
»Kehren wir um!« schlug Gerrit daher vor, und Leni war sofort einverstanden und sehr dankbar für diese Absichtserklärung. Einen so heftigen Sturm hatte sie noch nie erlebt; instinktiv erahnte sie die immensen Gefahren, die damit einhergingen.
Der erste Abend im Kreise der Familie Asmussen ging bei einem Punsch ganz gemütlich zu Ende, nachdem sich der Gast vom Festland etwas frisch gemacht hatte. Der Schlaf war – trotz des immer wieder aufheulenden Sturmes – tief und fest. Die Meeresluft und der damit verbundene Klimawechsel vom Main hierher an die Nordsee taten ihre Wirkung.
*
Markus Fischer war mit sich selbst zufrieden. Angesichts der Sturmwarnung am Vortag hatte er seinen Wecker auf vier Uhr morgens gestellt und das in der Hoffnung, der Sturm möge bis dahin einigermaßen abgeflaut sein. Bis er sich gewaschen und angezogen hatte, war es knapp nach halb Fünf. Bis zum Flugplatz brauchte er mit dem Wagen knappe vier Minuten, das Surfbrett hatte er am Abend zuvor in der Garage bereitgelegt und musste es nur noch auf dem Wagendach festschnallen.
Die Wellen schlugen noch hoch und hatten überhöhte weiße Krönchen, als er nahe der Surfschule unmittelbar hinter den Hochhäusern, die den Flugplatz zur Wattseite einrahmten, den Strand betrat. Aber da er einen hohen Schwierigkeitsgrad brauchte, um sein Training erfolgreich durchziehen zu können, war ihm das gerade recht. Seit einer Woche war er hier auf der Insel, Unterkunft hatte er bei seiner Tante Rosi in der Strandstraße gefunden, Kost und Logis frei – was brauchte er mehr.
Außer natürlich Wind, in seinem Sinne guten Wind, der ihm ein intensives Training ermöglichte. Nach einigen mehr oder weniger flauen Tagen, die in seinen Augen eine einzige Enttäuschung gewesen waren, war ihm mit diesem Nordwest-Sturm ein Risikosurfen möglich, wie es die im September stattfindende Europäische Meisterschaft auf Sylt von allen Teilnehmern erforderte.
Er war mit seinen 19 Jahren relativ jung, gemessen an den meisten Teilnehmern, hatte sich aber immerhin soweit bei seinem Heimatverein in Bremen qualifiziert, dass er als einer der jüngsten Teilnehmer nominiert worden war. Und ehrgeizig, wie er war, wollte er natürlich ein respektables Ergebnis erreichen; ein Platz auf dem Treppchen – das war sein Traum. Dann sollte es weitergehen, etwa vor Floridas Küsten, an Steilküsten Südamerikas oder gar auf den Wiesenwellen vor Tahiti, er sehnte sich danach, dass ihm alle diese Möglichkeiten offen stehen würden – vorbehaltlich es glückte ihm ein gutes Abschneiden im September auf Sylt.
Es erforderte einiges Geschick, gegen die anbrausenden Wellen genügend Entfernung zum Ufer zu gewinnen, doch da war er schon allzu sehr Profi, als dass er sich davon hätte abschrecken lassen. Im Abstand von einhundertfünfzig Metern vom Land fasste ihn der Sturm mit voller Wucht, er brauchte alle Kraft in Armen und Beinen, um nicht umgeworfen oder kopfüber nach vorne geschleudert zu werden. Kraft, die er sich durch systematisches Training in der »Muckibude« seit drei Jahren zugelegt hatte.
Plötzlich erspähte er im aufgewühlten Wasser ein seltsames Objekt, etwa groß wie ein Kindskopf oder sogar etwas größer, an dem er blaue Augen zu erkennen glaubte. Eine Welle trieb ihn nach rechts, so dass er das gesichtete Objekt aus den Augen verlor, nur um es alsbald wieder zu erblicken. Es hatte eine seltsame braungelbe Farbe, die wegen des anhängenden Tangs nur schwer genau zu definieren war.
Im Bestreben, Genaueres zu erkennen, verkantete er das Brett, so dass eine plötzliche Bö leichtes Spiel hatte, ihn umzuwerfen. Der Aufprall im siedenden Wasser war heftig, aber nicht so brutal, dass er sich nicht hätte helfen können. Da kannte er inzwischen alle Tricks, um wieder aufs Brett zu kommen.
Als er sich stabilisiert hatte und Ausschau hielt nach dem seltsamen Ding, war nichts mehr zu sehen. Er konnte sein Training fortsetzen, wie er es geplant hatte, und er war sich eigentlich sicher, dass er den Wettbewerb auf Sylt mit Bravour bestehen würde.
*
Am Tag nach dem Sturm hatte Mario di Pentola erst zur dritten Stunde Schule, an diesem Dienstag fiel der Deutschunterricht wegen Erkrankung zweier Lehrkräfte aus. Er besuchte das Gymnasium im Schul- und Sportzentrum und war ein guter Schüler, der sich Mühe gab, um das Abitur zu schaffen. Seine Eltern betrieben das Restaurant »Vesuvio« in der Fußgängerzone und waren sehr stolz auf ihren Sohn, der einmal studieren sollte. Die Schufterei in Küche und Service wollten sie ihm ersparen.
Mario liebte es, in den Freistunden am Strand entlang zu laufen und den Möwen zuzusehen, die zusammen mit den Dohlen auf der Suche nach Nahrung waren. Aus dem Restaurant nahm er des Öfteren altes Brot mit, das die Gäste übrig gelassen hatten. Eigentlich sollte man die Vögel ja nicht füttern, aber Mario konnte einfach nicht anders. Er hatte, dank des Restaurants seiner Eltern, so viel Essen wie z. B. nicht aufgegessenes Brot zur Verfügung, warum sollte er nicht ein wenig davon weitergeben an jene, etwa Möwen und Dohlen, die etwas zu fressen suchten?
Gegenüber vom Café Steigleder, einer der ältesten diesbezüglichen Einrichtungen der Stadt, sah Mario zwei ältere Schüler aus seiner Schule, die Fußball spielten. Offenbar hatten auch sie erst späteren Unterrichtsbeginn. Ihr Ball war relativ klein und sie schossen ihn sich eher lustlos zu. Vielleicht hatten sie ja Lust, mit ihm zu spielen? Zu dritt machte das sicherlich mehr Spaß, er war auch bereit, als Torwart zu fungieren.
»Kann ich mitmachen?« rief er ihnen zu, die daraufhin das Spiel unterbrachen und in seine Richtung blickten.
»Nee, eher nicht«, rief der stämmigere der beiden. Und der andere ergänzte: »Mit so jungem Gemüse spielen wir nicht!«. Und zu seinem Gefährten gewandt, fügte er hinzu: »Das ist der Italienerjunge vom ›Vesuvio‹, keinen Bock hab' ich da drauf!«
Mario hörte gerade noch, dass sie im Umdrehen etwas riefen wie »Ist sowieso kein richtiger Fußball!« und »Kannst ihn behalten! Viel Spaß damit!«
Daraufhin liefen sie weg und ließen den Ball liegen. Mario war mit wenigen Schritten am Platz des Geschehens und hob das ‚Ding‘ auf, denn aus der Nähe sah das keineswegs wie ein Fußball aus, auch wenn es annähernd rund war.
Außerdem war das Objekt, das er jetzt in der Hand hielt, verblüffend leicht. Als er genauer hinsah, kam ihm angesichts der braungelben Farbe eine Idee. Sein Vater Vincenzo di Pentola war bereits seit einer Stunde mit Vorbereitungen für den Tag im Restaurant beschäftigt, den würde er fragen. Er war ziemlich sicher, dass er ihm helfen konnte bei der Identifikation dessen, was er da am Strand aufgehoben hatte. Das hoffte er wenigstens. Und wenn alle Stricke reißen sollten: Neben dem »Vesuvio« befand sich ein Andenkenladen, betrieben von Anders Kieling, der des Öfteren zum preisgünstigen Mittagstisch herüberkam, den konnte er auch noch fragen.
Was Mario nicht voraussehen konnte, war die Aufregung, die sein Erscheinen in der Großen Straße auslösen sollte. Wyk hatte kurze Zeit darauf seine Sensation, die allerdings erst am nächsten Tag mit einem Artikel im »Inselboten« zur allgemeinen Kenntnis gelangen sollte.
*
Da Gerrit den ganzen Tag über in der Sparkasse, wo sie als Anlageberaterin arbeitete, Dienst hatte, hatte sich Leni ein eigenes Programm aufgestellt. Sie brauchte dringend eine Windjacke und eine Mütze, denn solche Kleidung war hier vonnöten; sie besaß das zwar alles, hatte diese Kleidungsstücke allerdings im Vertrauen auf die frühlingshafte Witterung zu Hause gelassen.
Ingrid Asmussen, Gerrits Mutter, hatte ihr am vergangenen Abend begeistert vom Museum der Westküste erzählt, das 2009 eröffnet worden war, private Stiftung eines von Föhr stammenden, in der Fremde zu Reichtum gekommenen Pharmakonzern-Unternehmers.