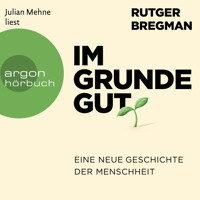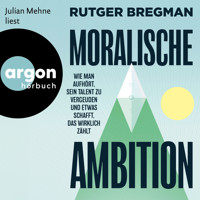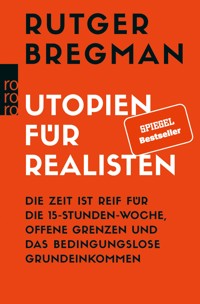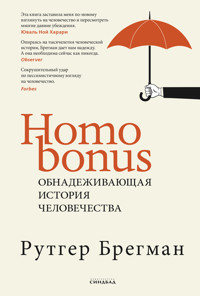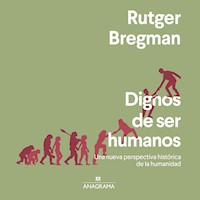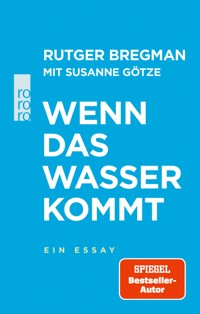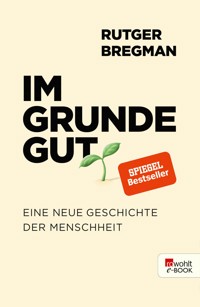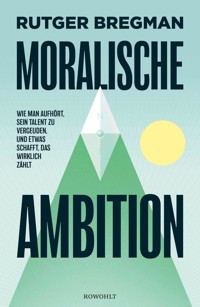
22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Dieses Buch ist Karotte und Peitsche zugleich. Rutger Bregman fragt: ‹Wer wollen Sie gewesen sein?›» Maja Göpel Dieses Buch handelt von Pionieren und Pionierinnen. Es erzählt die Geschichte von Menschen, die vor moralischer Ambition nur so strotzten: Abolitionisten, Suffragetten, Helden des Widerstands und Bürgerrechtlerinnen, von Menschen, die nicht nur Ideale hatten, sondern ihr Leben auch nach diesen Idealen ausrichteten – und den Lauf der Welt veränderten. Wie werden umwälzende Ideen nicht nur geboren, sondern auch in die Tat umgesetzt? Wie geht man die größten Herausforderungen seiner Zeit an? Wie kommt man vom Reden ins Handeln? Dieses Buch ist ein aufrüttelnder Blick in die Geschichte, ein packender Bericht über Menschen, die ihr ureigenes Talent in die Waagschale geworfen haben und zu großen Denkerinnen, Erfindern und Anführerinnen wurden, und über jene, die es ihnen heute gleichtun. Es ist auch eine Anleitung, wie jeder Einzelne im Angesicht von scheinbar überwältigenden Krisen in dieser Welt den Unterschied machen kann. «Das beste Gegenmittel gegen die Pessimisten und Zyniker, die glauben machen wollen, dass man gegen die Probleme unserer Zeit nichts ausrichten kann.» Max Roser
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Rutger Bregman
Moralische Ambition
Wie man aufhört, sein Talent zu vergeuden, und etwas schafft, das wirklich zählt
Über dieses Buch
Dieses Buch handelt von Pionieren. Es erzählt die Geschichte von Menschen, die vor moralischer Ambition nur so strotzten: Abolitionisten, Suffragetten, Helden des Widerstands und Bürgerrechtlerinnen, von Menschen, die nicht nur Ideale hatten, sondern ihre Karrieren auch nach diesen Idealen ausrichteten – und den Lauf der Welt veränderten. Wie werden umwälzende Ideen nicht nur geboren, sondern auch in die Tat umgesetzt? Wie geht man die größten Herausforderungen seiner Zeit an? Wie kommt man vom Reden ins Handeln? Dieses Buch ist ein aufrüttelnder Blick in die Geschichte, ein packender Bericht über Menschen, die ihr ureigenes Talent in die Waagschale geworfen haben und zu großen Denkerinnen, Erfindern, Aufwieglerinnen und Problemlöserinnen wurden. Es ist auch eine Anleitung, wie jeder Einzelne im Angesicht von scheinbar überwältigenden Krisen in dieser Welt den Unterschied machen kann.
«Dieses Buch wird Ihr Leben nicht leichter machen, sondern, ganz im Gegenteil, eher schwieriger. Ein Buch, von dem Sie sich vielleicht wünschten, Sie hätten es nie zur Hand genommen, denn nachdem Sie die letzte Seite umgeblättert haben, werden Sie nicht anders können: Sie müssen Ihr Leben ändern.» Rutger Bregman
Vita
Rutger Bregman, geboren 1988, ist Historiker und einer der prominentesten Denker Europas. 2017 erschien sein Bestseller «Utopien für Realisten», 2020 folgte «Im Grunde gut», das bisher in 46 Sprachen übersetzt wurde. Es war ein New-York-Times-Bestseller, ein Sunday-Times-Bestseller und steht seit vier Jahren auf der Spiegel-Bestsellerliste. Rutger Bregman lebt in den Niederlanden.
Ulrich Faure, geboren 1954 in Halle/Saale, war langjähriger Online-Chefredakteur beim Branchenmagazin BuchMarkt. Er lebt als Übersetzer aus dem Niederländischen, Publizist, Lektor und Herausgeber in Düsseldorf.
Impressum
Die Übersetzung wurde vom Nederlands Letterenfonds gefördert.
Schließen Sie sich der Bewegung auf moralischeambition.de an.
Die niederländische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel «Morele ambitie» bei De Correspondent (decorrespondent.nl/en), einer mitgliederfinanzierten Journalismusplattform für unabhängige Stimmen.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Morele ambitie» Copyright © 2024 by Rutger Bregman
Infografiken Leon de Korte
Illustrationen Cléa Dieudonné
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München, Nach dem Original von De Correspondent
Coverabbildung Creative director: Harald Dunnink (Momkai)
Lead designer: Martijn van Dam (Momkai)
ISBN 978-3-644-02137-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Mutter
Prolog
«I cannot believe that the purpose of life is to be ‹happy›. I think the purpose of life is to be useful, to be responsible, to be honorable, to be compassionate. It is, above all, to matter: to count, to stand for something, to have it make some difference that you lived at all.»
Leo Rosten
Schriftsteller (1908–1997)
Die Wissenschaftler trauten ihren Augen kaum. Ein solches Gehirn hatten sie noch nie gesehen. Es war der 22. Mai 2001, früh am Morgen, und in einem Labor an der Universität von Wisconsin starrten sie auf die letzten Bilder des MRT-Scanners.[1]
Was war da los? Das Gehirn der Versuchsperson zeigte das höchste Niveau von Gammawellen, das jemals in der Geschichte der Neurowissenschaft gemessen wurde. Die linke Seite des präfrontalen Kortex – der Teil des Gehirns, der für Glücksgefühle zuständig ist – brodelte nur so vor Aktivität, während die rechte Seite – der Teil, der für negative Gedanken zuständig ist – praktisch inaktiv war.[2]
Als die Ergebnisse der Studie bekannt wurden, jubelte die internationale Presse, dass der Mann mit dem weltbesten Gehirn gefunden sei. «Sein Level der Gedankenkontrolle ist atemberaubend hoch», schrieb ein britischer Journalist, «und die positiven Impulse in seinem Gehirn sind beispiellos.»[3]
Um wen handelte es sich? Und was war mit seinem Gehirn los?
Der Mann im Scanner war ein Mönch namens Matthieu Ricard. Er war im Paris der 1960er-Jahre aufgewachsen und hatte am renommierten Institut Pasteur im Fach Molekulargenetik promoviert. Doch mit 26 Jahren, eine glänzende wissenschaftliche Karriere in Aussicht, hatte er eine neue Richtung eingeschlagen. Er war in den hohen Norden Indiens gezogen. Dort, unter den Gipfeln des Himalajas, ging er bei den größten buddhistischen Meistern in die Lehre.
Schlussendlich sollte Ricard mehr als 60000 Stunden meditieren. Jahr für Jahr fütterte er seinen Geist mit Gedanken des Mitgefühls und der Nächstenliebe. Und die Ergebnisse waren verblüffend. Matthieu Ricard war, wie Zeitungen und Magazine titelten, «der glücklichste Mann der Welt».
Was dieser Mönch erreichte, ist das, was Millionen von Menschen als höchstes Ziel in ihrem Leben anstreben. Sie bedienen sich unzähliger Methoden, Mantras und Lifehacks, die Glück, Reichtum und Wohlbefinden verheißen. Man kann sehr leicht 60000 Stunden mit diesen Tausenden Büchern über die sieben Gewohnheiten, die zwölf Lebensregeln und das eine Geheimnis für ein langes und glückliches Leben verbringen. Immer in der Hoffnung, ein ebenso entzückendes Gehirn zu erwerben wie dieser illustre Franzose.
Aber man kann Monsieur Ricard auch unter einem anderen Blickwinkel betrachten. Er hat 60000 Stunden, 7500 Arbeitstage und damit dreißig Arbeitsjahre Vollzeit in seinem eigenen Kopf zugebracht. Dreißig Jahre, in denen er nichts für andere getan hat, dreißig Jahre, in denen er nicht einen Finger gerührt hat, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ist das wirklich so lobenswert?
Vielleicht wollen Sie mit Ihrer begrenzten Zeit auf diesem Planeten etwas anderes anfangen. Vielleicht ist Ihr persönliches Glück nicht Ihr einziges, geschweige denn Ihr höchstes Lebensziel. Vielleicht wollen Sie nicht mit dem nagenden Gefühl auf dem Sterbebett liegen, dass mehr drin gewesen sein müsste – viel mehr.
Wenn dem so ist, dann brauchen Sie ein anderes Buch als den soundsovielten Leitfaden für ein glückliches Leben. Ein Buch, das Ihnen das Leben nicht leichter, sondern schwerer macht. Ein Buch, das Ihnen keinen Trost spendet, sondern Unbehagen bereitet. Ein Buch, von dem Sie sich vielleicht sogar wünschen, es nie gelesen zu haben, weil Sie, wenn Sie die letzte Seite umgeblättert haben, selbst die Ärmel hochkrempeln müssen.
Das hier ist so ein Buch.
1.Nein, so wie Sie sind, sind Sie nicht gut
«People may spend their whole lives climbing the ladder of success only to find, once they reach the top, that the ladder is leaning against the wrong wall.»
Allen Raine
Schriftstellerin (1836–1908)
1.
Die größte Verschwendung unserer Zeit ist die Verschwendung von Talent. Überall auf der Welt gibt es Millionen von Menschen, die einen bedeutenden Beitrag zu einer besseren Welt leisten könnten, es aber nicht tun. Warum? Der erste Grund liegt auf der Hand: weil sie keine Möglichkeit dazu haben. Man denke nur an die Hälfte der Weltbevölkerung, die mit weniger als sieben Dollar pro Tag auskommen muss.[4] Wie viele verlorene Einsteins gibt es unter ihnen?
Aber hier möchte ich über diejenigen sprechen, die sehr wohl alle Chancen haben. Über Menschen, die ihre Karriere selbst gestalten können, deren Lebenslauf aber trotzdem traurig anmutet. Talente, denen die ganze Welt zu Füßen liegt, die aber in langweiligen, nutzlosen oder sogar schädlichen Jobs gestrandet sind.
Es gibt ein Mittel gegen diese Verschwendung, und dieses Mittel heißt «moralische Ambition». Moralische Ambition ist der Wille, die Welt drastisch zu verbessern. Die eigene Karriere den großen Problemen unserer Zeit zu widmen, seien es der Klimawandel oder Kindersterblichkeit, Steuerhinterziehung oder die nächste Pandemie. Es ist das Bedürfnis, etwas zu bewirken und etwas zu hinterlassen, das wirklich zählt.
Moralische Ambition beginnt mit einer einfachen Erkenntnis: Man hat nur ein Leben. Die Zeit, die einem auf Erden bleibt, ist das wertvollste Gut. Man kann keine zusätzliche Zeit hinzukaufen, und jede abgelaufene Stunde ist für immer verloren. Eine Fulltimekarriere besteht aus 80000 Stunden oder 10000 Arbeitstagen oder 2000 Arbeitswochen. Wie Sie diese Zeit verbringen, ist eine der wichtigsten moralischen Fragen in Ihrem Leben.
Was also wollen Sie in Ihren CV schreiben können? Wird Ihr curriculum vitae (Ihr «Lebenslauf») ein ordentliches, aber vorhersehbares Papier? Oder legen Sie die Messlatte höher? Moralisch ambitionierte Menschen trotten nicht in der Herde mit, sondern glauben an eine tiefere Form der Freiheit. Es ist die Freiheit, die üblichen Erfolgsmaßstäbe zu ignorieren und ihren Lebensweg als einen zu gehen, den sie tatsächlich nur einmal beschreiten können.
Wer die Welt zu einem besseren Ort machen will, muss sich in diesen Tagen nicht lange umsehen. Während sich die Menschheit von einer brutalen Pandemie erholt, erleben wir zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Anstieg des Hungers.[5] Während Demokratie und Rechtsstaat ins Wanken geraten, sind mehr als hundert Millionen Menschen auf der Flucht.[6] Während ein Hitzerekord den nächsten jagt, beschwört man in den Klimawissenschaften die Notwendigkeit «der größten und grundlegendsten Transformation» der Gesellschaft, die es je in Friedenszeiten gegeben hat.[7]
Es ist, kurz gesagt, Zeit für moralische Ambition.
Nun mögen Sie denken: Alles schön und gut, aber ich arbeite von neun bis fünf, habe zwei Kinder und einen laufenden Kredit. Ich tue mein Bestes, um den Müll zu trennen und ein bisschen weniger Fleisch zu essen, aber eine «grundlegende Transformation»? Danke, aber, ähm, nein.
In diesem Fall ist das Buch nichts für Sie. Um ehrlich zu sein, wollte ich mich ursprünglich vor allem an Teenager und Zwanzigjährige wenden, die das Grundgesetz ihres Lebens noch nicht geschrieben haben. Die meisten Menschen über dreißig ändern nur selten ihren Kurs. Wer einen Labrador, einen Tortenheber oder einen elektrischen Rasenmäher hat, ist in aller Regel ein hoffnungsloser Fall.
Falls es Sie irritiert, das zu hören – was ich mir gut vorstellen kann –, beweisen Sie doch das Gegenteil. Es gibt immer Ausnahmen, und in diesem Buch möchte ich Sie davon überzeugen, dass Sie diese Ausnahme sein können. Es ist nie zu spät, die eigene moralische Ambition zu steigern.
2.
Steigen wir ein mit einem einfachen Modell, was man mit seinem Talent anfangen kann. Ich glaube, die Möglichkeiten lassen sich grob in vier Kategorien zusammenfassen:
Es gibt Menschen, die mit ihrer Arbeit schlicht keinen Nutzen stiften. Sie schreiben Berichte, die niemand liest, oder managen Teams, die kein Management brauchen. Internationale Untersuchungen zeigen, dass etwa 8 Prozent aller Beschäftigten ihre eigene Arbeit für nutzlos halten. Weitere 17 Prozent bezweifeln, dass ihre Arbeit der Gesellschaft einen Nutzen bringt.[8]
Der Anthropologe David Graeber hat in solchen Fällen von Bullshit-Jobs[9] gesprochen. Aber welche Jobs sind damit gemeint? Auf jeden Fall wissen wir, um welche es nicht geht. Im Jahr 2020, zu Beginn der COVID-Pandemie, wurden überall Listen mit «systemrelevanten» Berufen angelegt, von Reinigungskräften bis zu Abfallwerkern, von Busfahrerinnen bis zu Feuerwehrleuten, von Lehr- bis zu Pflegekräften. Das sind die starken Schultern, die das Land am Laufen halten, und sie brauchen keine Predigt über moralische Ambition.
Aber es gibt auch eine nicht so unbedingt nützliche Klasse. Eine Klasse von Influencern und Werbetreibenden, von Lobbyisten und Managerinnen, von Börsenmaklerinnen und Wirtschaftsanwälten, die streiken könnten, ohne den Lauf der Welt zu stören. Bemerkenswerterweise gehören zu dieser Klasse auch viele Menschen mit hervorragenden Abschlüssen und beträchtlichen Gehältern. Wie ein Facebook-Mitarbeiter einmal seufzte: «Die größten Geister meiner Generation denken darüber nach, wie man Menschen am besten dazu bringt, auf Anzeigen zu klicken.»[10]
Aber es geht noch schlimmer. Einige Berufe sind rundum schädlich und fallen unter die sogenannten sin industries. Hier tummeln sich Werbetreibende, die süchtig machende Medikamente promoten, Buchhalter, die Reichen helfen, Steuern zu hinterziehen, Versicherungsvertreterinnen, die Wucherpolicen verkaufen, und alle, die für die Glücksspiel- oder Tabakindustrie arbeiten.
Über solche Jobs wird meist noch eine PR-Schicht gekleistert (beim Tabakkonzern Philip Morris zum Beispiel wirbt man eifrig für eine «rauchfreie Zukunft»). Aber man täusche sich nicht: Wir sprechen hier von Leuten, die ihre Diplome auf Kosten der Gesellschaft erwerben, nur um ebendiese Gesellschaft damit zu vergiften.
Es versteht sich von selbst, dass viele dieser Leute es für wenig erbaulich halten, auf Geburtstagsfeiern von ihrer nutzlosen oder gar schädlichen Arbeit zu erzählen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie überdurchschnittlich entlohnt werden, denn für eine derart peinliche Arbeit muss man ja fast schon eine Extravergütung erwarten. Tatsächlich besteht eine bemerkenswerte Korrelation zwischen der Höhe des Gehalts und der (Un-)Moral einer Branche.[11] Siehe z.B. diese Schweizer Studie:
Für manche Menschen in dieser «Weniger ambitioniert, weniger idealistisch»-Kategorie gibt es einen Ausweg: der nennt sich «frühzeitige Rente». Es existieren jede Menge Selbsthilfebücher, in denen erklärt wird, wie man mit einem Mindestmaß an Aufwand so viel Geld wie möglich «verdient», um sich so bald wie möglich bequem zurücklehnen zu können. Heutzutage gibt es jede Menge Zwanzig- und Dreißigjährige, die von einem «passiven Einkommen» träumen – Einkünfte aus Immobilien, Beteiligungen oder Kryptowährungen –, durch das sie hoffen, möglichst in jungen Jahren in Rente gehen zu können.[12]
Natürlich ist Sparen und Anlegen schön und gut, aber meist ist der Kern dieser Denkweise ein wenig bedauerlich. Ziel ist es, eine Form von Freiheit zu erreichen, in der man «nichts mehr tun muss». Der Übergang vom Bürosklaven zum Privatmenschen soll so schnell wie möglich erfolgen, damit man die lästige Arbeit auslagern kann und nichts mehr zur Gesellschaft beitragen muss.
Die zweite Kategorie verschwendeten Talents rekrutiert sich aus Menschen, die zwar ambitioniert, aber nicht sonderlich idealistisch sind. Oder anders gesagt, diese Menschen wollen zu den Besten gehören, hantieren aber eher mit seelenlosen Maßstäben für Erfolg herum: einem schicken Titel, einem fetten Gehalt, einem corner office und anderen Extrawürsten.
Man schaue sich nur die Abwanderung aus den renommiertesten Universitäten der Welt an. Nicht weniger als 45 Prozent der Absolventen und Absolventinnen der Harvard-Universität gehen in die Finanz- oder Beratungsbranche.[13] Aus einer Umfrage vor einigen Jahren geht hervor, dass auch in den Niederlanden 40 Prozent der high achievers (Studierte mit Bestnoten) bei großen Beratungsunternehmen wie McKinsey oder der Boston Consulting Group arbeiten wollen.[14] Vor allem bei jungen Männern stehen die Beratungsbranche und das Bankwesen hoch im Kurs.[15]
Wir können hier von einer kolossalen Verschwendung von Talent sprechen. Der Ökonom Benjamin Lockwood hat in den 2000er-Jahren am exklusiven Amherst College in den USA studiert und schon damals konstatiert, dass viele seiner Kommilitonen in Branchen andockten, deren Mehrwert nicht immer deutlich erkennbar sei.[16] 2017 veröffentlichte er zusammen mit zwei Kollegen eine bahnbrechende Studie, in der er errechnete, dass viele dieser ehemaligen Kommilitonen die Gesellschaft inzwischen Geld kosten.[17]
So verursache ein Wirtschaftsanwalt einen gesellschaftlichen Schaden von durchschnittlich rund 30000 Dollar pro Jahr, ein Investmentbanker sogar über 100000.[18] Das sind enorme Kosten, aber Lockwood betont, dass die sogenannten «Opportunitätskosten» noch weitaus höher liegen. Das ist der Fachjargon für: «Ach, wie viel hätten diese Leute beitragen können, wenn sie ihr Talent nicht vergeuden würden.»[19]
Die meisten Berater generieren zwar etwas Nutzen, aber – und das ist die Krux – viel weniger, als sie könnten. Sie verhelfen einer Organisation zu einem besseren Workflow oder einer klareren Personalpolitik, oder sie beraten ein Unternehmen nach dem anderen zu neuen Vorschriften. Das ist ehrliche Arbeit, und die Welt wird keineswegs schlechter davon. Aber denken Sie daran: Selbst im besten Fall tragen diese (Super-)Talente höchstens dazu bei, dass andere ein bisschen produktiver werden. Sie bringen nichts ins Rollen. Sie gründen keine neuen Organisationen, sorgen nicht für neue Erfindungen und befassen sich in der Regel nicht mit den größten Herausforderungen unserer Zeit.
Natürlich können diejenigen, die sich für diesen Karriereweg entscheiden, mit einem guten Gehalt rechnen. Wer zur Spitze gehört, verdient genug für das zweite Häuschen auf Sylt und kann dreimal im Jahr in den Skiurlaub fahren. Aber ist das wirklich alles, was man aus seinem Leben machen will? Gehört nicht viel mehr dazu? Viele talentierte Menschen, die in der Beratungsbranche arbeiten, so schrieb die Financial Times unlängst, «haben die Vorstellung, dass sie der Welt wenig Wert hinzufügen, und ihnen geht das Gefühl von persönlichem Wachstum, Gemeinschaft und Sinn» völlig ab.[20]
Selbst unter Ärztinnen und Ärzten sind solche frustrierten Töne zu vernehmen. Schließlich können die besten unter ihnen immer mehr für immer weniger Patienten tun. Ja, wir haben brillante Kardiologinnen, die eine Herzklappe durch einen Schnitt in der Leiste ersetzen können – toll, oder nicht? Aber in der Praxis werden solche sauteuren Operationen meist an reichen Achtzigjährigen durchgeführt, nur um deren Leben noch ein klein bisschen zu verlängern.[21] Schlimmer noch, Studien zeigen, dass bis zu einem Drittel der Behandlungen kaum einen Nutzen haben oder sogar schädlich sind.[22]
Inzwischen wird aber auch in der Unternehmenswelt viel Talent vergeudet. Natürlich, wenn man die Listen erfolgreicher Start-ups durchscrollt, stößt man immer auf ein paar inspirierende Initiativen. Denken Sie an ein Unternehmen, das an der Entwicklung von pflanzlichem Fleischersatz arbeitet, ein Unternehmen, das ein solarbetriebenes Auto baut, oder eine Organisation, die ein Nasenspray gegen Viren entwickelt – all das ist hervorragend und vielversprechend.[23]
Aber viel häufiger sieht man Menschen Unternehmen führen, die Lösungen für Probleme anbieten, von denen man gar nicht wusste, dass man sie überhaupt hatte. In der Kategorie «Beste Jungunternehmer» bin ich zum Beispiel über einen Abonnementdienst für elektrische Zahnbürstenköpfe gestolpert.[24] Oder denken Sie an die soundsovielte Kapitalanlage-App, das millionste Mode-Outlet, einen weiteren Versanddienst für Webshops oder ein Matratzen-Start-up, dessen Werbespots man in den Niederlanden in jedem Podcast zu hören bekommt. («Eine Matratze ist eigentlich das langweiligste Produkt, das man sich vorstellen kann», sagt der Gründer.[25])
Alles bestens, keine Sorge. Ich habe nichts gegen Matratzen, und es scheint superpraktisch zu sein, alle zwei Monate automatisch einen neuen Bürstenkopf für die Zahnbürste im Briefkasten zu haben. Gleichzeitig aber fragt man sich, was die Gründer solcher Unternehmen hätten erreichen können, wenn sie sich an dem Problem, dass jedes Jahr 5,4 Millionen Säuglinge und Kleinkinder an leicht zu verhütenden Krankheiten sterben, festgebissen hätten.[26]
Was wäre, wenn sie ihr Talent für etwas eingesetzt hätten, das wirklich zählt?
Und da wäre noch eine dritte Kategorie von Menschen, die zwar idealistisch sind, aber nicht sonderlich ambitioniert. Diese Lebenseinstellung scheint einen großen Teil der Generation Z zu kennzeichnen, Menschen, die nach 1996 geboren sind.
Eine Umfrage nach der anderen zeigt, dass die heutigen Teenager und Zwanzigjährigen die fortschrittlichste Generation aller Zeiten sind.[27] Das ist eine ausgezeichnete Nachricht. Viele junge Menschen sind ein Stück idealistischer als ihre Eltern und fokussieren sich auf die großen Themen unserer Zeit, ob es nun um Klimawandel oder Ungleichheit, Rassismus oder grenzüberschreitendes Verhalten geht.
Aber inzwischen scheint doch etwas zu fehlen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, wie viele junge Menschen über ihre Karriere nachdenken. Eine große Zahl will nicht mehr am kapitalistischen rat race teilnehmen und sucht einen Job, der gleichzeitig auch eine Leidenschaft sein soll, aber bitte in Teilzeit.[28]
Manchmal scheint es, als sei «Ambition» zu einem Schimpfwort verkommen, das nicht zu einem idealistischen Lebensstil passt. Viele machen sich lieber Gedanken über das Wie und Warum als über den impact ihrer Arbeit. Wenn es sich nur gut anfühlt. «Small is beautiful», heißt es dann, oder «Think global, act local» – als wäre es eine Tugend, wenig zu erreichen.
In manchen Kreisen scheint das höchste Ideal darin zu bestehen, überhaupt keinen Impact zu haben. Dann definiert sich ein gutes Leben vor allem dadurch, was man nicht tut. Nicht fliegen. Kein Fleisch. Keine Kinder. Und vor allem keine Plastikstrohhalme! Weniger, weniger, weniger. Das Ziel ist ein möglichst kleiner Fußabdruck mit eigenem Gemüsegarten neben dem Tiny House. Im besten Fall wäre Ihr Impact so gering, dass Sie genauso gut nicht existieren könnten.
Natürlich ist es eine gute Idee, Ihre kleinen Taten mit Ihren großen Idealen in Einklang zu bringen (und der Verzicht auf Fleisch aus Massentierhaltung scheint mir ein moralisches Minimum darzustellen). Aber ein gutes Leben besteht doch aus viel mehr als dem, was man nicht tut? Sie gehen doch sicher davon aus, auf dem Sterbebett sagen zu können, Ihr Beitrag ging über das hinaus, was Sie nicht kaputt gemacht haben …
So betrachtet kämpfen selbst die moralischsten Aktivisten und Aktivistinnen unserer Zeit mit mangelnder Ambition. Ich spreche von denen, die als «woke» gelten. Es wird oft gesagt, dass «Woke» zu weit gehen, aber in vielen Fällen gehen sie gerade eben nicht weit genug. Bezeichnend ist ihre Besessenheit für die Worte, mit denen wir die Welt beschreiben. Ja, Worte sind wichtig und prägen in gewisser Weise sogar die Realität, aber letztendlich ist es wichtiger, was man schafft.
Wenn wir uns die konkreten Erfolge dieser Sorte von Aktivisten ansehen, sind die Ergebnisse bescheiden. Heute kann man im Handumdrehen mit einer Tirade gegen Sexismus, Rassismus oder Kapitalismus (Kill the patriarchy! Defund the police! Tax the rich!) ein Millionenpublikum erreichen. Aber was passiert dann? Follower auf Instagram sind nicht dasselbe wie eine straffe Organisation. Ein trending topic ist nicht dasselbe wie eine Mehrheit im Parlament. Die moderne Form von Protest scheint manchmal kaum mehr zu sein als eine Menge Klicks und Likes in der Hoffnung, dass da draußen jemand zuhört.[29]
«Die Leute verstehen nicht», schreibt Patrisse Cullors, eine der Gründerinnen von Black Lives Matter, «dass sich zu organisieren nicht bedeutet, Menschen online zu beschimpfen oder zu einer Demonstration zu gehen und etwas zu verurteilen».[30] Für wesentliche Veränderungen ist viel mehr nötig. Wie bildet man eine Koalition? Wie führt man eine wirksame Lobby? Wie laufen die Geldströme? Wer spielt auf nationaler, Länder- und kommunaler Ebene in welchem Ausschuss eine Schlüsselrolle? Welche Aktenkenntnis benötigt man, um zu wissen, welche Hebel man in Bewegung setzen muss, und wie kann man mit einer kleinen Anpassung in einem unklaren Gesetzesartikel einen wichtigen ersten Schritt machen?
Das Problem ambitionsloser Idealisten und Idealistinnen besteht darin, dass bei ihnen «Awareness» höher im Kurs steht als Handeln. Dann werden Worte und Absichten wichtiger als Taten und ihre Auswirkungen, und alles scheint größer zu sein, als es wirklich ist. Aber im Bewusstsein kann man sich nicht niederlassen. Bewusstsein kann man nicht essen. Mit Bewusstsein kühlt man den Planeten nicht ab, bietet man hundert Millionen Geflüchteten kein Dach überm Kopf und tut auch nichts für die hundert Milliarden Tiere in der globalen Massentierhaltung.[31]
Bewusstsein ist bestenfalls der Anfang, für viele Aktivistinnen scheint es jedoch das Ziel geworden zu sein.
Geht es auch anders? Denken Sie an die Ambition eines Karrieristen und fügen Sie ihr eine kräftige Prise Idealismus hinzu. Was kommt dabei heraus?
Lassen Sie mich Ihnen meinen persönlichen Helden vorstellen, jemanden, auf den ich in diesem Buch noch oft zurückkommen werde: den Freiheitskämpfer Thomas Clarkson. 1785 beschloss er als 25-jähriger Student, an einem Essaywettbewerb der Universität Cambridge teilzunehmen. In dem Essay sollte er eine kurze Frage beantworten: Anne liceat invitos in servitutem dare?
Oder: Ist es erlaubt, andere gegen ihren Willen zu versklaven?
Seinerzeit bedeutete das Gewinnen eines solchen lateinischen Essaywettbewerbs die Möglichkeit, sich als Student zu profilieren. «Ich verfolgte kein anderes Motiv als das, welches andere junge Männer bei solchen Gelegenheiten verfolgten», schrieb Clarkson später, «nämlich den Wunsch, literarisches Ansehen zu erlangen.»[32]
Er hatte nur ein Problem: Er hatte keinen blassen Schimmer von der Sklaverei und nur zwei Monate Zeit, um seine Gedanken zu Papier zu bringen. Nun werden die meisten Studierenden erst dann nervös, wenn die Deadline näher rückt, aber Clarkson war aus einem anderen Holz geschnitzt. Er begann sofort mit der Recherche und arbeitete sich von Tag eins an in die Materie ein.
Der fleißige Student war davon ausgegangen, dass ihm die Untersuchung Spaß machen würde, denn er wusste eine intellektuelle Herausforderung durchaus zu schätzen. Aber die Fakten brachen gnadenlos über ihn herein. «Tagsüber war ich unruhig. Nachts fand ich kaum zur Ruhe. Manchmal konnte ich meine Augenlider vor lauter Kummer nicht schließen.»[33] Clarkson ließ eine Kerze neben seinem Bett brennen für den Fall, dass ihm ein Gedanke käme, denn er glaubte, dass «in einer so wichtigen Angelegenheit kein Argument von Bedeutung verloren gehen dürfe».[34]
Nach ein paar Wochen harter Arbeit war der Essay fertig. In wohltönendem Latein kam Clarkson zu dem Schluss, dass die Sklaverei unvereinbar sei mit «Vernunft, Gerechtigkeit, Natur, den Grundsätzen von Recht und Regierung … und der geoffenbarten Stimme Gottes».[35] Und ja, er gewann den ersten Preis. Clarkson wurde eingeladen, seinen Essay im hochherrschaftlichen Senatsgebäude der Universität Cambridge zu verlesen. Da stand er dann: ein baumlanger Kerl mit feuerrotem Haar und strahlend blauen Augen. Alles deutete darauf hin, dass Thomas Clarkson eine großartige Karriere bevorstand.
Doch auf dem Rückweg nach London wollte ihm das Thema seines Essays einfach nicht aus dem Kopf gehen. Er stieg vom Pferd, ging grübelnd weiter und versuchte sich selbst zu überzeugen, dass er einen Denkfehler begangen haben musste. Aber je länger er nachdachte, desto tiefer sank die Wahrheit über die Sklaverei in ihn ein. Als in der Ferne das Dorf Wadesmill auftauchte, setzte er sich verzweifelt an den Straßenrand. «Hier ging mir ein Gedanke durch den Sinn», sollte er später schreiben. «Wenn der Inhalt des Essays wirklich zutraf, dann war es an der Zeit: Irgendein Mensch sollte darum besorgt sein, diesem Schrecken ein Ende zu machen.»[36]
Wenn das Ende der Sklaverei irgendwo begann, dann dort, im Sommer 1785, am Straßenrand von Wadesmill.[37]
Ja, es gab schon früher Menschen, die gegen die schlimmsten Formen der Sklaverei protestierten. Und ja, die Geschichte ist voller Beispiele über den Widerstand versklavter Menschen, die immer wieder versuchten, ihre Ketten abzuwerfen.[38] Aber die bittere Wahrheit lautet, dass die Opfer des Systems jahrhundertelang nicht die Macht hatten, es zu zerstören. Der Begriff «Abolitionismus», die Idee, dass die gesamte Institution der Sklaverei ein für alle Mal abgeschafft gehörte, schien völlig unvorstellbar.
Anfangs glaubte Clarkson, er stünde mit seinen Ambitionen allein auf weiter Flur. In den Monaten nach seiner Offenbarung war er verzweifelt. «Ich ging oft in den Wald, um in der Einsamkeit über das Thema nachzudenken und Erleichterung für meinen Geist zu finden. Aber eine Frage drängte sich mir immer wieder auf: ‹Ist all das wahr?› – Und stets folgte die Antwort auf dem Fuße: ‹Es ist wahr.› – Immer kam ich zu dem Schluss: ‹Dann muss jemand etwas dagegen unternehmen.›»[39]
Der junge Engländer verfügte nur über wenige Kontakte, aber er überlegte, dass er seinen Aufsatz zumindest aus dem Lateinischen ins Englische übersetzen könnte. In London suchte er einen Drucker auf, der ihn für «Leute mit Geschmack» veröffentlichen wollte, doch Clarkson war an dem literarischen Ansehen einer kleinen Elite nicht mehr interessiert. Er wollte, dass sein Plädoyer möglichst viele Menschen erreichte.
Enttäuscht trat er aus der Druckerei, wo er einem alten Familienfreund in die Arme lief. Entscheidendes Detail: Dieser Freund der Familie war Mitglied der «Religiösen Gesellschaft der Freunde», auch bekannt als «Quäker». Clarkson hatte keine Ahnung, dass diese eigenartige Kirchengenossenschaft schon seit einiger Zeit gegen die Sklaverei kämpfte. Und er wusste auch nicht, dass sie ihn bereits eine Weile in den Blick genommen hatten.
Der Quäker führte ihn in eine kleine Druckerei im Herzen Londons. An diesem Tag stellte Clarkson fest, dass er nicht allein war. In England existierte ein bescheidenes Netzwerk von Frauen und Männern, die sich dem Kampf gegen die Sklaverei widmeten.[40] Eines Abends dann traf der junge Clarkson beim Essen mit seinen neuen Freunden eine endgültige Entscheidung. Er erkannte, dass es jemanden brauchte, der sein Leben in den Dienst des Kampfes gegen die Sklaverei stellen würde. Er erhob sich, ergriff das Wort und sagte feierlich: «Ich bin bereit, mich der Sache zu widmen.»[41]
Das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch. Und in der Tat: Wer heute die Memoiren von Thomas Clarkson liest, denkt manchmal: Puh, jetzt komm mal wieder runter. Aber vergessen Sie nicht: Idealismus geht oft mit einer Prise Eitelkeit einher. Bei vielen Weltverbesserern ist es schwer zu sagen, wo das eine aufhört und das andere beginnt. Und wenn Clarkson weniger selbstsicher gewesen wäre, wenn er sich nicht als Held, der Geschichte schreiben wollte, gesehen hätte, ob er dann wohl sein Leben dem Abolitionismus geweiht hätte?[42]
Clarkson schrieb später, dass er seine irdischen Bedürfnisse in Demut aufgab, um dem Weg zu folgen, den Gott ihm gewiesen hatte. Heutzutage nennen wir das Humblebragging. Natürlich war Clarkson ernsthaft besorgt über das Schicksal der Versklavten. Aber deswegen legte er nicht plötzlich seinen Geltungsdrang ab – im Gegenteil. Er hatte seine literarische Ambition gegen etwas viel Größeres eingetauscht, denn was konnte wichtiger sein als der Kampf gegen die Sklaverei?[43]
In der echten Welt sind Taten wichtiger als Absichten, und es zählt einzig und allein, dass der ehrgeizige Student sein Wort hielt. Für den Rest seines Lebens, 61 Jahre lang, kämpfte Clarkson für sein Ideal. Er wurde der größte Reformer seiner Zeit. Was der Apostel Paulus für das Christentum und Martin Luther für die Reformation war, wurde Thomas Clarkson für den Abolitionismus.
Eine «moralische Dampfmaschine» nannte ihn ein Zeitgenosse. «Der Riese mit der einen Idee.»[44]
3.
In diesem Buch werde ich Ihnen einige Thomas Clarksons unserer Zeit vorstellen. Eine Reihe von Unternehmern und Aktivistinnen, Anwältinnen und Ärzten, Ingenieuren und Erfinderinnen voller moralischer Ambition.
Sie alle haben gemeinsam, dass sie ihre Taten nicht als Tropfen auf den heißen Stein verstehen. Sie glauben daran, dass sie etwas bewirken können, und sind bereit, dafür Risiken einzugehen. Sie sagen nicht «jemand sollte …», sondern sie handeln selbst.
Was die meisten von ihnen ebenfalls gemeinsam haben, sind gewisse Privilegien. Schließlich können längst nicht alle Menschen ihr Leben den größten Weltproblemen widmen. Thomas Clarkson hätte ohne das Erbe seines verstorbenen Vaters niemals ein Vollzeit-Abolitionist werden können. Die Suffragette Elizabeth Cady Stanton (1815–1902) wäre niemals eine berühmte Kämpferin für die Rechte der Frauen geworden ohne ihre Ausbildung, die von ihren wohlhabenden Eltern finanziert wurde.
Aber wir wollen nicht verallgemeinern. Auch wer unter Armut und Krankheit, Rassismus und Sexismus leidet, kann Berge versetzen. Helen Keller (1880–1968) war taub und blind und wurde zu einer legendären Verfechterin der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Malcolm X (1925–1965) wuchs in tiefer Armut auf und wurde zu einem bedeutenden Anführer der Bürgerrechtsbewegung.
Ja, Menschen mit moralischer Ambition zahlen oft einen Preis für ihre Ideale. Thomas Clarkson reiste in sieben Jahren 35000 Meilen zu Pferd, oft nachts, um Pamphlete und Petitionen unters Volk zu bringen. Im Alter von 33 Jahren erlitt er einen schweren Nervenzusammenbruch, heute würden wir von einem Burn-out sprechen. Jahrein, jahraus hatte er sein Gehirn mit erschreckenden Fakten, Zahlen und Bildern der Sklaverei gefüttert. «Oft werde ich plötzlich von Schwindel und Krämpfen ergriffen», hielt Clarkson in seinem Tagebuch fest. «Ich habe ein unangenehmes Klingen in den Ohren, oft zittern mir die Hände. Plötzlich bricht mir kalter Schweiß aus.»[45]
Was wäre, wenn man ihn damals in einen MRT-Scanner gesteckt hätte wie diesen buddhistischen französischen Mönch? Ein erbärmlicheres Level von Gammawellen wäre wahrscheinlich noch nie gemessen worden. Gott, was für ein abscheuliches Gehirn dieser Kerl hatte! Auf der linken Seite des präfrontalen Kortex wäre wohl kein Fünkchen Glück angezeigt worden, während die rechte Seite vor negativer Energie nur so gebrummt hätte. Und dann stellen Sie sich die Reaktion der Medien vor. Breaking News: Wir haben den unglücklichsten Mann der Welt gefunden! «Sein Level der Gedankenkontrolle ist jämmerlich, und die negativen Impulse in seinem Gehirn sind beispiellos.»
Nein, Clarkson war nicht sonderlich aufmerksam, und er hätte es wahrscheinlich etwas ruhiger angehen sollen. Niemand hat etwas davon, wenn ein Weltverbesserer mit 33 zusammenklappt. Aber wenigstens ereilte ihn kein Burn-out durch seine umfassende Expertise bezüglich des Empowerments für ein valides gruppendynamisches Konzept. «Ich musste von dem Feld getragen werden», schrieb er in seinen Memoiren, «dem ich die große Ehre und den Ruhm meines Lebens zu verdanken habe.»[46]
Fragen Sie sich also: Was ist «die große Ehre und der Ruhm» Ihres Lebens? «Ein ehrenhafter Mensch hält es nicht nur für wichtig, respektiert zu werden», schreibt der Philosoph Kwame Anthony Appiah, «sondern auch, des Respekts würdig zu sein.»[47] Ihre Ehre ist etwas anderes als Ihr Ruf. Es geht nicht darum, gut dazustehen, sondern darum, Gutes zu tun.
Eines ist sicher: Wenn Sie ein moralisch ambitioniertes Leben führen möchten, können Sie nicht früh genug damit anfangen. Angst vor Veränderungen ist die erste altersbedingte Krankheit, die sich im Leben eines jeden Menschen einstellt. Bevor Sie es merken, hängen Sie mit goldenen Handschellen angekettet in einem durchschnittlichen Job fest, und Sie können nicht einmal den Bruchteil einer Sekunde und Ihres Einkommens entbehren, weil Sie jeden Cent für das Abonnement der Bürstenköpfe Ihrer elektrischen Zahnbürste benötigen.
Aber wenn Sie den Sprung wagen, sind die Möglichkeiten endlos. Denn gerade weil so viele Menschen ihr Talent vergeuden, können moralisch ambitionierte Menschen den großen Unterschied machen.
2.Setzen Sie Ihre Handlungsschwelle herab
«At critical moments in time, you can raise the aspirations of other people significantly, especially when they are relatively young, simply by suggesting they do something better or more ambitious than what they might have in mind. It costs you relatively little to do this, but the benefit to them, and to the broader world, may be enormous. This is in fact one of the most valuable things you can do with your time and with your life.»
Tyler Cowen
Ökonom (1962)
1.
Es ist natürlich bequemer, anzunehmen, man selbst sei für den Weg der moralischen Ambition nicht gemacht. Weil man einfach nicht so gestrickt ist und nun einmal nicht zum Heldentum neigt. Aber was macht bei manchen Menschen den Unterschied? Warum lassen diese sich sehr wohl von moralischer Ambition leiten?
Es gibt ein berühmtes Foto aus dem Jahr 1936 von deutschen Hafenarbeitern, die allesamt den Hitlergruß zeigen. Aber wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass eine einzige Person in der ganzen Menge nicht mittut. Während mehr als hundert Menschen dem Führer die Hand entgegenstrecken, bleibt er unerschütterlich mit verschränkten Armen stehen.
Wer war dieser Mann? Und woher nahm er den Mut, sich von der Masse abzusondern? Jahrelang verstaubte das Foto in einem Archiv, bis ein deutscher Historiker zufällig darauf stieß. Am 15. November 1995 veröffentlichte er im Hamburger Abendblatt einen Aufruf, ob vielleicht jemand den Mann erkennen würde. Noch in derselben Woche meldete sich eine Leserin, dass es sich um ihren Vater August Landmesser handeln müsse.
Seine Geschichte stellte sich als herzzerreißend heraus. 1931 war der junge Landmesser in der Hoffnung, dadurch an Arbeit zu kommen, der Nazipartei beigetreten. Doch dann, nur wenige Jahre später, lernte er die neunzehnjährige Irma Eckler kennen. Sie war Jüdin, und als Arier durfte er sich nicht mit ihr einlassen. Dennoch verliebten sich die beiden ineinander. Allen Regeln zum Trotz bekamen sie sogar zwei Töchter, Ingrid und Irene.[48]
Es gibt ein Familienfoto aus dem Juni 1938. Wir sehen einen lachenden Vater mit seiner ältesten Tochter und eine Mutter, die ihr Baby hält.
Einen Monat nach der Aufnahme dieses Bildes klopfte die Gestapo an die Tür der jungen Familie. Die Kinder wurden in ein Waisenhaus gebracht und die Eltern wegen «Rassenschande» verurteilt. Mutter Irma wurde schließlich in einem Konzentrationslager vergast, während Vater August an der Front kämpfen musste – er fiel 1944.
Mehr als ein halbes Jahrhundert später schlug die jüngste Tochter die Zeitung auf und sah das Foto ihres Vaters. Das Bild des Werftarbeiters ging um die ganze Welt. August Landmesser landete auf Millionen Ansteckern und Postkarten, T-Shirts und Postern. Das Foto wurde in Zimmern, Kneipen und Büros aufgehängt, und noch immer schwirrt es gelegentlich durchs Internet, meist mit dem gleichen Kommentar: BE THAT GUY!
Nach all den Jahren scheint uns der Mann, der nicht grüßte, immer noch anzustarren: Was hättest du an meiner Stelle getan? Wärst auch du so mutig gewesen, oder hättest du getan, was die Meute tat? Wir hoffen auf Ersteres, fürchten aber Letzteres. «Aus unserer heutigen Sicht ist er der einzige Mensch in der Menge», schreibt eine Historikerin, «der auf der richtigen Seite der Geschichte steht.»[49]
Die Geschichte von August Landmesser erinnert uns an eine simple Tatsache: Der Mensch ist von Natur aus ein Herdentier. Wir tun, was man uns zeigt, wir nehmen, was man uns gibt, wir glauben, was man uns glauben macht. In der Zwischenzeit mögen wir uns frei fühlen, aber in Wirklichkeit folgen wir dem Drehbuch, das zu unserer Art von Leben gehört.
Die Angst, anders zu sein, ist tief in der menschlichen Natur verwurzelt. Wir können feierliche Geschichten über unsere Überzeugungen erzählen, aber was wir tun, läuft in der Mehrzahl der Fälle auf Nachahmung hinaus. Unser Wunsch, dazuzugehören, ist meist stärker als unser eigener Kompass. Daher verwechseln auch diejenigen, die einfach nur in Ruhe ihr Leben leben wollen, gern Freiheit mit Unverbindlichkeit: «zu tun, worauf man Lust hat», bedeutet in aller Regel nicht viel mehr, als mit der Masse mitzuschwimmen.
Es gibt ein Zitat der Anthropologin Margaret Mead, an das ich oft denken muss. «Zweifle nie daran», sagte sie, «dass eine kleine Gruppe rechtschaffen denkender, engagierter Bürger die Welt verändern kann. Es ist schließlich nie anders gewesen.»[50] Das mag wie der fröhliche Leib- und Magenspruch für idealistische Weltverbesserer klingen, aber in Wirklichkeit ist es eine bittere Erkenntnis. Man beachte vor allem den letzten Satz: «Es ist schließlich nie anders gewesen.»
Tatsächlich sagt Mead, dass die meisten Menschen nur am Rande stehen. Sie hinterlassen nur einen flüchtigen Fußabdruck und geraten in Vergessenheit, weil sie sich kaum von anderen abgehoben haben. Es gibt nur eine kleine Minderheit engagierter Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein mühseligeres Leben entscheiden. Sie bestimmen ihren eigenen Kurs und legen die Messlatte für sich selbst höher.
Unterdessen verändern sie die Welt.
2.
Aber wie können Sie etwas bewirken? Was können Sie allein schon zu den größten Herausforderungen unserer Zeit beitragen, sei es Armut oder Hunger, Krieg oder Klimawandel? Auf einem Planeten mit acht Milliarden Menschen ist es leicht, die Flinte ins Korn zu werfen. Als Teil einer kleinen Minderheit scheint es unmöglich zu sein, dieser Ihren Stempel aufzudrücken.
Doch das Gegenteil ist der Fall.
Eine kleine Gruppe engagierter Bürgerinnen kann einen gigantisch großen Einfluss ausüben, eben weil die meisten Menschen einfach nur ihrem Leben nachgehen. Eigentlich handelt es sich um ein uraltes Gesetz der Statistik. Im Jahr 1896 machte der Ökonom und Gärtner Vilfredo Pareto eine bahnbrechende Entdeckung: 80 Prozent seiner Erbsen wuchsen in 20 Prozent der Schoten. Mit anderen Worten: Zwei von zehn Schoten enthalten viermal so viele Erbsen wie die anderen acht zusammen.
Dieses 80/20-Verhältnis zeigte sich noch häufiger und wird heute «Pareto-Prinzip» genannt. Die besten Sportlerinnen erzielen mehr Punkte als alle anderen Mitglieder der Mannschaft. Die beliebtesten Songs werden häufiger gespielt als alle anderen Platten zusammen. Die schlimmsten Kriege fordern mehr Opfer als alle anderen Kriege.
Für diejenigen, die in einer Demokratie aufgewachsen sind, in der «das Volk» regiert, mag die Nachricht, dass die meisten sich abseits halten, ein Schock sein. Angenommen, wir stellen alle Menschen dieser Welt in einer Reihe auf und ordnen sie nach ihrem Einfluss, dann wäre es doch eigentlich naheliegend, sich ein Diagramm mit einer sanft ansteigenden Kurve vorzustellen, wie hier auf der folgenden Seite zu sehen.
Doch Margaret Mead zufolge ist die Wirklichkeit weder sanft und auch nicht leicht ansteigend. Die Wirklichkeit ist extrem. Die einflussreichsten Menschen sind nicht zwei-, fünf- oder zehnmal so einflussreich, sondern hundert-, tausend- oder Millionen Mal. In der Statistik wird eine solche gesetzmäßige Verteilung als «Machtgesetz» bezeichnet, und das entsprechende Diagramm erinnert nicht an einen Hügel, sondern an eine Ebene mit einer turmhohen Spitze. Auf der linken Seite erkennt man die Mehrheit, die kaum Einfluss hat, auf der rechten Seite die winzige Minderheit, die die Fäden in der Hand hält.
Wenn Sie diese Realität auf sich wirken lassen, könnte Ihnen das Herz wieder in die Hose rutschen. Denn wird die Welt nicht schlicht und ergreifend ausschließlich von reichen Eliten regiert?
So einfach ist es nicht. Sicher, Einkommen und Vermögen sind extrem ungleich verteilt, und mit ein paar Millionen auf der Bank kann man eine Menge Einfluss ausüben. Aber die meisten reichen Leute stellen nicht viel Aufregendes mit ihrem Geld an. Ihre Wünsche sind eher vorhersehbar. Sie wollen ein dickes Auto, eine Luxusvilla und eine möglichst große Jacht, um ihre innere Leere zu bemänteln – nichts davon ist sonderlich überraschend.
Dabei ist die Geschichte inzwischen reich bevölkert mit Menschen, die nicht viel in der Tasche hatten, aber dennoch einen entscheidenden Einfluss ausübten.[51] Denken Sie an die Abolitionisten, die gegen die Sklaverei kämpften, oder an die Suffragetten, die sich für das Frauenwahlrecht einsetzten. Waren sie die reichsten oder mächtigsten Gruppen ihrer Zeit? Nein. Aber sie haben die Welt verändert.
Der libanesisch-amerikanische Statistiker Nassim Nicholas Taleb spricht deshalb auch von «unbeugsamen Minderheiten». Die Welt wird von verqueren, sturen, eigensinnigen, halsstarrigen und unnachgiebigen Sturköpfen regiert. «Der Intoleranteste siegt», stellt Taleb trocken fest.[52]
3.
Ich kenne nur wenige Geschichten, die die Macht dieser Sturköpfe so deutlich veranschaulicht wie die Geschichte von Nieuwlande, einem Dörfchen im Süden von Drenthe. Während des Zweiten Weltkriegs fanden hier fast hundert Jüdinnen und