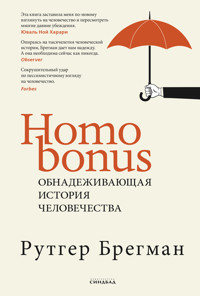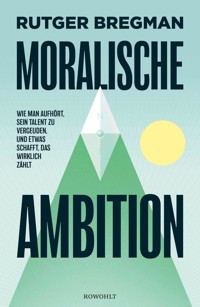5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Historiker und Journalist Rutger Bregman setzt sich in seinem Buch mit dem Wesen des Menschen auseinander. Anders als in der westlichen Denktradition angenommen ist der Mensch nicht böse, sondern, so Bregman, im Gegenteil: von Grund auf gut. Und geht man von dieser Prämisse aus, ist es möglich, die Welt und den Menschen in ihr komplett neu und grundoptimistisch zu denken. In seinem mitreißend geschriebenen, überzeugenden Buch präsentiert Bregman Ideen für die Verbesserung der Welt. Sie sind innovativ und mutig und stimmen vor allem hoffnungsfroh.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Rutger Bregman
Im Grunde gut
Eine neue Geschichte der Menschheit
Über dieses Buch
«Dies ist ein Buch über eine radikale Idee. Worin besteht diese Idee? Dass die meisten Menschen von Grund auf gut sind.»
Dass der Mensch grundsätzlich böse sei, ist ein Grundpfeiler westlichen Denkens. Es halten uns immer nur etwas zivilisatorischer Lack, eine Handvoll Gesetze und Autoritäten davon ab, über unsere Mitmenschen herzufallen. Rutger Bregman fragt, wie es zu diesem Menschenbild kam. Und er wagt eine neue Geschichte: die des Menschen, der von Grund auf gut ist. Denn nicht Argwohn und Egoismus ermöglichten den Fortschritt der Menschheit, sondern Vertrauen und Kooperation. Bregman zeigt, warum die Pessimisten falschliegen. Und dass eine bessere, gerechtere und ökologische Welt möglich wird, wenn wir erkennen: Wir sind besser, als wir denken.
«Rutger Bregman ist Teil einer Reihe von jungen Aktivisten, Vordenkern und Politikern wie Greta Thunberg oder Alexandria Ocasio-Cortez, die begonnen haben, mit ihren radikalen Ideen ganz entscheidend eine breite Akzeptanz zu erreichen.» New York Times
«Bregman spricht mit erstaunlicher Autorität. Seine Lösungen sind einleuchtend und genau entgegen aktuellen Trends. Halten Sie Ausschau nach Bregman. Er hat eine große Zukunft vor sich.» The Guardian
«Rutger Bregman ist einer der prominentesten und radikalsten Vordenker Europas.» Stern
«Wir stehen vor gigantischen Herausforderungen. Und die Sehnsucht wächst. Nach neuen, progressiven Ideen. Rutger Bregman trifft dabei einen Nerv. Der intellektuelle Shootingstar ist die herausragende Stimme einer neuen Bewegung.» Bayerischer Rundfunk
Vita
Rutger Bregman, geboren 1988 in den Niederlanden, ist Historiker und Journalist und einer der prominentesten jungen Denker Europas. Bregman wurde bereits zweimal für den renommierten European Press Prize nominiert. Er schreibt für die «Washington Post» und die «BBC» sowie für niederländische Medien. 2017 erschien sein Bestseller «Utopien für Realisten».
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel «De Meeste Mensen Deugen/Humankind» bei De Correspondent Uitgevers, Amsterdam.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«De Meeste Mensen Deugen/Humankind» Copyright © 2019 by Rutger Bregman
«Humankind» originated on The Correspondent, unbreaking news. www.thecorrespondent.nl
Infografiken: De Correspondent.
Zitat S. 163: Anne Frank. Tagebuch. Einzig autorisierte und ergänzte Fassung, Otto H. Frank und Mirjam Pressler. Copyright © 1991 by Anne Frank Fonds, Basel. Alle Rechte vorbehalten, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main.
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München,
nach dem Original von de Correspondent NL
ISBN 978-3-644-00763-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Für meine Eltern
«Der Mensch wird ...
Prolog
1. Kapitel Ein neuer Realismus
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
2. Kapitel Der echte Herr der Fliegen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Teil 1 Der Naturzustand
3. Kapitel Die Erfolgsgeschichte des Homo puppy
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
4. Kapitel Colonel Marshall und die Soldaten, die nicht schossen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel Der Fluch der Zivilisation
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
6. Kapitel Das Geheimnis der Osterinsel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Teil 2 Nach Auschwitz
7. Kapitel Im Keller der Stanford-Universität
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
8. Kapitel Stanley Milgram und die Schockmaschine
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
9. Kapitel Der Tod der Catherine Susan Genovese
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Teil 3 Warum gute Menschen böse Dinge tun
10. Kapitel Wie Empathie uns blendet
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
11. Kapitel Wie Macht korrumpiert
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
12. Kapitel Der Irrtum der Aufklärung
1. Kapitel
2. Kapitel
Teil 4 Ein neuer Realismus
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
13. Kapitel Die Kraft der inneren Motivation
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
14. Kapitel Der Homo ludens
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
15. Kapitel So sieht eine echte Demokratie aus
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Teil 5 Die andere Wange
16. Kapitel Tee trinken mit Terroristen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
17. Kapitel Die beste Medizin gegen Hass, Rassismus und Vorurteile
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
18. Kapitel Als die Soldaten aus den Schützengräben kamen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Epilog Zehn Lebensregeln
I. Geh im Zweifelsfall vom Guten aus
II. Denke in Win-win-Szenarien
III. Verbessere die Welt, stelle eine Frage
IV. Zügle deine Empathie, trainiere dein Mitgefühl
V. Versuche, den anderen zu verstehen, auch wenn du kein Verständnis aufbringen kannst
VI. Liebe deinen Nächsten, so wie auch andere ihre Nächsten lieben
VII. Meide die Nachrichten
VIII. Prügele dich nicht mit Nazis (oder: Strecke deinem größten Feind die Hand hin)
IX. Oute dich, schäme dich nicht für das Gute
X. Sei realistisch
Für meine Eltern
«Der Mensch wird erst dann besser, wenn Sie ihm zeigen, wie er ist.»
Anton Tschechow (1860–1904)
Prolog
Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs zeigte sich die britische Armeespitze über die Maßen besorgt. London sei in akuter Gefahr. Ein gewisser Winston Churchill behauptete, die Stadt sei «das größte Ziel der Welt, eine riesige, fette, teure Kuh, die festgebunden wurde, um das Raubtier anzulocken».[1]
Der Name dieses Raubtiers? Adolf Hitler. Wenn das Volk unter dem Terror seiner Bomber einknicken würde, wäre es um Großbritannien geschehen. «Der Verkehr wird eingestellt, die Obdachlosen werden um Hilfe schreien, und die Stadt wird in ein totales Chaos abrutschen», befürchtete ein britischer General.[2] Millionen Bürger würden in Panik ausbrechen. Die Armee würde nicht einmal zum Kampf kommen, weil sie die hysterischen Massen in Schach halten müsste. Churchill prophezeite, dass mindestens drei bis vier Millionen Einwohner Londons zur Flucht gezwungen würden.
Wer wissen wollte, welche Katastrophe sich da zusammenbraute, brauchte eigentlich nur ein einziges Buch aufzuschlagen: Psychologie des foules – «Psychologie der Massen». Der französische Autor Gustave Le Bon war einer der einflussreichsten Gelehrten seiner Zeit. Hitler hatte das Buch von vorn bis hinten gelesen, wie auch Mussolini, Stalin, Churchill und Präsident Roosevelt.
Le Bon erklärte detailliert, was in solchen Ausnahmesituationen vor sich geht. Fast unmittelbar, so schrieb er, falle der Mensch «mehrere Stufen von der Leiter der Zivilisation herab».[3] Dann griffen Panik und Gewalt um sich. Schließlich offenbare sich unsere wahre Natur.
Am 19. Oktober 1939 diktierte Hitler seinen Generälen den Angriffsplan. «Der gnadenlose Einsatz der Luftwaffe, um den britischen Widerstandswillen zu brechen, kann und soll zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen.»[4]
Die Briten befürchteten, dass es längst zu spät war. Hastig wurde noch erwogen, ein Netz von Schutzräumen unterhalb Londons zu graben, aber am Ende wurde der Plan doch verworfen. Bald würde die Bevölkerung sowieso vor Angst gelähmt sein. In letzter Minute wurden außerhalb der Stadt einige psychiatrische Notfallkliniken eingerichtet, um die ersten Opfer aufzufangen.
Dann ging es los.
Am 7. September 1940 überquerten 348 deutsche Bomber den Kanal. Das Wetter war gut. Viele der Londoner waren draußen und blickten gen Himmel, als die Sirenen Punkt 16:43 Uhr losheulten.
Dieser Septembertag sollte als schwarzer Tag in die Geschichte eingehen, und die andauernden Angriffe danach als «The Blitz» – der Luftkrieg. Allein auf London gingen in neun Monaten mehr als 80000 Bomben nieder. Ganze Stadtteile wurden ausgelöscht. Eine Million Gebäude blieben beschädigt oder vollständig zerstört zurück, und mehr als 40000 Menschen starben.
Und wie reagierten die Briten? Was geschah, als Millionen von ihnen monatelang mit Bomben aus der Luft zermürbt wurden? Wie hysterisch wurden sie, wie kopflos verhielten sie sich?
Beginnen wir mit dem Bericht eines kanadischen Psychiaters.
Im Oktober 1940 fuhr Dr. John MacCurdy durch den Südosten Londons. Er besuchte ein Armenviertel, das durch die ersten Bombardierungen schwer mitgenommen worden war, alle hundert Meter entdeckte man einen Krater oder eine Ruine. Wenn irgendwo Panik herrschen musste, dann hier.
Folgende Szenen beobachtete der Psychiater kurz nach der Auslösung eines Fliegeralarms:
Kleine Jungs spielten weiterhin auf dem Bürgersteig, Kunden ließen sich beim Feilschen nicht unterbrechen, ein Polizist regelte den Verkehr in königlicher Gelangweiltheit, und die Radfahrer trotzten dem Tod und den Verkehrsregeln. Niemand, soweit ich erkennen konnte, schaute zum Himmel.[5]
Wer über die Monate des Luftkrieges liest, stößt auf die eine oder andere Beschreibung einer seltsamen Ruhe, die sich über London ausgebreitet hatte. Eine amerikanische Journalistin interviewte ein britisches Ehepaar in seiner Küche. Während die Fenster zitterten, tranken sie in aller Seelenruhe Tee. Ob sie denn keine Angst hätten, fragte die Journalistin. «Aber nein. Was würde das helfen?»[6]
Alle Anzeichen wiesen darauf hin, dass Hitler den Charakter der Briten falsch eingeschätzt hatte. Keeping a stiff upper lip – die Ohren steifhalten. Der trockene Humor. Unternehmer stellten Schilder vor die Ruinen, die einst ihre Geschäfte gewesen waren: «MORE OPEN THAN USUAL.» («WEITER GEÖFFNET ALS SONST.») Der Eigentümer eines Pubs griff die Verwüstung gar humoristisch auf: «OUR WINDOWS ARE GONE, BUT OUR SPIRITS ARE EXCELLENT. COME IN AND TRY THEM.» («UNSERE FENSTER SIND HINÜBER, ABER UNSER GEIST IST NICHT GEBROCHEN. KOMMT REIN UND ÜBERZEUGT EUCH SELBST.»)[7]
Die Briten reagierten auf die Bomben der Luftwaffe wie auf die Verspätung eines Zuges: lästig, aber es gab Schlimmeres im Leben. Die Züge fuhren auch während der Luftangriffe weiter, und der Schaden für die Wirtschaft hielt sich in Grenzen. Im April 1941 wurde die britische Kriegsproduktion durch den Ostermontag, an dem alle Arbeiter freihatten, stärker getroffen als durch den Luftangriff.[8]
Nach einigen Wochen wurde über die deutschen Bomben wie über das Wetter geredet. «Es war heute recht blitzy, oder?»[9] Ein amerikanischer Schriftsteller notierte, dass «die Engländer schneller gelangweilt sind als alle anderen» und kaum jemand noch Deckung suchte.[10]
Und die mentale Verwüstung? Die Millionen an traumatisierten Opfern, vor denen die Experten gewarnt hatten? Nirgends zu entdecken. Natürlich gab es viel Kummer und Wut. Natürlich gab es tiefe Trauer um die umgekommenen Angehörigen.
Aber die psychiatrischen Notaufnahmen blieben leer. Mehr noch, mit der mentalen Gesundheit vieler Briten ging es bergauf. Der Alkoholmissbrauch nahm ab. Weniger Menschen als in Friedenszeiten begingen Selbstmord. Nach dem Krieg sehnten sich viele Briten sogar nach der Zeit des Luftkrieges zurück, als jeder jedem half und es keine Rolle spielte, ob man links oder rechts, arm oder reich war.[11]
«Die britische Gesellschaft wurde durch den Luftkrieg in vielerlei Hinsicht stärker», schrieb ein britischer Historiker später. «Hitler war enttäuscht.»[12]
Der berühmte Massenpsychologe Gustave Le Bon hätte also in diesem Fall nicht schlimmer danebenliegen können. Die Notsituation hatte nicht das Schlechteste im Menschen hervorgeholt. Das britische Volk stieg auf der Zivilisationsleiter ein paar Stufen hinauf. «Der Mut, der Humor und die Freundlichkeit der einfachen Menschen», notierte eine amerikanische Journalistin in ihrem Tagebuch, «sind angesichts dieses Albtraums erstaunlich.»[13]
Die unerwartet positiven Auswirkungen der deutschen Bombardements führten zu einer neuen militärischen Diskussion. Großbritannien selbst besaß eine Flotte von Bombern, und die Frage war: Wie konnten diese am effektivsten gegen den Feind eingesetzt werden?
Seltsamerweise beharrten die Experten der Royal Air Force unvermindert darauf, dass sich der Wille eines Volkes brechen ließe. Mit Bombardements. Gut, vielleicht war das bei den eigenen britischen Landsleuten nicht geglückt, aber das musste dann ein Ausnahmefall gewesen sein: Kein anderes Volk auf der Welt könnte ebenso nüchtern und mutig reagieren. Die Deutschen würden nach Ansicht der Experten «nicht ein Viertel»[14] der Bombenmenge ertragen. Der Feind sei sowieso moralisch wenig belastbar.
Diese Experten erhielten Rückenwind von Churchills Busenfreund: Frederick Lindemann, auch bekannt als Lord Cherwell. Eines der wenigen Porträts, die von ihm existieren, zeigt einen hochgewachsenen Mann mit Melone, Spazierstock und eiskaltem Blick.[15] In den hitzigen Diskussionen um die Luftmacht blieb Lindemann hart. Bombardements funktionieren. Wie Gustave Le Bon hatte er keine hohe Meinung vom einfachen Volk; er hielt es für feige und zur Panik neigend.
Um seinen Standpunkt zu bekräftigen, schickte Lindemann ein Team von Psychiatern nach Birmingham und Hull, zwei Städte, die gnadenlos bombardiert worden waren. In kurzer Zeit interviewten die Wissenschaftler Hunderte von Menschen, die während des Luftkrieges ihr Zuhause verloren hatten.[16] Sie fragten nach den belanglosesten Einzelheiten – von «der Anzahl der getrunkenen Pints bis zur Menge des gekauften Aspirins».[17]
Einige Monate später erhielt Lindemann den Abschlussbericht. Die Schlussfolgerung stand auf dem Titelblatt:
«KEIN BEWEIS FÜR EINE SCHWÄCHUNG DER MORAL».[18]
Und was tat Frederick Lindemann? Er winkte angesichts dieser Schlussfolgerung ab. Er hatte längst beschlossen, dass Bombardements hervorragend funktionieren würden, und ließ sich darin nicht beirren.
Lindemann schrieb schließlich auch eine der Untersuchung gänzlich widersprechende Notiz, die auf Churchills Schreibtisch landete:
Die Forschung scheint zu beweisen, dass die Zerstörung des Hauses eines Menschen sehr schädlich für seine Moral ist. Die Leute scheinen das für noch schlimmer zu halten als den Verlust von Freunden oder sogar ihrer Familie. […] Wir können in den 58 wichtigsten deutschen Städten zehnmal mehr Schaden anrichten. Es besteht kein Zweifel daran, dass das den Willen des Volkes brechen wird.[19]
So wurde die Diskussion über die Effektivität der Bombardements unterdrückt. «Es roch nach einer Hexenjagd», würde ein Beamter später schreiben.[20] Verantwortungsvolle Wissenschaftler, die sich gegen die Bombardierung der deutschen Bevölkerung ausgesprochen hatten, wurden als Feiglinge verleumdet. Landesverräter.
Die Fanatiker waren sich einig: Die Deutschen mussten einfach noch härter getroffen werden. Churchill gab grünes Licht, wonach die Hölle über Deutschland losbrach. Bei diesen Bombardements wurden schlussendlich zehnmal so viele Menschen getötet wie beim «Blitz». In Dresden starben in nur einer Nacht fast so viele Männer, Frauen und Kinder wie in London während des gesamten Krieges. Über die Hälfte der deutschen Städte wurde zerstört. Das gesamte Land verwandelte sich in einen großen, schwelenden Trümmerhaufen.
Dabei wurde nur ein kleiner Teil der alliierten Luftwaffe eingesetzt, um strategische Ziele wie Fabriken und Brücken zu bombardieren. Bis in die letzten Monate des Krieges blieb Churchill davon überzeugt, dass er nichts Besseres tun könne, als Bomben auf Zivilisten zu werfen, um die deutsche Moral zu brechen. Im Januar 1944 erreichte ihn eine Notiz der Royal Air Force, die berichtete, dass «die Wirkung umso befriedigender ist, je mehr wir bombardieren».
Der Premierminister unterstrich diesen Satz mit seinem berühmten roten Stift.[21]
Wie waren die tatsächlichen Auswirkungen der Bombardements auf die Moral der Deutschen?
Lassen Sie mich erneut mit dem Bericht eines damals führenden Psychiaters beginnen. Von Mai bis Juli 1945 befragte Dr. Friedrich Panse fast hundert Deutsche, die ihr Zuhause verloren hatten. «[I]ch war hinterher richtig aufgekratzt, steckte mir vergnügt eine Zigarette an», erzählte einer von ihnen. Die Atmosphäre nach einem Angriff wäre «wie nach einem gewonnenen Krieg», bemerkte ein anderer.[22]
Von einer Massenpanik konnte nirgends die Rede sein. Die Einwohner, die zum ersten Mal bombardiert wurden, reagierten sogar mit gegenseitiger Unterstützung. «Die nachbarliche Hilfsbereitschaft war groß», bemerkte Panse. «In Anbetracht der Schwere und Dauer der psychischen Belastung war die Haltung der Bevölkerung bemerkenswert gefasst und diszipliniert.»[23]
Das gleiche Bild ergibt sich aus den Berichten des deutschen Sicherheitsdienstes, der die eigene Bevölkerung genau im Auge behielt. Nach den Bombardements schienen sich alle gegenseitig zu helfen. Die Opfer wurden aus den Trümmern gezogen, die Brände gelöscht. Kinder der Hitlerjugend rannten herum, um den Verwundeten und Obdachlosen zu helfen. Ein Lebensmittelgeschäft stellte zum Spaß ein Schild mit der Aufschrift «HIER WIRD KATASTROPHENBUTTER VERKAUFT!» vor die Tür.[24]
Kurz nach der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 zog ein Team alliierter Ökonomen durch das besiegte Land. Das US-Verteidigungsministerium hatte den Auftrag erteilt, die Auswirkungen der Bombardements zu untersuchen. Die Hauptfrage: Hätte die Armee diese Art der Kriegsführung häufiger einsetzen sollen?
Die Wissenschaftler nahmen kein Blatt vor den Mund: Die Bombardements seien ein Fiasko gewesen. Die deutsche Kriegswirtschaft sei daraus wahrscheinlich eher gestärkt hervorgegangen, weshalb der Krieg länger gedauert haben dürfte. Zwischen 1940 und 1944 hatte sich die Produktion deutscher Panzer um den Faktor neun erhöht. Die von Kriegsflugzeugen sogar um den Faktor vierzehn.
Ein britisches Team von Ökonomen kam zu dem gleichen Ergebnis.[25] In den 21 zerstörten Städten, die sie untersuchten, war die Produktion schneller gewachsen als bei einer Kontrollgruppe von 14 Städten, die nicht bombardiert worden waren.
«Wir begannen einzusehen», schrieb ein amerikanischer Ökonom, «dass wir auf eine der größten Fehleinschätzungen, ja, vielleicht sogar auf die größte Fehlkalkulation des Krieges überhaupt, gestoßen waren.»[26]
Das Faszinierende daran ist, dass alle den gleichen Fehler begingen.
Hitler und Churchill, Roosevelt und Lindemann – sie alle teilten das Menschenbild von Gustave Le Bon, dem Psychologen, der behauptet hatte, dass die menschliche Zivilisation nur von einer dünnen Schicht geschützt würde. Sie waren davon überzeugt, dass die Luftwaffe diese Schicht zerstören würde. Aber je mehr Bomben fielen, desto dicker wurde die Schicht. Das dünne Häutchen hatte sich zu einer Hornhaut verhärtet.
Dennoch fand diese Schlussfolgerung bei den Militärexperten kaum Gehör. 25 Jahre später warfen die Amerikaner dreimal so viele Bomben auf Vietnam wie auf Deutschland während des gesamten Zweiten Weltkriegs.[27] Daraus resultierte bekanntermaßen ein noch größerer Fehlschlag. Selbst wenn der Beweis direkt vor unseren Füßen liegt, schaffen wir es immer wieder, uns selbst zum Narren zu halten. Bis auf den heutigen Tag glauben viele Briten, dass ihre Widerstandsfähigkeit während des Luftkrieges typisch britisch gewesen sei.
Aber sie war nicht typisch britisch. Sie war typisch menschlich.
1. KapitelEin neuer Realismus
1.
Dies ist ein Buch über eine radikale Idee.
Es ist eine Idee, die Machthabern seit Jahrhunderten Angst einjagt, gegen die sich unzählige Religionen und Ideologien gewandt haben. Über die die Medien eher selten berichten, deren Geschichte durch eine unaufhörliche Verneinung geprägt zu sein scheint.
Gleichzeitig ist es eine Idee, die von nahezu allen Wissenschaftsbereichen untermauert, die von der Evolution erhärtet und im Alltag bestätigt wird. Eine Idee, die so eng mit der menschlichen Natur verknüpft ist, dass sie kaum auffällt.
Wenn wir den Mut hätten, sie ernst zu nehmen, würde sich herausstellen: Diese Idee könnte eine Revolution entfesseln. Die Gesellschaft auf den Kopf stellen. Wenn sie tatsächlich in unsere Köpfe vordränge, wäre sie vergleichbar mit einer lebensverändernden Medizin, nach deren Einnahme man nie mehr in der gleichen Art und Weise auf die Welt blickt.
Worin besteht diese Idee?
Dass die meisten Menschen im Grunde gut sind.
Ich kenne niemanden, der diese Idee besser erklären könnte als Tom Postmes, Professor für Sozialpsychologie in Groningen. Seit Jahren stellt er seinen Studenten immer die gleiche Frage:
Ein Flugzeug muss notlanden und bricht in drei Teile. Die Kabine füllt sich mit Rauch. Allen Insassen ist klar: Wir müssen hier raus. Was passiert?
Auf Planet A fragen die Insassen einander, ob es ihnen gutgehe. Personen, die Hilfe benötigen, bekommen den Vortritt. Die Menschen sind bereit, ihr Leben zu opfern, auch für Fremde.
Auf Planet B kämpft jeder für sich allein. Totale Panik bricht aus. Es wird getreten und geschubst. Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen werden niedergetrampelt.
Frage: Auf welchem Planeten leben wir?
«Ungefähr 97 Prozent glauben, dass wir auf Planet B leben», sagt Postmes. «Aber tatsächlich leben wir auf Planet A.»[1]
Es spielt keine Rolle, aus welchem Milieu die Befragten kommen. Linke und Rechte, Arme und Reiche, Ungebildete und belesene Menschen – jedem unterläuft der gleiche Fehler in der Beurteilung. «Erstsemester wissen es nicht, Drittsemester auch nicht, Masterstudenten nicht, und auch viele Profis liegen falsch, selbst Katastrophenschutzkräfte haben keine Ahnung», seufzt Postmes. «Die Forschung ist nicht daran schuld. Dabei könnte man seit dem Zweiten Weltkrieg darüber Bescheid wissen.»
Selbst die bekanntesten Katastrophen der Geschichte spielten sich auf dem Planeten A ab. Nehmen wir den Untergang der Titanic. Wenn man den berühmten Film gesehen hat, glaubt man, dass alle in Panik gerieten (abgesehen von dem Streichquartett). Aber nein, es wurde nicht rumgeschubst oder -gezerrt. Ein Augenzeuge berichtete, dass es «keine Anzeichen von Panik oder Hysterie» gab, «keine Angstschreie und kein Hin- und Hergerenne».[2]
Oder denken Sie an den 11. September 2001. Tausende von Menschen liefen geduldig die Treppen der Twin Towers hinunter, obwohl sie genau wussten, dass ihr Leben in Gefahr war. Feuerwehrleuten und Verletzten wurde der Vortritt gewährt. Viele Menschen reagierten auf die Katastrophe mit Sätzen wie: «Nein, nein, du zuerst», erinnerte sich eines der Opfer später. «Ich konnte nicht glauben, dass die Leute in dieser Situation sagen würden: ‹Bitte, geh du zuerst.› Es war unwirklich.»[3]
Dass Menschen von Natur aus egoistisch, panisch und aggressiv sind, ist ein hartnäckiger Mythos. Der Biologe Frans de Waal spricht deshalb von einer «Fassadentheorie».[4] Die Zivilisation wäre demnach eine dünne Fassade, die beim geringsten Anlass einstürzen würde. Die Geschichte lehrt uns aber das genaue Gegenteil: Gerade, wenn Bomben vom Himmel fallen oder Deiche brechen, kommt das Beste in uns zum Vorschein.
Am 29. August 2005 brachen die Deiche von New Orleans. Der Hurrikan Katrina raste über die Stadt, in der Folge wurden 80 Prozent der Häuser überflutet. Es war die größte Naturkatastrophe in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Mindestens 1836 Menschen kamen ums Leben.
In jener Woche waren die Zeitungen voll mit Berichten über Vergewaltigungen und Schießereien in New Orleans. Fürchterliche Geschichten über Gangster, die plündernd durch die Gegend zogen, und einen Scharfschützen, der einen Rettungshubschrauber unter Beschuss nahm, machten die Runde: Im Superdome-Stadion, dem größten Schutzraum, säßen nicht weniger als 25000 Menschen wie Ratten in der Falle. Ohne Elektrizität. Ohne Wasser. Journalisten berichteten, dass die Kehlen von zwei Babys durchgeschnitten und ein siebenjähriges Mädchen vergewaltigt und ermordet worden war.[5]
Der Polizeichef prognostizierte, dass die Stadt in die Anarchie abgleiten würde, und dem Gouverneur von Louisiana schwante dasselbe. «Was mich besonders wütend macht», sagten sie, «ist, dass solche Katastrophen oft das Schlechteste in den Menschen zutage fördern.»[6]
Diese Schlussfolgerung verbreitete sich über die ganze Welt. Der renommierte Historiker Timothy Garton Ash schrieb in der britischen Zeitung The Guardian, was alle dachten:
Man entferne die Grundelemente eines geordneten, zivilisierten Lebens – Nahrung, Unterkunft, Trinkwasser, ein Minimum an persönlicher Sicherheit –, und wir fallen innerhalb weniger Stunden in einen Hobbes’schen Urzustand zurück, einen Krieg jeder gegen jeden. […] Einige wenige werden vorübergehend zu Engeln, die meisten wieder zu Affen.
Da war sie wieder: die Fassadentheorie. New Orleans hatte, wie Garton Ash meinte, ein kleines Löchlein in die «dünne Kruste über dem aufwallenden Magma der menschlichen Natur gestochen».[7]
Erst Monate später, als die Journalisten verschwunden waren, das Wasser abgepumpt war und sich die Kolumnisten einem neuen Thema zugewandt hatten, fanden Wissenschaftler heraus, was wirklich in New Orleans geschehen war.
Die Schüsse des Scharfschützen waren in Wahrheit das Ventilgeklapper eines Gastanks. Sechs Menschen waren im Superdome-Stadion gestorben: vier auf natürliche Weise, einer an einer Überdosis und einer durch Selbstmord. Der Polizeichef musste zugeben, dass es keinen einzigen offiziellen Bericht über Morde oder Vergewaltigungen gab. Und tatsächlich: Es war viel geplündert worden, aber vor allem von Gruppen, die gemeinsame Sache machten, um ihr Überleben zu sichern, manchmal sogar zusammen mit der Polizei.[8]
Wissenschaftler am Disaster Research Center der University of Delaware schlossen daraus, dass «die überwältigende Mehrheit des spontanen Verhaltens prosozial geprägt war».[9] Eine Armada an Schiffen war von Texas nach New Orleans gekommen, um so viele Menschen wie möglich zu retten. Hunderte von Rettungstrupps waren gebildet worden. Eine Gruppe hatte sich Robin-Hood-Plünderer genannt: elf Freunde, die Lebensmittel, Kleidung und Medikamente «stahlen» und verteilten.[10]
Kurz gesagt, die Stadt wurde nicht von Egoismus und Anarchie überflutet. Die Stadt wurde überspült von Mut und Nächstenliebe.
Katrina entsprach damit dem wissenschaftlichen Bild, wie Menschen auf Katastrophen reagieren. Das Disaster Research Center hat seit 1963 auf der Grundlage von fast 700 Feldstudien festgestellt, dass, im Gegensatz zu Darstellungen in den meisten Spielfilmen, nach einer Katastrophe nie die totale Panik ausbricht und auch keine Welle des Egoismus aufbrandet. Die Zahl der Verbrechen – Mord, Diebstahl, Vergewaltigung – nimmt in der Regel ab. Die Menschen bleiben ruhig, geraten nicht in Panik und handeln schnell. «Und egal, wie viel geplündert wird», stellt einer der Wissenschaftler fest, «es verblasst immer im Vergleich zu dem weitverbreiteten Altruismus, der zu einem großzügigen und umfangreichen Geben und Teilen von Gütern und Diensten führt.»[11]
In Notsituationen kommt das Beste im Menschen zum Vorschein. Ich kenne keine andere soziologische Erkenntnis, die gleichermaßen sicher belegt ist und dennoch gänzlich ignoriert wird. Das Bild, das in den Medien gezeichnet wird, ist dem, was nach einer Katastrophe tatsächlich geschieht, diametral entgegengesetzt.
Die hartnäckigen Gerüchte von den chaotischen Zuständen in New Orleans kosteten am Ende tatsächlich Menschenleben.
So kamen viele Hilfeleistungen quälend langsam in Gang, weil die Rettungskräfte es nicht wagten, die Stadt ohne Schutz zu betreten. 72000 Soldaten wurden einberufen, um das «Gesindel» im Zaum zu halten. «Diese Truppen wissen, wie man schießt und tötet, […] und ich erwarte, dass sie es tun werden», so der Gouverneur.[12]
Und so geschah es. An der Danziger Bridge im Osten der Stadt feuerte die Polizei auf sechs unschuldige und unbewaffnete Afroamerikaner, woraufhin ein Junge von 17 und ein geistig behinderter Mann von 40 Jahren starben. Fünf Polizisten wurden dafür später zu langen Haftstrafen verurteilt.[13]
Natürlich, die Katastrophe von New Orleans ist ein extremes Beispiel. Aber die Dynamik von Katastrophen ist immer dieselbe. Ein kollektiver Schicksalsschlag trifft eine Gemeinschaft, die Menschen beginnen einander zu helfen und sich zu solidarisieren, die zuständigen Oberen geraten in Panik, und dann erst tritt die zweite Katastrophe ein.
«Mein Eindruck», schreibt Rebecca Solnit in ihrem großartigen Buch A Paradise Built in Hell (2009) über den Hurrikan Katrina, «ist, dass elite panic entsteht, weil die Machthaber die Menschheit für ihr eigenes Ebenbild halten.»[14] Könige und Diktatoren, Gouverneure und Generäle glauben, dass die einfachen Menschen egoistisch sind, weil sie selbst es so oft sind. Sie greifen zu Gewalt, weil sie etwas verhindern wollen, das sich allein in ihrer Phantasie abspielt.
2.
Im Sommer 1999 zeigten neun Kinder an einer kleinen Schule in Bornem, Belgien, mysteriöse Krankheitssymptome. Kopfschmerzen. Erbrechen. Herzklopfen. Noch am Morgen hatten sie das Klassenzimmer fröhlich und putzmunter betreten, aber nach der Mittagspause fühlten sie sich unwohl. Die Lehrer fanden nur eine Erklärung: Alle diese neun Kinder hatten in der Pause eine Flasche Coca-Cola getrunken.
Es dauerte nicht lange, bis Journalisten den Vorfall aufgriffen. Und so begann das Telefon in der Zentrale von Coca-Cola zu klingeln. Am selben Abend noch schickte das Unternehmen eine Pressemitteilung in die Welt hinaus: Millionen von Flaschen würden in Belgien aus den Regalen entfernt. «Wir suchen fieberhaft nach der Ursache und hoffen, in den nächsten Tagen eine endgültige Antwort zu erhalten», sagte ein Sprecher.[1]
Aber es war bereits zu spät. Die Gerüchte verbreiteten sich wie eine Ölpest im ganzen Land und bis an die Grenze zu Frankreich. Auf sie folgten zahlreiche Beschwerden. Leichenblasse Kinder wurden in Krankenwagen abtransportiert. Alle Coca-Cola-Produkte erwiesen sich in dieser Woche für Kinder als gefährlich, sei es nun Fanta, Sprite, Nestea oder Aquarius. Der «Coca-Cola-Fall» wurde zu einem der größten finanziellen Desaster in der Geschichte des 107 Jahre alten Unternehmens. Nicht weniger als 17 Millionen Dosen mit Erfrischungsgetränken wurden in Belgien zurückgerufen, und alles, was noch in den Kühlhäusern stand, musste vernichtet werden.[2] Kosten: mehr als 200 Millionen Dollar.[3]
Doch dann geschah etwas Seltsames. Nach ein paar Wochen kamen die Toxikologen mit leeren Händen aus den Laboren: In den Flaschen hatte sich nichts finden lassen, was die Gesundheitsbeeinträchtigungen erklären könnte. Keine Pestizide. Keine Krankheitserreger. Keine schädlichen Metalle. Nichts. Auch im Blut und Urin von Hunderten Patienten ließ sich nichts nachweisen. Die Wissenschaftler konnten für die schweren Symptome, die inzwischen bei mehr als tausend Jungen und Mädchen festgestellt worden waren, keine Erklärung geben.
«Diese Kinder waren wirklich krank, daran besteht kein Zweifel», sagte einer der Forscher später. «Aber es war nicht die Cola, die sie krank gemacht hat.»[4]
Eigentlich drehte sich der Coca-Cola-Fall um eine alte philosophische Frage.
Was ist Wahrheit?
Einige Dinge sind wahr, ob man nun daran glaubt oder nicht. Wasser kocht bei 100 Grad. Rauchen schadet der Gesundheit. Präsident Kennedy wurde am 22. November 1963 in Dallas ermordet.
Andere Dinge können wahr werden, wenn man an sie glaubt. Die Soziologie spricht dann auch von einer «self-fulfilling prophecy». Wenn man zum Beispiel vorhersagt, dass eine Bank pleitegehen wird, und genügend Leute dem Glauben schenken, dann werden sie genau so lange Geld von ihrem Konto abheben, bis die Bank tatsächlich pleite ist.
Oder der Placebo-Effekt. Nehmen Sie eine Placebo-Tablette, von der der Arzt behauptet, dass sie wirke, und Sie werden sich gleich besser fühlen. Je aufwendiger das Placebo präsentiert wird, desto größer ist die Chance auf einen gefühlten positiven Effekt. Beispielsweise ist das Injizieren eines Placebos in der Regel wirksamer als die bloße orale Einnahme. Sogar der Aderlass konnte auf diese Weise helfen. Nicht weil die mittelalterliche Heilkunde so großartig gewesen wäre, sondern weil sich die Menschen einbildeten, dass es ihnen nach einem so heftigen Eingriff bessergehen würde.
Und das ultimative Placebo? Operieren! Ziehen Sie sich einen weißen Kittel an, sorgen Sie für eine Narkose, trinken Sie eine Tasse Kaffee und erzählen Sie Ihrem Patienten beim Aufwachen, dass die Operation einen atemberaubenden Erfolg gehabt hat. Eine große Übersichtsstudie im British Medical Journal, in der echte Operationen bei Rückenschmerzen oder Sodbrennen mit einem solchen Als-ob-Spiel verglichen wurden, ergab, dass das Placebo in drei Vierteln der Fälle wirkte. Bei der Hälfte sorgte das Placebo sogar für eine vergleichbare Schmerzlinderung wie ein tatsächlich durchgeführter Eingriff.[5]
Aber dieser Effekt tritt auch in der gegensätzlichen Richtung auf.
Schlucken Sie eine Medizin, von der Sie annehmen, dass sie Sie krank macht, und die Chancen stehen gut, dass Sie es auch werden. Warnen Sie Ihre Patienten vor schwerwiegenden Nebenwirkungen, und sie werden sofort Beschwerden wahrnehmen. Über diesen «Nocebo-Effekt» wurde relativ wenig geforscht, da es nicht unbedingt verantwortungsbewusst ist, Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass sie krank werden. Trotzdem deutet alles darauf hin, dass ein Nocebo sehr stark wirken kann.
Im Sommer 1999 kamen belgische Ärzte zu dem gleichen Ergebnis. Vielleicht war tatsächlich etwas mit ein paar Coca-Cola-Flaschen im Dörfchen Bornem nicht in Ordnung. Es ist möglich. Was allerdings die Beschwerden im Rest des Landes angeht, waren die Wissenschaftler überzeugt davon, dass es sich um eine «massive psychogene Erkrankung» gehandelt haben muss.
Das bedeutet nicht, dass die Opfer simulierten. Mehr als tausend belgische Kinder verspürten wirklich Übelkeit, Fieber und Schwindel. Wenn der Nocebo-Effekt uns etwas lehrt, dann, dass Ideen nicht einfach nur Ideen sind. Was wir glauben, bestimmt, was wir werden. Was wir suchen, bestimmt, was wir finden. Was wir vorhersagen, bestimmt, was tatsächlich eintritt.
Die Pointe bezüglich meiner Ausgangsthese lautet nun: Unser negatives Menschenbild ist ebenfalls ein Nocebo.
Wenn wir glauben, dass die meisten Menschen im Grunde nicht gut sind, werden wir uns gegenseitig auch dementsprechend behandeln. Dann fördern wir das Schlechteste in uns zutage.
Letztlich gibt es nur wenige Vorstellungen, die die Welt so sehr beeinflussen wie unser Menschenbild. Was wir voneinander annehmen, ist das, was wir hervorrufen. Wenn wir über die größten Herausforderungen unserer Zeit sprechen – von der globalen Erderwärmung bis zum schwindenden gegenseitigen Vertrauen –, glaube ich, dass deren erfolgreiche Bewältigung mit der Entwicklung eines anderen Menschenbildes beginnt.
In diesem Buch werde ich nicht behaupten, dass wir alle uneingeschränkt gut sind. Menschen sind keine Engel. Wir haben eine gute und eine schlechte Seite, die Frage ist, welche Seite wir stärken wollen.
Ich möchte nur darlegen, dass wir von Natur aus, wenn wir also etwa unbeeinflusste Kinder auf einer unbewohnten Insel wären, im Katastrophenfall der guten Seite den Vorzug geben würden. Ich werde eine lange Reihe wissenschaftlicher Beweise liefern, aus denen ersichtlich wird, dass ein positives Menschenbild realistisch ist. Gleichzeitig glaube ich, dass es noch realistischer werden kann, wenn wir anfangen, daran zu glauben.
Im Internet kursiert seit Jahren eine Parabel. Niemand weiß, woher sie ursprünglich stammt. Ich denke, sie illustriert eine simple, aber tiefe Wahrheit:
Ein Großvater sagte einst zu seinem Enkel: «In mir findet ein Kampf statt, ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Einer ist schlecht, böse, habgierig, eifersüchtig, arrogant und feige. Der andere ist gut – er ist ruhig, liebevoll, bescheiden, großzügig, ehrlich und vertrauenswürdig. Diese Wölfe kämpfen auch in dir und in jeder anderen Person.»
Der Junge dachte einen Moment nach und fragte dann: «Welcher Wolf wird gewinnen?»
Der alte Mann lächelte.
«Der Wolf, den du fütterst.»
3.
Wenn ich in den letzten Jahren auf Partys erzählte, dass ich an diesem Buch arbeitete, wurde ich oft mit ungläubigen Blicken und mit hochgezogenen Augenbrauen bedacht. Ein deutscher Verlag lehnte meinen Buchvorschlag entschieden ab: Die Deutschen würden nicht an das Gute im Menschen glauben. Ein Mitglied der Pariser Intelligenzija versicherte mir, dass die Franzosen die harte Hand des Staates spüren müssten. Als ich nach den Wahlen 2016 durch die USA reiste, fragte mich ein Amerikaner nach dem anderen, ob ich sie noch alle hätte.
Die meisten Menschen sollen im Grunde gut sein? Würde ich denn hin und wieder mal fernsehen?
Vor nicht allzu langer Zeit hat eine Studie zweier amerikanischer Psychologen gezeigt, wie hartnäckig sich der Glaube an unsere eigene Verdorbenheit hält. Die Forscher stellten ihren Probanden verschiedene Situationen vor, in denen Menschen etwas Gutes zu tun schienen. Es stellte sich heraus, dass wir darauf trainiert sind, überall Egoismus zu wittern.
Jemand hilft einem alten Mann über die Straße?
Macht er sicher, um selbst gut rüberzukommen.
Jemand gibt einem Obdachlosen Geld?
Bestimmt, um sein Gewissen zu beruhigen.
Auch als die Forscher harte Fakten über Fremde präsentierten, die Brieftaschen brav zurückgaben, und über die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung selten betrügt, wandelte die Mehrheit der Teilnehmer ihr negatives Menschenbild trotzdem nicht in ein positives um. «Stattdessen», schrieben die Psychologen, «beschließen sie, dass uneigennütziges Verhalten trotzdem noch egoistisch sein muss.»[1]
Zynismus ist eine allumfassende Theorie. Sie stimmt immer.
Die Frage, die mich seit Jahren fasziniert, ist, warum wir die Welt so negativ sehen. Wie ist es möglich, dass so viele Menschen glauben, wir lebten auf Planet B, während doch so viele wissenschaftliche Beweise auf Planet A deuten?
Ein Mangel an Bildung? Eher das Gegenteil. In diesem Buch werden unzählige Gelehrte zu Wort kommen, die von unserer Verdorbenheit überzeugt sind. Politische Einstellung also? Auch das hat oft wenig positiven Einfluss auf unser Menschenbild. Viele Gläubige betrachten uns als ein durch und durch sündiges Wesen. Viele Kapitalisten halten uns von Natur aus für egoistisch. Viele Umweltaktivisten sehen den Menschen als eine Geißel, die den Planeten zerstört. Tausend Meinungen, ein Menschenbild.
Und deshalb begann ich mich zu fragen, woher dieses düstere Bild unserer Spezies eigentlich stammt. Warum haben wir überhaupt angefangen, an die Verderbtheit der Menschheit zu glauben?
Ich habe da inzwischen einen Verdacht.
Stellen Sie sich vor: Morgen kommt eine neue Droge auf den Markt. Sie macht extrem süchtig und verbreitet sich in kürzester Zeit unter der Bevölkerung. Die Wissenschaftler recherchieren ausgiebig und kommen zu dem Schluss, dass die Einnahme der Droge, ich zitiere, von «Fehleinschätzung von Risiken, Angst, negativen Gefühlen, anerzogener Hilflosigkeit, Feindseligkeit gegenüber anderen und Abstumpfung» begleitet wird.[2]
Würden wir die Droge einnehmen? Dürften unsere Kinder sie konsumieren? Würde die Regierung sie gar legalisieren? Die Antwort lautet dreimal ja. Ich spreche nämlich von einer der größten Abhängigkeiten unserer Zeit. Von einem Suchtmittel, das wir jeden Tag konsumieren, das stark subventioniert und unseren Kindern in reichlichem Maße verabreicht wird.
Die Nachrichten.
Ich bin noch mit der Vorstellung aufgewachsen, dass die Nachrichten gut für die Entwicklung sind. Ein ordentlicher Bürger sollte regelmäßig Zeitung lesen und die Nachrichten anschauen. Je intensiver wir die Nachrichten verfolgen, desto besser sind wir informiert, desto gesünder ist die Demokratie.
Das ist immer noch die Geschichte, die Eltern ihren Kindern erzählen, aber Wissenschaftler kommen inzwischen zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Es gibt Dutzende Studien aus den Kommunikationswissenschaften, die belegen, dass Nachrichten der geistigen Gesundheit schaden.[3]
Der Begründer dieses Forschungsbereichs, der sogenannten Kultivierungsanalyse, Professor George Gerbner (1919–2005), sprach bereits in den 1990er Jahren vom «Gemeine-Welt-Syndrom». Die klinischen Symptome sind Misanthropie, Zynismus und Pessimismus. Menschen, die die Nachrichten verfolgen, stimmen Aussagen wie «Die meisten Menschen denken nur an sich selbst» häufiger zu. Sie glauben zumeist, dass man als Individuum nichts Wesentliches zu einer besseren Welt beitragen kann. Sie leiden auch häufiger unter Stress und Depressionen.
Kürzlich wurde Menschen in 30 Ländern eine einfache Frage gestellt: «Glauben Sie, dass sich die Welt verbessert, gleich bleibt oder sich verschlechtert?» In allen Ländern, von Russland bis Kanada, von Mexiko bis Ungarn, antwortete eine überwältigende Mehrheit, dass sich die Welt verschlechtere.[4]
In Wirklichkeit ist es angesichts wichtiger Kennzahlen genau umgekehrt. Die extreme Armut, die Anzahl der Kriegsopfer, die Kindersterblichkeit, die Kriminalitätsrate, der weltweite Hunger, die Kinderarbeit, die Anzahl der Todesfälle bei Naturkatastrophen und die Anzahl der Flugzeugabstürze sind in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Wir leben in der reichsten, sichersten und gesündesten Ära aller Zeiten.
Warum wir das nicht wissen? Ganz einfach: weil die Nachrichten die Ausnahmen präsentieren. Anschläge, Gewalt, Katastrophen: Je außergewöhnlicher ein Ereignis, desto nachrichtenwürdiger ist es. Man liest nie eine Schlagzeile wie «DIE ZAHL DER MENSCHEN IN EXTREMER ARMUT IST GESTERN UM 137000 GESUNKEN», obwohl diese Schlagzeile in den letzten 25 Jahren jeden Tag auf der Titelseite hätte stehen können.[5] Man sieht nie eine Liveschalte zu einem Korrespondenten, der sagt: «Ich stehe hier in Klein-Kleckersdorf, wo auch heute wieder kein Krieg ausgebrochen ist.»
Vor einigen Jahren untersuchte ein Team niederländischer Soziologen, wie Medien über Flugzeugabstürze berichten. Zwischen 1991 und 2015 ging die Zahl der Unfälle stetig zurück, die Aufmerksamkeit für Unglücke hingegen nahm zu. Das Ergebnis: Die Leute haben immer größere Angst, obwohl sie in zunehmend sicherere Flugzeuge einsteigen.[6]
Ein anderes Team von Medienwissenschaftlern baute eine Datenbank mit mehr als vier Millionen Zeitungsberichten über Einwanderung, Kriminalität und Terrorismus auf. Es stellte sich heraus, dass die Zeitungen dem Thema gerade in Zeiten mit geringer Einwanderung oder Gewalt mehr Aufmerksamkeit widmeten. «Es scheint keinen oder sogar einen negativen Zusammenhang zwischen den Nachrichten und der Realität zu geben», schlussfolgerten die Forscher.[7]
Mit «den Nachrichten» meine ich nicht alles, was Journalisten hervorbringen. Es gibt unzählige informative Formen des Journalismus, die einem helfen, die Welt besser zu verstehen.
Aber die Nachrichten – Berichterstattung über die jüngsten nebensächlichen und sensationellen Ereignisse – sind eben die am weitesten verbreitete Form. Acht von zehn Erwachsenen in der westlichen Welt konsumieren täglich Nachrichten. Im Durchschnitt verwenden wir eine Stunde pro Tag darauf. Das entspricht insgesamt drei Jahren in einem Menschenleben.[8]
Es gibt zwei einfache Gründe, warum Menschen so anfällig für die Trostlosigkeit der Nachrichten sind. Der erste wird von Psychologen als «negativity bias» bezeichnet. Wir sind sensibler für das Böse als für das Gute. In den Hunderttausenden Jahren als Jäger und Sammler hatten die Menschen Anlass, lieber hundertmal zu oft als einmal zu wenig vor einer Spinne oder einer Schlange Angst zu empfinden. An zu viel Furcht starb man nicht, wohl aber an zu wenig.
Zweitens leiden wir unter dem sogenannten «availability bias». Wenn Leute ein Beispiel für etwas nennen können, meinen sie, dass dieses Beispiel öfter auftritt, als es tatsächlich der Fall ist. Denn die Tatsache, dass wir mit schrecklichen Geschichten über Flugzeugkatastrophen, Kinderschänder und Enthauptungen bombardiert werden – Geschichten, die man nicht so schnell aus dem Kopf bekommt –, führt schnell zu einer verzerrten Weltsicht. «Wir sind nicht rational genug, um der Presse ausgesetzt zu werden», merkt der Statistiker Nassim Nicholas Taleb an.[9]
In diesem digitalen Zeitalter werden die extremen Seiten der Nachrichten noch weiter angeheizt. Früher wussten Journalisten nicht viel über die Konsumenten ihrer Nachrichten. Sie produzierten für ihnen unbekannte Massen. Die Leute hinter Facebook, Twitter und Google kennen einen hingegen sehr gut. Sie wissen, worauf man klickt. Sie wissen, was man am schockierendsten und gemeinsten findet. Sie wissen, wie man Ihre Aufmerksamkeit fesselt, um Ihnen dann die lukrativsten Anzeigen aufzutischen.
Man könnte die moderne Mediengewalt als einen Kampf gegen den Alltag ansehen. Denn seien wir ehrlich: Das Leben der meisten Menschen ist langweilig. Sympathisch, aber langweilig. Und ja, jeder will langweilige und sympathische Nachbarn (und die meisten Nachbarn ihrerseits ebenso). Aber mit «langweilig» fällt man nicht auf. Mit «sympathisch» verkauft man keine Werbung. Das Silicon Valley setzt uns daher stets extremeres Material vor, das wir immer schneller anklicken. «Nachrichten sind für den Verstand», merkt Rolf Dobelli an, «was der Zucker für den Körper ist.»[10]
Das Gute im Menschen findet in der Zwischenzeit keinen Platz in der Berichterstattung. Denn gerade das Gute ist alltäglich.
Vor ein paar Jahren habe ich versucht, einen anderen Kurs einzuschlagen. Ab sofort keine Nachrichten und kein Telefon mehr am Frühstückstisch. Ein gutes Buch von jetzt an. Geschichte. Psychologie. Philosophie.
Doch bald schon stieß ich auf das gleiche Problem. Die Ausnahmen beherrschen auch die Bücher. Die meistverkauften Geschichtsbücher zum Beispiel handeln immer von Katastrophen und Misserfolg, Tyrannei und Unterdrückung. Krieg, Krieg und noch mal Krieg. Gibt es mal keinen Krieg, nennen Historiker diese Zeit «Interbellum», also Zwischenkriegszeit.
Auch in der Wissenschaft hat sich seit Jahrzehnten ein trostloses Menschenbild durchgesetzt. Wenn Sie ein Buch über die menschliche Natur suchen, stoßen Sie auf Titel wie Dämonische Männer, Das Egoisten-Gen und Der Mörder von nebenan.
Biologen sind jahrelang von der deprimierendsten Version der Evolutionstheorie ausgegangen. Selbst wenn ein Tier etwas Uneigennütziges zu tun schien, wurde es trotzdem für Egoismus gehalten. Tiere lieben ihre Familie? Nepotismus! Ein Affe teilt eine Banane? Sie wird geklaut sein![11] Oder wie ein amerikanischer Biologe höhnte: «Was als Kooperation durchgeht, entpuppt sich als Mischmasch aus Opportunismus und Ausbeutung. […] Kratze an einem Altruisten, und du siehst einen Heuchler bluten.»[12]
In der Wirtschaftswissenschaft verhielt es sich nicht anders. Ökonomen sahen den Menschen als Homo oeconomicus. Wir wären ständig mit unserem eigenen Gewinn beschäftigt, wie selbstsüchtige und berechnende Roboter. Auf der Grundlage dieses Menschenbildes errichteten die Ökonomen eine Kathedrale aus Theorien und Modellen, auf denen Unmengen von Gesetzen basieren.
In der gesamten Zeit wurde nie untersucht, ob es überhaupt einen «Homo oeconomicus» gab. Erst um das Jahr 2000 besuchten der Ökonom Joseph Henrich und seine Kollegen fünfzehn kleine Gemeinden in zwölf Ländern auf fünf Kontinenten. Sie führten auf der Suche nach jemandem, der dem egoistischen Menschenbild entsprach, dem die Wirtschaftswissenschaftler seit Jahrzehnten anhängen, allerlei Tests mit Bauern, Nomaden, Jägern und Sammlern durch.
Ohne Ergebnis. Immer wieder verhielten sich die Menschen sozial und grundgut.[13]
Nach der Veröffentlichung dieser einflussreichen Arbeit suchte Henrich weiter nach dem berühmten Wesen, an das so viele Ökonomen glaubten. Und dann fand er es. Aber, nun ja, Homo (Mensch) ist nicht ganz die richtige Bezeichnung. Als Homo oeconomicus erwies sich nämlich der Schimpanse. «Das Modell hat sich bei der Vorhersage des Verhaltens von Schimpansen in einfachen Experimenten als besonders erfolgreich erwiesen», bemerkt Henrich trocken. «Die ganze theoretische Arbeit war also nicht umsonst. Wir haben sie nur auf die falsche Gattung bezogen.»[14]
Weniger erheiternd ist, dass das ökonomische Menschenbild jahrzehntelang als Nocebo gewirkt hat. Bereits in den 1990er Jahren fragte sich der Ökonom Robert Frank, was das Bild vom Menschen als selbstsüchtigem Wesen mit seinen Studenten machte. Er ließ sie alle möglichen Aufgaben erledigen, bei denen ihre Großzügigkeit gemessen wurde, und was stellte sich heraus? Je länger sie Ökonomie studiert hatten, desto egoistischer waren sie geworden.
«Wir werden zu dem, was wir lehren», sagt Frank.
Dass Menschen von Natur aus egoistisch sind, ist ein Lehrsatz, der im Westen seit Jahrhunderten unterrichtet wird. Große Denker wie Thukydides, Augustinus, Machiavelli, Hobbes, Luther, Calvin, Burke, Bentham, Nietzsche, Freud und die amerikanischen Founding Fathers unterstützten die Fassadentheorie der Gesellschaft. Sie alle sind davon ausgegangen, dass wir auf Planet B leben.
Es ist faszinierend, dass nicht nur das traditionelle Christentum, sondern auch die rationale Aufklärung (die Bewegung, die im 18. Jahrhundert den Verstand über den Glauben stellte) in einem fragwürdigen Menschenbild verwurzelt ist. Die orthodoxen Gläubigen meinten, dass wir sündig seien und unsere eigentliche Natur lediglich mit einer Schicht Frömmigkeit überdecken könnten. Viele aufgeklärte Philosophen glaubten ebenfalls, wir seien verderbt, hielten aber eher eine Schicht Rationalität für das wirksamere Mittel, um dies zu kaschieren.
Wenn man sich auf das dort propagierte Menschenbild fokussiert, ist eine Kontinuität im westlichen Denken zu erkennen. «[M]an kann von den Menschen insgeheim sagen, dass sie undankbar, wankelmütig, falsch, feig in Gefahren und gewinnsüchtig sind»[15], stellte Niccolò Machiavelli, der Begründer der Politikwissenschaft, fest. Abigail Smith schrieb gar in einem Brief an ihren Ehemann John Adams, einem der Gründerväter der Vereinigten Staaten: «Vergiss nicht, alle Männer wären Tyrannen, wenn sie könnten.» Und schließlich konstatierte Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse: «[Wir stammen] von einer unendlich langen Generationsreihe von Mördern [ab], denen die Mordlust, wie vielleicht noch uns selbst, im Blute lag.»[16]
Und das Seltsame ist, dass solche Denker immer «realistisch» genannt werden. Dissidentische Denker werden währenddessen zu Lebzeiten oft für ihren Glauben an das Gute im Menschen geschmäht.[17] Emma Goldman, eine Feministin, die ihr ganzes Leben lang wegen ihres Kampfes für Freiheit und Gleichheit verfolgt wurde, seufzte einmal: «Arme menschliche Natur, welch schreckliche Verbrechen sind in deinem Namen begangen worden! […] Je größer der geistige Scharlatan, desto beharrlicher sein Bestehen auf der Niederträchtigkeit und Schwäche der menschlichen Natur.»[18]
Erst seit einigen Jahren kommen Wissenschaftler aus völlig unterschiedlichen Disziplinen zu dem Schluss, dass unser düsteres Menschenbild reif für eine vollständige Überarbeitung ist. Diese Erkenntnis ist noch so frisch, dass die Wissenschaftler oft noch nicht einmal voneinander wissen. Oder wie es eine führende Psychologin nannte, als ich ihr von den neuen Strömungen in der Biologie erzählte:
«Oh God, so it’s happening there as well?»
4.
Bevor ich über meine Suche nach einem neuen Menschenbild berichte, drei Warnungen vorweg.
Wer sich für den Menschen einsetzt, tritt gegen eine Hydra an, das mythologische Monster mit sieben Häuptern, die sofort doppelt nachwuchsen, sobald Herkules sie abschlug. Ähnlich verhält es sich mit dem Zynismus. Für jedes menschenfeindliche Argument, das man für ungültig erklärt, kriegt man zwei zurück. Die Fassadentheorie ist ein Zombie, der sich weigert zu sterben.
Wer sich für den Menschen einsetzt, tritt auch gegen die Mächtigen der Erde an. Für sie ist ein hoffnungsvolles Menschenbild rundherum bedrohlich. Staatsgefährdend. Autoritätsuntergrabend. Schließlich bedeutet es immer, dass wir keine egoistischen Tiere sind, die von oben herab kontrolliert, reguliert und dressiert werden müssen. Es könnte außerdem zur Folge haben, dass der Kaiser keine Kleider trägt, dass ein Unternehmen mit selbstmotivierten Mitarbeitern vielleicht gut ohne Manager auskommt und eine Demokratie mit engagierten Bürgern keine Politiker mehr benötigt.
Wer sich für den Menschen einsetzt, wird auf Schritt und Tritt verspottet und beschimpft. Man wäre naiv. Einfältig. Jede Schwachstelle in der Argumentation wird gnadenlos aufgedeckt. Was das angeht, wäre es einfacher, Zyniker zu sein. Der pessimistische Gelehrte, der in seinem Armsessel vom menschlichen Defizit faselt, kann vorhersagen, was er will. Wenn sich seine Prophezeiungen nicht erfüllen, kann er trotzdem noch behaupten, im Recht zu sein. Denn wer weiß, ob sich die verderbte menschliche Natur nicht in der Zukunft offenbaren wird? Und vielleicht haben uns seine weisen Worte vor Schlimmerem behütet? Der Untergangsprophet klingt ach so tiefsinnig, was auch immer er von sich geben mag.
Die Gründe für die Hoffnung sind dagegen stets nur vorläufig. Noch ist nichts schiefgelaufen. Noch wurde man nicht betrogen. Ein Idealist kann sein ganzes Leben lang recht haben, aber dennoch als naiv abgetan werden. Mit diesem Buch möchte ich das ändern. Was jetzt unvernünftig, unrealistisch und unerreichbar erscheint, könnte bald das Normalste auf der Welt sein.
Es ist Zeit für ein neues Menschenbild. Es ist Zeit für einen neuen Realismus.
2. KapitelDer echte Herr der Fliegen
1.
Als ich mit dem Schreiben dieses Buches begann, wurde mir klar, dass ich um eine Geschichte nicht herumkommen würde.
Die Szenerie: eine unbewohnte Insel im Pazifik. Ein Flugzeug ist gerade abgestürzt. Die Überlebenden sind etwa 20 britische Schuljungen, die ihr Glück nicht fassen können. Der Strand, die Muscheln, das Wasser – es ist, als wären sie in einem Abenteuerbuch gelandet. Und noch besser: Es gibt keine Erwachsenen.
Gleich am ersten Tag errichten die Jungs eine Art Demokratie. Einer von ihnen, Ralph, wird zum Anführer gewählt. Er ist der golden boy, der John F. Kennedy der Gruppe: athletisch, charismatisch, attraktiv. Sein Aktionsplan besteht aus drei Punkten. Erstens: Spaß haben. Zweitens: Überleben. Drittens: Rauchsignale an vorbeifahrende Schiffe aussenden.
Nur Punkt eins wird erfolgreich umgesetzt. Die meisten der Jungs scheinen es vorzuziehen, zu spielen und sich den Bauch vollzuschlagen, statt auf das Feuer zu achten. Jack, ein strammer Kerl mit roten Haaren, jagt lieber Schweine. Im Laufe der Zeit werden er und seine Freunde immer leichtsinniger. Und gerade, als ein Schiff vorbeifährt, haben alle ihren Posten am Feuer verlassen.
«Du hältst dich nicht an die Regeln», ruft Ralph empört.
Jack zuckt mit den Schultern. «Ist doch scheißegal!»
«Die Regeln sind alles, was wir haben!»
Als die Dunkelheit hereinbricht, wächst die Angst vor einem Tier, das sich auf der Insel versteckt halten könnte. Aber die wahre Bestie steckt in den Jungen selbst. Sie bemalen sich die Gesichter und werfen ihre Kleider ab. Ihr Wunsch, einander zu piesacken, zu treten und zu beißen, wird immer größer.
Die ganze Zeit behält ein Junge, Piggy, einen kühlen Kopf. Piggy wird so genannt, weil er dicker ist als der Rest. Er hat Asthma, eine Brille und kann nicht schwimmen. Piggy ist die Stimme der Vernunft, aber niemand hört auf ihn. «Was sind wir denn?», fragt er sich verzweifelt. «Menschen? Oder Tiere? Oder Wilde?»
Wochen später setzt ein britischer Offizier endlich seinen Fuß an Land. Die Insel hat sich in ein schwelendes Chaos verwandelt. Drei Kinder, einschließlich Piggy, sind tot. «Ich hätte angenommen, dass eine Horde britischer Jungs in der Lage wäre, das besser hinzukriegen», kommentiert der Offizier abfällig. Ralph, der einstige Anführer dieser ordentlich erzogenen Kinder, bricht in Tränen aus.
«Ralph […] beweinte das Ende der Unschuld», lesen wir, «die Finsternis im Herzen der Menschen …»[1]
Die obenstehende Geschichte ist von Anfang bis Ende erfunden. Sie entstand 1951 im Kopf eines britischen Lehrers namens William Golding. «Wäre es nicht eine schöne Idee», hat er seine Frau eines Tages gefragt, «wenn ich ein Buch über ein paar Jungs auf einer Insel schreiben würde, um zu zeigen, wie sie sich wirklich verhalten würden?»[2]
Schließlich würden Dutzende Millionen Exemplare von Herr der Fliegen über die Ladentische gehen. Das Buch erschien in mehr als 30 Sprachen und wurde zu einem der bekanntesten Klassiker des 20. Jahrhunderts.
Im Nachhinein ist der Erfolg des Buches einfach zu erklären. Golding zeigte wie kein anderer, wozu der Mensch fähig ist. «Auch wenn wir als unbeschriebenes Blatt beginnen», schrieb er in seinem ersten Brief an seinen Verleger, «zwingt uns unsere Natur immer dazu, irgendeinen Murks zu machen.»[3]Oder, wie er später bemerkte, «der Mensch produziert Böses wie eine Biene Honig».[4]
Natürlich half der Zeitgeist mit: Anfang der 1960er Jahre fragte eine neue Generation ihre Eltern nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs. War Auschwitz eine Ausnahme, oder steckte vielleicht in jedem von uns ein Nazi?
William Golding suggerierte mit Herr der Fliegen Letzteres und landete damit einen großen Hit. Der einflussreiche Kritiker Lionel Trilling urteilte, dass der Roman eine «Mutation in der Kultur» zuwege brachte.[5] Golding erhielt schließlich sogar den Nobelpreis für sein Werk, das, wie das schwedische Komitee es formulierte, «als realistische Erzählkunst» den «menschlichen Zustand der heutigen Welt brillant beleuchtet».
Heute ist Herr der Fliegen viel mehr als ein Roman. Natürlich ist die Geschichte erfunden und steht in Bibliotheken in der Literaturabteilung. Doch das Buch ist auch zum ultimativen Beispiel für die Fassadentheorie geworden. Golding war der Erste, der es wagte, ein realistisches Kinderbuch zu schreiben. Kein sentimentales Gefasel über ein Häuschen in der Prärie oder einen kleinen Prinzen.
Nein, es war eine knallharte Geschichte darüber, wie Kinder wirklich sind.
2.
Ich weiß noch genau, dass ich den Roman als Teenager zum ersten Mal gelesen habe. Ich erinnere mich auch, dass mich die Geschichte traurig machte und dass ich lange Zeit daran herumgekaut habe. An dem Menschenbild, das Golding präsentiert, habe ich keinen Augenblick gezweifelt.
Erst Jahre später fing es an, in mir zu bohren, als ich das Buch noch einmal las. Ich beschäftigte mich intensiv mit William Goldings Biographie und fand heraus, dass er ein vielgeplagter Mensch war. Er war Alkoholiker. Litt unter Depressionen. Schlug seine Kinder. «Ich habe die Nazis immer verstanden», bekannte Golding, «weil ich von Natur aus auch so war.» Und es war «teilweise bitterer Selbsterkenntnis» geschuldet, dass er Herr der Fliegen geschrieben hatte.[1]
Andere Menschen interessierten den Schriftsteller wenig. Sein Biograph merkt an, dass er sich nicht einmal die Mühe machte, die Namen seiner Bekannten richtig zu schreiben. «Die Natur des Menschen mit einem großen Anfangsbuchstaben M», schrieb Golding, «wurde für mich zu einer dringenderen Angelegenheit, als tatsächlich Menschen zu treffen.»[2]
Ob ein Wissenschaftler jemals untersucht hat, fragte ich mich, was Kinder in einer solchen Situation wirklich auf einer einsamen Insel tun würden?
Ich schrieb einen Essay, in dem ich den Herrn der Fliegen mit den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft abglich, und kam zu dem Schluss, dass Kinder wahrscheinlich ganz anders reagieren würden.[3] «[E]s gibt nicht die Spur eines Beweises dafür», zitierte ich den Biologen Frans de Waal, «dass Kinder, die sich selbst überlassen bleiben, so handeln würden.»[4]
Aber als ich diesen Artikel dann veröffentlichte, waren viele Leser skeptisch. Ich hätte nur Studien über Kinder zu Hause, in der Schule oder in Sommerlagern herangezogen. Und die behandelten die eigentliche Frage nicht, nämlich: Was treiben Kinder, wenn sie allein sind, auf einer unbewohnten Insel?
Damals begann sie, meine Suche nach dem echten Herrn der Fliegen.
Natürlich, die Chance, dass eine Universität die Zustimmung gäbe, Kinder versuchsweise monatelang in der Wildnis auszusetzen, war nicht sonderlich groß. Nicht einmal in den 1950er Jahren. Aber vielleicht, dachte ich, hatte sich so etwas einmal unglücklicherweise zugetragen? Etwa nach einem Schiffbruch?
Ich tippte einige einfache Begriffe in die Suchmaschine ein. «Kids shipwrecked». «Real life Lord of the Flies». «Children on an island». Die ersten Ergebnisse führten zu einer üblen britischen Reality-Show von 2008, in der Kinder gegeneinander ausgespielt wurden. Aber nach etwa einer Stunde weiterer Recherche landete ich auf einem obskuren Blog, wo folgende Geschichte erzählt wurde:
Eines Tages, 1977, machten sich sechs Jungen aus Tonga auf den Weg zum Angeln. Die Jungs, in einen großen Sturm geraten, erlitten auf einer verlassenen Insel Schiffbruch. Was tat es, dieses kleine Völkchen? Es schloss einen Pakt, sich nie zu streiten.[5]
Es war keine Quelle angegeben. Nach ein paar Stunden Sucherei entdeckte ich, dass die Geschichte auf den bekannten Anarchisten Colin Ward zurückgeht, der darüber in seinem 1988 erschienenen Buch The Child in the Country geschrieben hatte. Ward wiederum bezog sich auf einen Bericht, den die italienische Politikerin Susanna Agnelli für eine internationale Kommission verfasst hatte.
Und also machte ich mich auf die Jagd nach diesem Bericht. Ich hatte Glück: Ein britisches Antiquariat hatte ein Exemplar, und zwei Wochen später lag es bei mir zu Hause. Ich überflog den Bericht, und tatsächlich – auf Seite 94 stand es.
Sechs Jungs, allein auf einer Insel. Aber wieder die gleiche Formulierung, wieder die gleichen Details, und wieder keine Quelle.[6]
Ich überlegte, Agnelli zu kontaktieren und zu fragen, woher sie die Geschichte hätte, aber dann fand ich heraus, dass sie 2009 gestorben war. Wenn es sich wirklich so zugetragen haben sollte, dann müsste ein Artikel aus dem Jahr 1977 darüber zu finden sein. Dann könnten die Jungs sogar noch am Leben sein. Aber wie lange ich auch suchte, in diesem oder jenem Archiv – ich fand nichts.
Manchmal braucht man einfach ein bisschen Glück. Eines Tages hatte ich meine Daten versehentlich falsch bei einem Zeitungsarchiv eingetippt und grub daher in den 1960er Jahren herum. Und das erwies sich als der Schlüssel, denn das Jahr 1977 in Agnellis Bericht war ein Tippfehler.
Dann fand ich sie, die Meldung vom 6. Oktober 1966 in der australischen Zeitung The Age. Die Überschrift: «SUNDAY SHOWING FOR TONGAN CASTAWAYS». Der Bericht handelte von sechs Jungen, die drei Wochen zuvor auf der kleinen Insel ‘Ata, südlich von Tonga, einer Inselgruppe im Pazifik, aufgespürt worden waren. Der australische Skipper Peter Warner hatte sie nach mehr als einem Jahr als Schiffbrüchige gerettet. Er hatte sogar das Fernsehen eingeschaltet, um eine Reportage über ihr Abenteuer zu produzieren.
«Es wird bereits jetzt als einer der großen Klassiker über das Meer gehandelt», schlussfolgerte die Zeitung.
Ich platzte vor lauter Fragen. Könnten die Jungs noch am Leben sein? Ließ sich diese Fernsehreportage auftreiben? Zumindest hatte ich jetzt den Namen des Kapitäns, Peter Warner. War der noch am Leben? Und wenn ja, wie findet man einen so Hochbetagten, der auf der anderen Seite der Welt lebt?
Als ich weiter nach dem Namen des Kapitäns forschte, folgte die nächste Überraschung. In einer kürzlich erschienenen Ausgabe der Daily Mercury, einer winzigen Stadtteilzeitung aus Mackay, Australien, fand ich eine Nachricht mit folgender Überschrift: «MATES SHARE 50-YEAR BOND». Es war ein kleines Bild von zwei lächelnden Männern dazu abgedruckt. Einer hatte den Arm um den anderen gelegt. Der Artikel begann so:
Im letzten Winkel einer Bananenplantage bei Tullera, in der Nähe von Lismore, leben zwei ungewöhnliche Freunde […]. Die Männer haben strahlende Augen und eine sprühende Energie, die man in ihrem Alter nicht erwarten würde. Der Ältere ist 83 Jahre alt und der Sohn eines reichen Industriellen. Der Jüngere ist 67, ein Kind der Natur.[7]
Ihre Namen? Peter Warner und Mano Totau. Woher sie sich kannten?
Von einer unbewohnten Insel.
3.
Eines Morgens im September sind wir, meine Frau Maartje und ich, losgefahren. Wir hatten ein Auto in Brisbane, an der Ostküste Australiens, gemietet, und ich saß aufgeregt am Steuer. Ich war nervös, weil ich auf der linken Straßenseite fahren musste (und fünfmal durch die Führerscheinprüfung gefallen war). Und vor allem, weil ich endlich eine der Schlüsselfiguren dieser Geschichte treffen würde.
Nach mehr als drei Stunden kamen wir an. Mitten im Nirgendwo, an einem Ort, zu dem nicht einmal Google Maps den Weg kannte. Aber da stand er vor einem kleinen Haus am Rande einer unbefestigten Straße: Kapitän Peter Warner, der Mann, der 50 Jahre zuvor sechs Kinder gerettet hatte.
Ehe ich seine Geschichte erzähle, müssen Sie ein paar Dinge über Peter wissen. Sein Leben ist nämlich einen Film für sich ganz alleine wert. Peter ist der jüngste Sohn von Arthur Warner, einem der reichsten und mächtigsten Männer Australiens in den 1930er Jahren. Arthur Warner war der Besitzer eines gigantischen Imperiums namens Electronic Industries, das damals den australischen Radiogerätemarkt beherrschte.
Peter sollte eigentlich in die Fußstapfen seines Vaters treten, rannte aber stattdessen mit 17 von zu Hause weg. Auf zum Meer, auf zum Abenteuer! «Ich kämpfte lieber gegen die Elemente als gegen Menschen», erinnerte er sich später.[1]