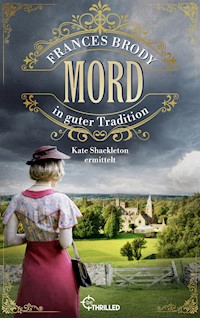4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kate-Shackleton-Krimis
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Kate Shackleton liebt verzwickte Kriminalfälle. Und sie liebt das Theater. Dass sich beides miteinander verbinden lässt - nun, damit hätte die Kriegswitwe und Gelegenheitsdetektivin wahrlich nicht gerechnet. Dies geschieht jedoch, als Kate nach einem Theaterbesuch in Harrogate über einen Toten stolpert, aus dessen Brust ein Dolch ragt. Ihr detektivisches Interesse ist rasch geweckt, vor allem, da der Ermordete enge Verbindungen zum Theaterensemble pflegte. Als schließlich die Hauptdarstellerin des Stücks entführt wird, ahnt Kate: Der letzte Vorhang dieser mörderischen Inszenierung ist noch lange nicht gefallen ...
"Kate Shackleton ist eine wundervolle Detektivin" Ann Granger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Dreiundvierzig
Vierundvierzig
Fünfundvierzig
Sechsundvierzig
Siebenundvierzig
Achtundvierzig
Neunundvierzig
Fünfzig
Einundfünfzig
Zweiundfünfzig
Danksagung
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Über dieses Buch
Kate Shackleton liebt verzwickte Kriminalfälle. Und sie liebt das Theater. Dass sich beides miteinander verbinden lässt – nun, damit hätte die Kriegswitwe und Gelegenheitsdetektivin wahrlich nicht gerechnet. Dies geschieht jedoch, als Kate nach einem Theaterbesuch in Harrogate über einen Toten stolpert, aus dessen Brust ein Dolch ragt. Ihr detektivisches Interesse ist rasch geweckt, vor allem, da der Ermordete enge Verbindungen zum Theaterensemble pflegte. Als schließlich die Hauptdarstellerin des Stücks entführt wird, ahnt Kate: Der letzte Vorhang dieser mörderischen Inszenierung ist noch lange nicht gefallen.
FRANCES BRODY
Mord braucht keine Bühne
Kate Shackleton ermittelt
Aus dem Englischen von Sabine Schilasky
Für meine Schwester Patricia
Prolog
Es dauerte beinahe einen ganzen Nachmittag, die Buchstaben auszuschneiden. Und trotz vorsichtigen Eintunkens des Backpinsels in das Glas gelangte Leim an die Fingerspitzen und musste abgezupft werden. Von dem Kleber schmerzte der Kopf, doch die Hoffnung blühte auf.
Beim Trocknen wurde das Blatt steif. Es wäre grotesk, sollte ein Buchstabe abfallen. Am Ende stand dort:
EINTAUSEND PFUND WENN LUCY LEBEND ZURÜCKKOMMEN SOLL
ANWEISUNGEN FOLGEN
KEINE POLIZEI SONST STIRBT SIE
Und das würde sie. Versagen bedeutete Vorhang, Erfolg Neuanfang.
Erster Akt, erste Szene.
Eins
An einem schwülen Freitagmorgen im August machten wir uns in meinem blauen 1910er Jowett-Cabriolet zu unserem Termin um 9.30 Uhr auf.
Jim Sykes, mein Assistent, ist ein ehemaliger Polizist, der drolligerweise glaubt, er sehe überhaupt nicht wie ein ehemaliger Polizist aus. Er ist rein zufällig drahtig, engstirnig und wachsam wie ein Kater mit ausgeprägtem Revierinstinkt. Während seines zehntägigen Urlaubs mit Frau und Familie in Robin Hood’s Bay hatte er Sonnenbräune und ein unbeschwertes Auftreten gewonnen, von dem ich annahm, dass es nicht lange halten würde.
Ich bremste scharf, um eine wirre alte Frau die Woodhouse Lane überqueren zu lassen, die den Verkehr anhielt, indem sie ihren Gehstock in die Luft schwang.
Ein Lumpensammlerkarren, vor den ein geduldiges Zugpferd gespannt war, rollte neben mich. Der Bursche neben dem Fahrer auf dem Bock zeigte auf mich. Er rief Sykes zu: »Hat dir keiner gesagt, dass Frauen nicht fahren können?«
Sykes zog seine Schutzbrille nach oben und strich sich mit einem Finger über die Kehle, wobei er den Jungen streng ansah.
»Lassen Sie es gut sein«, sagte ich und gab Gas. »Sie drohen ihm ja.«
»Drohen? Den erwürge ich.«
Sykes fiel es schwer, Dinge auf sich beruhen zu lassen. An ihm perlte rein gar nichts ab.
Wir hielten wacker durch, während ich uns ins Stadtzentrum von Leeds brachte und vor einem Juwelier mit gleich zwei Schaufenstern in der Lower Briggate parkte. Drei goldene Kugeln über dem Geschäft bedeuteten, dass es zugleich eine Pfandleihe war.
Im Schaufenster sah ich flüchtig mein Spiegelbild. Was trägt eine stilsichere Privatdetektivin in dieser Saison unter ihrem Automobilisten-Mantel? Ein Seidenkreppkleid in Braun und Türkis, eine von einem Coco-Chanel-Modell kopierte Jacke, dazu Topfhut und Handschuhe im Braunton des Kleids. Meine Mutter mag kein Braun, weil es sie angeblich zu sehr an das düstere Khaki der Kriegszeit erinnert, doch es passte zu meinem blassen Teint und dem kastanienbraunen Haar.
In Juweliergeschäften herrscht stets eine gedämpfte Atmosphäre, ähnlich wie in Kirchen oder Banken. In diesem duftete es nach Lavendelpolitur und Fensterleder. Der junge Verkäufer mit dem sorgfältig gekämmten hellen Haar und dem dunklen Anzug hätte ebenso gut in einem Kontor arbeiten können. Konzentriert hielt er den Kopf gesenkt und zeigte einem jungen Paar ein Tablett mit Ringen.
Mr. Moony, ein dünner Mann in einem grauen Anzug und mit einer glänzenden Halbglatze, schenkte uns ein Mona-Lisa-Lächeln. Er sparte sich das Vorstellen fürs kleine Hinterzimmer auf.
»Einen Moment!« Er verschwand im Geschäft und kehrte mit einem Stuhl für mich zurück. Ich bin einen Meter siebenundfünfzig groß, und Mr. Moonys Höflichkeit sorgte dafür, dass er und Sykes mich auf ihren hohen Hockern deutlich überragten. Sykes meisterte den Moment mustergültig und widmete sich ausgiebig der Aufgabe, Notizbuch und Stift hervorzuholen.
Ich bat Mr. Moony, uns von dem Vorfall zu erzählen, der sich am letzten Montag, dem 21. August 1922, ereignet hatte.
Seufzend strich er sich über das Kinn. »In meinen dreißig Jahren hier hatten wir so etwas noch nicht, auch nicht zu Zeiten meines Vaters vor mir.« Während er zu erzählen begann, umklammerte er die Sitzfläche seines Hockers. Seine Fingerknöchel wurden weiß. Er sprach flüssig, da er die Geschichte bereits der Polizei erzählt hatte. »Ungefähr gegen Mittag ging ich zu einem Spaziergang nach draußen und kehrte eine halbe Stunde später zurück. Dann unternahm mein Verkäufer, der junge Mr. Hall, einen Spaziergang. Es ist meine feste Überzeugung, dass es von bekömmlicher Wirkung ist, sich mittags die Beine zu vertreten.« Hier brach er kurz ab, als erwartete er beinahe, dass man seine Theorie infrage stellte.
»Ich halte es ganz genauso, Mr. Moony«, hörte ich mich lügen. »Erst gestern ging ich von Woodhouse Ridge bis Adel Crags.«
Diese kleine Schwindelei lenkte Mr. Moony zurück zu seiner Geschichte.
»Während ich hier allein war, kam dieser Kerl herein. Mein einziger Trost ist, dass ich und nicht der junge Hall das meiste von dem Aufruhr abbekam.«
Bei dem Namen Hall stupste Sykes meinen Knöchel mit dem Fuß an, und ich trat ihn. Als würde ich nicht von selbst daran denken nachzufragen!
»Ist Mr. Hall schon lange bei Ihnen?«
Es folgte eine fünfminütige Lobrede auf den jungen Albert Hall. Ich hoffte, dass Sykes sich alles notierte, solange ich mich bemühte, nicht zu kichern. Welche Mrs. Hall nannte ihren Sohn Albert? Nenn mich Bert, nenn mich Al, nenn mich irgendwie, aber nicht wie den Prinzgemahl und die große Liebe der verstorbenen Königin.
Nachdem er seinen Verkäufer gänzlich und überaus blumig von jedem Verdacht freigesprochen hatte, holte Mr. Moony tief Luft, bevor er mit seiner Geschichte fortfuhr. Seine Augen verengten sich, als er sich an die verstörende Szene erinnerte. »Der Mann war etwa einen Meter siebzig groß, von schmaler, leicht gebeugter Statur und eher jung. Er trug einen dunklen Regenmantel und einen Homburg. Er hätte etwas zu verpfänden, sagte er, zeigte mir eine Uhrkette aus zwanzigkarätigem Gold und verlangte zwölf Shilling. Ich machte die Papiere fertig, nahm die Kette und gab ihm das Geld. Da der Handel abgeschlossen war, steckte ich die Kette in einen Beutel.«
»Können Sie sich sonst noch an etwas erinnern, Mr. Moony?«
»Es war ein warmer Tag. Der Kerl tupfte sich die Stirn mit einem Taschentuch ab. Und da war so ein Geruch, als er das Taschentuch hervorholte …« Er runzelte die Stirn.
»Was für ein Geruch?«
»Solch einer, der einem zu Kopfe steigt.«
»Haarlotion?«
»Nein. Wie Politur und Rosen. Die Polizei hat das gar nicht bemerkt. Der Officer, der hier war, hatte überhaupt keinen Geruchssinn und sagte, es könnte die Politur meiner Auslagen gewesen sein. Er behauptete, dass die Sinne auf übertriebene Weise geschärft seien, wenn etwas Ungewöhnliches oder Schlimmes geschieht.«
»Also haben Sie den Handel abgeschlossen?«, hakte ich nach.
»Ja, ich zählte die zwölf Shilling auf den Tisch, steckte die Uhrkette in den Beutel …«
»Und dann?«
»Wir wünschten einander einen guten Tag. Er wandte sich schon halb zum Gehen. Als er es tat, drehte ich mich weg, um den Beutel in den Tresor zu legen. Die Ladenglocke läutete nicht gleich. Ich wandte mich um und sah, dass doch noch ein Artikel in der Auslage seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Das geschieht manchmal, wissen Sie?«
Mr. Moony verstummte, als widerstrebte es ihm, sich das Ereignis ins Gedächtnis zu rufen. Seine Augenlider zuckten, und es dauerte einige Sekunden, bis er es unter Kontrolle hatte.
Ich sagte: »Die Polizei muss erfreut gewesen sein, einen solch guten Bericht zu bekommen. Was geschah danach?«
Mr. Moony schluckte. Ein tiefer Seufzer entfuhr ihm, ehe er weitererzählte. »Er war gar nicht an der Tür, sondern plötzlich hinter mir. Bevor ich Gelegenheit hatte, den Safe zu schließen, hatte er die Hände um meinen Hals gelegt. Er holte sich die Uhrkette zurück, schleuderte mich zu Boden und griff sich alles aus dem Tresor, was er konnte. Bis ich wieder bei mir war, war er fort. Ich rief die Polizei. Binnen Minuten war ein Constable hier. Aber sie konnten weder den Mann noch die fehlenden Gegenstände finden. Natürlich hatte der Mann eine falsche Adresse angegeben, in der Headingley Lane. Die Polizei überprüfte sie. Mir fiel auf, dass Sie in Headingley wohnen, Mrs. Shackleton. Ich weiß, dass es absurd erscheint, aber meine Frau nahm es als gutes Omen.«
»Hoffen wir es.«
Sykes blickte von seinem Notizbuch auf. »Mr. Moony, können Sie uns sonst noch etwas erzählen? Was den Teint, die Gesichtszüge, das Auftreten des Mannes oder seine Art zu sprechen angeht?«
Mr. Moony zuckte mit den Schultern. »Ich habe so sehr versucht, mich an ihn zu erinnern, dass ich mir inzwischen gut gewisse Dinge einbilden könnte. Aber er hatte etwas Feines an sich. Ich kann es nicht benennen. Etwas so Vornehmes, dass ich vollkommen überrascht war, als er sich auf mich stürzte. Es mag lächerlich klingen, das zu sagen, und ich kann es auch nicht recht erklären. Er hatte etwas von einem Kontoristen an sich. Vielleicht war es die gebeugte Haltung, die mich zu diesem Eindruck verleitete. Ich bin mir nicht sicher.«
»Hiesiger Akzent?«, fragte Sykes.
»Sehr artikuliert, auf neutrale Art. Nicht von hier, würde ich sagen.«
»Und die Polizei hat nach Fingerabdrücken gesucht?«, fragte ich.
»Ja, aber sie fanden keine. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht sehr zuversichtlich, dass sie ihn oder die Pfandobjekte finden werden, die er mitnahm. Und das ist das Furchtbare. Hätte er meine Auslage eingeschlagen und neue Ware mitgenommen, wäre es nicht allzu schlimm gewesen. Dies ist schlimmer. Es geht um Vertrauen, verstehen Sie? Meine Kunden kommen zurück und möchten ihre Pfandstücke auslösen. Was soll ich ihnen denn sagen?«
Sykes und ich wechselten einen Blick. Es war ein etwas ungewöhnlicher Auftrag, sollten wir gefordert sein, dem Juwelier eine wohlformulierte Ausrede für seine enttäuschten Kunden zu bieten. »Sind wir deshalb hier, Mr. Moony?«, fragte ich.
»Nun, es wäre wunderbar, wenn Sie den Schurken finden könnten.«
Sehr viel zuversichtlicher, als ich mich fühlte, sagte ich: »Mr. Sykes und ich werden unser Bestes tun, das Diebesgut aufzuspüren.«
»Je mehr Tage vergehen, desto unwahrscheinlicher wird es.« Mr. Moony zog eine Aktenmappe unter einer Juwelierzange hervor, die auf seiner Werkbank lag. »Dies ist eine Abschrift dessen, was ich der Polizei gab. Eine Liste der gestohlenen Gegenstände: ein Paar goldene Manschettenknöpfe und eine Krawattennadel, drei Uhrketten, zwei Taschenuhren, vier Ringe und ein Armband. Neben jedem der Gegenstände finden Sie eine detaillierte Beschreibung. Es ist furchtbar, wenn man als Pfandleiher Dinge verliert. Manche dieser Stücke sind von großem sentimentalem Wert. Wenn ich sie verloren habe, muss ich die Besitzer informieren und für Entschädigung sorgen. Was wiederum nach Diskretion verlangt. Zwei der betroffenen Personen sind verzweifelte Damen aus den besseren Kreisen, die vollstes Vertrauen zu mir haben. Ich dachte, wenn Sie, Mrs. Shackleton, mit dem größtmöglichen Takt … also … die Situation … erklären …«
Ich verstand, warum alte Damen auf Mr. Moony vertrauten – das sanfte Auftreten, die altmodische Höflichkeit, das Verständnisvolle.
Und ich verbarg meine Überraschung ob der Bitte, ich möge Mr. Moonys Kunden Nachricht bringen. Das war nicht unbedingt, was man von einer Detektivin erwartete. »Und Mr. Sykes würde mit den Herren sprechen? Ist das Ihr Wunsch?«
Mr. Moony sah erleichtert aus. »Richtig. Und wenn die Damen und Herren am Fälligkeitstag hierherkommen, kann ich eine Entschädigung arrangieren.«
Ich blickte auf die Liste mit den Namen und Adressen. »Es sind nicht nur Leute von hier.«
Mr. Moony lächelte. »Ich bin der beste Pfandleiher in Bahnhofsnähe. Die Damen und Herren der feinen Gesellschaft finden es bisweilen peinlich, ein Etablissement an ihrem Wohnort aufzusuchen.«
»Dann können wir gleich anfangen, Mr. Moony.« Ich sah zu Sykes, ob er mir zustimmte.
Er nickte. »Natürlich.«
»Danke. Was sollte Ihrer Meinung nach am besten gesagt werden?«
Ich versuchte mir vorzustellen, wie ich an Türen klopfte und die Situation erklärte. »Die Wahrheit über den Raub, ohne irrelevante Einzelheiten, und dass alle, die mit ihrem Pfandschein am Fälligkeitstag zu Ihnen kommen, auf eine Entschädigung oder Ersatz zählen können. Wäre das die angemessene Herangehensweise?«
»Ja. Ich denke schon.« Er erlaubte sich etwas Zuversicht. »Selbstverständlich wäre es das Beste, wenn Sie oder die Polizei die gestohlenen Gegenstände wiederbeschaffen könnten.«
»Hat sich die Polizei bei Ihnen gemeldet?«, fragte Sykes.
Mr. Moonys tiefer Seufzer schien zu Boden zu fallen und von dort abzuprallen. »Nur um mir zu sagen, dass es keine Neuigkeiten gibt.« Er senkte den Kopf, gleichsam überwältigt von der beschämenden, unangenehmen Situation. Als er wieder aufsah, nahm ich einen verzweifelten Ausdruck an ihm wahr. Er benetzte seine schmalen Lippen. »Dies sind die schlimmsten, die traurigsten Tage meines Lebens. Ich kann nicht glauben, dass ich so nachlässig war, dies geschehen zu lassen.«
»Ich sehe mich mal im Geschäft um, wenn ich darf.« Sykes ging schnell hinaus, sodass mir die Aufgabe zufiel, Mr. Moony zu beruhigen und davon zu überzeugen, dass ihn keine Schuld traf.
»Ist Ihnen an der Uhrkette, die der Dieb verpfänden wollte, irgendetwas aufgefallen?«
»Hatte ich das nicht erwähnt? An ihr hing eine Goldmünze. Das ist nicht besonders ungewöhnlich, aber es handelte sich um eine südafrikanische Münze, einen goldenen Rand.«
»Da hätten wir einen Anhaltspunkt«, sagte ich bemüht zuversichtlich.
Lediglich mehrere hunderttausend britische Männer hatten in Südafrika gedient oder gearbeitet. Das grenzte den Kreis ein.
Wir besprachen die Konditionen. Mr. Moony hatte bereits einen großzügigen Scheck als Vorschuss ausgestellt. Ich steckte ihn in meine Handtasche und versicherte ihm, dass wir unser Bestes tun würden.
Als die Tür hinter uns geschlossen wurde, erinnerte ich mich wieder an meinen letzten Besuch beim Juwelier Moony. Ich war dort gewesen, um ein Geschenk für meinen Mann Gerald zu kaufen, bevor er zu seiner Militärausbildung abreiste. Er war Chirurg und hatte sich gleich zu Beginn des Großen Kriegs voller Patriotismus und Courage zur Army gemeldet. Sein Verschwinden war ein Rätsel, das ich bisher nicht gelöst hatte. Er könnte noch immer irgendwo am Leben sein, krank oder unter Gedächtnisverlust leidend. Da er mich gut versorgt zurückließ, kann ich es mir leisten, andere Rätsel aufzuklären, die mir kaum zu Herzen gehen. Ich kaufte Gerald seinerzeit eine silberne Taschenflasche. Seine alte trage ich in meiner Handtasche bei mir.
Sykes unterbrach meine Gedanken. »Soll ich fahren?«, fragte er.
»Nein, sollen Sie nicht. Ignorieren Sie die komischen Blicke und schlauen Bemerkungen. Es wird Ihrem Charakter guttun, einen Eindruck davon zu gewinnen, was wir Frauen auszuhalten haben.«
Zwei
Sykes las die Straßenkarte und dirigierte mich aus dem Stadtzentrum auf die Beckett Street und die Harehills Road entlang. Dorset Mount war eine Straße mit gepflegten Reihenhäusern aus rotem Backstein hinter einer Ladenzeile. Ich parkte bei den Geschäften und empfand einen starken Widerwillen, eine arme Frau auf eine sehr private Transaktion ansprechen zu müssen.
Sykes blieb im Wagen. Ich war ein klein wenig zu gut gekleidet für diese Gegend und wurde unsicher, als meine neuen braunen Schuhe auf dem Gehwegpflaster klackerten. Die Hintertür schien mir die diskrete Wahl. Das Glück war mir hold, denn eine rundliche, freundlich wirkende Frau fegte gerade den Hinterhof.
»Mrs. Simons?«
Sie hielt sich eine Hand aufs Herz. »Es ist Solly«, sagte sie. »Es ist etwas passiert.«
»Nein, nichts ist passiert. Niemand ist verletzt.«
Sie ließ den Besen los und kam zur hinteren Mauer. »Was ist dann?«
»Darf ich für einen Moment hereinkommen?«
Sie öffnete die Pforte. An der Tür ihres Kohlenschuppens teilte ich ihr die groben Fakten zum Raubüberfall auf Moonys Pfandleihe mit. Sie nahm die Nachricht besser auf, als ich gedacht hätte.
»Der arme Mr. Moony. Wenn er mich entschädigt, reicht das vollkommen. Es gibt Schlimmeres.«
»Nicht alle werden es so gut aufnehmen, Mrs. Shackleton«, sagte Sykes finster, als wir wieder in meinem Esszimmer waren, das auch als Büro fungierte. Er betrachtete den neuen Aktenschrank aus Rosenholz.
»Er ist für unsere Fallakten«, erklärte ich.
»Tja, ich hoffe, Sie fordern das Schicksal nicht heraus und werden mehr Fälle haben.«
»Mr. Sykes, müssen Sie solch ein Hiobströster sein?«
Die Wahrheit war, dass der Auftrag des Pfandleihers erst mein zweiter richtiger Fall war. Davor hatte ich nach dem Krieg nach Vermissten gesucht, was allerdings aus reiner Freundlichkeit geschah, denn ich wollte den Frauen helfen, die, wie ich, nach Kriegsende mit offenen Fragen zurückgeblieben waren.
Wir legten Mr. Moonys Liste der gestohlenen Pfandstücke zwischen uns auf den Tisch. Mr. Sykes runzelte die Stirn, als er die Namen und Adressen der männlichen Besitzer abschrieb, zusammen mit den Daten, an denen man die Gegenstände wieder hätte auslösen können.
Ich hielt es mit den Namen der Damen genauso, hakte Mrs. Simons von heute ab und machte eine Notiz, was sie gesagt hatte. Auf meiner Liste waren nun noch vier Leute übrig, auf Sykes’ waren es sechs. Verpfänden war eindeutig eine demokratische Angelegenheit mit beinahe ausgeglichener Geschlechterverteilung.
»Was halten Sie davon, dass der Dieb eine falsche Adresse in Headingley angab, Mr. Sykes? Ich frage mich, ob er die Gegend kennt.«
Sykes stieß einen zweifelnden Laut aus. Er hatte ein breites Repertoire nonverbaler Laute, mit denen er eine Menge auszudrücken vermochte. Dieses besondere Ausatmen schien zu bedeuten, dass er nicht glaubte, der Dieb würde in Headingley wohnen. »Schwer zu sagen. Wahrscheinlich lebt er ganz woanders und sagte Headingley, um Mr. Moony auf die falsche Fährte zu locken.«
In diesem Moment kam meine Haushälterin, Mrs. Sugden, mit einem Tablett herein. Darauf befand sich ein frühes Mittagessen, bestehend aus Schweinepastete, Tomaten und Gurke und einer Kanne Tee. »Essen Sie lieber, ehe Sie nach Harrogate fahren, Mrs. Shackleton.«
Durch die Brille auf ihrer Nasenspitze schaute sie zu meinem Notizbuch. Mrs. Sugden war die Diskretion in Person, ausgenommen sie musste Dinge über mich an meine Mutter weitergeben. »Davon habe ich gar nichts gehört«, sagte sie überrascht. »Ich wusste nicht, dass der alte Moony ausgeraubt wurde.«
Sykes’ Miene verfinsterte sich. So zu arbeiten war er von der Polizei nicht gewohnt.
»Es wäre nicht gut für sein Geschäft, sollte es bekannt werden, Mrs. Sugden«, antwortete ich und reichte Sykes einen Teller.
Als Mrs. Sugden gegangen war, sagte Sykes: »Es könnte sich lohnen, mal mit einem Freund von mir auf der Millgarth-Wache zu reden. Er arbeitet dort am Tresen vorn. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Er wird mir verraten, falls es Spuren zu unserem vornehmen Juwelendieb gibt oder irgendwelches Diebesgut zum Verkauf angeboten wurde.«
»Was ist mit dem Verkäufer, Mr. Hall?«
»Ich erkundige mich. Und danach mache ich mich auf den Weg nach Chapel Allerton zu diesem Mr. Bing, der damit rechnet, nächsten Donnerstag seine Uhrkette auszulösen.«
»Ich werde als Nächstes nach Harrogate zu Mrs. deVries fahren.«
Mr. Moony hatte sie als eine feine Dame beschrieben, die jedes Jahr im Sommer den Ring ihrer Mutter verpfändete. Ihr die Nachricht von seinem Verlust zu überbringen würde nicht erfreulich sein. Aber da sie ihn spätestens am kommenden Montag wieder auslösen sollte, ging es nicht anders. Zum Glück wollte ich ohnedies nach Harrogate, sodass ich das Geschäftliche mit dem Vergnügen verbinden konnte. Ich biss in die Schweinefleischpastete, die sehr gut war.
»Ach ja«, sagte Sykes. »Sie wollten ins Theater.« Und dann ergänzte er bemüht beiläufig: »Fahren Sie mit dem Automobil?«
»Nein, das gehört heute ganz Ihnen. Falls es Ihnen nichts ausmacht, eine halbe Stunde zu warten, während ich meine Schuhe wechsle und eine Tasche packe, können Sie mich zum Bahnhof mitnehmen. Um kurz nach eins geht ein Zug.«
Sykes sah froh aus, den Wagen zu haben. »Es macht mir nichts aus zu warten.« Er spießte eine eingelegte Zwiebel auf. »Harrogate, was? Ein Jammer, dass die werte Dame ihren Ring nicht irgendwo in ihrer Nähe verpfändet hat. In Harrogate gibt es nie Verbrechen.«
Drei
Als der Zugführer pfiff, damit der Zug den Bahnhof von Leeds verließ, nahm ich mein Buch hervor. Die Abteiltür flog auf. Eine Rauchwolke vom Bahnsteig vermengte sich mit Veilchenduft. Erleichtert murmelnd, dass sie den Zug noch erwischt hatte, stellte eine schlanke, vertraute Gestalt von ungefähr vierzig Jahren einen cremeweißen Sonnenschirm ab. Sie öffnete den obersten Knopf ihrer grünen Satinjacke. »So heiß, so furchtbar heiß heute.« Sie sprach atemlos mit sich selbst, stellte ihre Tasche und ihr Gepäck ab und breitete sich auf den Sitzen mir gegenüber aus.
Mit einem tiefen Seufzer nahm sie Platz, zog einen Fächer aus Elfenbein und Seide aus ihrer Tasche, klappte ihn auf und wedelte sich damit Luft zu. Der Zug stieß eine Dampfwolke aus.
Natürlich! Dieses vollkommene Profil, das elegant hochgesteckte Haar und diese zierlichen Schuhe. Die Belgierin war eine der Darstellerinnen in der Laienproduktion, die ich mir am Abend ansehen würde. Die Regisseurin, eine schillernde Frau, die ich auf einer Party kennengelernt hatte, hatte mich überredet, ihre Schauspieler zu fotografieren. Es war ein vergnügliches Unterfangen gewesen. Die Kamera verliebte sich in sie alle.
Diese Belgierin und ihr Ehemann spielten einen englischen Ratsherrn und dessen Gemahlin. Sie polsterte sich für die Rolle auf, um wie eine beleibte Matrone aus der Töpferindustrie auszusehen. Meriel, meine Regie-Bekanntschaft, sagte, sie hätte intensiv mit den beiden trainiert, und manchmal wäre ihr Akzent hervorragend.
Die Frau spürte meinen Blick, als ich mich an ihren Namen zu erinnern versuchte, und erkannte mich. »Ah, die Fotografin, Mrs. …«
»Shackleton. Und Sie sind die Gattin des Ratsherrn in dem Stück, aber im wahren Leben …«
»Ach, das wahre Leben, das wahre Leben. Davon gibt es viel zu viel. Aber, ja, ich bin Madame Geerts. Olivia Geerts. Bitte, nehmen Sie doch ein Parma Violet.«
Ich zog Birnendrops vor, doch man sollte Harrogate unbedingt mit wohlriechendem Atem erreichen. »Vielen Dank.« Wäre es unhöflich, sie zu ignorieren und mein Buch zu lesen? Sie lächelte und beantwortete die Frage für mich.
»Sie lesen das Buch zum Stück, wie ich sehe. Anna of the Five Towns.«
»Ja, mir fehlt nur noch ein Kapitel. Und ich bin gespannt, wie Meriel diese Geschichte für die Bühne adaptiert hat. Es war gewiss nicht leicht, würde ich meinen.«
Sie wedelte mit ihrem Fächer. »Dann will ich Sie nicht stören. Lesen Sie nur. Ich schaue aus dem Fenster.«
Als wir uns Harrogate näherten, schlug ich das Buch zu. »Wie schrecklich! Es ist das falsche Ende. Schlimm genug, dass sich eine der Figuren erhängt.«
»Die Szene ist gestrichen. Wir sehen nicht mehr, wie dieser Mann von seinem Sohn abgeschnitten wird.« Madame Geerts seufzte. »Ein vom Unglück Verfolgter. Aber diese Heldin der Geschichte, was für ein lästiges Mädchen. Ich möchte sie schütteln. Ihr sagen, rede! Setz dich durch!«
Sie brachte mich zum Lachen. Ich wusste genau, was sie meinte.
Anna of the Five Towns ist eine Aschenputtel-Geschichte ohne gute Fee. Anna ist die Tochter eines Geizhalses. An ihrem einundzwanzigsten Geburtstag erbt sie ein Vermögen. Aber der Geizhals hat Macht über sie. Sie wagt kaum, auch nur einen Sixpence auszugeben. Anna macht eine gute Partie und heiratet den aufstrebenden Geschäftsmann der Stadt. Zu spät entdeckt sie, dass ihr Herz dem jungen Willie Price gehört, dem Sohn ihres bankrotten Pächters. Der ältere Mr. Price erhängt sich aus Verzweiflung. Meine kurze Zusammenfassung lässt die Geschichte melodramatisch klingen. Sie pulsiert wie das wahre Leben. Annas Königreich ist ihre blitzblanke Küche. Ihre Gefühle sind schön und empfindsam, und sie hat eine natürliche Abneigung gegen Heuchelei. Sie kann ihre Gedanken indes nicht in Worte fassen, nicht einmal sich selbst gegenüber. Kein besonders vielversprechender Stoff für ein Theaterstück.
Madame Geerts steckte ihren Fächer ein und knöpfte ihre Jacke wieder zu. Ruckelnd kam der Zug zum Stehen. Sie beugte sich vor und ergriff meine Hände. Zuerst dachte ich, sie wollte ihr Mitgefühl ob des tragischen Romanendes ausdrücken.
Sie blickte mich eindringlich an. »Bitte, erzählen Sie keiner Menschenseele, dass ich in diesem Zug war.« Obwohl wir allein im Abteil waren, senkte sie die Stimme zu einem Flüstern. »Als verheiratete Dame werden Sie wissen, dass medizinische Angelegenheiten von Frauen am besten geheim bleiben. Mein Ehemann, Monsieur Geerts, wenn er erfährt, dass ich im Zug aus Leeds war, wird er außer sich sein. Er ist ein eifersüchtiger Mann. Immer heißt es: Wo warst du? Wen hast du gesehen? Was hast du getan? Ahhh! Sie können es sich nicht vorstellen.«
Ich lächelte. »Ich würde nicht im Traum daran denken zu erwähnen, dass ich Sie gesehen habe. Ich werde kein Wort darüber verlieren.«
Sie lehnte sich vertraulich näher. »Sie sind eine Frau von Welt. Ihnen kann …«
Gnädigerweise öffnete ein Zugbegleiter in diesem Moment die Abteiltür und rettete mich vor medizinischen Einzelheiten.
»Werden wir Sie heute Abend sehen?«, fragte sie, als wir uns an der Schranke trennten. »Kommen Sie zu unserer letzten Vorstellung?«
»Die würde ich um keinen Preis versäumen.«
Ich gab meine kleine Reisetasche bei der Gepäckaufbewahrung ab. Vor der Haustür der armen Mrs. deVries zu erscheinen und ihr mitzuteilen, dass der Ring ihrer Mutter aus der Pfandleihe gestohlen wurde, würde schlimm genug sein. Sie sollte nicht noch den Eindruck gewinnen, ich wolle bei ihr einziehen.
Durch das Gedränge der Reisenden machte ich mich auf den Weg zur Bahnhofsbuchhandlung. Zwischen Fremdenführern über das Heilbad fand ich einen Stadtplan von Harrogate. Zufällig wohnte Mrs. deVries in derselben Straße wie meine Regie-Bekanntschaft, die angeboten hatte, dass ich bei ihr übernachten dürfte.
Der Karte nach schätzte ich, dass die St. Clement’s Road ungefähr eine Meile vom Bahnhof entfernt war. Die Karte täuschte mich. In der Nachmittagshitze und bei strahlender Sonne am wolkenlosen Himmel fühlte ich, wie ich dahinwelkte, als ich die West Park hinaufging. Seidenkrepp ist nicht die klügste Wahl für einen heißen Nachmittag. Ich hatte meine braunen Riemchensandalen gegen schwarze Schuhe mit Keilabsatz ausgetauscht, die sich für den abendlichen Theaterbesuch eher eigneten. Nun behinderten sie mich. Du bist nicht hier, um im Schatten eines Baums im The Stray zu sitzen, ermahnte ich mich. Doch der Gedanke war verlockend. Der Park, der Duft von Gras und die winzigen Gänseblümchen weckten Erinnerungen. Meine Mutter und ich hatten Harrogate besucht, bevor sie die Zwillinge, meine Brüder, bekam. Mein Vater war bei einer Polizeikonferenz gewesen, und meine Mutter und ich waren zum Vergnügen mitgereist. Mein Vater musste damals für eine Stunde entkommen sein. Ich erinnerte mich, wie wir drei zusammen im Gras gesessen hatten. Ich hatte mich einen riesigen Hügel hinuntergekullert und es abenteuerlich gefunden, Himmel und Erde immer wieder die Plätze tauschen zu sehen, während mich das Gras an Armen und Beinen kitzelte. Nun sah ich keinen gewaltigen Hügel mehr, sondern nur einen sanften Abhang.
Bis ich die St. Clement’s Road erreichte, fühlten sich meine Füße doppelt so groß an, wie sie waren. Ich achtete nicht auf den Schmerz und stellte mir stattdessen vor, wie ich in wenigen Momenten an die Tür von Nummer 92 klopfen würde. Selbst mit Mr. Moonys Visitenkarte, die ich Mrs. deVries unter die Nase halten konnte, könnte sich das Gespräch unangenehm gestalten. Im Idealfall war die Frau allein und bat mich hinein, sodass ich mich kurz erholen könnte, während ich ihr taktvoll erklärte, dass ihr verpfändeter Ring leider gestohlen worden war.
Wie es das Pech wollte, befand ich mich an dem Straßenende mit der Hausnummer eins. Erst als ich die gesamte Straße abgewandert war, wurde mir klar, dass es keine Nummer 92 gab.
Ich blieb an Meriel Jamiesons Gartenmauer stehen. Dahinter befand sich ein viergeschossiges Doppelhaus aus rotem Backstein, wahrscheinlich Mitte des letzten Jahrhunderts erbaut. Manche Häuser in der Straße waren sehr gepflegt, hatten glänzend lackierte Türen und Fensterrahmen, elegante Vorhänge in den Fenstern, Schalen mit Geranien und Petunien auf den Fenstersimsen und makellose kleine Vorgärten.
An Meriels Fassade blätterte die Farbe ab. Eine der Stufen zur Haustür war gesprungen. Nesseln und Disteln wuchsen im Garten, wo zwei vernachlässigte Rosenbüsche um Platz kämpften.
In der Hoffnung, dass Meriel noch zu Hause war und ich meine Füße ausruhen könnte, stieg ich die sieben Stufen zur Haustür hinauf. Dort gab es zwei Klingeln und zwei Namensschilder: Capt. Wolfendale und Miss Fell. Keine Miss Jamieson. Aus dem Erkerfenster glotzte mich eine Rüstung an. Indem ich zwei Stufen wieder hinabstieg, konnte ich ins Zimmer spähen, ohne gesehen zu werden. Zwei Männer saßen an einem niedrigen Tisch vorm Kamin, die Köpfe über etwas gebeugt, was ein Brettspiel sein mochte. Das musste der Captain Wolfendale vom Namensschild sein. Ihn und seinen Mitspieler störte ich lieber nicht. Meriel wohnte noch nicht lange in Harrogate. Vielleicht hatte sie kein Namensschild.
Plötzlich ging die Tür auf. Ein Pekinese streckte seinen kleinen Kopf heraus. Als sich die Tür weiter öffnete, sah ich, dass er an der Leine war und von einer älteren Dame mit einem runden, freundlichen Gesicht geführt wurde. Sie schlug die linke Hand vor ihre Brust. »Du meine Güte! Sie haben mich erschreckt.« Sie schloss die Tür hinter sich.
»Verzeihung, das wollte ich nicht. Ich bin auf der Suche nach Miss Jamieson.«
»Miss Jamieson wohnt im Souterrain.« Ihre Stimme klang kultiviert, sogar ein wenig affektiert. »Sie ist nicht zu Hause. Ich sah sie vorhin weggehen.«
So viel zu meinem Traum, meine geschundenen Füße auszuruhen. »Oh, nun, nicht so wichtig.« Der Pekinese schnüffelte an meinen Schuhen, als wüsste er, dass sie zu eng waren. »Ich treffe sie später. Ich bin hier, um mir das Stück anzuschauen.«
»Ah, dann werden wir uns vielleicht auch wiedersehen, denn ich gehe ebenfalls hin. Da erwartet Sie etwas Nettes, Miss …«
»Mrs. Shackleton. Ich habe die Fotografien gemacht.«
»Ja richtig! Ich habe viel von Ihnen gehört.« Nun klang sie sehr viel freundlicher.
Wir stiegen zusammen die Stufen hinunter und standen für einen Moment auf dem Gehweg.
»Dann gehe ich lieber zurück in die Stadt, um Miss Jamieson dort zu treffen.« Ich bückte mich und streichelte den seidigen Pekinesenkopf. Auf diese Weise machte ich mich bei seiner Halterin beliebt und sie offener für meine Frage. »Miss Fell, bevor Sie gehen …« Der Hund zog an der Leine. »Eine Freundin meiner Mutter wohnt irgendwo hier in der Nähe, nur habe ich ihre Adresse nicht. Ihr Name ist Mrs. deVries.«
Miss Fell starrte mich an, unfähig, ihre Überraschung zu verbergen. Oder war es Schock? Sie kannte Mrs. deVries, dessen war ich mir sicher. Der Hund zerrte wieder. Miss Fell ließ sich eilig von ihm über die Straße ziehen und rief mir zu: »Bedaure! Nie von ihr gehört.«
Sie log. Aber warum? Dann kam mir ein seltsamer Gedanke. Dies war die Hausnummer 29 St. Clement’s Road. Mrs. deVries wohnte in der nicht vorhandenen Nummer 92. Ich zog meinen Rock enger an mich, damit er sich nicht in einer riesigen Distel verfing, und beschloss, einen Blick auf die Souterrainwohnung zu werfen, in der ich die Nacht verbringen sollte. Ich ging einen schmalen Pfad entlang und drei Stufen zu einer Tür hinunter. Auch hier hing ein Namensschild: Root – Uhrenreparateur.
Dies war der auffallend gut aussehende junge Mann, der zur Besetzung von Anna of the Five Towns gehörte. Indem sie ihn aus seinem schattigen Souterrain auf die Bühne holte, hatte Meriel der weiblichen Bevölkerung von Harrogate einen großen Gefallen getan. Ich ging an seiner Wohnungstür vorbei. Weiter hinten hatte Meriel ihren eigenen Eingang, aber kein Namensschild. Ich schaute durchs Fenster und sah einen schwach beleuchteten Kellerraum mit einem schmalen Bett und einer Chaiselongue. Miss Fell hatte recht. Meriel war bereits fort.
Als ich zurückging, bemerkte ich Dan Root. Er saß mit dem Rücken zu mir vor dem Kamin, wie ein Junge, der wartete, dass der Weihnachtsmann durch den Schornstein kam. Er war eine breitschultrige, einsame Gestalt in einem weißen Hemd, dunkler Hose und Weste.
Ich erinnerte ihn als außerordentlich charmant und sehr fotogen. Sein gutes Aussehen wäre auf einer Londoner Bühne oder in einem Lichtspieltheater durchaus passend, auch wenn die Helden dort ausnahmslos dunkelhaarig waren. Dieser Adonis war blond, aber mit einem honigfarbenen Teint und einem Lächeln, das Herzen zum Rasen brachte.
Auf einmal drehte er sich um, als hätte er meinen Blick gespürt. Wie peinlich, dabei ertappt zu werden, wie ich durch sein Fenster starrte! Er kam so zur Tür, wie er war, noch mit seiner Schürze um.
»Entschuldigen Sie mein Starren. Ich dachte, ich könnte Meriel entdecken. Wir hatten verabredet, uns in Valley Gardens zu treffen, aber ich wollte sie zu Hause erwischen, bevor sie geht.«
Wenigstens erinnerte er sich an mich. »Mrs. Shackleton, dann sind Sie nicht hier, um noch eine Fotografie zu machen?« Er zog eine Uhr aus seiner Westentasche. »Sie ist vor einer halben Stunde gegangen und sagte, dass sie vor der Aufführung noch mal zum Theater wolle.«
Die Goldkette an seiner Uhr fiel mir auf, doch er bewegte sich zu schnell, als dass ich sie richtig sehen konnte. Ich konnte ihn wohl kaum fragen: Ist das ein südafrikanischer Rand, und haben Sie diese Woche einen Pfandleiher ausgeraubt?
Er lächelte mich charmant an. »Tut mir leid. Ich würde Sie hereinbitten oder Ihnen anbieten, Sie zu begleiten, aber ich habe noch eine Menge Arbeit zu erledigen.«
»Ist schon gut.«
»Dann auf Wiedersehen«, sagte er recht abrupt.
»Auf Wiedersehen.«
Nun fühlte ich mich wie eine Idiotin. Gewiss rannten ihm immerfort irgendwelche Frauen die Tür ein. »Diese Uhr geht seit zehn Minuten um drei Stunden nach. Sicher können Sie sie für mich reparieren, schöner Mr. Root.«
Verärgert ob meines Mangels an Erfolg humpelte ich zurück in die Stadt und fand nach einigem Suchen Crispin’s Boot Company in der Cambridge Street. Widerwillig erstand ich ein Paar flache Schnürschuhe, auf die jede alte Dame stolz gewesen wäre. Die Verkäuferin, eine junge Frau etwa in meinem Alter, sah müde aus und schien froh, etwas verkauft zu haben. Als ich sie fragte, wo es zur Post ginge, begleitete sie mich zur Tür. »Sie sind praktisch da, Madame. Sie ist gleich um die Ecke dort.«
Sie hatte meine Schuhe eingepackt, und ich wanderte deutlich uneleganter zur Post.
Im Straßenverzeichnis fand sich keine Mrs. deVries in der St. Clement’s Road oder benachbarten Straßen. Ebenso wenig war sie im Verzeichnis der Telefoninhaber zu finden. Was mich nicht verwunderte. Nicht jeder leistete sich den Luxus eines Telefons, zumal wenn die wirtschaftlichen Umstände ihn oder sie dazu zwangen, kostbare Besitztümer zum Pfandleiher zu bringen.
Ich nahm ein Telegrammformular auf und entwarf meine Nachricht an Sykes. Kein Glück in St. Clement’s Road STOP Korrekte Adresse bestätigen.
Am Schalter bezahlte ich meine neun Wörter und gab Meriels Anschrift für die Antwort an.
Nahe Valley Gardens lief ich Meriel über den Weg. Sie begrüßte mich mit einer exaltierten Umarmung. Ihr großes ovales Gesicht und die ausdrucksvollen Augen strahlten vor Entzücken. Ich trug mein Haar zu einem Bob geschnitten. Ihres war lang, lose aufgesteckt und mit Kämmen fixiert. Ihr weiter Rock, die voluminöse Bluse und die bestickte lila Seidenweste sorgten für einen exotischen Zigeuner-Look.
Für den Moment ließ ich alle Gedanken an die Arbeit sausen, während wir den Weg entlang und vorbei an einem Orchester schlenderten, das einen Marsch spielte. Ein kleines Mädchen schlug Rad im Gras. Ein Kinderreifen rollte vor uns über den Weg. »Den nehmen wir als Glücksreifen«, sagte Meriel. »Wenigstens ist das Wetter besser geworden. Die Landwirtschaftsschau letzte Woche war ein Reinfall, und der Golfplatz wurde überschwemmt – etwas mit einem geplatzten Rohr.«
»Das dürfte enttäuschend für die Touristen gewesen sein.«
»Ach, die trinken einfach weiter das Heilwasser und baden. Und nichts davon hat meinem Stück geschadet. Hervorragende Kartenverkäufe.«
Wir erreichten ein Café und setzten uns. Meriel drehte ihr Gesicht zur Sonne, und der Kellner räumte ab, ehe er uns die Speisekarten gab. Sie schloss die Augen. »Dies erinnert mich an die herrlichen Tage, als meine Mutter in der Scala sang. Da war ich die Nachmittage über draußen, solange sie ausruhte.«
Dann blickte sie mich über ihre Karte hinweg an. »Du bist so schlank«, sagte sie vorwurfsvoll. »Du könntest jeden dieser köstlichen Eisbecher essen. Letzte Woche probierte ich Pistazie, und sie haben hier eine fantastische Auswahl an Kuchen und Eclairs.«
Das Orchester stimmte einen Wiener Walzer an. Noch bevor die Melodie verklungen war, hatte der Kellner unsere Bestellungen gebracht.
»Es ist reizend hier, Meriel.« Ich fühlte mich entspannt und froh, am Leben zu sein.
»Die Musiker sind ausgezeichnet. Harrogates Stadtväter glauben, Musik würde die Sorgen vertreiben und für eine heitere Gesinnung sorgen. Und ich fühle mich tatsächlich heiter. Sieh dir das an.« Sie hielt mir eine Zeitung vor die Nase. Es war also genau wie zu Hause, wo Mrs. Sugden die Geschichten von Torheit und Verbrechen verschlang. Aber dies hier war Harrogate. Und der Beitrag im Herald von Mittwoch war eine Namensliste – die Heilbadbesucher der Woche, geordnet nach den Hotels, in denen sie wohnten. Meriel zeigte auf einen Namen. »Siehst du! Da ist er.«
»Burrington Wheatley?«
»Ebender.« Sie blickte sich um, als wolle sie sich vergewissern, dass selbiger Mann nicht in Hörweite war. »Ein komischer Klops von einem Mann mit einem permanent rot glühenden Gesicht, schlohweißem Haar, weißem Schnauzbart und sehr buschigen schwarzen Augenbrauen. Du kannst ihn nicht verwechseln.« Während sie sprach, malte sie sich Schnauzbart und extreme Augenbrauen mit den Fingerspitzen ins Gesicht, um ihre Beschreibung zu illustrieren.
Mir kam ein Verdacht. »Warum soll ich ihn nicht verwechseln wollen?«
Der Kellner kam mit unseren Salaten. Meriel wartete. »Weil du, meine liebe Kate, mich heute Abend über den grünen Klee loben sollst, wenn du neben ihm sitzt. Er ist der berühmte Impresario aus Manchester.«
»Was tut ein Impresario?«
Sie sah mich an, als wäre ich sträflich unbedarft. »Er produziert natürlich Stücke, plant Gastspiele an den besten Adressen im ganzen Land. Falls ihm meine Arbeit gefällt … Nun, sagen wir, es könnte mein Durchbruch sein. Klatsche, bis dir die Hände wehtun. Ein Hurra oder zwei wären auch nicht verkehrt.«
Ich wurde skeptisch. »Mir war nicht bewusst, dass ich deine Bannerträgerin sein soll.«
Sie schloss die Augen, reckte den Hals und zog die Schultern nach hinten. »Mein Leben wird sich verändern. Das fühle ich in den Zehenspitzen.«
Beim Essen unterhielten wir uns über Neuigkeiten von unserer gemeinsamen Freundin, bei deren Kostümparty zu Silvester letzten Jahres wir uns kennengelernt hatten.
Meriel bestellte mehr Brot und ließ etwas davon, zusammen mit einer Tomate, verstohlen in ihrer Tasche verschwinden. »Harrogate hat mir Glück gebracht. Wer hätte gedacht, dass ich mitten in der Hochsaison mit einer Laienproduktion ins Opera House darf? Es ist zu schön, um wahr zu sein. Ich hatte versucht, in London einen Fuß in die Tür zu bekommen, aber da tat sich einfach nichts. Ich war die Assistentin der Assistentin der Gewandmeisterin. Jede Minute dort war eine Pein – und eine Vergeudung meines Talents.«
Ich lauschte ihren Ausführungen über Kostümschneiderei, bis uns der junge Kellner unsere Kuchen und das Eis brachte. Die Eiscreme schmolz bereits in der Nachmittagshitze.
Meriel fragte den Kellner nach seinem Namen und sagte dann: »Nun, Malcolm, können Sie mir sagen, was diese Woche im Opera House läuft?«
»Ja, es ist die Bühnenfassung eines Romans von Arnold Bennett, Madame. Anna of the Five Towns.«
»Was haben Sie darüber gehört?«, fragte sie.
Er wurde rot und blickte sich nach einem Fluchtweg um.
»Nun?«
»Bei dem Stück bin ich mir nicht sicher«, gestand er. »Aber mir wurde erzählt, dass das bestaussehende Mädchen von Harrogate darin mitspielt.«
»Danke. Das ist eine ausgezeichnete Empfehlung.« Seine Antwort schien sie zufriedenzustellen. »Es spielt keine Rolle, was sie sagen, Kate, solange sie reden.« Sie blätterte die Zeitung um. »Lies mal diese Kritik.«
Ich überflog den Artikel. Ihre Inszenierung hatte wirklich eine hymnische Besprechung bekommen.
Meriel tupfte sich einen Eisklecks vom Kinn. »Weißt du, warum ich diese Geschichte ausgesucht habe, Anna of the Five Towns?«
»Sie scheint eine schwierige Wahl. Ich selbst hätte wohl eher ein bekannteres Theaterstück gewählt.« Ich schnitt mit der Gabel in mein Eclair.
»Ich wählte das Stück aus, weil es Heuchelei, Gemeinheit, Unterdrückung und Tyrannei anprangert.« Sie schwenkte ihren Löffel, sodass etwas Eiscreme auf dem Hut der Dame am Nebentisch landete. Bedachte man den Schmelzgrad, war es ein beeindruckender Treffer. Als Meriel über das Stück sprach, lockte sie einiges an Aufmerksamkeit auf unseren Tisch.
Im Café war es voll, und auch wenn man die Gäste nicht direkt zur Eile trieb, wurde uns bedeutet, nicht allzu sehr zu trödeln. Der Kellner brachte die Rechnung. Meriel entriss sie mir. »Ich lade dich ein.«
Sie öffnete ihre geräumige Handtasche und begann zu suchen. »Oh nein, ich habe meine verfluchte Geldbörse im Theater vergessen. Wie ärgerlich!«
Ich nahm ihr die Rechnung ab.
»Aber, wie ich eben sagte, Kate, was Anna of the Five Towns angeht, haben wir da eine Heldin, die sich nicht wehren kann, weil sie immer unter Tyrannei gelebt hat und es ihr an der Sprache oder der Fähigkeit fehlt, für sich zu kämpfen oder zu sagen, was sie will. Und in Lucy Wolfendale habe ich die perfekte Anna.«
»Hast du jemanden gewählt, der ihr im Charakter ähnlich ist?«
»Um Himmels willen nein! Die beiden könnten nicht gegensätzlicher sein.«
Beim Theater ging ich direkt an die Abendkasse, während sich Meriel mit dem Pförtner unterhielt.
Die weißhaarige Frau mit der Brille reichte mir meine Karte für den Abend. Ich dankte ihr und fragte: »Wissen Sie, ob eine Mrs. deVries eine Karte reserviert hat? Ich bin ohne ihre Adresse aus Leeds hergekommen und habe gehofft, dass sie heute Abend hier sein wird.« Es war ein guter Versuch, aber vergebens.
Die Frau schüttelte den Kopf. »Halb Harrogate hat das Stück gesehen, aber der Name sagt mir nichts.« Sie runzelte die Stirn. »DeVries? Klingt belgisch. Die Belgier bleiben eher in ihrer Clique, wenn Sie mich fragen.«
Vier
Der letzte Vorhang von Anna of the Five Towns fiel. Die Besetzung hatte sich immer wieder zu tosendem Applaus verneigt.
Bravorufe hallten der jungen Hauptdarstellerin entgegen, als sie vortrat, an jeder Seite einen jungen Mann: den, der ihre Hand gewinnen konnte, und den, der tragisch ums Leben kam. Anna verneigte sich allein.
Mr. Burrington Wheatley, Meriels samtgewandeter Impresario, saß rechts von mir und applaudierte laut.
In der Pause waren er und ich von der ersten Reihe in eine der hinteren umgezogen, um einem abscheulichen Sitznachbarn zu entfliehen, der zu spät gekommen war, Zigarrenqualm nach oben zur Bühne blies und mir laufend Kommentare zuraunte, während er laut mit einer Tüte Pfefferminzbonbons knisterte.
Als der Applaus verklang, drängten Mr. Wheatley und ich aus dem Saal und blieben unten an der Treppe der Eingangshalle stehen, wo es zum ersten Rang und der Bar ging. Mr. Wheatley drehte sich zu mir. »Das Mädchen, das die Anna gespielt hat …«
»Lucy Wolfendale.« Ich erinnerte mich von den Aufnahmen an sie.
»Sie wird eine Schneise von gebrochenen Herzen und leeren Brieftaschen hinter sich zurücklassen, verlassen Sie sich darauf. Solch eine Schauspielerin gibt es in jeder Generation nur einmal. Sie ist ein Naturtalent.«
Hinter mir war ein Knurren zu vernehmen. Es kam von dem Pfefferminz schmatzenden Zigarrenraucher, vor dem wir hatten fliehen können. Recht erbost brummelte er: »Ein solch exquisites Geschöpf wie Miss Lucy Wolfendale sieht man nicht einmal in jeder Generation, sondern nur einmal im Leben.«
Mr. Wheatley zwinkerte mir amüsiert zu. »Ich bezog mich ausschließlich auf ihr schauspielerisches Können, Sir. Ich plane und leite Theaterproduktionen, die durch die Provinz reisen. Miss Wolfendale würde ich gleich morgen für mein Ensemble anwerben wollen.«
Der Zigarrenraucher rümpfte angewidert die Nase und blieb uns auf den Fersen, als wir die breite Treppe hinaufgingen. »Miss Wolfendale wird für niemanden auf die Bühne gehen. Ihre Zukunft ist hier.«
Mr. Wheatley zog eine Augenbraue hoch. »Sind Sie ihr Vater?«
»Ihr Vater?« Der Zigarrenraucher blieb abrupt stehen. Für einen Moment dachte ich, er würde Mr. Wheatley schlagen. Er biss auf seine Zigarre und sagte frostig aus dem Mundwinkel: »Ich bin Lawrence Milner, ein enger Freund der Familie. Miss Wolfendale ist ein ehrbares Mädchen. Ein wenig Laientheater mit Freunden mag hinnehmbar sein. Doch das professionelle Theater kommt nicht infrage.«
Um die Stimmung aufzulockern, warf ich ein: »Die jungen Männer waren ebenfalls sehr gut.«
»Einer von ihnen ist mein Sohn Rodney«, sagte Lawrence Milner. »Und er wird keine Zeit mehr für solche Dinge haben.«
Das hatte er bereits während der Aufführung angemerkt, und die Ähnlichkeit war nicht zu leugnen. Der junge Milner und der alte hatten das gleiche rotblonde Haar.
Ich beschloss, ihn zu ignorieren. »Fanden Sie nicht auch, Mr. Wheatley, dass Dylan Ashton den Willie hervorragend gespielt hat? Er schien wirklich sehr verliebt in Anna.«
»Das war nicht gespielt«, murmelte Mr. Wheatley freundlich.
Mr. Milner schob sich an uns vorbei und drängelte sich zur Bar durch.
Mr. Wheatley nahm meinen Arm. »Miss Jamiesons Talent als Regisseurin besteht darin zu wissen, was zu schneiden und was zu spielen ist.«
»Oh, und was hat sie herausgeschnitten?«
Meriel und ich verließen das Theater als Letzte. Sie musste sich vergewissern, dass nichts in den Garderoben zurückgelassen wurde. Dann dankte sie dem Pförtner überschwänglich, als wir ihm zum Bühneneingang folgten, und beteuerte, dass sie seine Freundlichkeit nie vergessen würde.
»Ein Trinkgeld wäre angebracht«, flüsterte sie mir zu. »Bei all dem Kram in dieser Tasche kann ich meine Geldbörse nicht finden.«
In dem Augenblick, in dem wir aus dem Theater und in die kleine Seitengasse traten, verwandelten sich die dicken warmen Regentropfen in einen beachtlichen Sommerguss. Ich eilte zum nächsten Hauseingang und wühlte in meiner sehr vollen Tasche. »Irgendwo hier habe ich einen Regenschirm.«
Meriel zog sich ihre Kapuze über. »Den müsstest du mich halten lassen. Ich bin größer.«
Meine Ferse berührte etwas. Ich blickte nach unten und trat mit einem erschrockenen Laut einen Schritt zurück, weil ich fürchtete, versehentlich auf einen schlafenden Landstreicher getreten zu sein.
»Ist er betrunken?« Meriel nahm mir den Regenschirm ab und öffnete ihn schwungvoll.
Ich bückte mich und berührte die warme Wange des Mannes. Er hatte seinen Hut verloren. Schütteres rotblondes Haar fiel ihm in die Stirn. Sein Jackett war offen, und ein Knopf fehlte. Später wunderte ich mich, dass ich auf solch kleine Details achten konnte. Vielleicht sträubte sich etwas in mir, zum Heft des Dolchs zu sehen, das aus seiner Brust ragte. Im Schein der Gaslaterne bemerkte ich einen blutigen Streifen auf dem gestärkten weißen Hemd.
Ich schaute entsetzt hin und fragte mich, ob es ein geschmackloser Schmerz mit einem harmlosen Theaterdolch sein könnte. Ob der Mann gleich aufspringen und loslachen würde. Was er nicht tat. Im schwachen Licht wurden die Gesichtszüge klarer. Das vorgeschobene Kinn, die breite Nase. Es war ein ansehnliches Gesicht, erstarrt in einem Ausdruck wütender Überraschung, als hätten seine Lippen nicht erwartet, so bald ihrer Zigarre beraubt zu werden.
»Das ist dieser Mann … der neben mir saß. Er ist tot.«
Meriel kreischte. »Nicht mein Mr. Wheatley!«
Ich drückte ihr meine Tasche in die Arme und fühlte am Hals des Mannes nach einem Puls, obwohl ich wusste, dass es sinnlos war.
Meriel wich zurück und sagte ängstlich: »Das ist Lawrence Milner.« Ich richtete mich wieder auf, und als ich mich zu ihr drehte, sah ich das Entsetzen in ihren Augen. »Das ist sein Automobil, gleich da auf der Straße.« Hastig eilte sie hin, als könnte das, was wir in dem Hauseingang sahen, eine Täuschung sein und der wahre Mr. Milner lebendig hinterm Steuer sitzen.
»Jemand hat die Reifen aufgeschlitzt!«, rief sie.
Das dürfte Mr. Milner nicht mehr kümmern.
Ich wartete, dass sie wieder zurückkam. »Furchtbar, furchtbar«, war alles, was sie über die Lippen brachte. Der Tote lag hinter mir, und Meriel versperrte mir den Weg. Ich fühlte mich wie gelähmt.
Eine von uns musste etwas tun. Meriel schien wie von Sinnen.
»Bleib hier, Meriel. Ich sage dem Pförtner, dass er die Polizei rufen soll.«
Hierauf wandte sie sich um, rannte zurück zum Bühneneingang und rief: »Ich sage es ihm.«
Sie hatte meinen Schirm mitgenommen, sodass ich vor der Wahl stand, entweder mit dem Rücken zum Fenster im Regenguss stehen zu bleiben oder mich zu dem Toten in den Hauseingang zu stellen. Ich entschied mich für den Regen.
Fünf
Lucy Wolfendale hatte in der Rolle der Anna Tellwright brilliert. Der Applaus gab ihr das Gefühl zu schweben. Sie fühlte, wie ihr Geist, befeuert vom Klatschen, das gesamte Theater einnahm und jeden erreichte. Anschließend wollte sie Champagner trinken und in einem prächtigen Ballsaal tanzen. Stattdessen musste sie sich mit einem Glas Sherry an der Theaterbar zufriedengeben, wobei sie die widerlichen Annäherungsversuche von Rodney Milners ekligem alten Bock von Vater abwimmelte. Igitt.
Wären ihre guten Freunde nicht gewesen, es hätte sie rasend gemacht.
Nun war es kurz vor Mitternacht, und sie saß auf dem Gepäckträger eines Fahrrads. Regentropfen fielen ihr in den Nacken und rannen ihren Rücken hinab.
»Ich hätte nicht gedacht, dass es bei meinem großen Abenteuer wie aus Eimern gießen würde.« Lucy lehnte sich an Dylans Rücken. »Ich kann es nicht leiden, bei Regen auf dem Fahrrad zu sein.«
Dylan antwortete nicht gleich. Er trat kräftig in die Pedale und hetzte über die unebene Straße, als wäre der Teufel hinter ihnen her.
An der Abbiegung zur Stonehook Road verlangsamte er. »Es wird nicht aufhören. Willst du umkehren?«
»Nein!«
Schweigend fuhren sie weiter die sich schlängelnde Straße entlang. Der Regen hörte so plötzlich auf, wie er begonnen hatte. Schließlich ragte der Turm in dem dunklen Feld auf, vom Mond beschienen. Ihn bei Nacht zu sehen erschreckte Lucy. Er wirkte so anders. Bedrohlich.
Dylan wurde erneut langsamer und brachte das Fahrrad am Straßenrand zum Stehen.
Lucy stieg ab und schüttelte Regentropfen von ihrer Kleidung. Sie hüpfte von einem Fuß auf den anderen. »Nur einen … Lass mich …« Sie stützte sich auf seine Schulter und schüttelte ihr Bein. »Oh, oh, oh! Das kribbelt!«
Ihr Rocksaum war durchnässt vom Wasser, das der Reifen hochgespritzt hatte.
Dylan lehnte das Rad an die Weißdornhecke. Er zog die Lampe vom Lenker. »Noch kannst du es dir anders überlegen.«
»Sei nicht solch ein Baby.« Sie nahm ihm die Lampe ab und begann, nach einer Lücke in der Hecke zu suchen. »Mein Entschluss steht fest.«
Er folgte ihr, wollte sie zurückhalten. »Musst du denn? Warum kannst du nicht morgen früh zu Hause sein, wenn die Post kommt? Die Nachricht abfangen, ehe dein Großvater sie sieht?«
»Dylan! Dann wäre ich erbärmlich.« Sie riss sich von ihm los. Sollte er ruhig feige sein, wenn er wollte. Das passende Aussehen dafür hatte er bereits. Er war nur wenig größer als sie, hager und hatte immer noch etwas Kindliches. »Ich finde die Lücke nicht!«, rief sie. »Wir müssen über die Pforte klettern.« Mit der Lampe in einer Hand, stellte sie einen Fuß auf die zweite Querstrebe der Pforte. »Jetzt mach dich mal nützlich! Du hast gesagt, dass du mir hilfst.«
»Das war an einem sonnigen Tag«, entgegnete er hilflos. »Da schien es eine gute Idee.«
Sie war auf der einen Seite der Pforte, er auf der anderen und rührte sich nicht. Sie legte ihre Hand auf seine. »Ich muss das tun. Ich will nur, was mir gehört.«
Es war an jenem Sonntagnachmittag im Juni gewesen, als sie zusammen Text gelernt hatten. Sie hatte ihn zum Schweigen verpflichtet. Als sie ihm erzählte, dass sie Schauspielerin werden wolle und sich bei der Royal Academy of Dramatic Art beworben hatte, wagte sie kaum zu hoffen, dass etwas dabei herauskommen würde. Als man ihr ein Vorsprechen anbot, fürchtete sie, ihr würde kein glaubwürdiger Vorwand für ihre zweitägige Abwesenheit einfallen oder sie bekäme das Fahrgeld nach London nicht zusammen. Ihr Großvater war ein solcher Geizkragen wie der Geizhals in dem Stück. Doch Lucy wäre nicht Lucy, hätte sie das Geld nicht aufgetrieben. Und sie wäre ebenso wenig Lucy, hätte man ihr nicht einen Platz an der RADA angeboten, den sie auch anzunehmen beabsichtigte.
An ihrem einundzwanzigsten Geburtstag hatte sie ihren Großvater auf den Kopf zu nach dem Erbe gefragt, von dem sie wusste, dass es ihres war. Er verweigerte es.
Die Idee mit dem Erpresserbrief hatte Lucy aus einem von Miss Fells Büchereiromanen. Eintausend Pfund würden für die Gebühren an der RADA und eine Unterkunft in London ausreichen.
Nun war sie in dieser nassen Augustnacht hier, kämpfte für ihren Traum und hatte nur Dylan als Hilfe. Der erwies sich leider als Waschlappen, als ein feiger Hasenfuß.
»Was ist, wenn dein Großvater dahinterkommt, dass du den Brief geschickt hast?«
»Na, soll er ruhig. Dann weiß er, dass ich es ernst meine.« Sie begann, über das Feld zu stapfen.
Dylan kletterte hinter ihr her und lief, um sie einzuholen. »Er wird die Polizei rufen.«
Sie drehte sich um. Der Mond leuchtete ihnen den Weg. Lucy sah, dass Dylan auf den Boden blickte, damit er möglichst keine Butterblumen und Gänseblümchen zertrat. »Mein Großvater wird die Polizei nicht rufen. Er wird bezahlen, weil er Angst hat.«
»Wovor?«, fragte Dylan.
Sie waren sich so nahe, dass Lucy sie zwei auf einmal als ein Paar begossener Vogelscheuchen in einem Feld vor sich sah. Sie würden zusammenhalten gegen alle Raubvögel der Welt. Allerdings müsste sie das Beschützen übernehmen. Dylan besaß keinen Funken Courage oder Tatendrang.
»Ich weiß nicht genau, wovor er Angst hat. Einem Skandal, vermute ich.«
Schon als kleines Mädchen hatte sie gespürt, dass ihr Großvater keine Aufmerksamkeit auf sich lenken wollte. Ihre flachen Absätze sanken in dem weichen Boden ein. Feuchte Grashalme kitzelten ihre Knöchel durch die Strümpfe.
Lucy leuchtete auf das Schloss an der alten Eichentür. Dylan steckte den schweren Eisenschlüssel hinein und drehte ihn. Mit einem lauten Knarzen öffnete sich die Tür. Sie standen erstarrt da. Lucy fröstelte. »Hier drinnen ist es stockfinster.«
»Das sage ich doch. Es wird dir nicht gefallen. Und nachts ist es unheimlich …«
Sie ging hinein. Der Lampenstrahl brachte rissige Dielenbretter zum Vorschein, darunter nichts als düstere Leere. »Halt! Die Dielen geben nach. Unter denen geht es über drei Meter ins Nichts«, warnte Dylan.
Sie zupfte an seinem Ärmel. »Dann gehen wir die Treppe hinauf. Schau nicht nach unten.«
Dylan schnupperte. »Dieser Gestank! Unten müssen sie irgendwas Verrottendes gelagert haben. Deshalb sind die Dielen auch morsch.«
Eine gerade Treppe mit zwei fehlenden Stufen führte ins obere Stockwerk.
»Vorsichtig, Lucy!«
»Stell dich nicht so an.«
Ein Stabwerkfenster, dessen Glas gesprungen war, ließ ein klein wenig Mondlicht herein.
Als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah Lucy, dass alles an seinem Platz war, genau wie sie es hinterlassen hatte: Decken, eine Wasserflasche, eine Keksdose mit Essen, Kerzen und Streichhölzer. Sie zündete eine Kerze an.
Dylan rang erschrocken nach Luft. »Hier brennt alles wie Zunder. Hätte ich doch nur nie …«
»Alles in Ordnung.« Sie entzündete eine zweite Kerze, ließ etwas Wachs auf den Boden tropfen und fixierte sie darauf.
»Es ist Irrsinn«, jammerte Dylan.
»Manchmal ist Irrsinn das Beste. Und du wirst das nicht mehr sagen, wenn alles vorbei ist. Ich verlange nur, was mir zusteht. Eintausend Pfund mögen viel klingen – aber mein Gott, wenn eine fiktive Figur wie Anna Tellwright in dem Stück zu fünfzigtausend Pfund kommen kann … Und es wird auch etwas für dich abfallen, weil du mir hilfst.«
»Ich will kein Geld.«
»Es wird nichts Schlimmes passieren. Und überhaupt kann ich ja jederzeit raus, also hör auf, dir Sorgen zu machen.« Sie streckte ihm die Hand hin. »Lass uns den Mond ansehen. Lass uns die Sterne zählen. Lass uns auf dem Wehrgang tanzen. Heißt der nicht so?« Sie ging voraus zu einer schmalen Wendeltreppe. »Komm mit nach oben. Ich habe einen Kompass dabei und kann dir sagen, wo was ist.«
Widerstrebend folgte er ihr. »Ich weiß, wo was ist, und mir ist nicht nach Tanzen.«
»Siehst du, diese Treppe ist recht stabil.«
Sie erreichten die Turmspitze.
»Ist das nicht herrlich?« Sie breitete die Arme weit aus. »Man kann meilenweit sehen.«
Der Mond beschien die umliegenden Wiesen. Sterne wetteiferten funkelnd um Aufmerksamkeit. Auf einem fernen Feld war Heu gemacht worden, und der Duft hing noch in der Luft. Dylan sagte: »Wer diesen Turm gebaut hat, kam hier rauf, um die Sterne anzusehen.«
»Oder mit seiner wahren Liebe zu tanzen.« Sie streckte die Arme aus und begann zu singen: »If you were the only boy in the world, and I were the only girl, nothing else would matter in the world today…Komm schon! Tanz mit mir!«
»Ich träume«, sagte er, trat vor und legte einen Arm um ihre Taille, den anderen an ihre Schulter. »Ich werde bald aufwachen.«
»Träum ruhig weiter, aber sing.«
»If you were the only girl in the world…«
Sie tanzten um die Turmspitze herum.
»Wenn ich erst Schauspielerin bin, musst du an jeden Bühneneingang der Welt kommen und nach mir fragen. Ich werde meinen Freund in der Not nie vergessen, Dylan. Mir ist, als würde ich dich lieben, so wie Anna Willie liebte. Wahrhaft und für immer.«
»Dann …«
»Schhh.« Sie legte einen Finger an seine Lippen. »Ich werde mich immer an dich erinnern, ganz gleich, wohin mich das Leben führt.« Sie lachte. »Wir haben den alten Milner schön abgeschüttelt. Er wollte mich unbedingt fahren …«
»Das war nicht alles, was er wollte«, fiel Dylan ihr ins Wort.
»Und dein Gesicht!«
»Rede nicht von ihm.«
»Er ist abscheulich. Wäre ich ein Mann und Charakterdarsteller, würde ich ihn studieren. Aber so …« Sie imitierte ein Würgegeräusch. »Kannst du dir vorstellen, dass er und mein Großvater tatsächlich dachten, ich würde ihn heiraten?«
»Ja, kann ich mir vorstellen.«
»In welchem Jahrhundert, in welchem Land glauben sie zu leben?«
»Niemand kann dich zur Heirat zwingen. Man darf ebenso sehr ›Ich will nicht‹ sagen, wie man ›Ich will‹ sagen darf. Jedenfalls denk nicht mehr daran. Das beschert dir nur Albträume.«
»Du solltest jetzt gehen, Dylan.«
»Lass mich hierbleiben und auf dich aufpassen. Ich kann dich bewachen, während du schläfst.«
»Du hast schon genug getan. Und du musst morgen ausgeschlafen und frisch für die Arbeit sein. Die Mädchen werden in Scharen zum Fenster von Croker & Company kommen, um einen Blick auf dich zu erhaschen.«
»Das bezweifle ich.« Dennoch klappte er seinen Kragen hoch.
Sie ging hinter ihm her die Treppe hinunter.
Er wollte die Fahrradlampe nicht zurücknehmen. »Der Mond wird sich gleich wieder blicken lassen. Gute Nacht, Lucy.«
»Gute Nacht.« Sie drehte den Schlüssel im Schloss, stieg zurück die Treppen hinauf und beobachtete ihn, als er die Wiese überquerte. An der Pforte schaute er sich um und winkte.
Für einen Augenblick dachte sie, er würde kehrtmachen und zu ihr zurückeilen.
Gestern hatte Lucy die Unterlegplane und die khakifarbenen Decken aus der Army-Zeit ihres Großvaters stibitzt. Sie hatte sich ein Fahrrad geliehen und alles, was sie brauchte, zum Turm gebracht. Als Schlafplatz wählte sie eine Stelle an der Wand im Geschoss unter dem Wehrgang. Ihre Umhängetasche aus dickem Webstoff diente ihr als Kissen.
Es war ein großes Wagnis, dessen war sie sich bewusst. Was wäre, wenn ihr Großvater den Erpresserbrief öffnete, einen lebenslangen Grundsatz verwarf und zur Polizei ging? Nun, die würden sie nicht finden. Das würde keiner. Dieser Ort war seit Jahren verlassen.
Natürlich war morgen Samstag, und er könnte nicht zur Bank gehen. Aber das hatte sie bedacht. Sollte er ruhig schwitzen. Sollte er den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag vor Grübeln vergehen. Sollte er den Verstand verlieren. Er würde gleich am Montagmorgen an die Banktür klopfen.
Sie runzelte die Stirn. Fraglos bestand die Möglichkeit, dass er ihr Erbe wirklich nicht hatte, dass er es verspielt hatte oder ausgegeben, dass er sie über Jahre an der Nase herumgeführt hatte, als er sagte, in der fernen Zukunft würde sie Beträchtliches erwarten. Doch die ferne Zukunft war mit Anbruch des 6. Augusts dieses Jahres da gewesen, mit ihrem einundzwanzigsten Geburtstag.
In dem Fall sollte er lieber wissen, wie er zu etwas Geld kam, denn sie wollte es haben. Sie wollte ihr Leben leben, fernab von ihm und seinen Waffen, Uniformen, Medaillen und uraltem Unsinn.