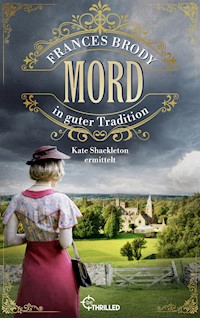
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kate-Shackleton-Krimis
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der Banker Everett Runcie wird tot in einem Hotelzimmer in Leeds aufgefunden. Wurde er ermordet? Runcies Witwe beauftragt Kate Shackleton herauszufinden, wie ihr Mann ums Leben gekommen ist. Ihr Freund, Chief Inspector Marcus Charles, der den Fall für Scotland Yard untersucht, ist darüber nicht sonderlich erfreut. Zumal sich der Mord rasch zu Kates bisher kompliziertesten - und persönlichsten - Fall entwickelt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Über dieses Buch
Der Banker Everett Runcie wird tot in einem Hotelzimmer in Leeds aufgefunden. Wurde er ermordet? Runcies Witwe beauftragt Kate Shackleton herauszufinden, wie ihr Mann ums Leben gekommen ist. Ihr Freund, Chief Inspector Marcus Charles, der den Fall für Scotland Yard untersucht, ist darüber nicht sonderlich erfreut. Zumal sich der Mord rasch zu Kates bisher kompliziertesten – und persönlichsten – Fall entwickelt …
FRANCES BRODY
Mord in guter Tradition
Kate Shackleton ermittelt
Aus dem Englischen von Sabine Schilasky
»Die meisten Männer waren höflich genug, die Farce eines Ehebruches mit einer ›Unbekannten‹ zu durchlaufen und ihren Frauen so einen Scheidungsgrund zu geben.«
THE LONG WEEKEND, ROBERT GRAVES UND ALAN HODGE
Prolog
THE TIMES
Montag, 3. September 1923
Mr. Everett Roderick Runcie verstarb im Alter von siebenundvierzig Jahren. Mr. Runcie, der jüngere Bruder des dritten Barons Kirkley und einer der Direktoren der Kirkley Bank, war zu Beginn der Moorhuhn-Jagdsaison nach Yorkshire zurückgekehrt.
Der bekannte, gesellige Mr. Runcie wurde letzten Mittwoch beim Ebor-Handicap-Pferderennen in der Öffentlichkeit gesehen, schien bei bester Gesundheit und guter Dinge zu sein, obwohl er keine Gewinne verzeichnen konnte.
Charismatisch und dynamisch, wie Mr. Runcie war, kannte man ihn als Förderer der Künste und jemanden, der sich nicht vor abenteuerlichen Unternehmungen fürchtete. Kürzlich äußerte er sich unter gewissen Investoren voller Begeisterung über die Big-G-Mine in Tasmanien und die Bechuanaland Peanut Farm Company.
Mr. Runcie war seit 1918 mit Miss Philippa Emerson verheiratet, der Tochter eines amerikanischen Kaufhaus- Magnaten, mit der er abwechselnd am Cavendish Square in London und in Kirkley Hall in Yorkshire residierte.
Der Coroner hat eine Untersuchung des Todesfalles angeordnet.
Eins
Zehn Tage zuvor
Mein Name ist Kate Shackleton. Ich bin Privatdetektivin, wozu ich eher zufällig kam, als ich herauszufinden versuchte, was mit meinem Ehemann Gerald geschehen war, der zuletzt gegen Ende des Großen Krieges gesehen wurde. Ich erhielt das übliche Telegramm: vermisst, wahrscheinlich tot. Ein Teil von mir hoffte weiterhin, dass er noch am Leben sein könnte. Nach fünf Jahren verblasst die Hoffnung, doch gelegentlich befeuert sie eine seltsame Geschichte in der Zeitung oder ein Gerücht von einem Überlebenden aufs Neue.
Um halb sieben an einem Augustabend probierte ich ein neues Stück auf dem Klavier und entschied, dass es Zeit war, den Klavierstimmer zu bestellen, als ich ein vertrautes Klopfen an der Hintertür hörte. Ich klappte den Klavierdeckel zu. Mein Assistent, ein ehemaliger Polizist, stapft in seinen Schuhen Größe vierundvierzig gewöhnlich nicht zur Hintertür; er ist ein klassischer Haustür-Mensch.
Auf dem Weg durch den Flur fragte ich mich, was ihn um diese Zeit herführte, wenn er eigentlich zu Hause bei seiner Frau Rosie und den Kindern sein sollte.
Mr. Sykes drückte die Nase ans Küchenfenster. Ich öffnete die Tür und trat zur Seite, um ihn hereinzulassen.
Er lüpfte seinen Filzhut. »Verzeihen Sie den unangekündigten Besuch, Mrs. Shackleton. Ich hatte mich gerade zu meinem Tee gesetzt, als jemand sehr aufgeregt bei mir erschien und um unsere Hilfe bat. Ich habe ihm gesagt, dass ich nichts versprechen kann, ehe ich mit Ihnen geredet habe.«
»Um wen geht es?«
»Mr. Cyril Fitzpatrick.« Er sprach den Namen bedeutungsschwanger in seinem Das-könnte-heikel-werden-Tonfall aus.
»Und was haben Sie mit Mr. Fitzpatrick angestellt?«
»Er sitzt vorn auf Ihrer Gartenmauer. Ich habe ihm gesagt, dass er warten soll, solange ich mich mit Ihnen unterhalte.«
»Was möchte Mr. Fitzpatrick?« Ich ging voraus ins Esszimmer, das gleichzeitig mein Büro war.
»Er sorgt sich wegen seiner Frau – was sie hinter seinem Rücken treiben könnte.« Sykes legte den Hut auf die Remington-Schreibmaschine. »Ich fühle mich verantwortlich, sollte Mrs. Fitzpatrick von der rechten Bahn abgekommen sein. Erinnern Sie sich, wie wir ihr letztes Jahr aus der Bredouille geholfen hatten?«
Mir gefiel sein majestätisches »Wir«. Sykes war als Ladendetektiv im Dienst bei Marshalls gewesen, als er gesehen hatte, wie Mrs. Fitzpatrick eine Parfümflasche in ihrer Tasche verschwinden ließ. Daraufhin hatte er sie zur Rede gestellt. Sie brach in Tränen aus, und er brachte die verzweifelte Dame ins Büro der Geschäftsleitung. Dort erklärte sie, dass sie erst am Tag zuvor den Arzt zu ihrer Mutter gerufen und erfahren hatte, dass keine Hoffnung mehr bestünde. Aus dem in Seidenpapier gewickelten und bezahlten Flanellstoff sollte ein Nachthemd für ihre Mutter genäht werden. Und Mrs. Fitzpatrick war so von der schlimmen Nachricht betroffen gewesen, dass sie das teure Parfüm vollkommen gedankenlos eingesteckt hatte.
Sykes war sicher gewesen, dass sie die Wahrheit sagte, und ich vermutete, dass sie jung und gut aussehend sein musste.
»Lassen Sie mich raten: Mr. Fitzpatrick hegt den Verdacht, dass seine Frau wieder Ladendiebstahl begeht?«
Sykes seufzte. »Er behauptet, dass sie etwas im Schilde führt, und er nicht weiß, was es ist. Er sagt, er sei mit seinem Latein am Ende.«
»Kämen alle Ehemänner und Ehefrauen zu uns, die mit ihrem Latein am Ende sind, reichte die Schlange bis nach Woodhouse Moor.«
»Mag sein, aber falls sie wieder stiehlt, wird es meinem Ruf nicht guttun, sollte ich sie noch einmal laufen lassen.«
»Setzen Sie sich. Ich lasse Mr. Fitzpatrick herein.« An der Esszimmertür drehte ich mich um. »Gibt es etwas, das ich wissen müsste, bevor wir mit ihm sprechen?«
Sykes schüttelte den Kopf. »Er wird ausreichend für sich selbst sprechen.«
Mein Assistent hatte sowohl Mr. als auch Mrs. Fitzpatrick kennengelernt. Ich kannte bisher keinen von beiden.
Als ich den Mann ansah, der nun keinen Meter von meinen Eingangsstufen entfernt stand und mich erwartungsvoll ansah, überkam mich ein leichtes Unbehagen, und ich wünschte, er wäre zu jemand anders gegangen. Er betrachtete mich mit traurigen braunen Augen, nahm seinen braunen Filzhut ab, unter dem dichtes, grau meliertes braunes Haar zum Vorschein kam, das vor Haaröl glänzte und streng aus der Stirn gekämmt war. Am Revers seines braunen Nadelstreifenanzugs trug er einen Sacred-Heart-Anstecker und hatte trotz des warmen Augustabends einen braunen Mantel über dem Arm. Seine braunen Schuhe schimmerten von Spucke und Politur. Mir kam umgehend das Bild einer verwundeten Robbe in den Sinn, die am Strand angespült wurde und ihren Glanz verlor.
»Mr. Fitzpatrick? Treten Sie bitte ein. Ich bin Mrs. Shackleton.«
Sein feuchter Händedruck ließ mich erneut an einen Seehund denken.
Sykes hatte aus dem Esszimmerfenster geschaut und drehte sich um, als wir hereinkamen.
Ich setzte mich an das Tischende mit dem Rücken zum Fenster, sodass ich die wärmenden letzten Sonnenstrahlen an meinem Kopf und im Nacken spürte. Lichtstreifen tanzten über den Tisch. Fitzpatrick nahm rechts von mir und Sykes gegenüber Platz.
»Es geht um meine Frau«, begann Mr. Fitzpatrick ungefragt. »Wie ich Mr. Sykes schon erklärt habe, verschwindet Deirdre tagelang. Ich bin halb verrückt vor Sorge und möchte wissen, was sie im Schilde führt.«
Ich stöhnte innerlich. Dies war genau die Art Anfrage, die ich befürchtet hatte. »Wie Ihnen Mr. Sykes vielleicht schon erklärt hat, übernehmen wir keine Ehestreitigkeiten.«
»Hier geht es nicht um Ehestreitigkeiten, Mrs. Shackleton. Wir haben keine Probleme. Ich möchte nur wissen, wohin sie geht, was sie tut.« Er warf Sykes einen flehenden Blick zu. »Sie könnte wieder in alte Gewohnheiten verfallen, und sollte sie abermals ertappt werden, wird sie nicht so leicht davonkommen. Es würde Gefängnis, Scham und Schande bedeuten.«
Sykes hätte den Mund kaum fester zusammenkneifen können, hätte er eine Flasche Leim entkorkt und den Inhalt geschluckt, doch seine Besorgnis war offensichtlich.
»Könnten Sie genauer sagen, womit Sie Ihre Sorge begründen, Mr. Fitzpatrick?« Beinahe hätte ich »Verdacht« gesagt, doch ich wählte meine Worte vorsichtig, um seine Ängste nicht zu verstärken.
Er legte die großen Hände flach auf den Tisch. »Manchmal frage ich mich, ob jemand anders etwas gegen sie in der Hand hat, sie zwingt, Dinge zu tun, die sie von sich aus nicht tun würde, oder ihr Geld abpresst.«
»Es hört sich an, als glaubten Sie, dass irgendeine Nötigung im Spiel ist oder Ihre Frau erpresst wird. Haben Sie Anlass zu der Befürchtung?«
»Ich weiß selbst nicht, wie ich auf Erpressung gekommen bin, sondern nur, dass Deirdre irgendetwas treibt. Das fühle ich ganz deutlich in den Knochen.«
Ich widerstand dem Impuls zu fragen, in welchen Knochen – den Kniescheiben, den Musikknochen, dem Schädel? Stattdessen nickte ich aufmunternd. »Wie lange sind Sie schon verheiratet?«
Aufgepasst, Kate!, ermahnte ich mich. Als Nächstes würde ich empfehlen, dass sie sich aussprachen und ein Wochenende nach Blackpool reisten, nur sie zwei, solange das Wetter noch gut war.
»Seit sechs Jahren. Wir haben 1917 in St. Anne’s geheiratet.« Er holte eine Hochzeitsfotografie aus einer Innentasche und schob sie mir über den Tisch zu.
Das Bild war einem Rahmen entnommen worden. Die Braut sah glücklich und zuversichtlich aus. Sie war zierlich mit welligem Haar, hohen Wangenknochen und einem ansteckenden Lächeln. Der Bräutigam sah aus, als hätte er auf das falsche Pferd gesetzt und seinen Lohn verloren. »Wie alt war Ihre Frau bei der Hochzeit?«
»Achtzehn.« Er rutschte unsicher auf dem Stuhl hin und her. »Ich werde bald fünfundvierzig. Sie hat schon vierundzwanzig Sommer verlebt, sieht aber aus wie der Frühling. Warum sollte sie auch nicht? Ich ermögliche ihr ein unbeschwertes Leben. Sie arbeitet nicht, und wir haben keine Kinder.« Seine Unterlippe bebte. »Und jetzt ist sie immerfort aus dem Haus.«
Fitzpatrick schien ein freundlicher Mann zu sein, und sein Unbehagen war beinahe mit Händen zu greifen. »Haben Sie Ihre Frau gefragt, wohin sie geht?«
Er runzelte die Stirn. »Sie erzählt mir Lügen. Und was soll ich tun, außer sie im Haus einschließen? Ich muss arbeiten. Einmal habe ich versucht, die Tür zu verriegeln, nachdem wir uns gestritten hatten, aber da ist sie aus dem Fenster geklettert. Und es gibt immer eine plausible Geschichte. Ihre Mutter ist krank. Ihre Tante im Kloster hat sie für einige Tage eingeladen. Ein anderer Mann würde sie schlagen, aber sie ist so …« Er blickte zu Sykes. »Sie wissen, wie außergewöhnlich sie ist. Niemals könnte ich die Hand gegen sie erheben.«
Er klang, als hätten wir ihm genau das geraten. »Vielleicht sagt sie die Wahrheit«, entgegnete ich.
»Oh, zum Teil sagt sie immer die Wahrheit. Seit sie letztes Jahr erfuhr, dass ihre Mutter nicht mehr lange zu leben hat, ist sie dauernd bei ihr, in ihrem Elternhaus in The Bank, und Sie wissen ja, was für eine Gegend das ist.«
Ich kannte The Bank nur vom Hörensagen. Es handelte sich um das Armenviertel der Stadt zwischen der Eisenbahnlinie und dem Fluss. Es hieß, dass sich die Polizei nur selten dorthin verirrte.
Von der Sonne auf meinem Hinterkopf wurde mir ein wenig schwindlig, und ich verrückte meinen Stuhl.
Fitzpatrick seufzte. »Ich bin Schriftsetzer bei der hiesigen Zeitung. Als ich heiratete, verdiente ich vier Pfund und einen Shilling die Woche. Seitdem gab es nichts als Gehaltskürzungen, und jetzt bekomme ich nur noch drei Pfund, acht Shilling und sechs Pence.«
Sykes zog eine Augenbraue hoch. Das war immer noch ein guter Lohn, bedachte man die schlechten Zeiten.
Fitzpatrick trommelte mit den Fingern auf dem Tisch. »Ich habe eine Lohnkürzung von zwölf Shilling und six Pence gehabt, aber habe ich ihr Haushaltsgeld gekürzt? Nein, habe ich nicht. Ich habe sie aus der Armut geholt, und jetzt will sie mehr, als ich mir leisten kann. Gibt sie jemandem Geld?« Er beugte sich vor und ballte die Hände zu Fäusten. »Als ich ihr eine Guinea verweigert habe, hat sie gesagt, es sei egal, denn sie würde sie woanders herbekommen. Da habe ich mich gefragt, ob sie stiehlt.«
Ich hatte den Eindruck, dass er den möglichen Ladendiebstahl lediglich betonte, weil er wusste, dass er Sykes am meisten verstörte.
Er hüstelte und sagte entschuldigend: »Verzeihung. Schwache Brust.«
Als er sich erholt hatte, fragte ich: »Was Ihren Verdacht angeht, dass Ihre Frau stiehlt … Sind Ihnen Gegenstände im Haus aufgefallen, von denen Sie glauben, sie könnten unehrlich erworben sein?«
»Vor einem Monat bin ich nach Hause gekommen und traf sie an, wie sie wie ein Derwisch zur neuesten Musik getanzt hat. Sie hatte ein Grammofon und konnte mir nicht erklären, woher es stammte. Jetzt ist es wieder fort. Sie sagt, dass es repariert wird, aber sie hat es entweder verkauft oder verpfändet. Tja, woher war es? Wer hatte es für sie getragen? Sie hat einen alten Verehrer, der sich immer noch in ihrer Nähe herumtreibt und sich bei ihrer Mutter nützlich macht.«
»Mir ist nicht ersichtlich, wie wir helfen können, Mr. Fitzpatrick.«
Er berührte das Sacred Heart an seinem Revers. »Sie könnte sich mit einer Diebesbande eingelassen haben.«
Sykes Züge verhärteten sich. Er sagte nichts, und für einen Moment saßen wir drei schweigend da. War Fitzpatrick hier, um zu gestehen, dass er bald vor Wut explodieren und wer weiß was tun könnte, wenn er keine Erklärung fand, die seine Zweifel und seine Eifersucht ausräumte?
Fitzpatrick sackte in sich zusammen und zog die Arme dicht an seinen Oberkörper. »Ich habe ein Haus, das meinen Eltern gehörte. Sie weilen beide nicht mehr unter uns. Ich habe Deirdre versprochen, dass es ihr an nichts mangeln würde, und dieses Versprechen habe ich gehalten. Aber ich denke, dass sie enttäuscht ist, weil ich nicht zugestimmt habe, ihre Mutter bei uns wohnen zu lassen. Vielleicht hätte ich das tun sollen, nur …«
»Nur was?«, hakte ich nach.
»Als ich das erste Mal ablehnte, hat sie gesagt, dass ich es bloß tue, weil die Leute denken würden, ihre Mutter wäre meine Frau und sie unsere Tochter. Sie kann sehr grausam sein. Letztes Jahr, als ich erfuhr, wie krank meine Schwiegermutter ist, habe ich gesagt, dass wir sie einladen sollten. Aber da wollte sie nicht kommen und meinte, sie erkenne, wenn sie nicht erwünscht sei.«
Schließlich meldete Sykes sich zu Wort. »Was spräche dagegen«, fragte er mich, »nachzusehen, dass Mrs. Fitzpatrick nicht zu Schaden kommt? Immerhin war ich derjenige, der dafür sorgte, dass keine Anklage gegen sie erhoben wurde.«
»Ich bezahle natürlich«, ergänzte Fitzpatrick und griff bereits in seine Innentasche, als wollte er gleich seine Brieftasche hervorholen.
Ich nannte ihm unseren Tagessatz und erklärte, dass er wie üblich eine Rechnung bekäme, sollten wir den Fall übernehmen.
Seine Mundwinkel zuckten. »Schicken Sie bitte keine Rechnung zu mir nach Hause. Wenn Deirdre sie sieht, wird sie sich fragen, was ich tue.«
Wieder betrachtete ich die Hochzeitsfotografie. Solch ein ungleiches Paar.
Wider besseres Wissen blickte ich von Fitzpatrick zu Sykes und beschloss, dass es nicht schaden würde, sich diese junge Dame, die derart starke Gefühle hervorrufen konnte, mal näher anzuschauen.
Zwei
Deirdre saß am Bett ihrer Mutter in dem kleinen weiß getünchten Zimmer mit dem vertrauten bernsteinfarbenen Feuchtigkeitsmuster an Decke und Wänden. Im Zimmer roch es nach Kampfer, Veilchenöl und dem gekochten Kohl vom gestrigen Abendessen. Deirdre glättete die üblichen Beulen in der Überdecke.
Ihre Mam war eingenickt und murmelte im Schlaf. Beim Träumen zuckten ihre Lider. Gewiss war sie wieder im neb ligen Irland ihrer Kindheit, einem Ort, über den Deirdre endlose Geschichten gehört, den sie jedoch nie besucht hatte.
Was Deirdre überzeugt hatte, dass ihre Mutter aus diesem Haus musste, war das eine Mal gewesen, dass die Ratte durch den Schornstein gekommen war. Nun erblickte sie noch einen verdammten Floh auf der Bettdecke. Gekonnt zerknipste sie ihn zwischen den Fingern und ließ die Hälften in den Nachttopf fallen, weil man nur so mit den kleinen Biestern fertig wurde. Sie lauerten in den Mauerritzen, wo sie ihre Quälereien planten. Wenn man wollte, konnte man ein halbes Dutzend innerhalb einer Minute töten. Es würde immer noch eine kleine Armee darauf warten, sich von der Decke fallen zu lassen. Nichts hiervon gäbe es in einem Pflegeheim.
Manchmal brachte Deirdre ein oder zwei Flöhe in ihren Rocksäumen mit nach Hause. Fitz beschwerte sich dann, dass sie nach Armut stank und Krankheiten einschleppte. Er sorgte sich um seine Gesundheit und seine schwache Brust.
Ihre Mutter öffnete die Augen und lächelte zahnlos. »Ich habe gedacht, du bist nach Hause gegangen.« Ihr Körper mochte verfallen, doch geistig war sie noch ganz da. »Wie spät ist es?«
»Es ist zwölf Uhr. Ich habe dir Kalbsfuß-Sülze mitgebracht. Und während du isst, muss ich dir etwas erzählen.«
Ein Hoffnungsschimmer leuchtete in den Augen ihrer Mutter auf. »Hast du von Anthony gehört?«
»Nein.« Es dauerte ein wenig, bis Deirdre ihre Mutter aufgesetzt und an die aufgeschüttelten Kissen gelehnt hatte. Sie breitete ein Handtuch unter ihrem Kinn aus und reichte ihr den Löffel und den Teller.
Ihre Mam schluckte einen Happen Sülze. Dann sagte sie: »Ich habe geträumt, dass Anthony gekommen ist. Ich bin sicher, dass er auf dem Weg ist.«
Sie wünschte sich, ihren Sohn noch einmal zu sehen, bevor sie starb. Deshalb hatte sie einen rührenden Brief an den kleinen Jungen diktiert, der vor dreiundzwanzig Jahren nach New York abgereist war. Bei den Worten hatte Deirdre sich innerlich gekrümmt.
»Mach dir keine zu großen Hoffnungen, Mam. Er hat nicht geschrieben.«
»In dem Traum war er im selben Alter wie bei seiner Abreise. Seine Babylocken waren noch nicht abgeschnitten. Dein Onkel hat das gemacht. Er hatte die Schere mitgenommen, um einen großen Jungen aus ihm zu machen.«
Deirdre sagte nichts. Sie hatte ihrem Bruder Jahr für Jahr geschrieben, seit sie zehn war, und in anderthalb Jahrzehnten hatte sie gerade mal zwei kurze Antworten erhalten. Zwei Monate vor ihrer Hochzeit mit Fitz hatte sie kalte Füße bekommen und an Anthony geschrieben. Könnte er ihr das Geld für die Überreise für Mam und sie nach New York schicken? Es war keine Antwort gekommen, und sie hatte Fitz geheiratet.
»Mam, ich sorge dafür, dass du es bequemer hast.«
Ihre Mutter stach den Löffel in die Sülze und ließ ihn dort. »Von Fitzpatrick nehme ich nichts an.«
»Da gibt es ein schönes Haus, das von einer Frau geleitet wird, deren Großmutter aus Kilkenny ist. Dort kommst du wieder zu Kräften. Es hat auch einen Garten, zu dem man hinaussehen kann.«
»Ich nehme keine Almosen von dem Mann.«
»Ich bezahle es. Ich habe Arbeit bei einem Anwalt.«
Noch ehe sie die Leeds Bridge erreichte, nahm Deirdre den Gestank des Flusses Aire wahr, beißend und klebrig, sodass er sich in der Kehle festsetzte. Der glückliche Fluss, der sich zum Meer schlängelte! An diesem heißen Freitagnachmittag im August gefiele ihr nichts besser, als dieselbe Richtung einzuschlagen. Sie strich mit der Hand über das Eisengeländer der Brücke, wobei sie zu allem Überfluss auch noch ihre cremeweißen Handschuhe schmutzig machte.
Unten riefen sich zwei Flussschiffer etwas zu. Am Ufer sah sie Calls Landing, dessen Name in riesigen Lettern seitlich auf das Gebäude gemalt war. Es war großartig, in dieser Stadt mit all ihrem Trubel zu sein. In der Ferne ragte die protestantische Pfarrkirche hoch in den Himmel auf.
Eine verbrauchte Gestalt kam ihr entgegengeschlurft. Der Mann sah sie direkt an, als würde ein Mensch, der hier nichts verloren hatte, einen anderen, für den das Gleiche galt, auf Anhieb erkennen. Die Sohle seines linken Schuhs war lose, und er wich ein wenig zur Seite aus, um ihr Platz zu machen. Der Mann war eindeutig vom Pech gebeutelt und brachte die Zeit herum, bis es Nacht wurde und er irgendwo einen Schlafplatz auftun konnte, vielleicht bei der Heilsarmee. Deirdre tauchte eine Hand in ihre Tasche und steckte ihm eine Münze zu.
Und dann sah sie ihn: Giuseppe Barnardini, groß, schlank und keinen Tag älter aussehend als dreißig. Er hatte etwas Komisches und Unverkennbares an sich, wie er über die Brücke schlenderte und mit den Kahnschiffern scherzte.
Dieser Mann war anders als die vorherigen beiden. Der erste war ein ach-so-hagerer Junge mit einem entsetzlichen Husten gewesen, der zweite ein kräftiger, wortkarger Bursche, der sie halbherzig gefragt hatte, was ihr Preis für ein bestimmtes Extra sei. Er hatte es ihr nicht übel genommen, als sie ablehnte.
Und nun sah Barnardini sie mit einem Ausdruck von Verwunderung an.
Sie hörte sich selbst sagen: »Sind Sie es wirklich?«
Er lüpfte den Hut und verneigte sich knapp, aber höflich. »Falls Sie die Dame höchstselbst sind, dann bin ich es, ja.« Er streckte eine Hand vor, um ihr die Tasche abzunehmen. »Darf ich?«
Sie gab ihre kleine Reisetasche nicht frei. »Nicht nötig.«
Einen Moment lang schien er insistieren zu wollen, dann zuckte er mit den Schultern. »Sie kennen die Regeln. Ich halte mich an sie. Wollen wir unser Abenteuer beginnen, Mrs. Fitzpatrick?«
»Warum nicht?« Sie blickte nach vorn. Ihr Ziel, das Adelphi Hotel, lauerte knapp außer Sichtweite. »Wenn wir es richtig machen wollen, sollten wir uns mit Vornamen ansprechen.«
»Natürlich. Ich bin Joseph Barnard. Nenn mich Joe. Guiseppe Barnardini ist mein Künstlername.«
Ehe sie ihren Vornamen sagen konnte, erschien ein großer Mann in einem Regenmantel aus dem Nichts. Er zog eine kleine Kamera hervor und richtete sie auf den Fluss, dennoch fühlte Deirdre aus unerfindlichen Gründen die Linse auf sich gerichtet. Sie kannte diesen Mann mit seiner typischen karierten Mütze und dem sandfarbenen Schnauzbart. Er war der Zeitungsfotograf, der früher in diesem Sommer eine Aufnahme von Kindern gemacht hatte, die nahe Kirkstall Abbey im Fluss planschten. Fitz hatte sie stolz mit ihm bekannt gemacht. Nun funkelte sie den Fotografen böse an. Er sollte ja Fitz keine Aufnahme von ihr zeigen.
Deirdre wandte sich ab, doch Joe ging bereits auf den Mann zu. »Sie da, Sie haben uns fotografiert.«
»Oh nein, Sir.« Der Fotograf hielt die Kamera in die Höhe. »Ich habe die Brücke und den Fluss aufgenommen. Sie haben selbst gesehen, worauf meine Linse gerichtet war. Doch falls Sie eine Aufnahme von sich wünschen …« Der Fotograf streckte die rechte Hand vor. »Diamond, Len Diamond, zu Diensten. Ich erkenne Sie, Sir. Mr. Barnardini, nicht wahr? Ich bin ein großer Bewunderer. Keiner singt komische Opern besser. Ich sage immer, dass Sie in Covent Garden auftreten sollten.«
Deirdre ging einige Schritte zum anderen Ende der Brücke und hörte, wie Joe fröhlich das Lob des Fotografen entgegennahm.
Der eitle Narr posierte für eine Aufnahme. Diamond zückte eine andere Kamera aus seiner Tasche. Gewiss musste man stark sein, um so viel Kram mit sich herumzutragen, aber Deirdre kannte jemanden, der stärker war. Sollte Diamond versuchen, ihr Schwierigkeiten mit Fitz zu machen, würde er es bitter bereuen.
Joe holte sie ein. Wieder griff er nach ihrer Tasche. »Ich kann dich die nicht tragen lassen. Das sieht nicht gut aus.« Er winkelte den Arm an, damit sie sich bei ihm einhakte. »Keine Sorge wegen des Fotografen. Selbst wenn er uns aufgenommen hat, was soll’s? Wir haben uns ja nicht bei den Händen gehalten. Und wir sollten nicht angespannt sein.«
Deirdre hakte sich bei ihm ein. Dies alles geschah zu nahe bei ihrem Zuhause. Damit hätte sie rechnen müssen. Wenn sie wieder daheim war, würde sie beiläufig sagen: »Ach, Fitz, als ich neulich Nachmittag über die Leeds Bridge gegangen bin, hat mich jemand nach dem Weg gefragt.«
Der prächtige Anblick des Adelphi Hotels vertrieb ihre Sorgen. Das Hotel zog sich um die Straßenecke wie eine elegante Nixe, die ihren Schwanz schwang, und forderte sowohl in der Dock Street als auch in der Hunslet Road Raum für die schillernde Fassade ein. Schaut mich an und staunt, würde diese Nixe rufen, falls Meerjungfrauen denn wirklich singen konnten. Als sie durch den von Säulen gerahmten Eingang trat, atmete Deirdre die herrliche Mischung von Tabakrauch, Ale und Erhabenheit ein. Blassgrüne Blattmuster zierten glänzende, cremeweiße Fliesen, und ins Milchglas der ersten Bar waren die Worte Smoke Room I geätzt.
Joe ging voraus durch den Korridor zwischen dem Schankraum zur Linken und der breiten Treppe zur Rechten in Richtung eines Sitzbereiches hinten, der um diese Tageszeit leer war. Deirdre hielt dies für den schönsten Raum, voller edel gepolsterter Sitzmöbel und dunkler Holztische, mit einem hübschen Kamin und zahlreichen Schusterpalmen.
Wenig später kam ein Kellner, dessen spärliches Haar genauso weiß war wie seine Schürze.
»Wir werden hier wohnen«, erklärte ihr Begleiter. »Mr. und Mrs. Joseph Barnard.«
»Ah, sehr wohl, Sir.« Der Kellner neigte den Kopf, als könnte er so besser hören. »Und was wünschen Sie?«
»Für mich bitte ein großes Glas von Ihrem besten Bitter, und für dich, Liebling? Gin und Tonic?«
Sie nickte. Der Kellner sollte nicht denken, dass ein Mann die Vorlieben seiner Frau nicht kannte.
Als der Kellner gegangen war, sagte Deirdre: »Deinem Künstlernamen nach hatte ich einen Italiener erwartet.«
Er lachte. »Barnardini. Gut, nicht? Ich habe ihn einem gut aussehenden italienischen Magier gestohlen, der die Touristen in Kairo unterhielt. Da wusste ich noch nicht, dass ich eine Karriere in den englischsten aller Operetten anstreben würde.«
Kairo. Der Name beschwor die wunderbarsten Bilder herauf – von Kasbahs, Wasserpfeifen und Schlangen in Körben.
Er blickte hinunter zu seinem rechten Knie, das sich schnell auf und ab bewegte, als wäre es mit einem kleinen Schlüssel aufgezogen worden. »Verzeih mein Bein. Nervosität.« Er drückte eine Hand darauf, um es ruhig zu halten. »Das passiert nie, wenn ich auf der Bühne bin.«
»Erzähl mir von deinen Reisen.«
Bei ihren Drinks kam Joe ihrer Bitte nach. Er sprach von Pyramiden, dem Nil, der von Süden nach Norden floss, den Daus, Männern mit Turbanen, Kaffee, bei dem sich einem die Zehen krümmten, müden Eseln, Seidenballen und Parfüms, die Kleopatras würdig wären. Deirdre war halb schwindlig vor Staunen.
Eine halbe Stunde später und gewärmt vom Gin und der Nachmittagshitze, die in das Dachzimmer fiel, stand Deirdre an dem großen ovalen Fenster und schaute hinunter zur Straße. Eine Straßenbahn glitt heran und blieb stehen. Der Schaffner half einer winzigen alten Frau die hohe Stufe hinauf.
Joe klopfte an die Tür und trat ein. »Ich habe es getan und die Anmeldung im Hotelregister unterschrieben.«
Er sah sie an. Es war dieser Blick. Sie legte die zusammengefaltete blaue Bluse in die Kommodenschublade, strich die Bänder oben glatt und setzte sich auf den Stuhl daneben.
»Über eines sollten Sie sich im Klaren sein.«
»Aha?« Er setzte sich aufs Bett und blickte sie ernst an.
»Mr. Barnard, wir sind nur aus einem Grund hier: um Ihrer Frau den Beweis zu liefern, den sie für die Scheidung braucht, nicht weniger und ganz sicher nicht mehr. Also möchte ich das lieber gleich sagen. Ich halte es für eine gute Idee, eine Nackenrolle zwischen uns zu haben …«
Er öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, doch sie hob eine Hand. Da dies ihr drittes Mal war, würde es nicht schwierig sein, ihn in seine Schranken zu weisen. »Zwei Nächte hier werden ausreichen, und physische …«
»Haben Sie das schon vorher gemacht?«
»Ja, aber ich werde nichts zu den vorherigen Herren sagen, wie ich auch nichts über Sie verlauten lassen werde. Physische Intimität ist weder notwendig noch wünschenswert. Alles, was nötig ist, ist die Hotelrechnung auf ›Mr. und Mrs. Barnard‹ und die Versicherung des Zimmermädchens, dass wir beide hier waren und sie den Aufenthalt bezeugen wird.«
Nachdem sie ihren Teil gesagt hatte, stand sie auf, blickte zu ihm hinab und straffte die Schultern, während sie tief Luft holte.
Er sah auf verstörende Weise zu ihr auf. »Verstehe.«
Verfluchter Mann. Nur weil er Sänger auf einer Bühne war. Nur weil er bei einem Bier und einem Gin versucht hatte, sie mit Lügengeschichten zu bezaubern. Nun, eines sollte er in seinen Do-Re-Mi-Schädel bekommen. »Ich bin eine verheiratete Frau, Joe. Und ich bin Katholikin. Ich habe nie Ehebruch begangen.«
Die großen dunklen Augen schauten direkt in ihr Herz und ihre Seele.
Sie sagte nicht: Ich habe nie Ehebruch begangen, weil ich überhaupt noch nie einem Mann so nahe gewesen bin. Ich könnte den Meerjungfrauen das eine oder andere beibringen.
Er lächelte. »Tut mir leid. Ich muss falsch informiert worden sein. Diese Rechtsverdreher sind alle gleich.«
Und plötzlich war er nicht mehr wie die gelenkige Gestalt, die sich über die Brücke lehnte, oder der Prahler aus der Bar unten, sondern so ernst und aufrecht wie ein Baum, als er sich aufrichtete. Er berührte ihren Kopf mit seinen Lippen, was eher einem Segen als einem Kuss entsprach. Mit einer Hand auf seinem Herzen und einem Ausdruck, der halb Bewunderung und halb Schläfrigkeit war, was wohl Liebe darstellen sollte, stimmte er das alte Lied an, das Onkel Jimmy bei jeder Familienfeier verhunzte: The Ring My Mother Wore.
»The earth holds many treasures rare in gems and golden ore;
My heart holds one more precious far – the ring my mother wore.
I saw it first when I, a child, was playing by her side;
She told me then ’twas father’s gift when she became his bride.«
Anfangs dachte Deirdre an Onkel Jimmy und wollte lachen. Doch Joe sang mit so viel Gefühl, dass sie, als die letzte Note zitternd in der ausgeblichenen Tapete versank, mit einer Hand über ihre Wange wischte.
Er griff in seine Tasche und zog ein großes weißes Taschentuch heraus. »War ich so schlecht?«
»Du warst großartig. Wie herrlich es sein muss, Opern zu singen!«
»Ist es gewiss.« Er lächelte und vollführte einen kleinen Tanz, bei dem er die Beine verbog, als wären sie aus Gummi. Dann verneigte er sich tief.
Und sie dachte: Warum soll ich wie eine Meerjungfrau leben? Ich bin es leid, ich zu sein. Dieser Mann ist wie kein anderer.
Als sie ihm sein Taschentuch zurückgab, berührten sich ihre Finger.
Joseph Barnard hatte Deirdre Fitzpatrick zum Abschied Freikarten für das Grand Theatre geschenkt.
Sie und Fitz saßen in der Mitte der dritten Reihe vorn. Fitz hatte die Geschichte geschluckt, dass die Karten von ihrer Tante kamen, die sie von einer Kollegin hatte, deren Sohn die Kulissen malte.
Fitz rutschte auf seinem Sitz hin und her. Er hielt sich seinen braunen Ärmel vor die Nase, als er nieste, weil er nicht schnell genug war, rechtzeitig sein Taschentuch hervorzuholen. Er wollte, dass sie hinsah und sich sorgte, weil er nieste. Fitz fand sein Taschentuch und seine Pastillen. »Ich vertrage den Zigarrenrauch nicht.«
Der arme Fitz und seine schwache Brust.
Sie würde ihn vermissen, wenn er starb, seinen rasselnden Atem, den Geruch nach Druckerschwärze und Lösungsmitteln, den er in seiner Kleidung mit nach Hause brachte, das Schniefen, die schweren Schritte auf der Treppe, die regelmäßige Lohntüte. Eines Morgens würde sie aufwachen und feststellen, dass Fitz im Schlaf gestorben war. Warum sollte es nicht geschehen? Schließlich verbrachte man den Großteil seiner Kindheit damit, für einen gnädigen Tod zu beten. Und früher oder später könnten Gebete auch erhört werden.
Für sich selbst betete Deirdre schon lange nicht mehr für einen gnädigen Tod, sondern für ein aufregenderes Leben.
Etwas veranlasste sie, hinauf zur Loge rechts von ihr zu sehen, der Royal Box, in der König George und Königin Mary sitzen würden, falls sie jemals ins Leeds Grand Theatre kamen, um Gilbert and Sullivan zu genießen.
Dort waren zwei Paare in der Loge. Der Mann, der ihren Blick einfing und keinerlei Anzeichen zeigte, dass er sie wiedererkannte, war der, der sie im Marshalls erwischt und beinahe wegen jener Parfümflasche angezeigt hätte.
Drei
Sykes erprobte seine Bauchrednerfertigkeit zu flüstern, ohne die Lippen zu bewegen. »Sehen Sie jetzt nicht hin. In der Mitte der dritten Reihe, Cyril und Deirdre Fitzpatrick.«
Fitzpatrick hatte Sykes erzählt, dass er mit seiner Frau ins Theater käme, um Die Piraten von Penzance zu sehen. Da mir das zweifelhafte Vergnügen zuteilwürde, Mrs. Fitzpatrick zu observieren, war dies meine Gelegenheit, einen Blick auf sie zu werfen. Der Dirigent schwang den Taktstock, und das Orchester stimmte die Ouvertüre an. Während die Lichter im Zuschauerraum gedimmt wurden, hob ich lustlos mein Opernglas an und blickte auf Mrs. Fitzpatricks Kopf.
Sie war nicht der Hauptgrund, aus dem ich im Theater war. Wir saßen zu viert in der königlichen Loge: Sykes, seine Frau Rosie, mein früherer Verehrer Marcus Charles und ich. Marcus hatte überraschend angerufen und gesagt, er sei in der Gegend, ob ich den Abend Zeit hätte. Zu viert auszugehen bedeutete, dass ich nicht mit Marcus allein sein musste. Er ist Chief Inspector beim Scotland Yard. Wir lernten uns vergangenes Jahr kennen, als wir beide in denselben Fällen ermittelten. Zu sagen, wir wären uns nähergekommen, wäre eine Art, es auszudrücken. Wir hatten uns verliebt, ich mich allerdings weniger als er. Und ich hoffte inständig, dass er nicht gekommen war, um seinen Heiratsantrag zu erneuern. Er besitzt einige gute Eigenschaften, kann jedoch überheblich und verschlossen sein. Was sich eventuell ausbügeln ließe, aber mit einem aufsteigenden Stern beim Scotland Yard verheiratet zu sein würde heißen, dass ich das aufgeben müsste, was mir am meisten Freude bereitete: auf eigene Faust zu ermitteln.
Die schmetternde Ouvertüre erreichte ihren Höhepunkt, und die Vorstellung begann. Bis die Piraten ihr Sherry-Lied sangen, hatte ich meinen Klienten in der dritten Reihe beinahe vergessen. Der erste Akt endete, und ich blickte nach unten zu den Fitzpatricks. Sie lehnten sich zueinander, als flüsterten sie sich etwas zu, und wirkten kein bisschen wie ein eifersüchtiger Mann und seine umherstreifende Frau. Ich wünschte, ich hätte Mr. Fitzpatricks Bitte abgewiesen; vor allem hatte ich es ganz und gar nicht eilig damit, Mrs. Fitzpatrick zu beschatten.
Der Applaus für den ersten Akt war so laut, dass Sykes und Rosie uns pantomimisch mitteilen mussten, sie würden sich die Beine vertreten. Ein taktischer Zug wie aus dem Lehrbuch. Marcus und ich blieben allein bei einer Pralinenschachtel zurück und waren beide ein wenig verlegen.
Ehe wir beide gleichzeitig zu sprechen begannen. Ich bestand darauf, dass er zuerst redete, und war ziemlich zuversichtlich, dass er seinen Heiratsantrag nicht in der Pause wiederholen würde. Dennoch musste ich ein bisschen misstrauisch dreingeschaut haben.
Er sagte: »Es ist nicht, was du denkst. Ich werde die Frage nicht wieder aufbringen. Ich respektiere deine Antwort und verstehe sie. Doch ich bin froh, dass wir Freunde sein können, denn ich weiß, dass wir einander vertrauen.«
Wenn ein Polizist Marcus’ Rang erreicht, hat er weidlich Übung darin, wie man mit Menschen spricht, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Worauf also hatte er es jetzt abgesehen?
»Bist du wegen einer Ermittlung hier?«
Marcus lächelte. Er wirkte solide und gut aussehend, wenn er lächelte, wie ein Mann, auf den sich eine Frau verlassen konnte – sofern er denn mal da war und nicht gerade Beweise durchging oder Schurken dingfest machte.
»Kate, du weißt, dass ich das nicht sagen kann.«
»Und hätten wir geheiratet? Wäre ich deine Frau, würdest du es mir dann erzählen?«
»Selbstverständlich nicht.«
Genau wie ich gedacht hatte. Es wäre nicht gut gegangen.
Es war günstig, dass Sykes und Rosie in diesem Moment zurück in die Loge kamen. Die Lichter wurden zum zweiten Akt heruntergedreht.
Als die Polizisten tanzten und dazu A Policeman’s Lot is Not a Happy One trällerten, kippten Sykes, Rosie und ich beinahe von den Stühlen vor Lachen. Ich stupste Marcus an und flüsterte: »Findest du es nicht witzig?«
Wenn Stimmen die Stirn runzeln könnten, täte es seine. »Das Elend beginnt, wenn ein Publikum ermuntert wird, über Polizisten zu lachen.«
»Du bist schon wieder überheblich, Marcus.«
Er lachte auf wenig überhebliche, indes recht gekünstelte Art.
Erst als wir uns alle zum Abendessen setzten, fragte er mich, ob ich Zeit hätte, mit ihm zum Ebor-Handicap-Pferderennen in York zu kommen.
Ich sagte zu, weil ich neugierig war, was er vorhatte, und mehr als gewillt, meine Beschattung von Deirdre Fitzpatrick aufzuschieben.
Vier
Natürlich brauchte ich einen neuen Hut für das Pferderennen. Meine Lieblingsmodistin hat ein Geschäft in unserem besten Hotel, dem Metropole, wo Marcus wohnte und ich mich mit ihm verabredet hatte.
Madam Estelle, Hutmacherin der gehobenen Klasse, strahlte zur Begrüßung, drückte ihre Zigarette aus und wedelte mit der Times, um den Rauch zu vertreiben. Sie war eine winzige, zierliche Gestalt mit eher dunklem Teint, vielen Falten und einem weißen Haarknoten, der tief genug saß, um keinem Hut im Weg zu sein.
Ich erklärte ihr meine Notlage ob der kurzfristigen Einladung zum Pferderennen.
Sie neigte den spatzenhaften Kopf zur Seite und musterte meine Kleidung. »Ich habe genau den richtigen Hut für Sie.« Madam Estelle eilte durch das Geschäft, öffnete einen Vorhang, tauchte dahinter und kam triumphierend mit einer kleinen dunkelroten Hutschachtel wieder hervor.
Bei dem Hut, den sie mir hinhielt, handelte es sich um ein elegantes Topfmodell mit einem verwirbelten Muster in den alten Suffragettenfarben Grün und Violett; der einzige Schmuck war eine weiße Rosenknospe. Vielleicht lag es an der Rosenknospe, jedenfalls verliebte ich mich sofort in den Hut.
Ganz die vollkommene Verkäuferin, enthüllte Madam Estelle den Preis erst, als die Liebe mit einer Hutnadel besiegelt war.
Die Hutmacherin öffnete mir die Innentür, sodass ich direkt in den Hotelkorridor gelangte. Dort bog ich nach links zur Eingangshalle ab.
Ich war ein wenig zu früh und fand einen Platz, der mir einen guten Blick über die Halle gewährte. Marcus und ich waren nicht die Einzigen, die zum Rennen wollten. Eine Frau in fließender Seide und mit einem flotten neuen Florentinerhut trat aus dem Fahrstuhl, gefolgt von einem Mann in Frack und Zylinder. Dieser Aufzug legte nahe, dass sie ebenfalls zur Knaves mire-Rennbahn wollten.
Ein seltsames Paar kam die breite Treppe herunter. Zwei Männer, die angeregt plaudernd nebeneinander gingen. Der jüngere Mann war ungefähr dreißig Jahre alt, schlank und hatte ein hübsches, jungenhaftes Gesicht. Er trug eine dunkle Hose, ein sehr schön geschneidertes graues Jackett und einen grauen Seidenzylinder. Sein untersetzter Begleiter war ein Mann in den Fünfzigern mit wettergegerbtem Gesicht, der in voller High land-Kluft war – sein Kilt könnte das Stewart-Muster sein, überlegte ich –, und um seinen Hals hing eine braune Fernglastasche.
Neugierig gab ich vor, mich recken zu wollen und mir eine Zeitschrift zu nehmen. Ich beobachtete, wie die Männer in einen Rolls-Royce mit Chauffeur stiegen. Als ich mich mit der Zeitschrift wieder zurückdrehte, erschien Marcus aus Richtung der Hoteltelefonzelle. Er bewegte sich im Tempo einer Maus, die Schokolade roch. Und ich war sicher, dass er die ganze Zeit dort hinten gewesen war.
Er sah fantastisch aus. Zwischen einem gut gekleideten Rennbahnbesucher und einem gut aussehenden Bräutigam besteht kein großer Unterschied, und für einen flüchtigen Moment dachte ich, dass ich verrückt gewesen sein musste, seinen Antrag abzulehnen.
»Kate! Entschuldige, dass ich dich warten ließ. Du siehst wunderschön aus. Grün steht dir.«
»Es war das Beste, was ich an Tarnfarbe auftreiben konnte.«
Er bot mir seinen Arm an. »Ist es dir recht, wenn wir gleich aufbrechen?«
»Ist es.«
Wenn ich mich nicht irrte, wollte er mit dem Rolls-Royce und dem seltsamen Paar darin mithalten.
Als wir das Hotel verließen, stand ein Portier neben einem schwarzen Alvis, dem Marcus zunickte und eine Münze gab.
Ich setzte mich auf den Beifahrersitz.
Der Portier kurbelte den Motor an.
»Scotland Yard ist nobel zu dir. Du wohnst im Metropole und hast einen Alvis zur Verfügung. Mich wundert nur, dass du keinen Fahrer hast.«
»Auf diese Weise ist es diskreter. Nur du und ich, die einen Tag beim Pferderennen genießen.«
»Marcus, ich weiß, dass du arbeitest.« Es konnte extrem ärgerlich sein, wenn er tat, als verriete ich das Spiel, was immer es sein mochte. »Mich überrascht, dass jemand von deinem Rang solch eine Aufgabe zugeteilt bekommt. Sind es sonst nicht Detective Sergeants, die Verdächtige observieren?«
Er überlegte kurz, erwog gewiss, was er sagen konnte und was nicht, bevor er entschied, mir einen Brotkrumen hinzuwerfen. »Unsere amerikanischen Cousins interessieren sich für jemanden, und wir müssen uns hilfsbereit zeigen. Jetzt hör auf zu fragen.«
Schließlich reihten wir uns in den Verkehr zur Rennbahn ein – eine lange Schlange von Automobilen, Fuhrwerken und Bussen, einer einsamen altmodischen Kutsche, Ponywagen und wenigen Reitern, die allesamt nach Knavesmire wollten.
Als wir uns der Rennbahn näherten, hielt eine kleine Gruppe von Glücksspielgegnern Plakate in die Höhe:
Macht euch bereit für die Verdammnis! Der Preis der Sünde ist der Tod! Alle Rennstrecken führen in die Hölle!
»Ob sie in die Hölle führen, hängt davon ab, wer auf der Bahn ist und was er tut«, murmelte Marcus.
An der Parkplatzeinfahrt gab er einem Angestellten eine halbe Krone, und wir wurden durchgewinkt. Ein zweiter Bediensteter dirigierte uns zu einer Lücke neben einem Morris.
Für einen Moment blieben wir im Wagen sitzen. Marcus nahm seine Fernglastasche auf und studierte den Verschluss, als könnte er ihm eine Eingebung bescheren.
Auf der Rennbahn würde es vor Polizisten in Zivil wimmeln, die nach Taschendieben, Kartenbetrügern und Buchmachern mit kleinen, schnellen Automobilen Ausschau hielten, mit denen sie nach einem Rennen davonbrausten, ohne die Gewinne auszuzahlen. Einige von ihnen hatten vielleicht Bescheid bekommen, für die Ermittlungsabteilung besonders auf der Hut zu sein.
Ich holte einen Spiegel hervor und überprüfte den Sitz meines Hutes.
Marcus hängte sich seine Fernglastasche um.
Als ich aus dem Wagen stieg, versanken meine Absätze ein wenig im Gras.
Marcus setzte seinen Hut auf. »Im Bereich für die Eigner und Trainer anzufangen wäre gut. Hast du dir dein Pferd wirklich ausgesucht, indem du mit geschlossenen Augen und einer Nadel in der Hand getippt hast?«
»Natürlich. Sein Name ist Flint Jack.« Marcus musste nicht erfahren, dass es sich um einen Tipp von meinem Nachbarn handelte, dem Professor, der sich intensiv mit Pferderennen beschäftigte.
Er lachte. »Ich wette, du hast gestern Abend über der Sporting Pink gebrütet. Gib es zu! Du hast dir Form, Gewicht, Jockey und alles genau angesehen.«
»Mir war gar nicht bewusst, dass du solch ein versierter Rennbahnbesucher bist, Marcus. Deine Arbeit spannt dich offenbar nicht so sehr ein, wie du vorgibst.«
Es herrschte bereits eine festliche Atmosphäre. Wir folgten den Zylindern und vornehmen Kleidern zum Bereich der Eigner und Trainer, wo ein Bediensteter unsere Eintrittsmarken überprüfte. Das erste Rennen sollte gleich beginnen.
»Sehen wir es uns von der Absperrung aus an«, sagte ich.
Die Sicht war nicht sehr gut, aber mir gefiel die Stimmung dort. Wir lehnten uns auf den Zaun, beobachteten, wie die Pferde auf uns zugedonnert kamen, und fühlten praktisch den Windzug, als sie mit wummernden Hufen vorbeipreschten.
Nach dem ersten Rennen führten Stallburschen die vor Schweiß glänzenden Pferde in den Ring, um sie in der halbstündigen Pause zwischen den Rennen zu bewegen.
Marcus kam mit einem Kartenverkäufer ins Gespräch (wahrscheinlich ein Polizist in Zivil).
In diesem Augenblick sah ich die beiden Männer aus dem Hotel, die Marcus’ Interesse geweckt hatten. Sie bewunderten ein kastanienbraunes Pferd, das Flint Jacks Nummer trug.
»Da ist mein Pferd. Ich bin gleich wieder zurück, Marcus.«
Wenn er mir keinen Hinweis geben wollte, wen er verfolgte und warum, würde ich es eben allein herausfinden.
Ein verlebter alter ehemaliger Jockey führte Flint Jack zum Aufwärmring. Als der Schotte aus Marcus’ Hotel ihn ansprach, antwortete er, dass Flint Jack »bereit für seinen großen Tag« sei.
Der Schotte, eindeutig ein Highlander, äußerte sich nun über die Rennbahn. Er war noch nie in York gewesen. Sein Begleiter mit dem grauen Seidenzylinder sprach leise. Seine Lieblingsrennbahn sei in Virginia, sagte er. Der Mann hatte einen leichten New Yorker Akzent, war jedoch Engländer und von hier. Er faszinierte mich. Seine Kleidung, die Schuhe und das Auftreten waren erster Güte. Seine Stimme war es nicht.
Während ich einmal um den Ring und zurück zu Marcus ging, bewirkte das Belauschen des redseligen Paares einen Sherlock-Schub bei mir. Es waren nicht genug Informationen, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen, doch wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass der Highlander etwas verkaufte. Seine plumpe, selbstsichere Art vermittelte diesen Eindruck. Was assoziierte ich mit den Highlands? Haggis, Dudelsäcke, Highland Games, Bonnie Prince Charlie und Whisky.
Marcus hatte gesagt: »Unsere amerikanischen Cousins interessieren sich für jemanden.«
Amerika hatte Gesetze gegen den Import und Verkauf von Alkohol. Und diese Prohibitionsgesetze wurden im größtmöglichen Umfang missachtet. Der Mann mit dem grauen Zylinder mochte eine Rennbahn in Virginia; also kam er aus Amerika. Und seiner eleganten Aufmachung nach zu urteilen, hatte er sich in der Savile Row eingekleidet. Ein Mann mit Geld.
»Nun?«, fragte Marcus. »Soll es immer noch Flint Jack sein?«
»Unbedingt, nachdem ich ihn gesehen habe.«
Wir wanderten weiter herum, bahnten uns unseren Weg durch die Menge von kleinen Wettern und Fabrikarbeitern aus York, deren Firmen für den Tag geschlossen hatten.
In der Ferne spielte ein Orchester. Von einem der Essensstände waberte ein verlockender Würstchengeruch heran. Ein Mann neben einem kleinen Zelt hielt ein Schild mit der Aufschrift Gentlemen, ein Penny in die Höhe.
Als Marcus vorschlug, dass wir zur Tribüne gingen, antwortete ich: »Ich will vorher noch meine Wette platzieren, mal sehen, ob ich Glück habe. Ich komme nach.«
Ich hatte einen Fotografen-Freund gesehen, einen jener Menschen, die wirklich alles und jeden kannten.
Marcus seufzte. »Wenn du darauf bestehst.« Er griff in seine Tasche. »Setz zwei Shilling für mich auf den Favoriten. Wir sehen uns dann auf der Tribüne.«
Ich wählte einen Buchmacher namens Willie Price, einen rundlichen, fröhlichen Mann mit einem erdbeerroten Gesicht. Sein großer, gut gebauter junger Gehilfe stand auf einer umgedrehten Kiste neben ihm und gab jemandem weiter entfernt ein Zeichen. Kühn setzte ich eine Guinea auf Sieg und je einen Shilling für Marcus auf Sieg und Platz von Little Marten.
»Kate!«, ertönte eine Stimme hinter mir. Gut. Ich hatte meinem Zeitungsfotografen erlaubt, mich zuerst zu sehen.
»Len, hallo!«
Len Diamond und ich verstanden uns gut, seit er bei meinem örtlichen Fotografieverein einen Vortrag über seine Arbeit gehalten hatte. Er ist der talentierteste Fotograf, den ich kenne, und ich vermute, deshalb habe ich ihn ganz frech in die Freunde-Kategorie eingeordnet, nicht in die bloßer Bekannter. »Müssten Sie nicht unten an der Strecke stehen, um den Sieger zu fotografieren?«
Er zwinkerte, wobei ich nie sicher war, ob es Absicht oder ein nervöser Tick war. »Oh, das werde ich. Aber Sie kennen ja meine Vorliebe für heimliche Aufnahmen. Wir haben heute ein weniger bedeutendes Mitglied des Königshauses hier und die übliche Crème de la Crème.« Selbst beim Sprechen huschte sein Blick umher. Bei seinem Vortrag hatte er gesagt, dass er seine Motive gern unbemerkt einfing. Ich vermutete, dass ein Taschendieb auf frischer Tat ein großer Coup für ihn wäre.
»Wen haben Sie heute im Visier?«
»Sie kennen mich, Kate. Ich kann mich nicht von den Großen, den Guten und den Bösen fernhalten, am allerwenigsten von den Bösen. Wir haben heute jemanden aus New York hier, der sehr gut in letztere Gruppe passt, einen sogenannten ›Geschäftsmann‹.«
»Etwa der Mann mit dem grauen Zylinder?«
»Das mag ich an Ihnen. Wir sind uns sehr ähnlich. Uns entgeht nichts.«
»Wer ist er?«
»Er heißt Hartigan, stammt aus Leeds, die Vorfahren sind irisch. Als Kind haben ihn ein Onkel und eine Tante mit nach New York genommen. Angeblich ist er hier, um seine Familie zu besuchen, die er nicht mehr gesehen hat, seit er kurze Hosen trug, die ihm zweifellos um den Hintern schlackerten. Treffen Sie mich mal im Lloyds, dann erzähle ich Ihnen alles über ihn.«
»Erzählen Sie es mir jetzt. Er ist ein gut aussehender Mann, und anscheinend hat er ein gutes Herz.«
Mit einem besorgten Stirnrunzeln erwiderte Len: »Denken Sie nicht mal dran, Kate. Von meinem Kumpel in der Fleet Street habe ich gehört, dass Hartigan wegen heimtückischen Mordes am helllichten Tag in einer New Yorker Straßenbahn verhaftet wurde. Er hatte einem Rivalen um die Gunst einer Frau mitten ins Herz geschossen. Aber die Polizei und das Gericht hatten zu wenig in der Hand. Kein einziger Zeuge war zu einer Aussage zu bewegen.«
»Und wer ist der Mann bei ihm, der Schotte?«
Len grinste breit. »Oh, der ist in Ordnung. Er brennt den zweitbesten Malt-Whisky in Schottland. Was wollen wir wetten, dass er mit einer Großbestellung nach Hause reist, die er nach Kanada verschiffen soll, von wo sie es auf mysteriöse Weise über die Grenze nach Amerika schafft?«
Also hatte mich mein Sherlock-Instinkt nicht getäuscht. Ich lächelte nachsichtig und probierte es mit einer anderen Taktik. »Hartigan und sein Kumpan setzen auf dasselbe Pferd wie ich.«
Len zog eine Augenbraue hoch. »Erzählen Sie.«
»Flint Jack.«
»Danke für den Tipp. Da Geld immer nach Hause findet, werde ich meinen halben Shilling auf Flint Jack setzen. Darf ich Ihnen jetzt einen Tipp geben?«
»Ich bin ganz Ohr.«
»Da ist ein Bildhauer auf der Tribüne, Rupert Cromer.«
»Ah, ich habe seine Arbeit gesehen. Letztes Jahr hatte er eine Ausstellung.«
Im Weggehen rief Len: »Falls Sie mit Ihrem Pferd gewinnen, kaufen Sie etwas von ihm. Es wäre die beste Investition, die Sie je getätigt haben.«
Ich ging zu Marcus auf die Tribüne. Als er mir ein Glas Champagner reichte, flüsterte er: »Jetzt kann ich entspannen, Kate, und dir die Aufmerksamkeit schenken, die du verdienst.«
Daraus schloss ich, dass er die Observierung jemand anders übertragen hatte, wahrscheinlich dem Kartenverkäufer. Ich flüsterte ebenfalls. »Dann haben dein Mann mit dem grauen Zylinder und sein Whiskybrenner ihren Handel abgeschlossen?«
Marcus runzelte die Stirn. »Wer? Welcher Handel?«
Ich trank einen Schluck Champagner und senkte meine Stimme zu einem Flüstern, das ein ahnungsloser Beobachter für Liebesgetuschel halten könnte: »Hartigan und der Whiskyfabrikant. Ich nehme an, deshalb wollen die Amerikaner, dass du ihn beobachtest, um den Import unanständiger Getränke zu verhindern.«
Marcus verspannte sich. »Wie hast du das herausbekommen?«
Ich tippte an meinen Mund. »Keine Sorge. Meine Lippen sind versiegelt.«
Er seufzte. »Das ist eine sehr heikle Sache. Wir haben sowohl im Ober- als auch im Unterhaus Mitglieder, die ein starkes Interesse daran haben, dass die Umsätze der Brennereien stabil bleiben. Deshalb wollen wir den Amerikanern sagen können, dass der fragliche Gentleman einzig hier war, um seine Familie zu besuchen.«
»Und hat er sie schon besucht?«
»Noch nicht.«
Und natürlich wünschte sich keine Polizeieinheit im Land Hartigan wieder dauerhaft auf britischem Boden.
Wir wanderten zum Balkon, und dort entdeckte ich ein vertrautes Gesicht, Philippa Runcie. Ich ertappte sie zufällig, wie sie so traurig vor sich hin blickte, dass ich erschrak. Philippa ist Amerikanerin, ein Goldkind, und wurde während ihrer Londoner Saison 1913 von meiner Tante gefördert. Und sie machte eine vermeintliche Traumpartie: amerikanisches Geld und britischer Adel. Sie heiratete den begehrtesten Mann in London, manche sagen, in England, den höflichen und charmanten Everett Runcie.
Der ebenfalls hier war, jedoch nicht neben seiner Frau. Eve rett Runcie, der auch mit beinahe fünfzig immer noch gut aussah, stand ein Stück von Philippa entfernt. Er unterhielt sich mit seiner langjährigen Geliebten, Caroline Windham, die allenthalben bekannt war unter ihrem Spitznamen »Wikingerkönigin«. Sie standen mit Rupert Cromer, dem Bildhauer, zusammen, den ich nur von einer Fotografie kannte. Runcie und Caroline Windham lachten über etwas, das Cromer gesagt hatte.
Der kräftige junge Mann, der als Philippas Privatsekretär fungierte, bemühte sich, Konversation mit ihr zu machen, um sie davon abzulenken, dass ihr Mann sie vollkommen ignorierte. Mit seinem breiten, flachen Kopf, dem dicken Hals und der kompakten Statur entsprach der Sekretär perfekt meiner Vorstellung von Attila dem Hunnen.
Philippa sah mich und winkte.
Ich winkte zurück. »Marcus, bist du bereit, dich richtig unter die Leute zu mischen?«
»›Richtiges Unter-die-Leute-Mischen‹ klingt hervorragend.«
In diesem Moment schien eine Bewegung den Privatsekretär zu stören. Er drehte sich rechtzeitig um, dass er Len Diamond sah, der seine Kamera hob und sie auf Philippa mit Runcie und der Wikingerkönigin hinter ihr richtete. Es war allgemein bekannt, dass sich Philippa und Runcie scheiden lassen wollten. In diesem Augenblick hätte ich Len gern seine Thornton- Pickard- Reflexkamera über den Schädel gezogen. Seine eigene Zeitung würde solch ein Bild niemals drucken. Er musste an eines der Londoner Skandalblätter verkaufen.
Philippas Sekretär, King, war erstaunlich schnell für solch einen massigen Burschen. Er packte Diamond am Arm und zog den größeren Mann zur Seite.
Philippa ignorierte die Szene eisern. Ich stellte ihr Marcus als Freund aus London vor, der für ein paar Tage in Yorkshire war. Beim Klang einer neuen Stimme spitzte Everett Runcie die Ohren. Runcie war die Sorte Mann, den man einfach mögen musste, wenn man ihn kennenlernte, denn er war freundlich und witzig. Und stets war er auf der Suche nach neuen Investoren, die er für eines seiner Projekte gewinnen konnte. Er schnappte sich Marcus, während Philippa und ich redeten.
»Lass deinen Freund nicht ködern«, sagte sie, wobei sie sich keinerlei Mühe gab, die Stimme zu senken.
»Wozu?«
»Eine Erdnussfarm. Die ist Everetts jüngstes Groschengrab.«
Ich lächelte. »Ich glaube nicht, dass Marcus dafür zu haben wäre.«
Sie und ich gingen zum Balkon, als über Lautsprecher verkündet wurde, dass man die Pferde hinausführte.
»Hast du auf eines gesetzt?«, fragte ich Philippa.
Sie lächelte milde. »Ich wette nicht. Aber ich habe ein Pferd gekauft, das als Deckhengst in die Staaten überführt werden soll.«
Also würde es nicht mehr lange dauern, bis sich das goldene Paar trennte. Die Gerüchte von einer Scheidung hatte ich vor ungefähr einem Monat erstmals gehört.
»Und welches Pferd feuerst du an?«, fragte ich.
»Das verrate ich noch nicht.« Sie hob ihr Fernglas an und blickte zu den Startgattern.
»Ich habe auf Flint Jack gesetzt.«
»Dann nehmen Sie dies lieber. Ich bin kein Wetter.«
Ich drehte mich um und sah, wer das gesagt hatte. Es war Rupert Cromer, der Bildhauer. Er war ein Riese von einem Mann mit hübschem hellem Haar und einem Bart, der dringend getrimmt werden musste. Cromer hielt mir sein Fernglas hin.
»Vielen Dank.«
Er lächelte. »Schon gut. Mir ist gleich, wer als Erster durchs Ziel läuft, also viel Glück!«
Der Start verlief glatt, und Little Marten und Flint Jack rannten Seite an Seite. Everett Runcie rief Little Martens Namen, ich Flint Jacks.
Ich behielt die beiden Pferde im Blick. Komm schon, Flint Jack! Und als hätte er mich gehört, holte er auf und führte auf einmal um eine Länge.
Hinter mir fragte Marcus: »Hast du meine zwei Shilling auf Flint Jack gesetzt?«
»Nein! Du wolltest, dass ich auf den Favoriten setze.«
Das Rennen endete mit Jubel und Stöhnen.
Bei der Boshaftigkeit in Everett Runcies Stimme durchfuhr mich ein kalter Schauer. Er zerriss seinen Wettabschnitt und warf ihn zu Boden. Dann sah er Philippa geradezu hasserfüllt an und sagte: »Ich habe auf das falsche Pferd gesetzt. Mal wieder.«
Sie wurde rot und wandte sich ab. Ich war froh, dass Marcus ein Gespräch mit Philippa begann. Er winkte einen Kellner herbei und reichte ihr etwas zu trinken.
Ich gab Cromer das Fernglas zurück. »Danke. Es hat mir Glück gebracht.«
Er lächelte. »Jederzeit gern.« Dann drückte er mir die Hand. »Rupert Cromer.«
»Kate Shackleton. Ich war letztes Jahr in Ihrer Ausstellung.« Vielleicht machte mich der Gedanke an den Wettgewinn leichtsinnig. Bisher hatte ich nie erwogen, Gemälde oder Skulpturen zu kaufen.
»Was gefiel Ihnen dort am besten?«
Nun hatte ich es getan. Ich murmelte etwas von seiner Mutter mit Kind und versuchte, mich an meine Eindrücke zu erinnern. Das Stück, das den größten Aufruhr verursacht hatte, war ein Akt gewesen, für den angeblich die Wikingerkönigin Modell gesessen hatte.





























