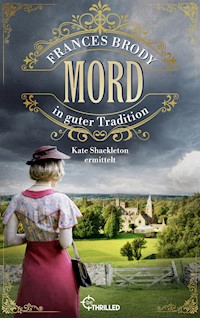4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kate-Shackleton-Krimis
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Entdecken Sie England und die Zwanziger Jahre mit der charmanten Detektivin Kate Shackleton - beste Krimi-Unterhaltung für alle Fans von Ann Granger und M. C. Beaton
Kate Shackleton liebt Rätsel. Und dank ihres wachen Verstands hat die junge Kriegswitwe noch jedes gelöst. Als eine Bekannte sie bittet, dem mysteriösen Verschwinden ihres Vaters auf den Grund zu gehen, sagt Kate sofort zu. Ihre Nachforschungen führen sie nach Bridgestead, ein idyllisches Dörfchen in Yorkshire, wo der Verschwundene eine Weberei leitete. Als Kate den Dorfbewohnern auf den Zahn fühlt, wird sie den Eindruck nicht los, dass hier etwas ganz gehörig faul ist: Wieso scheint niemand zu wollen, dass sie den Fall löst? Was verbergen die Dörfler? Auf der Suche nach Antworten gerät Kate ins Visier einer Person, die über Leichen geht, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt.
Dieses eBook enthält die Bonus-Kurzgeschichte "Eine unerhörte Tat. Kate Shackletons erster Fall - Wie alles begann".
"Kate Shackleton ist eine wundervolle Detektivin" ANN GRANGER
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
1. Die Geschichte entspinnt sich
2. Der Mann im heimischen Tweed
3. Der Schal aus schlesischer Merinowolle
4. Crêpe de Chine
5. Krankenhauswäsche
6. Der Einschuss
7. Kettfäden verdrehen
8. Häkelgarn
9. Modetafeln
10. Färbernebel
11. Scheren
12. Vorgarn
13. Khaki
14. Tänzelnde Schiffchen
15. Der Tuchmoloch
16. Aufschlagen
17. Spülen
18. Ein Anzug aus feinstem Mohair
19. Zarte Stoffwaren
20. Mischwolle
21. Hocken
22. Der Kettfaden
23. Spannen
24. Noppen & Flicken
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Bonus-Kurzgeschichte
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Kate Shackleton liebt Rätsel. Und dank ihres wachen Verstands hat die junge Kriegswitwe noch jedes gelöst. Als eine Bekannte sie bittet, dem mysteriösen Verschwinden ihres Vaters auf den Grund zu gehen, sagt Kate sofort zu. Ihre Nachforschungen führen sie nach Bridgestead, ein idyllisches Dörfchen in Yorkshire, wo der Verschwundene eine Weberei leitete. Als Kate den Dorfbewohnern auf den Zahn fühlt, wird sie den Eindruck nicht los, dass hier etwas ganz gehörig faul ist: Wieso scheint niemand zu wollen, dass sie den Fall löst? Was verbergen die Dörfler? Auf der Suche nach Antworten gerät Kate ins Visier einer Person, die über Leichen geht, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt.
FRANCES BRODY
Mord nach Strich und Faden
Kate Shackleton ermittelt
Aus dem Englischen von Sabine Schilasky
Im Andenken an Peter
Anmerkung
Bradford hatte einst Zwirnerei-Millionäre, die über mehr Rolls-Royces pro Zylinderhut verfügten als die Millionäre in London. Heute stehen die Fabriken still, und diejenigen, die nicht auf mysteriöse Weise abgebrannt sind, wurden zur anderweitigen Verwendung umgebaut.
Bridgestead findet sich auf keiner Karte, ebenso wie Braithwaites Mill in keinem Branchenverzeichnis auftaucht.
1Die Geschichte entspinnt sich
Mein Name ist Kate Shackleton. Ich bin einunddreißig Jahre alt und halte mit aller Kraft an meiner Freiheit fest. Da ich verwitwet bin, möchte meine Mutter mich wieder bei sich haben, doch nachdem ich die Unabhängigkeit kosten durfte, habe ich nicht vor, aufs Neue in geselliger Langeweile unterzugehen.
Es war sieben Uhr an einem schönen Aprilmorgen, und ich lag gemütlich unter meinen Decken und dem roten Daunenbett. Durch die offenen Vorhänge blickte ich zum blauen Himmel und zu der einzigen kleinen weißen Wolke weit und breit. Im Batswing Wood sang eine Drossel. Eine Krähe landete auf meinem Fenstersims, neigte den Kopf zur Seite und beobachtete mit einem Knopfauge, wie ich mich aus dem Bett schwang und auf dem Läufer aus Lammfell streckte, wobei ich die Zehen in die weiche Wolle grub. Der Krähenbesuch wandte sich ab und ließ ein Andenken auf den Sims plumpsen, ehe er davonflog.
Es war Zeit, den Tag zu beginnen. Unten traf die Post ein, was an dem Klappern des Briefschlitzes, gefolgt von einem leisen, flappenden Geräusch auf der Fußmatte, zu erkennen war.
Während ich meine Zähne putzte, war das Hufklappern eines Pferdes zu hören, das in Richtung Headingley Lane lief.
Die Hintertür ging auf. Das musste Mrs. Sugden sein, die sich ihrer selbstgewählten Aufgabe widmete. Sie schepperte mit Eimer und Schaufel, eilte den schmalen Weg zur Straße entlang und sammelte den Pferdemist ein. Dünger. Gut für die Rosen, sagt sie. Gutes darf man nicht vergeuden. Aber wie viel Dünger brauchte man in einem einzigen Garten?
Zwischen dem Kohlenschuppen und dem Zaun, der den Garten vom Wald trennt, wuchs ein kleiner Berg an Dung, und Heere von Schmeißfliegen erfreuten sich an seinem Gestank.
Da ich weiß, dass einige Leute, besonders meine Mutter, meine Lebensweise wie auch meine Beschäftigungen eigenartig finden, halte ich mich zurück, was Mrs. Sugdens Pferdemist-Gewohnheit betrifft. Aus Gründen, über die ich nicht mal nachdenken möchte, hat meine Haushälterin sich nun einmal zur Pferdedungwache des Viertels ernannt.
Ich wohne nur einen kurzen Radweg von Leeds’ Stadtzentrum entfernt, unweit der Universität und der General Infirmary, wo Gerald früher als Arzt arbeitete. Wir wohnen in dem Pförtnerhaus, das die Eigentümer des Herrenhauses verkauften, als sie ihr Personal verkleinerten. Ein hübscher Anbau bietet Mrs. Sugden ihre eigene Wohnung, was uns beiden sehr recht ist.
Wegen der Nähe zur Universität und Klinik wohnen viele kluge Köpfe in der Gegend, zu denen ich mich allerdings nicht zähle. Mein Talent zur Lösung von Rätseln verdanke ich meinem Vater, dem Polizisten, der mich lehrte, hartnäckig in meiner Neugier zu sein und ein Auge für Details zu haben.
Mit dem Morgenmantel über den Schultern setzte ich mich aufs Bett und zog meine Strümpfe an. Die Knie sind ein eigenartiger Teil der Anatomie. Meine sind für meinen Geschmack zu knochig. Während ich sie betrachtete, dachte ich an das eine Rätsel, das ich noch immer nicht gelöst hatte: Seit vier Jahren wurde mein Ehemann Gerald vermisst und für tot gehalten.
Wie eine Schlafwandlerin hatte ich mich von seiner und meiner Familie bewegen lassen, die Versicherung einzufordern, das Haus auf mich überschreiben zu lassen und sein Erbe anzutreten. Finanziell bin ich abgesichert. Ich tue das, was wir Menschen uns so ausdenken, um dem Leben einen Sinn abzuringen. Das Schlafwandeln ist vorüber, dennoch bleibt meine Welt aus den Fugen.
Sosehr ich mich auch bemüht hatte, konnte ich bislang niemanden finden, der Geralds letzte Momente bezeugt oder die Umstände seines Todes ergründet hätte.
Die einzige Nachricht von ihm, sofern man sie überhaupt so nennen konnte, ließ sich in wenigen Worten zusammenfassen. Captain Gerald Shackleton vom Royal Medical Corps wurde zuletzt in der zweiten Aprilwoche 1918 auf einer Straße nahe Villers-Bretonneux gesehen, wo es zu schwerem Granatenbeschuss kam. Es war Gas in dem Tal gewesen, und es hatte viele Opfer gegeben. Gerald hatte in einem Steinbruch Posten bezogen und lagerte seine Krankentragen und sonstige Ausrüstung in einer großen Höhle. Er hatte mir geschrieben, wie wenig er auf seinem Lazarettposten ausrichten konnte – abgesehen davon, die Männer durch seine bloße Anwesenheit zu beruhigen. Eine Granate traf den Steinbruch. Geralds Träger wurden getötet, seine Ausrüstung zerstört. Die wenigen Männer, die noch übrig waren, machten sich zu Fuß auf den Weg nach Amiens. Ich konnte einen Lieutenant aufspüren, der auf der Straße dorthin mit Gerald gesprochen hatte. Er erzählte, dass es ein Sperrfeuer nach dem anderen gegeben hatte. Doch irgendjemand musste Gerald danach noch gesehen haben, nur für einen Moment. Jemand musste wissen, was geschehen war.
Vier Jahre später sagt mir eine Hälfte meines Verstandes, dass Gerald tot ist. Die andere Hälfte stellt weiter Fragen. Manchmal schrecke ich nachts aus dem Schlaf und denke, dass Gerald noch irgendwo auf dieser Erde sein könnte – nicht tot, aber verwundet und verlassen.
Nachdem Gerald vermisst gemeldet wurde, fing ich an, für andere Frauen Nachforschungen anzustellen. Ich konnte einige entscheidende Einzelheiten über den ein oder anderen Ehemann oder Sohn in Erfahrung bringen, Augenzeugenberichte von Freunden oder Kameraden. 1920 spürte ich einen Soldaten auf, der sein Gedächtnis verloren hatte, und konnte ihn wieder mit seiner Familie vereinen. Ein Offizier, den ich letzten Dezember aufspürte, wusste hingegen noch sehr gut, wer und woher er war. Er hatte schlicht beschlossen, seine Familie und seine Freunde hinter sich zu lassen und ein neues Leben in Crays Foot zu beginnen, von wo er jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit in der Kent District Bank fuhr.
Die Suche nach Menschen und Informationen, das Durchsieben der Asche, die der Krieg zurückgelassen hatte, zog mich schrittweise immer tiefer in die Detektivarbeit hinein. Während meine Bemühungen in meinem eigenen Fall scheiterten, waren sie für andere durchaus von Erfolg gekrönt. Und so konnte ich etwas Nützliches tun.
Das verlockende Aroma von gebratenem Bacon wehte die Treppe hinauf, holte mich aus meinen Gedanken und trieb mich zum Kleiderschrank.
Beim Öffnen des Schrankes stöhnte ich. Ich konnte mir etwas Hübsches anziehen, etwa das Kleid aus Delphos-Seidenplissee, mein elegantes schwarzes Kleid, das modische Coco-Chanel-Kostüm oder das Kleid mit dem Gürtel und dem passenden Cape, über dem ich keinen Mantel tragen kann. Diese Stücke hängten eingeklemmt zwischen auf Wadenlänge gekürzten Vorkriegsröcken, dem Hosenrock zum Fahrradfahren und dem schäbigen Mantel, den ich trug, als ich seinerzeit mit den anderen Frauen und Mädchen vom Voluntary Aid Detachment, kurz VAD, als freiwillige Helferin vom Bahnhof Leeds aus aufgebrochen war. Zum Glück besaß ich mehrere Nachmittagskleider. Mrs. Sugden und ich studierten regelmäßig die Rubrik »Kleid des Tages« im Leeds Herald. Mrs. Sugden kann beinahe alles kopieren, und ich bin eine brauchbare Assistentin.
Ich zog meinen Lieblingsrock heraus, holte eine hellgrüne Bluse aus der Kommode und nahm mir fest vor, noch diese Woche einkaufen zu gehen und mich elegant auszustatten. Zu dem Rock und der Bluse wählte ich eine kurze, gegürtete Jacke im Militärstil. Leichtere Kleidung hätte zur Folge gehabt, dass mir Mrs. Sugden unten sofort mit einer ihrer Bauernregeln gekommen wäre: »Wenn es der Teufel will, kommt der Frost noch im April.«
Ich sah in den Spiegel und bürstete mir das Haar. Vor dem Krieg trug ich es lang. In gewisser Weise machten lange Haare das Leben einfacher, ausgenommen nach dem Bad, aber ich würde es nicht wieder wachsen lassen. Könnten Haare sprechen, würden meine vermutlich sagen, sie wären lieber lang. Jedenfalls sind sie gegen mich und müssen mit Wasser und Bürste nach unten gezwungen werden.
Nach dem Frühstück am Küchentisch schenkte ich mir eine zweite Tasse Tee ein und griff nach der Post.
Mrs. Sugden war an der Spüle beschäftigt. Mit ihrer hohen Stirn und der langen, schmalen Nase, die andere gern mit Intelligenz und Überheblichkeit gleichsetzten, hat sie etwas von Edith Sitwell an sich. Sie drehte den Kopf zu mir und bereitete mich wie üblich auf das vor, was mich erwartete: »Sie haben nur zwei richtige Briefe bekommen. Einer ist von Ihrer Mam.«
Meine Mutter würde es nicht entzücken, als meine »Mam« bezeichnet zu werden.
Ich öffnete ihren Brief zuerst, weil er gewiss irgendwelche Anweisungen enthielt.
Mutter erinnerte mich, dass sie Zugfahrkarten für uns für den elften April nach London gekauft hatte, am Dienstag in einer Woche. Ich mag Tante Berta und würde ihre Geburtstagsfeier um nichts versäumen wollen. Sie und Onkel Albert leben in Chelsea in einem Haus, das von innen sehr viel größer wirkt als von außen.
Nimm nicht wieder dasselbe schwarze Kleid mit, schrieb Mutter. Das hast du schon die letzten drei Jahre getragen. Und ehe du jetzt sagst, dass du das Delphos-Kleid anziehst, denk bitte daran, wer es dir vermacht hat und dass es praktisch eine Antiquität ist. Wir werden in London einkaufen, doch zuvor werde ich diesen Montag mit dem Zug nach Leeds kommen. Wir beide werden zu Marshalls gehen und ein Abendkleid aussuchen. Es ist Zeit für einen Farbtupfer.
Sicher hatte es mal eine Zeit gegeben, in der es mir gefiel, Kleider kaufen zu gehen. Hm, Montag. Heute war Samstag. Vielleicht war das Ganze gar nicht so schlimm. Ich könnte das tun, würde es müssen. Dennoch sollte ich wohl einfach zugeben, dass meine Abneigung gegen ein neues Abendkleid dem gänzlich unlogischen Gefühl geschuldet ist, dass ich, sollte Gerald durch ein Wunder wieder zurückkommen, lieber etwas tragen möchte, was er wiedererkennt. Ich weiß, dass dieser Gedanke unvernünftig ist und mich wahrscheinlich zu einem Fall für den Psychiater macht, aber so ist es nun mal.
In dem braunen Umschlag war das Bewerbungsformular für den Fotografie-Wettbewerb All British Photographic Competition 1922, Einsendeschluss 30. Juni. Ich bin eine begeisterte Fotografin, seit Tante Berta und Onkel Albert mir zum zwanzigsten Geburtstag eine Brownie-Kameraausrüstung schenkten. Bis heute erinnere ich mich an meine Freude, als ich die Schleife zerschnitt, das braune Papier aufschlug, den Pappkarton öffnete und ein magisches Zubehörteil nach dem anderen entdeckte. In dem Karton hatten sich eine stabile Kastenkamera befunden, bis zu sechs 3¼ x 2¼ Inch-Aufnahmen, ohne einen neuen Film einzulegen, die Tageslicht-Entwicklerbox, Papier, Chemikalien, ein Glasmessbecher sowie die ermutigende Ankündigung, hier alles Nötige für den Anfänger, um Bilder von hoher Qualität aufzunehmen, in den Händen zu halten. Ich abonniere die Zeitschrift Amateur Photographer und gehe hin und wieder zu Vorträgen und Diskussionen des Vereins hier in Headingley. Doch an einem Wettbewerb hatte ich noch nie teilgenommen.
»Ich glaube, ich mache bei diesem Fotografie-Wettbewerb mit, Mrs. Sugden.«
Wieder blickte sie über die Schulter zu mir und hob die Teekanne an. »Warum auch nicht? Sie fotografieren ja oft genug. Aber bitten Sie mich ja nicht, für Sie zu posieren.«
Mit diesen Worten eilte sie zur Küchentür, als könnte ich auf der Stelle eine Kamera zücken und sie an einen Stuhl fesseln.
Es waren noch beinahe drei Monate bis zum Einsendeschluss, womit mir reichlich Zeit blieb, einen richtig guten Druck von einer meiner älteren Fotografien auszuwählen oder mir ein neues Motiv zu suchen. Am liebsten fotografiere ich Menschen, die entweder in irgendeine Tätigkeit vertieft oder ganz sie selbst sind.
Ich beobachtete durchs Fenster, wie Mrs. Sugden die Teekanne ausleerte. Sie schüttet die Teeblätter nie auf ihren Misthaufen; der bleibt unangetastet. Es wäre eine ziemliche Herausforderung, einen Dunghaufen zu fotografieren, auf dem Schmeißfliegen tanzen, und das so lebendig und mit solch einer Kunstfertigkeit, dass sich der Betrachter beim Anblick die Nase zuhält. Nein, besser nicht.
Den dicksten Brief hob ich mir bis zum Schluss auf.
Tabitha Braithwaite hatte die saubere, leicht geneigte Schrift eines Schulmädchens und schenkte ihrem L eine großzügige Schleife. Ein Amateur in der Kunst der Handschriftenanalyse würde wohl sagen, dass sie ein großzügiger Mensch ist, und das wäre die Wahrheit.
Ihr Brief war mehrere Seiten lang, und die Schrift wurde mit jeder Seite größer. Beim Lesen stockte mir der Atem. Unsere Wege hatten sich während des Krieges zweimal gekreuzt, als wir beim Voluntary Aid Detachment waren. Danach waren wir uns bei der Eröffnung des Cavendish Clubs im Queen Anne House begegnet. Wir beide waren große Unterstützerinnen eines Clubs für VAD-Frauen in London. Seither schrieben wir uns an Weihnachten, und in einem dieser Briefe musste ich ihr von meiner Detektivarbeit und meinen bisherigen Erfolgen im Aufspüren Vermisster erzählt haben.
Ich hatte keine Ahnung, wie Tabitha eine solche Last die ganze Zeit mit sich herumtragen konnte. Kein einziges Mal hatte sie ihre privaten Sorgen und ihren Verlust erwähnt. Was sie mir nun schrieb, war Folgendes: Ihr Vater wurde im August 1916 vermisst gemeldet, einen Monat nachdem ihr Bruder an der Somme gefallen war. Nun, da sie im Begriff war zu heiraten, hatte sie diesen einen dringenden Wunsch, der sie halb verrückt machte. Sie malte sich aus, dass ihr Vater sie zum Altar führen würde. Die Trauung sollte am Samstag, den 6. Mai, in einer Kirche in Bingley stattfinden.
Ich las den Brief ein zweites Mal, suchte nach einer Erklärung, warum sie über sechseinhalb Jahre gewartet hatte, bis sie entschied, nach ihrem vermissten Vater suchen zu lassen. Und natürlich tauchte das eine Wort auf, jene fünf Buchstaben, die uns alle gezeichnet haben. Krieg. Doch Mr. Joshua Braithwaite war ein Zivilist gewesen, ein Webereibesitzer.
Der Krieg hatte das normale Leben verlangsamt. Wurde in Friedenszeiten ein Mann vermisst gemeldet, setzte man alle Hebel in Bewegung, um ihn zu finden. In Kriegszeiten schienen Männer ohne Uniform weniger wichtig. Mr. Joshua Braithwaite hätte dennoch eine Ausnahme sein sollen. Zwischen den Zeilen spürte ich eine gewisse Scham angesichts der Situation. Das erklärte wohl auch, warum Tabitha ungern über die Sache sprach.
Mrs. Sugden kam zurück in die Küche und spülte die Teekanne aus. »Irgendetwas Interessantes, Madam?«
Sie nennt mich Madam, wenn sie neugierig ist. Ich könnte schwören, dass sie es ahnt, wenn ich einen neuen Fall habe. Allerdings kann sie auch eine große Hilfe sein und ist die Diskretion in Person.
Ich hörte mich seufzen. Der Brief beunruhigte mich. »Es ist eine Bitte um Hilfe«, sagte ich leise. »Und es klingt nach einer unmöglichen Situation.«
Mrs. Sugden zog sich einen Stuhl heran und setzte sich mir gegenüber hin. Dann beugte sie sich nach vorn und faltete die Hände.
»Der Brief ist von einer Miss Braithwaite. Wir sind uns zum ersten Mal während des Krieges in einem Krankenhaus in Leeds begegnet. Und dann noch einmal in Frankreich.«
Ich hätte Tabitha Braithwaite nicht als enge Freundin bezeichnet, da wir uns dafür nicht gut genug kannten, aber das, was wir beide durchgemacht hatten, schaffte eine besondere Verbundenheit. »Es geht um ihren Vater, Besitzer einer Weberei, der 1916 verschwand.«
Ausnahmsweise versuchte Mrs. Sugden nicht, den Brief kopfüber zu lesen, und sah mich mit einem Ausdruck solch tiefen Mitgefühls an, dass ich mich fragte, wen sie als junge Frau verloren hatte. Ich hatte sie nie danach gefragt.
Mrs. Sugdens Augenbrauen hoben sich und sorgten für nachdenkliche Falten auf ihrer hohen Stirn. »Und nach all der Zeit möchte sie, dass Sie ihn finden?«
Ich blickte erneut auf die letzte Seite von Tabithas Brief. »Ja, aber das ist nicht alles. Sie möchte meine Dienste offiziell in Anspruch nehmen, mir alle Ausgaben erstatten und mehr als mein übliches Honorar zahlen, weil die Angelegenheit so kurzfristig ist.«
Für einen Moment saßen Mrs. Sugden und ich stumm da. Ich habe schon aus Freundlichkeit Verwandten geholfen, Vermisste zu finden, unentgeltlich. Nun konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich erfreut, erschrocken oder gekränkt sein sollte, weil Tabitha mir Geld anbot.
Um Mrs. Sugden das mühsame Überkopflesen zu ersparen, schob ich ihr den Brief zu. Stirnrunzelnd und mit der Brille tief auf ihrer Nase, las sie das Geschriebene. Ihre dünnen, abgearbeiteten Finger mit den vom Alter geriffelten Nägeln blätterten langsam die Seiten um. Mrs. Sugden liest grundsätzlich schnell, verschlingt Romane und tauscht mit einem großen Netzwerk von Vielleserinnen in Headingley und Woodhouse eifrig die spannendsten Taschenbücher aus.
Nachdem sie das letzte Blatt umgedreht hatte, nagte sie an ihrer Unterlippe, als würde es ihr beim Nachdenken helfen. »Na, dann tut endlich mal jemand das Richtige.«
»Nach ihrem Vater suchen?«
Sie schob den Brief wieder über den Tisch zu mir. »Das auch. Aber mich beeindruckt die Bezahlung, die sie Ihnen für Ihre Mühe anbietet. Sie haben sich einen Namen gemacht.«
»Doch nur, weil sie mich kennt.«
»Und weil sie weiß, dass Sie hervorragend sind.«
Was für ein ungünstiger Zeitpunkt. Ich wollte Tabitha Braithwaite sehr gerne helfen, doch mit Mutters Einkaufsexpedition und der darauffolgenden Woche in London war das schwerlich einzurichten.
»Ich habe damals etwas über den Fall gelesen.« Mrs. Sugdens Gedächtnis verblüffte mich immer wieder. Sie sog Zeitungsmeldungen auf wie Löschpapier. »War er nicht einer von den Bradford-Millionären?«
»Nicht direkt aus Bradford. Die Braithwaite-Fabrik befindet sich in Bridgestead, zwischen Bingley und Keighley.«
Sie winkte ab. »Ist doch egal. Das liegt alles in der gleichen Richtung.«
»Woran erinnern Sie sich bei dem Fall, Mrs. Sugden?«
»Es ist lange her, und in den letzten sechs Jahren ist eine Menge passiert.« Sie nahm ihre Brille ab und polierte die Gläser mit ihrer Schürze. »Ich weiß aber noch, wie sehr mich überraschte, dass sich ein Mann wie Mr. Braithwaite in Schwierigkeiten gebracht hatte.«
»Was für Schwierigkeiten?«
»Genau wurde das nicht gesagt. Ich hatte nur so ein Gefühl, dass da mehr war, als man auf den ersten Blick glaubte. Ich erinnere mich, dass es um die Zeit war, als es diese schreckliche Explosion in Low Moor gab. Ein Cousin von mir war einer der Feuerwehrmänner, die dort ihr Leben verloren.«
Sie nahm die Morgenzeitung auf und klatschte sie verärgert auf den Tisch. »Sehen Sie sich das an. Nun sehen Sie nur!«
Ihr knochiger Finger zeigte vorwurfsvoll auf die Titelzeile: Mannschaftsaufstellungen beim Universitätsrudern bekannt gegeben. »Typisch«, sagte sie. »Die drucken die Namen von einem Haufen junger Ruderer in der Zeitung, aber haben sie den meines Cousins und die der anderen Feuerwehrmänner genannt, die ihr Leben ließen? Haben sie nicht. Sie haben nicht mal geschrieben, wo die Explosion stattgefunden hat.«
»Es gab die Zensur. Man konnte nicht einmal einen Wetterbericht lesen, weil das dem Feind hätte helfen können.«
»Dutzende Menschen kamen ums Leben, doch kein einziger Name wird veröffentlicht. Aber ein feiner Pinkel dreht durch, und das können sie drucken.«
Dürfte Mrs. Sugden die Times herausgeben, würde sie sehr genau bestimmen, was Nachrichten waren und was keine.
Sie öffnete die Küchenschublade. »Aber wenn die junge Frau will, dass Sie ihren Dad finden …« Sie kramte zwischen Flaschenöffnern, Schnur, Band, Siegelwachs und Bandmaßen herum, bis sie einen Block und einen Bleistiftstummel gefunden hatte. »Dann sollte ich lieber notieren, wo Sie wann sein werden. Nur zur Sicherheit. Zweifellos wird Ihre Mam dieses Telefon zum Glühen bringen.«
»Ich weiß nicht, wie ich Tabitha helfen kann, zumindest nicht vor ihrer Hochzeit. Sie heiratet in …« Ich sah noch einmal im Brief nach. »Fünf Wochen.« Ich beobachtete, wie Mrs. Sugden Tabitha Braithwaites Adresse und Telefonnummer aufschrieb. »Selbstverständlich würde ich ihr gerne helfen, doch es muss damals schon nach ihm gesucht worden sein. Jede Spur wird längst eiskalt sein.«
Ich erwähnte nicht, dass es mir schreckliche Angst einjagte, für eine richtige Detektivin gehalten zu werden, die sich Honorar und Spesen bezahlen ließ. Nun bereute ich fast, gegenüber Tabitha damit geprahlt zu haben, dass ich einen verschwundenen Offizier in einer Bank in Kent aufspüren konnte, nachdem ein professioneller Ermittler versagt hatte.
Es wäre unanständig, Geld von Tabitha anzunehmen. Ich bin keine richtige Ermittlerin, sondern lediglich stur und manchmal vom Glück gesegnet. Meine üblichen Kontakte, um vermisste Soldaten zu finden, waren die Regimenter. Offiziere und Soldaten waren jederzeit bereit zu helfen. Aber dies hier war etwas anderes. Gleichzeitig reizte mich Tabithas Bitte. Könnte ich herausfinden, was mit Joshua Braithwaite geschehen war, einem Zivilisten ohne jede Militärverbindung, dessen letzte Spur bereits kalt war, wäre das ein echter Erfolg. Es könnte mich auf irgendeine Weise verändern. Ich hätte etwas vorzuweisen, würde mir Anerkennung verdienen. Gegenwärtig bin ich eher eine Art gute Fee, an die sich Ehefrauen oder Mütter wenden, wenn sie nicht weiterwissen und keiner mehr auf ihre Nachfragen eingeht.
Warum sollte ich also nicht mal eine schwierige Aufgabe annehmen und dafür eine Bezahlung akzeptieren?
Es wäre zumindest ein guter Vorwand, um mich vor dem kurzfristig angesetzten Termin zum Kleiderkauf zu drücken.
Mrs. Sugden runzelte die Stirn, sodass dort zwei perfekt parallele Linien erschienen. »Sie haben schon Ja gesagt.«
»Nein, habe ich nicht.«
»Ich sehe es in Ihren Augen. Sie können nicht widerstehen.«
Ich steckte Tabithas Brief in die Innentasche meiner Jacke. »Es schadet nicht, sich die Sache anzusehen. Da Sie sich erinnern, in der Zeitung von Joshua Braithwaite gelesen zu haben, werde ich zum Herald gehen und versuchen, den Artikel zu finden, den Sie erwähnten.«
Und alle anderen, die es noch gegeben haben könnte, dachte ich. Ich würde mir ein Notizbuch schnappen und zu den Zeitungsredaktionen radeln. Wenn ich zügig in die Pedale trat, könnte ich in zwanzig Minuten dort sein.
Mrs. Sugden strahlte. Ihr gefiel es immer, mich für ein oder zwei Stunden aus dem Weg zu haben. Dann stand es ihr frei, sich ihrem Dunghaufen zu widmen, der noch auf den Inhalt ihres Nachttopfes wartete.
»Was sage ich, wenn Ihre Mam anruft?«, fragte sie.
2Der Mannimheimischen Tweed
Ich bog mit dem Rad in die Headingley Lane. Keiner hatte dem März gesagt, dass er verschwinden und dem April das Feld räumen sollte. Ein kühler Wind blies mir in den Nacken, so kalt, dass es kitzelte. Segel wären eine gute Idee für ein Fahrrad, damit man sie bei günstigem Wind setzen und so zusätzlichen Antrieb gewinnen könnte.
In der Woodhouse Lane am Rand des Moors setzte sich ein Telegrammjunge in den Kopf, ein Wettrennen mit mir zu veranstalten. Eine Weile lang lagen wir Kopf an Kopf, was uns den kräftigen Fluch eines Lumpensammlers eintrug, den wir überholten. Mich machte dieser Fluch langsamer, nicht jedoch den Jungen. Er preschte voraus und setzte sich vor mich, sodass ich genötigt war, entweder zu bremsen oder auszuweichen. Dabei blickte er sich um, lüpfte seine zu kleine Mütze und grinste mich an wie ein Kobold. Ich gab mich mit einem Winken geschlagen.
Nur zu, pickliger Knabe. Jemand muss dir ja den Tag versüßen, ehe du unter der Tram endest.
Oben an der Albion Street bremste ich leicht ab. Reklametafeln am Gehwegrand und Plakate in den Fenstern verkündeten die Schlagzeilen des Tages: Irischer Gesetzesentwurf gebilligt – Mr. Churchill und das neue Abkommen.
Plötzlich kamen mir Bedenken. Mir wurde erst jetzt richtig bewusst, wie unsinnig mein Vorhaben war – ähnlich wie wenn man während einer Wanderpause auf einem feuchten Stein gehockt hat, es aber erst entdeckt, wenn man wieder aufsteht und der Rock hinten klamm ist. Auf jeden Fall müsste ich bei meinen Erkundigungen diskret sein. Tabitha wäre nicht erfreut, sollte ein Reporter durchschauen, was ich vorhatte, und die Geschichte um ihren Vater erneut in die Zeitungen kommen.
Der Pförtner empfahl mir, mein Fahrrad hinter dem Gebäude abzustellen, also schob ich es durch eine Seitengasse zu einem gepflasterten Hof, wo Männer in Hemdsärmeln und Westen schwere, geschnürte Bündel mit den Zweitausgaben auf einen Blockwagen hievten, um sie durch die Gasse nach vorn zu bringen und an die Zeitungsverkäufer und Läden in der Stadt auszuliefern.
Ich lehnte mein Fahrrad an ein Geländer und machte mich auf den Weg zum Empfang. Ein rotgesichtiger Pförtner saß über ein rautenförmiges Kreuzworträtsel gebeugt und kaute auf seinem Bleistift. Dass er nicht aufschaute, sollte signalisieren, wie wenig er von der lästigen allgemeinen Öffentlichkeit hielt.
Wäre ich eine richtige Ermittlerin, hätte ich eine Karte oder irgendeinen Ausweis bei mir getragen, um ihn in Habachtstellung zu bringen.
»Guten Tag. Ich würde mir gerne Zeitungsausgaben aus dem Sommer 1916 ansehen.«
»Öffentliche Bücherei, Madam.« Immer noch sah er nicht auf.
»Ich möchte einige alte Ausgaben kaufen.«
Er kaute weiter auf seinem Stift, als er nun hochsah und mich kühl betrachtete. »Wenn Sie eine alte Ausgabe kaufen wollen, brauchen Sie das genaue Datum.«
»Das werde ich wissen, wenn ich gefunden habe, wonach ich suche.«
»Öffentliche Bücherei. Unsere Bibliothek hier ist das Firmenarchiv, Zugang nur für Reporter.«
Ich wusste sehr wohl, dass ich die Zeitungen in der Bücherei einsehen konnte, hatte aber gehofft, dass ich bei meinem Besuch hier noch einige zusätzliche Informationen über Joshua Braithwaite bekommen könnte.
Also verfiel ich auf eine Mrs. Sugden-Technik und las eine der Kreuzworträtselfragen kopfüber. »Stecken Sie bei vier waagerecht fest?«
Er beäugte mich feindselig.
Was war mit dem Mann? War er heute Morgen mit dem linken Fuß aufgestanden, oder mochte er keine Frauen? Ich machte unverdrossen weiter und sagte beinahe entschuldigend: »Ich löse selbst gerne Kreuzworträtsel.«
Wir mussten vier Wörter lösen, bevor er ein wenig auftaute. Ich nutzte es, um noch einmal mein Glück bei ihm zu versuchen.
»Ich recherchiere für einen Bekannten, der ein Theaterstück schreibt. Es spielt im Sommer 1916, und ich bräuchte ein wenig Lokalgeschichte, nur für den Rahmen. Deshalb wollte ich ihm einige alte Zeitungen besorgen.«
Für mich klang diese Lüge recht überzeugend, und anscheinend ging es dem Pförtner nicht anders. Er legte seinen Stift hin.
Sogleich lächelte ich süßlich. »Mein Bekannter sagt, die Presse ist die fünfte Gewalt im Land, und wir tun gut daran, sie nie zu vernachlässigen.«
»Recht hat er«, stimmte der Pförtner zu. Nun saß er tatsächlich aufrecht, nicht mehr träge vorgebeugt.
»Gewiss gelten Sie bei Freunden und Verwandten als Experte in Sachen aktuelles Zeitgeschehen, nicht wahr?«
»Ja, da könnte was dran sein«, bestätigte er mit einem wehmütigen Unterton, der mir verriet, dass dem ganz und gar nicht so war. »Keiner außer dem Herausgeber und den Druckern sieht die Schlagzeilen vor mir.«
»Und Sie wachen über diese großartige Zeitung. Im Mittelalter hätten Sie die Zugbrücke bedient.«
Bedauerlicherweise muss ich gestehen, dass mir diese schmierige Schmeichelei nicht neu war. Mit einem offiziellen Ausweis hätte ich sie nicht nötig gehabt.
Nun leuchteten die Augen des Mannes auf. »Ich weiß, wer Ihnen vielleicht helfen kann.«
»Das dachte ich mir.«
»Unser Mr. Duffield.«
Fünf Minuten später kehrte der Pförtner mit einem vornehmen Gentleman zurück. Er war ungefähr sechzig, trug ein schon oft ausgekochtes weißes Hemd, eine dunkelgrüne Seidenfliege, die bei einem Bühnenzauberer keineswegs deplatziert gewirkt hätte, ein abgetragenes Tweedsakko und eine ausgebeulte Flanellhose. Sein Gesicht war leichenblass, und er hatte dichtes, verdächtig schwarzes Haar, das ihm als Tolle in die Stirn fiel.
Er streckte mir die Hand hin. »Eric Duffield, der Archivar dieser Zeitung.«
»Freut mich sehr, Mr. Duffield. Kate Shackleton.«
»Ich erinnere mich an Sie von einer Spendenveranstaltung in der Infirmary. Dr. Shackletons Witwe. Die Tochter von Superintendent Hood.«
Ich fühlte, wie ich vor Freude und Verärgerung rot wurde. Konnte ich denn nicht dies eine Mal einfach nur Mrs. Kate Shackleton sein?
Mr. Duffield lächelte und entblößte dabei schiefe gelbliche Zähne. »Nun denn, Mrs. Shackleton, wenn Sie mit mir kommen wollen. Sehen wir mal, ob der Herald der Tochter der West Riding Constabulary zu Diensten sein kann. Sie recherchieren für einen Theaterschreiber, wie ich höre?«
War da ein Anflug von Misstrauen? Konnte sein. Ich murmelte etwas, was bejahend klang.
Ohne ein weiteres Wort führte mich Mr. Duffield einen Korridor entlang, von dem links Büros abgingen, und dann in einen noch schmaleren, der vor einem Aufzug endete. Im ersten Stock hielt der Fahrstuhl ächzend an, und wir stiegen aus.
»Arbeiten Sie schon lange hier, Mr. Duffield?«, fragte ich, als er mit mir auf eine schwere Flügeltür zuging.
»Seit fünfunddreißig Jahren. Angefangen habe ich als Laufbursche.«
»Hat es Sie nicht gereizt, Reporter zu werden?«
»Nein, das ist mir viel zu hektisch, Mrs. Shackleton. Ich ziehe es vor, bei den Geistern der Geschichten von gestern zu sein.«
Der große Raum war voller Regale mit Ordnern, die an den Wänden wie auch in der Mitte standen. Unter den hohen Fenstern befanden sich einige alte Eichentische mit einfachen Stühlen. Der Archivar erklärte mir voller Stolz sein Katalogsystem, bevor er mich eindringlich ansah. »Wofür genau interessieren Sie sich?«
Ich wollte ihn fragen, ob er sich an den Fall von Mr. Joshua Braithwaite aus Bridgestead erinnerte. Es hätte mir eine Menge Zeit gespart. Andererseits durfte ich nicht riskieren, den Braithwaite-Fall wieder an die Öffentlichkeit zu bringen.
»Im Grunde sind es eher allgemeine Hintergründe als bestimmte Ereignisse. Ich würde mir gerne die Zeitungsausgaben von Juli und August 1916 ansehen, wenn das möglich ist.«
Ich suchte mir einen Platz an einem holzwurmzerfressenen Tisch unter dem hohen Fenster. Kurz darauf kehrte Mr. Duffield mit einem schweren Ordner zurück und ließ ihn mit einem dumpfen Knall auf den Eichentisch fallen.
Ich schlug den Ordner auf und begann, mir die Zeitungen anzusehen. Dort las ich vom Bradford City Council, der über den Regierungsantrag diskutierte, den Bankfeiertag im August zu verschieben, was bei den Leuten in Bradford nicht gut angekommen war. Ich las von Auszeichnungen für Soldaten, von Fliegerangriffen, der Methodisten-Tagung, den Färberlöhnen und den Opferzahlen von kanadischen Waldbränden.
Die Geschichte, die ich suchte, war am 21. August erschienen. Und sie hatte nichts mit den Informationen zu tun, die ich Tabithas Brief entnommen hatte.
Unter der Überschrift Weberei-Besitzer von Pfadfindern gerettet stand dort:
Mr. Joshua Braithwaite, 50, angesehener Weberei-Besitzer in Bridgestead, wurde am Samstagabend, 19. August, von furchtlosen Pfadfindern vor dem Ertrinken gerettet. Eine fähige Gruppe von ihnen zeltete unter Leitung von Mr. Wardle in Calverton Woods.
Gegen fünf Uhr nachmittags spazierten drei Jungen zum Bridgestead Beck, um ihre Teekessel zu füllen. Dort fanden sie Mr. Braithwaite, seines Zeichens Abstinenzler und Stütze der Bridgestead Kapelle, bewusstlos im Wasser vor. Es wird angenommen, dass er bei einem Spaziergang ohnmächtig wurde.
Der Jüngste der Pfadfinder holte Hilfe, während die beiden älteren Jungen Mr. Braithwaite geistesgegenwärtig ans Ufer zogen. Dank des raschen Eingreifens der Jungen kam Mr. Braithwaite wieder zu sich, war jedoch sehr geschwächt. Auf einer eilig improvisierten Trage wurde er zum Privathaus des örtlichen Arztes getragen, der ihn über Nacht zur Beobachtung dort behielt. Es wurde nach Mrs. Braithwaite geschickt, die umgehend zum Arzt eilte und die Nacht über am Bett ihres Ehemannes wachte.
Ich machte mir Notizen, weil ich meine wahre Absicht nicht preisgeben wollte, indem ich um diese Ausgabe der Zeitung bat. Am nächsten Tag fand sich nichts zu dem Vorfall in der Zeitung. Inzwischen waren meine Hände grau von Druckerschwärze. Ich blätterte weiter zum 23. August. Hier gab es den Beitrag über die Explosion in einer Munitionsfabrik in Yorkshire, über den sich Mrs. Sugden so ereifert hatte, weil keinerlei Einzelheiten darin zu finden waren und ihr Cousin unerwähnt geblieben war. Der Artikel kam von der offiziellen Pressestelle, war vom entsprechenden Ministerium genehmigt und schien mir recht angemessen. Weiter zum 24. August. Immer noch nichts von Braithwaite. Um weiterhin vorzugeben, dass ich mich für den ganzen Sommer 1916 interessierte, machte ich mir wahllos Notizen zum Überraschungsbesuch des Königs bei den Truppen in Frankreich, zur Ausweitung staatlicher Kontrollen über Woll- und Tuchhandel und darüber, warum Horlicks Malzmilch mit nichts zu vergleichen war.
Mr. Duffield, der in seine Registerkarten vertieft war, blickte auf, als ihm ein junger Bote neue Zeitungen auf den Tresen legte und eilig wieder verschwand. Ich fragte mich, ob sich der Archivar jemals von der schieren Bürde überwältigt fühlte, alles zu katalogisieren, was jemals geschah.
»Haben Sie gefunden, was Sie suchen, Mrs. Shackleton?«
»Darf ich bitte noch die September-Ausgaben sehen?«
Auch im gesamten September stand nichts über Mr. Joshua Braithwaite geschrieben. Ich schloss den Ordner.
»Sie sehen verwundert aus«, stellte Mr. Duffield fest, als ich aufstand, um zu gehen.
»Ja, es ist eigenartig, was als Nachricht gilt«, sagte ich, »und wie einige Geschichten überhaupt nicht erscheinen oder einfach im Sande verlaufen. Ich vermute, dass die Herausgeber sehr mit dem Kriegsgeschehen beschäftigt waren und immerfort darauf achten mussten, was sie nicht schreiben durften.«
»Sie meinen die Explosion in der Munitionsfabrik.«
Meinte ich nicht, doch ich stimmte ihm trotzdem zu. »Ja, eine gewaltige Explosion, bei der so viele Menschen ihr Leben verloren.« Mrs. Sugden wäre froh gewesen, hätte sie sich auf diese Weise zitiert gehört. »All die Feuerwehrmänner, die in Ausübung ihrer Pflicht starben, und nicht ein Funken Anerkennung für sie.«
»Wir hatten einen Reporter, der an der Low-Moor-Geschichte dran war. Er schrieb auch einen guten Beitrag, soweit ich mich erinnere, aber der wurde nicht gedruckt. Der Herausgeber durfte ausschließlich offizielle Quellen nutzen. Der Reporter gab mir damals eine Kopie des Artikels. Wenn Sie mir Ihre Adresse dalassen, suche ich die heraus und schicke sie Ihnen.« Mr. Duffield schien rundum zufrieden mit sich, weil er, wie er glaubte, auf Anhieb erraten hatte, wofür ich mich angeblich interessierte.
Und mir war es ganz recht, ihn in diesem Glauben zu lassen. »Macht es dem Reporter denn nichts aus?«
»Er wäre entzückt! Der arme Mann ist 1917 gestorben – Schlaganfall. Wenn Sie mich fragen, aus lauter Zorn über die Zensur während des Krieges und das Verbot, seine Arbeit so auszuüben, wie er es für richtig hielt. Er war für die Gegend um Bradford und Keighley zuständig.«
»Danke, es wäre sehr nett, wenn Sie mir den Artikel schicken könnten.« Ich holte tief Luft und bemühte mich, so beiläufig wie möglich und mit lediglich einem Hauch von Interesse zu sprechen. »Ich vermute, dass er auch über diese seltsame Geschichte mit dem Textilfabrikanten berichtet hatte, der von Pfadfindern aus dem Bridgestead Beck gezogen wurde.«
Er runzelte nachdenklich die Stirn. »Ah, ja! Das war eine komische Sache. Übrigens auch im August, wobei das sonst solch ein ruhiger Monat an der Heimatfront war.«
Wir standen an dem Tisch, und Mr. Duffield schlug den Artikel über Joshua Braithwaite auf, überflog ihn und fuhr sich mit den Fingern durch sein schwarzes Haar. Falls sich dabei Haarfarbe löste, verschmolz sie unbemerkt mit der Druckerschwärze. Mr. Duffield kam mir widersprüchlich vor. Die dramatische grüne Seidenfliege sprach für einen Mann, den nicht kümmerte, was andere über ihn dachten. Das gefärbte Haar jedoch sagte etwas anderes, verriet Eitelkeit oder den Wunsch, dazuzugehören und nicht zu alt für diese Arbeit zu wirken.
Er blickte von dem Artikel auf. »Bleibt das hier unter uns, Mrs. Shackleton?«
»Natürlich.«
»Wir haben nicht mehr über Mr. Joshua Braithwaite gehört, weil es nicht gut für die Moral gewesen wäre, dass jemand von seinem Rang und Namen nicht mit dem Verlust seines Sohnes fertigwurde.«
»Heißt das, er wollte sich ertränken? Dass es ein Selbstmordversuch war?«
»Ja, und für die Geschichte war derselbe Reporter zuständig, Harold Buckley, Gott sei seiner Seele gnädig. Er hat sich oft beklagt, dass Artikel, wenn sie nicht direkt zensiert wurden, Gefahr liefen, vom Herausgeber ›weichgebürstet‹ zu werden. Harold war gewissermaßen ein alter Radikaler. Wann immer etwas politisch war, eine Provokation für die hohen Tiere sein konnte, war Harold zur Stelle. Er berichtete über die Gründung der Independent Labour Party, ja, so lange war er schon dabei. Und es war ganz nach seiner Fasson, einen Millionär aus Bradford bloßzustellen, einen aufgeblasenen Kapitalisten.«
»Inwiefern wurde diese Geschichte ›weichgebürstet‹, wie Sie es nennen?«, fragte ich, als Mr. Duffield mich zurück zum Aufzug begleitete.
Er schaute sich um, ob uns auch niemand hörte. »Anscheinend – und das habe ich von dem alten Harold – wollte unser Millionärsfabrikant nicht gerettet werden. Es war sogar die Rede von einer Anklage wegen versuchten Selbstmordes. Dann löste sich Braithwaite auf einmal in Luft auf. Der Mann muss Feinde gehabt haben, sonst hätte Harold nie von ihm gehört.«
Der Fahrstuhl brachte mich ratternd nach unten. Warum hatte Tabitha den Bach, die Pfadfinder und die Geschichte vom vermeintlichen Selbstmord nicht erwähnt? Dieses spannende Detail musste sie sich aufgespart haben.
Ich radelte von der Zeitung aus nach Hause und ließ den Schmutz der Innenstadt hinter mir. Die Aprilsonne strahlte im Woodhouse Moor durch die Bäume und warf ein Muster sich überkreuzender Zweige auf die Rasenflächen im Park. Ich fragte mich, wer im August 1916 mit der Braithwaite-Geschichte zu den Zeitungen gelaufen war.
Ein vertrauter Wagen stand vor meiner Pforte. Eine der schnittigen schwarzen Alvis-Limousinen, wie sie die Zentrale der West Riding Constabulary bevorzugte. Das konnte nur eines bedeuten: Mein Vater stattete mir einen Besuch ab. Was wiederum hieß, dass er hellseherische Kräfte besitzen musste oder meine Mutter angerufen und Mrs. Sugden meine noch recht vagen Pläne entlockt hatte.
Ich schob mein Fahrrad in den Garten, und auf einmal überkam mich Furcht, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte. Mein Vater besuchte mich gewöhnlich nicht tagsüber, wenn er im Dienst war.
»Dad!«, rief ich, sobald ich die Haustür geöffnet hatte.
Er trat aus meinem winzigen Wohnzimmer, wobei er den Kopf einziehen musste, um ihn sich nicht am niedrigen Türrahmen zu stoßen. Er lächelte. »Hallo, Liebes.« Er trug seine elegante Superintendent-Uniform mit den schimmernden Knöpfen. Sein gelassenes Auftreten beruhigte mich. »Mein Sergeant ist in der Küche und trinkt einen Tee mit Mrs. Sugden. Wir waren bei einer Sitzung im Rathaus und kommen eben von einem kleinen Umweg, auf dem wir mit jemandem das Cricketspiel zwischen den Einheiten besprochen haben.«
Als junger Bursche hatte mein Vater Rugby und Cricket gespielt, und noch heute griff er hin und wieder nach dem Cricketschläger.
Wir sahen einander an, und angesichts meiner unausgesprochenen Frage zog er eine Braue hoch. Der Umweg über das Cricketfeld war sein Vorwand, mich besuchen zu kommen. Jetzt stand fest, dass meine Mutter mit Mrs. Sugden gesprochen und ihn angewiesen hatte, mit mir zu reden.
»Wie geht es Mutter?«, fragte ich möglichst wenig misstrauisch.
»Sehr gut. Es würde ihr noch besser gehen, wenn du dich bereit erklärtest, nächsten Montag mit ihr einkaufen zu gehen. Doch wie ich höre, hast du eventuell andere Pläne.«
Ich spürte die Verärgerung irgendwo an meinen Zehen, bevor sie sich von dort ihren Weg nach oben suchte. Mrs. Sugden mochte der Inbegriff der Diskretion sein, nur nicht, wenn es meine Mutter betraf.
»Dad! Ich bin jetzt ein großes Mädchen.«
»Weiß ich doch, Liebes, ich weiß. Und ich nehme an, dass ich schuld bin an deiner Detektivarbeit.«
»Ja, das bist du wohl.«
»Geerbt, was?« Er zwinkerte mir zu.
Ich lachte. »Das ist so gut wie sicher!«
In Wahrheit bin ich adoptiert, und folglich konnte mein Hang, Nachforschungen über alles und jedes anzustellen, nicht im eigentlichen Sinne ererbt sein. Vielleicht entsprang meine Neigung dem Umstand, dass mich seine funkelnden Uniformknöpfe von klein auf fasziniert oder wir einen ungeeigneten Polizeihund als Haustier gehalten hatten.
Ich wurde als Baby adoptiert, als meine Mutter glaubte, sie würden keine eigenen Kinder bekommen. Als ich fast sieben war, gebar sie meine Zwillingsbrüder. Bis dahin musste ich die Probezeit gemeistert haben, denn ich wurde nicht für überflüssig erachtet und zurückgeschickt.
Ich nenne das kleine Waldstück hinter meinem Haus Batswing Wood, weil die glänzenden dunklen Efeublätter dort die Form von Fledermausflügeln haben. Dort gibt es Ahorn, Bergahorn, Ulmen, Buchen, Farne und Pilze. Eine Eiche, der eine kleinere mitten aus dem Stamm wächst, sodass sie wie guter Hoffnung scheint, nimmt die Mitte einer kleinen Lichtung ein, wo die Kinder der Gegend an Sommernachmittagen oft ihren märchenhaften Spielen nachgehen.
Mein Vater und ich setzten uns auf eine Bank, die vor langer Zeit von irgendeinem Gärtner aus einer gefällten Buche gesägt worden war. Ich erzählte von Tabithas Brief und meinem Besuch bei der Zeitung.
Sofort war mein Vater ganz bei dem Fall. »Wie haben Mrs. und Miss Braithwaite die letzten sechs Jahre ihren Unterhalt bestritten? Bis das Gericht nicht vollkommen vom Tod eines Mannes überzeugt ist, sind alle Vermögenswerte eingefroren. Und wer hat die Fabrik seitdem geleitet?«
»Weiß ich nicht.«
Er streckte die Beine aus. Die Bank ist zu niedrig für einen großen Mann. »Das hört sich nach einer Menge praktischer Probleme an. Mich wundert, dass seine Frau bisher keine Anstalten gemacht hat, ihn für tot erklären zu lassen.«
»Tabithas Brief zufolge hofft sie, dass er doch noch lebend gefunden wird. Vermisst ist nicht gleichbedeutend mit tot.«
Ich hatte das Falsche gesagt. Mein Vater wurde sehr still. Und ich wusste, was er dachte. Warum kann Kate sich nicht damit abfinden, dass Gerald nicht zurückkommen wird? Vermisst heißt nur: Niemand hat ihn sterben gesehen und es erzählen können. Vermutlich tot heißt, dass er in abertausend Fetzen gesprengt wurde.
»Ich gehe davon aus, dass ich mehr erfahre, wenn ich mit ihr rede«, ergänzte ich schnell. »Dem Brief nach glaube ich nicht, dass es um Geld geht.«
Er schüttelte den Kopf. »Die Leute geben nie zu, worum es eigentlich geht. Das Gericht wird erwarten, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, um Braithwaite zu finden.« Er beobachtete ein Eichhörnchen, das die Eiche hinauf und über die Äste in Richtung Haus eilte. »Nach allem, was du erzählst, wird dies ein Fall, wie du ihn noch nie hattest, Kate. Das ist etwas anderes, als Informationen über Soldaten für trauernde Angehörige aufzutreiben. Du wirst dich in einer anderen Sphäre bewegen. Bradford – oder Worstedopolis, der Tuchmoloch, die Wollhauptstadt der Welt. Dort geht es immer um viel Geld.«
»Der Fall ist auch sonst anders, Dad. Tabitha denkt offensichtlich, dass ich diese Arbeit professionell mache. Sie hat angeboten, mich zu bezahlen, und ich bin geneigt, Ja zu sagen.«
Zu meiner Überraschung lächelte er strahlend. »Besser könnte es gar nicht sein! Das passt prima. Schließlich hast du in den letzten paar Jahren wahrscheinlich mehr bockige Ehemänner und Söhne aufgespürt als eine kleine Polizeieinheit.«
Er wiegte sich leicht, was er stets ohne Absicht tat, wenn er davon ausging, dass sich alles seinen Vorstellungen fügte. Ich wurde misstrauisch.
»Was soll das heißen, es passt prima? Was passt?«
»Ich wollte dir einen Vorschlag machen. Es gibt da einen Mann, der keine Meile von hier wohnt, in Woodhouse. Er war früher bei uns, doch es funktionierte nicht so gut, also hat er den Dienst quittiert. Danach arbeitete er kurzfristig als Sicherheitsmann für eine Schuhfirma, bei der sich zu viele Stiefel allein auf den Weg machten. Das ist jetzt vorbei, und ich würde dich gerne mal mit ihm bekannt machen.«
Ich drehte mich zu ihm und widersprach energisch: »Dad, ich kann einem Mann doch keine dauerhafte Beschäftigung versprechen!«
»Versuch es erst mal nur für diesen Fall, und warte ab, wie ihr miteinander auskommt. Vergiss nicht, dass du zu Bertas Party nach London reist. Und über Ostern sind wir auch dort. Du hast doch nicht vor, deine Mutter zu enttäuschen, oder?«
»Nein.«
Er gewann mich bereits für die Idee, auch wenn ich mich immer noch ein wenig sträubte. Ja, es könnte nützlich sein, Hilfe zu haben. Schließlich hatte auch Sherlock Holmes seinen Dr. Watson. Allerdings lege ich großen Wert auf meine Eigenständigkeit. Ein Expolizist klang bedrohlich. Sicher würde er alles besser wissen.
Mein Vater legte die Fingerspitzen zusammen. »Deine Mutter sorgt sich. Sie ist heute Morgen zu mir ins Rathaus gekommen und hat auf mich eingeredet. Wenn ich ihr sagen kann, dass du einen vollkommen furchtlosen, geradlinigen Mann hast …«
»Ich brauche keinen Beschützer!«
»… der dir assistiert und einige Aufgaben übernimmt, wird sie beruhigt sein. Und ich denke, dann kann ich sie überreden, dich in Ruhe zu lassen, damit du … dein Leben leben kannst.«
Mir entging nicht, dass er zwischendurch schluckte. Er wollte mich genauso dringend wieder zu Hause haben wie sie. Keiner von beiden sah ein, dass man mit einunddreißig Jahren nicht wieder zum kleinen Mädchen werden konnte. Ich befand mich in dieser großen, bösen Welt und musste etwas zu tun haben, damit ich nicht verrückt wurde.
»Ich muss mir mal die Beine vertreten.« Er stand auf. Ich hakte mich bei ihm ein, als wir den Pfad entlang um Batswing Wood spazierten. »Ich weiß, dass du selbst deinen Weg machen willst, Kate, aber es gibt Beschränkungen, sogar für eine so eigenständige Frau wie dich. Du hast schon nach Militärangehörigen gesucht und warst auf das Wohlwollen ihrer Kameraden und Offiziere angewiesen. Diesmal bewegst du dich in einer anderen Welt. Bei dem, was du über den vermissten Mr. Braithwaite erzählst, könnte es sinnvoll sein, sich an der Wollbörse von Bradford umzuhören. Da hört man aber bestenfalls einen Rock rauschen, wenn die Putzfrau morgens durch den Saal fegt.«
»Moment mal …«
»Du brauchst jemanden, der einige Lauferei für dich erledigt.«
Ein Mistelzweig verfing sich in meinem Rock, und ich blieb stehen, um mich zu befreien. »Ich sehe gern, mit wem ich rede, Dad, damit ich die Leute einschätzen und erkennen kann, was sie nicht sagen.«
»Du musst wissen, wo deine Stärken liegen, und darfst keine Scheu haben, Hilfe anzunehmen. Wenn diese junge Frau heiraten will, und das schon … wann?«
»In etwas über einem Monat, am ersten Samstag im Mai.«
Mein Vater stieß einen leisen Pfiff aus und schüttelte den Kopf. »Selbst ich würde es mir zweimal überlegen, den Auftrag anzunehmen. Da wirst du reichlich zu tun haben, um ohne Hilfe zu irgendeinem Schluss zu kommen.«
Wir hatten das Wäldchen einmal umrundet und meinen Gartenzaun erreicht. Durch das Küchenfenster konnte ich den Fahrer meines Vaters sehen, der sich über den Tisch beugte und Mrs. Sugden Feuer gab.
Ich dachte an die Worte meines Vaters. Vielleicht würde es nicht schaden, Unterstützung zu haben, nur dieses eine Mal, da Tabithas Anliegen so drängte. »Wie heißt der ehemalige Polizist, Sicherheitsmann und Stiefeljäger?«
»Sykes.«
»Wie Bill Sykes? Der berüchtigte Schurke und Mörder von Nancy in Oliver Twist?«
»Nicht Bill, sondern Jim. Jim Sykes. Er ist fünfunddreißig Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Du musst ihm mindestens zwei Pfund die Woche bezahlen, also berücksichtige das bei deiner Honorarforderung.«
»Noch habe ich nicht Ja gesagt. Weder zu dem Auftrag noch zu Sykes.«
»Triff ihn. Warte ab, wie du mit ihm auskommst.«
Ich wollte nicht, dass Mr. Sykes zu mir nach Hause kam oder ich zu ihm, für den Fall, dass wir uns nicht verstanden und ich seine Dienste ablehnen musste. Daher verabredeten wir uns für kurz nach sechs Uhr abends im Woodhouse Moor. Ich sollte Sykes auf der zweiten Bank treffen, wie mein Vater arrangiert hatte.
Ich trug mein gegürtetes Kleid mit dem passenden Cape und dazu Riemenpumps mit abgeschrägtem Absatz. Mir schien dies die passende Kleidung für eine geschäftliche Verabredung. Die feuchte Abendluft roch frisch und süß. Ein leichter Regen setzte ein, als ich den Park erreichte. Ich spannte meinen Schirm auf. Plötzlich kam mir die Situation komisch und absurd vor. Eine kleine Stimme in meinem Kopf verspottete diese ganze Geschichte und höhnte, ich sollte eine Rose quer zwischen den Zähnen tragen, die ich ihm mit den Worten entgegenschleudern könnte: »Sie sind Jim Sykes, Sohn von Bill, dem Mörder Nancys. Ich verlange meinen Preis.«
Seit ich mit Tabitha telefoniert und vereinbart hatte, sie am Montag zu treffen, versuchte ich mir alles ins Gedächtnis zu rufen, was ich über Webereien, Kammgarn und Wolle wusste. Meinem minimalen Wissen nach wurden Harris-Tweed, Irish Tweed, Scottish Tweed und vermutlich auch der aus Yorkshire gerne unter »heimischer Tweed« zusammengefasst. Dann entdeckte ich den Mann.
Umso passender war, dass er dort in der Mitte der Bank saß, gekleidet in heimischen Tweed mit Filzhut und blank polierten braunen Stiefeln. Womöglich waren die Stiefel ein Bonus von der Schuhfirma, für die er als Sicherheitsmann gearbeitet hatte. Auf jeden Fall sahen sie neu aus.
Er hielt das Gesicht gen Himmel gereckt, als wolle er fragen, wie lange der Regen noch dauernd würde. Seinen Schirm hatte er nicht geöffnet. Auf den ersten Blick wirkte er gänzlich unberührt von allem um sich herum. Auf den zweiten Blick erkannte ich, dass ihm rein gar nichts entging. Gewiss hatte er ein Guckloch hinten in seinem Hut, für das Auge in seinem Hinterkopf.
Drahtig und wachsam saß er mitten auf der Parkbank, gleichsam als Warnung an jeden, sich ja von der Bank fernzuhalten.
Obwohl er nicht zu bemerken schien, dass ich mich näherte, sprang er auf und hob freundlich seinen Hut.
Wir schüttelten uns die Hand, und er rückte ein Stück zur Seite, um mir auf der Bank die trockene Stelle zu überlassen, auf der er zuvor gesessen hatte. Zum Glück hörte der kurze Nieselregen wieder auf, sodass wir nicht aufpassen mussten, wie wir unsere Schirme hielten.
Sykes war einen knappen Kopf kleiner als mein Vater, aber ebenso viel größer als ich, hatte recht ausgeprägte Wangenknochen sowie Ohren und Nase, die mich an seinen Schädel darunter denken ließen – und an den armen Yorick aus Hamlet. Was mich wiederum glauben ließ, dass ich einen Mann vor mir hatte, der beim Rasieren in den Spiegel schaute und wusste, dass er seine kurze Zeit auf Erden bestmöglich nutzen sollte. Es war kein sehr logischer Gedanke, doch bisweilen kann ich nichts dagegen tun, wohin es mein Denken treibt. Sykes war glatt rasiert, obgleich ich aus unerfindlichen Gründen mit einem Schnauzbart gerechnet hatte. Er hatte leuchtende, kluge Augen mit der Sorte Ringen darunter, wie ich sie mit Müttern assoziiere, die nachts von ihren Kindern wachgehalten wurden.
Mein Vater hatte erzählt, dass es für Sykes bei der Polizei nicht gut gegangen war. Dass sein Vorgesetzter den Falschen für einen Diebstahl verhaftet und zu Sykes gesagt hatte, er solle die Sache auf sich beruhen lassen, was der jedoch nicht wollte. »Meiner Meinung nach zeichnet das einen guten Polizisten aus«, hatte mein Vater gesagt. Aber auf Sykes’ Wache wurde es als Insubordination gesehen. Er wäre niemals über den normalen Streifendienst hinausgekommen, und den mit den schlimmsten Schichten, die ihm der Sergeant zuteilen konnte. Auf meine Frage, ob mein Vater nicht hätte eingreifen können, hatte er gesagt, so liefe es bei ihnen nicht. Also hatte Sykes gekündigt.
Zunächst wechselten wir einige Worte darüber, wie lange Mr. Sykes mit seiner Familie schon in Woodhouse lebte, was fünf Jahre waren, und wie lange ich in Headingley, was acht waren – seit Gerald und ich 1913 nach unserer Wirbelwindromanze geheiratet hatten. Zog ich allerdings meine Zeit beim VAD ab, hatte ich bis Ende des Krieges so gut wie überhaupt nicht in meinem kleinen Haus gewohnt.
Hinter uns begannen einige Jungen, einen Ball umherzuschießen. Eine Frau, die sich fest in einen Bisampelz gehüllt hatte, ging den Weg entlang und redete freundlich auf zwei Zwergspitze ein, die neben ihr hertrotteten.
»Wie gut kennen Sie Bridgestead und das Webereigeschäft, Mr. Sykes?«
Er drehte sich ernst zu mir, so förmlich, als wäre ich gleich ein ganzer Vorstand, der ihn für einen Posten als Bankdirektor in Erwägung zog. »Ich kenne Bridgestead überhaupt nicht, Madam. Aber ich habe Verwandte, die in diesen Fabriken arbeiten.« Er erzählte mir von seinen Tanten, die bei Listers Mill arbeiteten, und von den Spinnern und Webern unter seinen Vorfahren. »Mein Wissen sollte helfen, mich unter die Leute zu mischen und keinen übermäßigen Verdacht zu erregen, wenn ich Nachforschungen anstelle.«
»Wo würden Sie anfangen? Mein Vater erwähnte die Wollbörse.«
»Die stünde sicherlich auf der Liste, Mrs. Shackleton, zumal an Börsentagen, montags und donnerstags. Aber anfangen würde ich vielleicht mit den Pubs, in denen Braithwaites Arbeiter verkehren. Über einem Pint lässt sich einiges an Klatsch erfahren, von dem sich manches als nützlich erweist.« Er verstummte, um mir Gelegenheit zu geben weiterzufragen.
»Ich werde den Dorfpolizisten von Bridgestead besuchen. Haben Sie, Mr. Sykes, jemanden, den Sie um Informationen bitten könnten?«
Er sah nachdenklich aus. »Es gibt ein oder zwei Officers in Keighley, die bereit wären, mit mir über das zu reden, woran sie sich im Fall Joshua Braithwaite erinnern. Falls Sie einverstanden sind, würde ich gerne alles herausfinden, was ich kann, ohne meine Verbindung zu Ihnen aufzudecken.«
»Und warum das, Mr. Sykes?«
»Man könnte sagen, dass ein Polizist instinktiv ungern sein Blatt offenlegt. Doch ich glaube, dass es zwei Typen von Menschen gibt – diejenigen, die alle Informationen preisgeben, und diejenigen, die sie sammeln.«
Bei ihm klang es, als würden wir herumlaufen und Passanten Spucknäpfe hinhalten.
»Und wie würden Sie Ihre Verbindung zu mir geheim halten und dennoch alles herausfinden, was Sie wissen möchten?«
»Ich hätte eine gute Geschichte parat … wie Sie es zweifelsohne auch haben.«
Nein, daran hatte ich noch nicht gedacht. »Bevor ich Miss Braithwaite nicht gesprochen habe, bin ich unsicher, wie ich vorgehen will.«
Ich erzählte ihm, was ich im Zeitungsarchiv gelesen und von dem Archivar über den Reporter vor Ort erfahren hatte, der davon ausgegangen war, dass Mr. Braithwaite sich das Leben nehmen wollte.
Traurig schüttelte Sykes den Kopf. »Versuchter Selbstmord ist eine scheußliche Sache. Und sie wühlt eine Menge Dreck auf, wenn ich so sagen darf.« Sykes seufzte. »Die Jungs aus Keighley werden mir verraten, ob sie mit Bluthunden nach einer Leiche gesucht haben.«
Ohne dass wir ausdrücklich eine Zusammenarbeit vereinbart hatten, stellte ich überrascht fest, dass wir bereits gemeinsam an dem Fall arbeiteten und darüber sprachen, wer was tun würde.
Ich wollte mit der Familie und dem Dorfpolizisten sprechen, um herauszufinden, ob es familiäre oder finanzielle Probleme gegeben hatte. Sykes würde die Arbeiter, die Polizisten in Keighley sowie die Kontakte an der Wollbörse befragen.
»Mein Vater sagte, zwei Pfund die Woche wären ein angemessenes Entgelt«, sagte ich, weil ich es für das Beste hielt, dieses Thema direkt anzusprechen.
»Das hat er mir auch gesagt. Hinzu kämen noch Ausgaben, die ich für Fahrten, spendierte Runden im Pub und dergleichen habe.«
»Dann wollen Sie vielleicht schon mal etwas Bargeld für die ersten Ausgaben?« Ich holte einen zusammengefalteten Fünf-Pfund-Schein hervor und gab ihn Sykes.
Zum ersten Mal grinste er. Dabei strahlte sein Gesicht, und ich sah pure Erleichterung. Er würde nach Hause zu seiner Frau und den Kindern gehen und ihnen sagen, dass er eine Stelle hatte.
Als er mir nun wieder die Hand schüttelte, tat er dies fester und etwas länger. »Ich danke Ihnen. Sie werden es nicht bereuen.«
»Ich fahre am Montag nach Bridgestead und schlage vor, dass wir uns am Dienstagabend treffen, um unsere Notizen zu vergleichen.«
Er nickte. »Ich nehme den Zug bis Bingley, das liegt am nächsten.« Er zückte ein Notizbuch und schrieb den Namen und die Telefonnummer eines Wirtshauses auf. »Ich kenne den Wirt des Ramshead Arms. Er schuldet mir noch einen Gefallen und wird mir ein Zimmer geben, sofern ich eines brauche.«
»Dann um sechs Uhr. Und falls ich es aus irgendwelchen Gründen nicht einrichten kann, rufe ich Mrs. Sugden an und sie lässt Ihnen eine Nachricht zukommen.«
So geschah es, dass ich zum ersten Mal richtig offiziell arbeitete und Jim Sykes einstellte, den Mann im heimischen Tweed.
3Der Schal aus schlesischer Merinowolle
Am Montagmorgen schien die Sonne vom klarblauen Himmel. Es war einer dieser Tage, an denen man beim Blick aus dem Fenster erwartet, dass es warm ist, um dann eine kühle Überraschung zu erleben, sobald man die Nase zur Tür hinausstreckt. Ich belud den Kofferraum meines Jowett-Cabriolets mit einer Reisetasche, der Kameratasche und einem Stativ, das sich zum Gehstock zusammenklappen ließ. Ich hatte meine Thornton Pickard Reflex eingepackt, die mit und ohne Stativ gut war. Die winzige Vest Pocket Autographic Kodak steckte im Notizbuchfach meiner Handtasche. Die VPK verhält sich zu anderen Kameras wie die Armbanduhr zur Wanduhr lautete der Reklamespruch. Mit anderen Worten: Sie verlor sich leicht in den Untiefen einer Handtasche. Mrs. Sugden schüttelte die Reisedecke aus und faltete sie sorgsam zusammen.
Aufzubrechen kann eine echte Prüfung sein.
Mrs. Sugden fragte: »Haben Sie die Karte?«
»Ja.«
Zwei Minuten später: »Haben Sie Ihre Schutzbrille?«
»Ja.«
Eine Minute später: »Ist da Benzin in dem Kanister?«
An diesem Punkt gebe ich gewöhnlich vor, sie nicht zu hören, und habe vollkommen vergessen, woran ich eigentlich denken wollte.
Trotz des Sonnenscheins würde es auf der Fahrt kühl sein. Mein Fahrmantel ist ein großes, flauschiges Ungetüm mit herausnehmbarem Futter. Er hat mich durch den Krieg begleitet und ist längst aus der Mode, doch er gibt mir das Gefühl, sicher und immun gegen Verkehrsunfälle zu sein.
Ich setzte mir die Ledermütze mit den Quasten auf und streifte die langen Handschuhe über.
»Haben Sie …«, begann Mrs. Sugden.
Ich drehte die Benzinzufuhr auf.
»Wenn ich es nicht habe, macht es nichts.« Ich schaltete die Zündung ein. »Ich fahre nach Bingley, nicht zum Nordpol.«
Nun drehte ich den Choke auf und drückte den Anlasser. Wie man dieser Beschreibung entnehmen kann, war mein Fahrzeug für den einfachen Gebrauch gebaut, und dafür werde ich mich jetzt nicht entschuldigen.
Mrs. Sugden winkte. »Fahren Sie vorsichtig!«
»Werde ich.«
Nächtlicher Regen hatte die Straßen befeuchtet, sodass sie nicht so staubig waren. Als ich erst aus Leeds heraus war, kam ich gut voran, fuhr durch Dörfer, an Farmen und Mühlen vorbei und achtete auf Wegweiser und Meilensteine.
Unterdes dachte ich über das letzte Mal nach, dass Tabitha und ich uns gesehen hatten. Es war fast zwei Jahre her, im Juni 1920, bei der Eröffnung des Cavendish Clubs. Den ganzen Krieg hindurch hatten wir VAD-Frauen keinen Platz für uns in der Hauptstadt gehabt. Später wurde das korrigiert, und Tabitha und ich waren unter den Unterstützerinnen der Kampagne für einen Club, den Frauen sich leisten konnten. Seither versprachen wir uns gegenseitig in unseren Weihnachtsbriefen und auf den Sommerpostkarten, uns dort zu treffen, was bisher jedoch nicht passiert war.
Wir hatten uns in einem Café in der Bingley High Street verabredet. Nachdem ich geparkt hatte, zog ich den uralten Mantel aus, tauschte meine Mütze gegen einen Topfhut aus und begab mich auf die Suche nach dem Café.
Als ich über die halbhohen rot-weiß-karierten Vorhänge spähte, entdeckte ich sie. In einer Hand hielt Tabitha eine Zigarette, mit der anderen wickelte sie eine Strähne ihres lockigen blonden Haars auf. Sie hatte die Züge einer Porzellanpuppe, samt Stupsnase und geschwungenen Lippen.
Die Glocke läutete, als ich die Tür öffnete. Die Bedienung, die Tabithas vollen Aschenbecher wegnahm und einen sauberen hinstellte, versperrte ihr die Sicht auf mich. Im nächsten Augenblick stand Tabitha auf und kam mir entgegen. Ich wollte ihr die Hand reichen, da lächelte sie strahlend, nahm mich und umarmte mich fest. Wir küssten uns auf die Wange.
»Kate, vielen Dank, dass du gekommen bist! Ich bestelle noch eine Kanne Tee.«
Nach den üblichen Fragen über meine Fahrt und ob ich gut hergefunden hätte, sagte sie: »Es ist so nett von dir, dass du so kurzfristig hier sein konntest. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich dich um Hilfe bitte. Du warst immer so gut in allem. Erinnerst du dich, wie ich nicht klar denken konnte, als der arme Kerl im St. Mary’s starb?«
Ich nickte. »Du hattest ihn gepflegt und lieb gewonnen.«
Sie seufzte. Ihre Finger spielten ein stummes Requiem auf dem Tischtuch. Sie sah viel jünger als dreißig aus, beinahe wie ein Schulmädchen.
»Du gehst den Dingen auf den Grund, Kate. Du hast den Bruder dieser Bedienung in Cavendish gefunden.«
»Obwohl er wünschte, ich hätte es nicht.« Ich lächelte. »Aber ich finde, die Leute haben ein Recht, die Wahrheit zu erfahren – ganz gleich, wie schwer erträglich sie sein mag.«