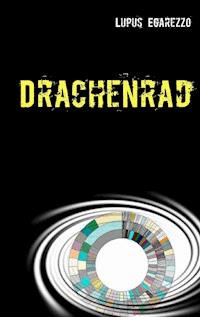Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das idyllische Ukranenland ist ein Freilichtmuseum in der Nähe des Stettiner Haffs, südlich von Ueckermünde - ideal für Familienausflüge und historisch interessierte Menschen, die etwas über das Leben der Slawen von vor über tausend Jahren kennenlernen möchten. Dieses Idyll wird jäh zerstört durch ein geheimnisvolles Verbrechen im Museumsdorf, dessen Umstände auf einen Ritualmord hindeuten. Als auch nahe einer archäologischen Ausgrabungsstätte an einem Kultstein ein ähnliches Verbrechen geschieht, nehmen zwei Ermittlungsteams ihre Arbeit auf, deren Spur bis ins Rheinland führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Früh oder spät schlägt
Jedem von uns die Stunde.“
(La Paloma)
Inhaltsverzeichnis
Urschrei
Ausgrabung
Am Lagerfeuer
Odo
Alltag
Wartislaw
Spekulationen
Alltag im Ukranenland
Mord
Ein Unfall
Nachts im Wald
Ermittlungen
Neuheiden
Am Wartislawstein
Ermittlungen
Ein Stick
Vernehmungen
Eine Spur
Artefakte
Noch eine Spur
Lebensgeschichten
Ein Nachmittag im Kommissariat
Spuren im Rheinland
Die Glasmenagerie
Urschrei
Arbeit in Bonn und Umgebung
Adam Gut
Der Experte
Das Lied
Connection
Konsolidierung
Henny
Verlorene Identität
Flucht
Gefundene Identität
Endspiel
Expertise
Urschrei
Graue Nebel waberten über das unendlich ferne Wasser, über das stille Wasser. Kein Kräuseln über der Oberfläche, kein Zischen und kein Hauch. Der Morgen war schon hell, aber die dünne Sonnenscheibe hing über dem Wasser wie ein blass toter Mond – kahl und strahlenlos, getragen vom Nebelgries oder unsichtbaren Stelzen. Dahinten in der Ferne über dem unendlich stillen Wasser.
Der Alte schlich zwischen morschen Erlenstämmen hindurch, die von den Kormoranen noch nicht vernichtet worden waren. Braune Stümpfe wie angekohlt, manche mannshoch, andere reichten nur noch bis zu den Knien in dem sumpfigen Uferwasser.
Der Mann watete barfuss und sicheren Schritts durch das eisige Nass, während der Saum seines grauen ärmellosen Obergewandes, das um die Taille durch einen Lederriemen gerafft wurde, gelegentlich an etwas tieferen Stellen durch das stehende Gewässer geschleift wurde. Es war bitterkalt, aber noch zu warm, als dass sich jetzt morgens noch kleine Eisränder um die toten Erlenstämme gebildet hätten. Vor ein paar Wochen noch. Jetzt war es schon zu spät im Jahr.
Der Mann mit dem rostroten Bart trug eine Stofftasche um die Schulter und am Gurt seitlich eine lederne Scheide, in der ein Dolch steckte. Als er den Schilfgürtel erreichte, blieb er stehen und blinzelte der toten Sonnenscheibe entgegen. Es war still, manchmal gluckste das Wasser im Schilf, manchmal platschte ein Frosch irgendwo …. nirgendwo. Der Mann wartete, senkte seinen Blick auf das mannshohe Röhricht, das jetzt wie undurchdringlich vor ihm stand. Eine graubraune Mauer mit grünen Einsprengseln und grünem Dach. Er wartete.
Dann kam der Ruf. Aus weiter Ferne. Er schien über Wasser und Grasland anzuschwellen, bis er an das Ohr des einsamen Menschen drang. Der Mann nickte. Dumpf rollten die Töne herüber. Aus den Altwässern, aus dem Schilf von der anderen Seite. Sein Freund, der Moorochse.
Der Alte ging zielstrebig auf eine dunkle Stelle im Schilf zu und teilte die Stängel, schlüpfte in das Gestrüpp hinein und war nach drei, vier Schritten hindurch. Rechts verbarg sich sein Boot. Der Mann nahm das Bündel von seiner Schulter und warf es hinein, dann schob er den Einbaum ins Tiefe, watete bis zu den Oberschenkeln ins Wasser, zog sich hoch und schwang sich ins Boot. Nahm den Paddel und führte zwei, drei Schläge aus, bis das Gefährt durch seine Trägheit leise ins Offene trieb. Er ließ es treiben.
Wieder rollte der Balzruf des Moorochsens herüber. Der Mann saß jetzt still, dann riss er beide Arme nach oben und stieß einen fürchterlichen Schrei aus, einen Schrei, der seine Lungen, seine Stimmbänder zerreißen wollte, der seinen Kopf fast zum Platzen brachten.
„Ich bin. Ich bin hier. Ich weiß, wer ich bin. Ich. Ich Bogemil, der Fischer.“
Ausgrabung
Drei junge Leute hatten es sich auf den Bänken draußen vor der Cafeteria an einem der grob gefügten Holztische bequem gemacht und tranken aus großen Pötten Kaffee: zwei Männer und eine Frau. Die Männer trugen graue Kaftan ähnliche Überwürfe, darunter weitärmelige dunkelgrüne Blusen und braune lange Beinkleider. Ihre Füße steckten in Lederlatschen. Alle drei befanden sich im studentischen Alter. Die Frau war ähnlich gekleidet. Sie trug ein langes weißes Baumwollkleid, darüber eine Art dunkelgrüner Schürze, die an den Rändern mit zickzackförmigen Stickereien verziert war. Ihre Füße steckten ebenfalls in hellbraunen Lederschuhen, die mit Riemchen an ihren Fesseln befestigt waren. Ihr Schmuck bestand aus drei Schnüren, auf denen einige bunte Steinchen aufgereiht waren, und die sie um den Hals trug, und einem hölzernen, glatt polierten dicken Armreifen um ihr Handgelenk.
Es war noch früh am Tag, der gutes Wetter versprach: blauer Himmel mit viel Sonnenschein. Die Vögel zwitscherten in dem grünen Laubdach der mächtigen Bäume, unter denen die drei saßen. Ansonsten herrschte herrliche Ruhe, und auch die Bedienung im Kaffeehäuschen saß ungestört am Ausgabefenster und las den Nordkurier. Die Parkplätze neben dem Imbiss waren noch leer. Kein Besucher zu sehen.
„Heute wird´s voll. Bei dem Wetter“, meinte die junge Frau.
„Na denn: viel Spaß bei der Arbeit!“ lachte einer der beiden jungen Männer. Sein braun gebranntes Gesicht wurde von einem Vollbart eingerahmt. Sein Gegenüber war glatt rasiert.
„Wo fängst Du heute an, Arno?“ wollte die Frau wissen.
„Ich glaube, in der Schmiede. Das erledige ich heute Morgen. Nachmittags ist es mir da zu heiß. Das soll ein anderer machen. – Und Du, Henny?“
„Wie immer. Am Webstuhl.“
Dann war wieder Ruhe. Nach einer Weile reckte sich der Dritte.
„Na, Freddie, noch nicht ausgeschlafen?“ wollte sein Kumpel wissen.
„Doch, doch. Bin nur zu faul heute. Könnte mich am Besten irgendwo ins Gras hinhauen und die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Was macht eigentlich die Ausgräbertruppe? Kommen die heute auch noch?“
„Keine Ahnung. Vielleicht am Nachmittag. Zum Lagerfeuer. Die sind jetzt in Grüttow. Da soll schwer was los sein.“
„Hab ich auch gehört.“
„Was denn?“ fragte Henny.
„Die haben ´ne Leiche gefunden. Da oben“, rief jetzt die Bedienung vom Ausgabefenster, die zugehört hatte. „Da steht ein ganzer Artikel im Nordkurier drin heute Morgen. Hier.“
Und sie hielt die Zeitung hoch.
„Was für ´ne Leiche? ´Ne richtige Leiche?“
„Nee. Keine richtige. So ´ne Art Moorleiche. Weißte? Von früher. Dafür graben die ja aus.“
„Die haben aber keine Leiche gesucht, bloß Werkzeuge und so. Das war Zufall“, mischte sich Arno jetzt ein. Die Frau vom Kiosk ließ aber nicht locker: „Mag ja wohl sein, aber trotzdem. Und hier steht, dass der Tote wohl nicht im Krankenbett gestorben ist. Der ist erschlagen worden. Der hat einen eingeschlagenen Schädel. Das war so wie damals beim Ötzi. Der in den Alpen.“
„Interessant“, bemerkte Henny.
„Ja, interessant. War früher wohl nicht anders als heute: irgendwann wird irgendwo irgendeiner erschlagen. So ist das Leben“, kommentierte Arno.
„So ist der Tod“, ergänzte Freddie. „Los, wir müssen.“
Freddie sammelte die Kaffeepötte ein und stellte sie aufs Brett vor der Ausgabe:
„Schönen Tag noch, Ingrid. Es geht los. Da kommt schon das erste Auto.“
Während ein dunkelblauer Peugeot 207 langsam suchend auf den Parkplatz unter den Bäumen einfuhr, erhob sich das Trio ein wenig träge und verließ den kleinen Park auf der entgegen gesetzten Seite. Ein gut ausgetretener Pfad führte am Waldsaum entlang durch eine langgestreckte Brachwiese, über die die ersten Morgenschmetterlinge flatterten. Links und rechts Holzstöße zum Abtransport bereit, gelegentlich ein Unterstand.
„Ganz schön starke Truppe, die Ausgräber“, setzte Arno das Gespräch fort. „Woher kommen die eigentlich?“
„Ich glaube aus Greifswald“, wollte Henny wissen. „Der eine Typ hat mir das gesagt. Oder er selbst kommt daher. Da ist ein Prof bei und sonst auch nur Studenten, Archäologen. Sechs Leute.“
„Ach, Du kennst schon einen?“ wollte Freddie wissen.
„Kennen nicht. Mit dem hab ich nur gesprochen. Keine Bange.“
„Ich sag ja nichts.“
Inzwischen war der Wald zu Ende, und sie hatten einen ausgeblichenen Staketenzaum erreicht, der wie hölzerne Panzersperren menschliche Feinde und Tiere abhalten sollte. Eine Bohlenbrücke führte hindurch über einen kleinen glucksenden Bach. Auf dem schmalen Weg liefen unsere drei Komparsen an Palisaden entlang bis zu einem großen Tor ins Ukranenland hinein.
Am Lagerfeuer
Fröhliches Lachen dringt vom Ufer der Uecker herüber in den sommerlichen Abend hinein. Arno holt das frisch gebackene Brot aus dem Lehmofen und trägt es hinüber auf eine Holzplanke in der Nähe des Lagerfeuers, das von den auswärtigen Handwerkern schon seit einer knappen Stunde am Flackern gehalten wird. Henny bringt ihre selbst geschlagene Butter mit. Über dem Feuer, suspendiert von einem Dreibein, hängt der tönerne Kessel mit der Brennnesselsuppe. Freddie lässt die Esse in der Schmiede ausgehen und wandert langsam zu der entspannten Runde, die es sich rund um das Feuer bequem gemacht hat. Am Flussufer schnattern Gänse und man hört das beruhigende Ploppen beim Öffnen der Bierflaschen. Die Menschen, die hier in geselliger Runde ihren Feierabend genießen, sind wahrscheinlich keine Ukranen. Wahrscheinlich noch nicht einmal direkte Nachfahren. Aber: wer weiß? Die Menschheit geht manchmal seltsame Wege.
***
Im Jahre 1993 hatte man im damaligen Landkreis Ueckermünde die Ideen eines dänischen Archäologen aufgegriffen, der in seiner Heimat bereits Erfahrung mit historischen Werkstätten gemacht hatte. Dahinter steckte das Projekt, eine slawische Handels- und Handwerkersiedlung des 9. und 10. Jahrhunderts aufzubauen. Man verfolgte dabei zweierlei Ziel. Zum Einen wollte man ein Beschäftigungsprojekt für langzeitarbeitslose Jugendliche schaffen, zum anderen sollte daraus ein Besucherzentrum entstehen, in dem man den Menschen die Lebensweise und Kultur des Volkes, das zu seiner Zeit Ukranen – Grenzvolk – genannt wurde, nahebringen wollte. Die Ukranen siedelten damals zwischen den Wilzen und den Pommeranen in dieser Gegend. Dieses Siedlungsgebiet reichte im Osten bis zur unteren Oder, im Norden bis ans Oderhaff, und die Westgrenze wurde durch die Zarow und die Friedländer Wiese gebildet. Im Süden war dann am undurchdringlichen Urwald an der Finow Schluss.
Das Museumsdorf mit seinen idyllischen Hütten, die meistens nur einen Arbeits- und gleichzeitig Wohnraum umfassten, wurde als typische Siedlung mit Wallanlage am Flussufer angelegt. Am Eingang befand sich die Wachstube. Es gab eine Mühle, Backöfen, einen Räucherstamm, den Töpferofen, ein Gerber- und Musikerhaus, das Haus des Wollwebers und eines für den Schuhmacher, eine Schmiede, ein Priesterhaus und eine Kultstätte für die slawische Götterwelt.
Tagsüber und zu den Öffnungszeiten wurden die Handwerke durch junge Leute betrieben, die in der Tracht der damaligen Zeit den Besuchern Leben und Wirken des mittelalterlichen Volkes demonstrieren sollten. Und nebenher wurden neue Hütten errichtet und alte Anlagen ausgebessert. Dazu engagierte die Verwaltung Handwerksbetriebe aus der Umgebung. Heute Abend waren noch andere Gäste gekommen: ein Ausgrabungsteam, das gut sechzig Kilometer weiter nördlich arbeitete, sich aber auch für das Museumsdorf interessierte. Die Studenten mit ihrem Grabungsleiter schauten gerne mal abends vorbei, um den Tag in geselliger Runde ausklingen zu lassen.
***
Manche saßen direkt auf dem Rasen, andere hatten es sich auf Bierbänken bequem gemacht. Einige liefen noch hin und her, verteilten Bier oder Weingläser. Es gab auch gegrillte Würstchen und Schweinenackensteaks. Ein lustiges Ukranenvölkchen von knapp zwanzig Leuten: Komparsen, Schreiner, die mit Neubau und Instandsetzung beauftragt waren und Ausgräber. Und mittendrin flackerte lustig ein großes Lagerfeuer. Der Abend war kühl, aber nicht frostig. Die allgemeine Laune prächtig.
Henny hatte rumgesucht und dann doch ihren Platz auf einer Bierbank neben dem Studenten gefunden, den sie schon kannte. Sie nippte an einem Rotweinglas und kam schnell zur Sache:
„Ihr habt ja ´nen tollen Fund gemacht da oben in Grüttow. Die Zeitungen stehen ja voll davon. Erzähl mal.“
Der junge Mann lächelte ein wenig stolz und blickte in die Flammen hinein, gute zwei Meter vor ihm.
„Ja, ist schon spannend. Damit hatten wir eigentlich nicht gerechnet. Aber Glück muss man haben.“
„Und, was ist mit der Leiche. Nun erzähl doch.“
Der Archäologiestudent nahm einen guten Schluck aus seiner Lübzer Flasche:
„Was gibt es da zu erzählen. Na ja, der ist noch ziemlich gut erhalten – bis auf den Schädel. Ich meine, gut erhalten als Leiche, als Toter. Der hat ja wohl so tausend Jahre da drin gelegen, in der Erde.“
„Solange?“
„Ja. Genau können wir das noch nicht sagen. Dafür gibt es Experten. Die können den genauen Zeitpunkt bestimmen. Wir nehmen das nur an. Das ist nicht offiziell. Wir schätzen das wegen der Kleidungsreste und den Sachen, die er bei sich hatte.“
„Waren das wertvolle Stücke? Ich meine, Schmuck und so?“
„Nee, nee. Kein Schmuck. Wenigstens bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht kommt das noch. Andere Sachen. So ´ne Art Tasche, aber da ist nicht mehr viel von übrig. ´Nen Gürtel. ´Nen Ledergürtel.“
„Waffen? Schwert oder Messer?“
„Nee. Davon auch nichts.“
„Aber der soll doch den Schädel eingeschlagen gehabt haben.“
„Sieht so aus.“
Beide nahmen noch einen Schluck aus ihren Getränkebehältern. Dann ließen sie sich eine Weile von den tanzenden Flammen verzaubern. Der Student wollte gerade ein neues Gesprächskapitel aufschlagen, als auf der anderen Seite des Flammenmeeres lustige Töne erklangen. Jemand hatte ein Akkordeon mitgebracht. Man konnte ihn durch Flammen und Rauch schlecht erkennen, aber es war ein ziemlich langer Typ, der auch nicht mehr zu dem jungen Gemüse gehörte. Erst seichte, dann volle Akkorde tönten herüber. Das waren kein Rap und auch kein Techno, nicht einmal deutsche Schlagermelodien.
„Das ist der Boss von den Schreinern, der spielt uns manchmal seine Shanties vor“, bemerkte Henny.
„Schön. Romantisch. Da könnte man fast bei einschlafen.“
„Ihr seid sicher müde von der Gräberei den ganzen Tag bei der Hitze, nicht?“
„Ein bisschen schon. Ich glaube, wenn ich die Flasche hier auf habe, mach ich Schluss für heute Abend.“
„Schon so früh?“
Er schaute auf seine Armbanduhr: „Ist ja schon neun vorbei, Mensch.“
Die Frau stand auf: „Komm, ich hol Dir noch ne Flasche. Bin gleich wieder da.“
Und verschwand. Der Mann mit dem Schifferklavier hatte ein neues Stück begonnen. Der junge Mann hob interessiert den Kopf und lauschte angestrengt durch das Geschwätz rings um ihn herum, fixierte den Musiker auf der anderen Seite des Feuers mit starrem Blick. Bei der Melodie formten sich ungewollt und gegen jeden Widerstand altbekannte Worte in seinem Kopf:
„Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf
See,
mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied
weh.
Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise
geh'n,
Dein Schmerz wird vergeh'n und schön wird das
Wiederseh'n.“
Er stand auf und warf einen letzten Blick auf den Musiker. Als Henny mit dem Bier zurückkam war ihr Gesprächspartner verschwunden.
Odo
Ein Mann machte sich auf aus seinem kleinen Heimatort, um zu Fuß bei Wind und Wetter, Sonne und Regen, in eine sumpfige Ebene zu wandern und dort einen anderen Mann zu treffen, der davon aber noch nichts wusste. Der Wanderer war guten Mutes, ging mit wachen Sinnen. Nach einiger Reisezeit, als er sich schon dem nächsten größeren Ort näherte, nahm er in der Ferne abseits vom Weg etwas wahr, das ihn stutzig machte. Er verließ den befestigten Weg, ging einige Meter ins wilde Land hinein und machte einen grausigen Fund: eine männliche Leiche.
Der Tote war von zahlreichen Wunden übersät, besonders am Kopf, und über und über mit Blut bedeckt. Als der Wanderer näher kam, verscheuchte er einige wilde Hunde ins nahegelegene Gebüsch. Der Tote war wohl von mehreren Personen erschlagen worden. Der fremde Wanderer deckte die Leiche mit umher liegenden Steinen notdürftig zu und, nachdem er sich die ganze Situation gründlich eingeprägt hatte, ging er in das nahe Dorf hinein. Er hatte einen Auftrag, den nur er kannte, und die Ermittlungen, die er jetzt führte, passten in diesen Auftrag hinein.
Nachdem er Quartier bezogen hatte, befragte er einige Menschen nach der Identität des Toten draußen vor dem Dorf. Wie sollte es anders sein: eine Mauer des Schweigens stand ihm gegenüber. Aber unser Detektiv blieb hartnäckig, und so notierte er für sich nach einigem Insistieren den Namen des Opfers (es gibt immer welche, die Geheimnisse nicht für sich behalten können). Es handelte sich bei dem Opfer um einen Einwohner dieses Dorfes.
Die Ermittlungen gingen weiter. Die gleiche Quelle, die ihn bisher unterrichtet hatte, gab ihm noch zwei weitere Namen mit auf den Weg. Die sollte der Fremde auch befragen. Sie würden auch von hier kommen und mehr wissen. Der Ermittler fand sie nach einigem Suchen und nahm sie ins Verhör:
Nein, sie hätten mit der Ermordung des besagten Menschen nichts zu tun. Zumindest seien sie nicht dabei gewesen und hätten sich an dem Geschehen auch nicht direkt beteiligt. Und im Übrigen, was ihm einfiele, sich als Fremder in Dorfangelegenheiten einzumischen; die Sache käme von oben, und somit könne ohnehin niemand belangt werden.
Stecken alle unter einer Decke und die Obrigkeit möglicherweise dazu, muss man eben letztere auch befragen, will man weiterkommen. So suchte er die Vertreter der Dorfverwaltung auf und stellte sie zur Rede. Weshalb draußen vor ihren Toren ein erschlagener Mann läge, was der eventuell verbrochen hätte, und wer an seiner Tötung beteiligt gewesen wäre.
„Der Mann da draußen hatte seinen Tod verdient. Er ist nach einem rechtmäßigen Verfahren verurteilt worden wegen Verunglimpfung der Obrigkeit und Gotteslästerung“, gab man ihm zu verstehen. Der Ermittler verlangte Akteneinsicht: Man zeigte ihm einen Brief von höchster Stelle – der Frau des Regenten dieses Landes. Dieses Schreiben beinhaltete sowohl die Anschuldigungen als auch Verfahrensvorschläge für die Aburteilung.
Der Fremde musste zur vollständigen Aufklärung noch den letzten Schritt tun: nach ganz oben vordringen. Man bedeutete ihm, dass der Regent sich nicht in der Nähe befände, sondern eine notarielle Angelegenheit erledigen müsste. Da nämlich der durch Steinigung zu Tode Gekommene keine Erben hinterlassen hätte, fiele nunmehr dessen Grund und Boden dem Volke zu, und der Regierungschef befände sich draußen zur Inaugenscheinnahme. Man sagte dem Manne noch, in welcher Richtung das Grundstück sich befände.
Der Wanderer machte sich wieder auf – voller Gewissheit, dass er seinen Auftrag bald erfüllt haben würde. Er traf den Regenten an jenem Ort und redete mit ihm und sprach:
„So spricht der Gott: Du hast gemordet, dazu auch fremdes Erbe geraubt! An der Stätte, wo Hunde das Blut des Erschlagenen geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken.“
Der Fürst erwiderte: „Hast du mich gefunden, mein Feind?“
„Ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, Unrecht zu tun vor Gott. Ich will Unheil über dich bringen und dich vertilgen samt deinen Nachkommen. Und auch über Deine Frau hat Gott geredet und gesprochen: Die Hunde sollen sie fressen an der Mauer Deiner Festung.“