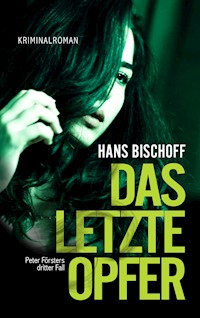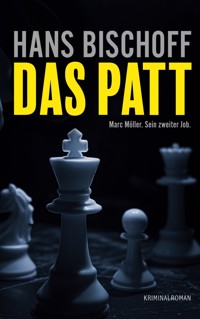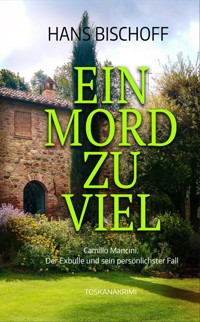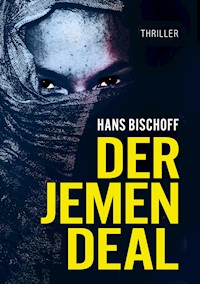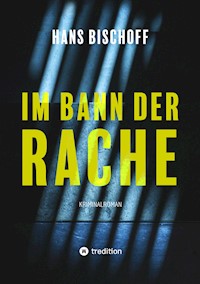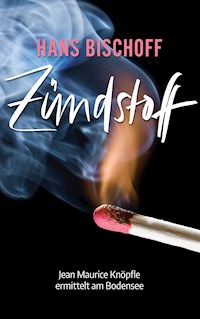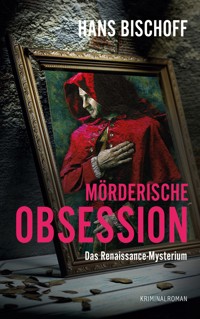
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mit einem nächtlichen Anruf beginnt die tödliche Fortsetzung eines Dramas, das fast hundert Jahre zuvor begonnen hatte. »Wenn Du mich brauchst, bin ich dabei«, sagte ich dem Anrufer. Seine Bitte klang nach Urlaub. Ich sollte mich täuschen und in einem bizarren Gestrüpp aus Habgier, Obsession und Lügen landen, in dem ein Gemälde aus der Renaissance die mörderische Hauptrolle spielt. Sein zweiter Fall führt Peter Förster in die diskrete Welt der Kunstbranche und ins kulinarische Herz Italiens, dem Piemont.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Nachdem er sich nach vierzig Jahren in der Werbung, in leitender Position in der Industrie und als Inhaber einer erfolgreichen Werbeagentur 2014 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hatte, entdeckte Hans Bischoff seine Lust am Schreiben von Kriminalromanen und originellen Kurzgeschichten. Insgesamt sind sechs Romane von ihm veröffentlicht. Geboren und aufgewachsen in Stuttgart, lebt Hans Bischoff heute als Autor, Fotograf und Filmer in Überlingen am Bodensee.
Leseproben, mehr zum Autor sowie weitere Titel von ihm gibt es auf der Autorenwebseite www.hans-bischoff.de
Inhaltsverzeichnis
Mai 1919, Turin. Der Sammler
November 1924, Castagnole. Der Diebstahl
November 1924, Castagnole. Die Folter
November 1924, Castagnole. Der Verdacht
November 1924, Castagnole. Die Flucht
13. Juni 2016, Curaçao. Der Anruf
15. Juni 2016, Stuttgart. Das Wiedersehen
17. Juni 2016, Alba. Das Erbe
20. Juni 2016, Castagnole. Die Bombe
21. Juni 2016, Castagnole. Das Bild
23. Juni 2016, Turin. Der Auftrag
23. Juni 2016, Castagnole. Die Idee
24. Juni 2016, Castagnole. Der Besuch
25. Juni 2016, Castagnole. Der Verdächtige
26. Juni 2016, Castagnole. Die Helfer
29. Juni 2016, Turin. Die Erpressung
30. Juni 2016, Turin. Die Suche
30. Juni 2016, Castagnole. Die Entführung
30. September 2016, Turin, Galeria Sabauda
24. Dezember 2016, Castagnole, Casa Kalle
Nachwort und Dank
Mai 1919, Turin. Der Sammler
Die beiden Herren mittleren Alters trafen sich wie zufällig vor der kleinen Bar auf der Piazza Vittorio Veneto.
Rund fünf Monate nach Ende des furchtbaren Krieges, dieser Urkatastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts, waren Bars, Cafés und Restaurants auch auf den Prachtstraßen Turins noch nicht wieder so dicht gesät wie vor dem großen Gemetzel, in das sich auch Italien gestürzt hatte.
Die riesige, lang gezogene Piazza, die sich als Ponte Vittorio Emanuele I. über den durch Turin fließenden Po fortsetzte, war in dieser späten Nachmittagsstunde wie leer gefegt. Ein böiger Wind peitschte vom Fluss über den Platz und in die Stadt hinein. Der Mai zeigte sich in diesen ersten Tagen in keiner Weise von seiner wonnigen Seite.
»Selbst das Wetter weiß noch nicht genau, wo es hin will. Machen wir dennoch einen kurzen Spaziergang, da sind wir ungestört?«, meinte der größere der beiden. Er wartete nicht auf Antwort.
Eduardo Morsini war knapp über fünfzig und trotz der Kriegswirren ein erfolgreicher Wirtschaftsanwalt und Kunstsammler aus der kleinen Gemeinde Castagnole, zwischen Asti und Alba in den Hügeln des Roero im Piemont gelegen. Ein unbedeutender Ort. Korrekt im schwarzen Gehrock gekleidet, aufrecht mit der selbstbewussten Haltung des vermögenden Geldadels schreitend, hinterließ er einen durch und durch seriösen Eindruck. Er stützte sich beim Gehen wegen einer im Krieg erlittenen Verletzung am Bein auf einen mit silbernem Griff veredelten Spazierstock. Sein Blick, sein ganzes Auftreten strahlten Härte, Distanz und Selbstbewusstsein aus. Er schien es gewohnt zu führen.
Sein Begleiter dagegen verkörperte bereits die Bohème der kommenden Zwanziger Jahre. Elegantes bordeauxrotes Jackett, grauweiß gestreifte Hose, hellgrauer Hut. Er war etwa im selben Alter wie sein Gesprächspartner, wirkte jedoch in seinem ganzen Auftreten jünger und ungezwungener.
Giovanni Andreotti war Kunsthändler und besaß eine vor dem Krieg gut gehende Galerie in Turin. Im Moment jedoch kämpfte er, wie viele andere Unternehmen gegen die Tristesse der Nachkriegszeit. Andreotti hatte die Galerie 1896 gegründet und sich von Anfang an auf Werke der Renaissance spezialisiert.
»Dottore Morsini, ich schließe mich Ihnen gerne an. Gehen wir.«
Beide blickten sich unauffällig um, bevor sie sich in Richtung Fluss auf den Weg machten. Die ersten Meter gingen sie stumm nebeneinander her. Morsini starrte nach vorne, Andreotti blieb einen halben Schritt hinter seinem Begleiter zurück und versuchte, sich einen Eindruck von Morsini zu verschaffen. Sie hatten zwar in den vergangenen Jahren das ein oder andere Geschäft miteinander gemacht, waren sich aber persönlich noch nie begegnet. Alles lief stets über Mittelsmänner. Morsini wollte bei seinen Käufen stets anonym bleiben.
Er hatte dem Galeristen vor drei Tagen ein Telegramm geschickt und zum ersten Mal um ein persönliches Treffen gebeten. Er hätte einen etwas speziellen Wunsch, von einem Auftrag war nicht die Rede. Andreotti hatte sich dennoch sofort zu diesem Treffen bereit erklärt.
»Was will der von mir und plötzlich persönlich?«, fragte er sich nun erneut, als sie schweigend über das rötliche, von großformatigen hellen Steinplatten unterbrochene Pflaster des Platzes schritten. Er entschied sich, abzuwarten. »Soll der andere doch beginnen«, sagte er sich.
»Signor Andreotti, wie Sie sicher inzwischen wissen, bin ich Anwalt und fanatischer Kunstsammler. Wir hatten ja schon mehrfach das Vergnügen.«
Andreotti nickte nur, Morsini machte eine kurze Pause.
»Ich kenne und schätze Sie als vertrauenswürdigen und vor allem verschwiegenen Geschäftspartner und komme deshalb mit einem ganz speziellen, sogar fragwürdigen Anliegen heute zu Ihnen. Ich gehe davon aus, dass dieses Treffen und mein Wunsch ausschließlich unter uns bleiben. Auch falls Sie Nein sagen sollten, was ich Ihnen selbstverständlich zugestehe. Allerdings ungern.« Er schaute Andreotti abwartend an.
»Meine absolute Diskretion kennen Sie, Dottore.«
»Gut, ich habe das erwartet. Ich möchte nicht darum herum reden, kurz gesagt, sie sollen für mich den jugendlichen Johannes der Täufer von Andrea del Sarto besorgen.«
Andreotti blieb abrupt stehen, riss die Augen auf und starrte seinem Gegenüber fassungslos ins Gesicht. Beide schwiegen. Der Galerist brauchte ein paar Sekunden, um sich wieder einigermaßen zu fassen.
»Wenn mich nicht alles täuscht, hängt genau dieses Gemälde in der Sammlung des Königshauses Savoyen hier in Turin. Im Palazzo dell‘Accademia delle Scienze!«
»Stimmt! Und Sie sollen es für mich dort heraus holen. Egal, was es kostet. Zumindest fast egal.«
Morsini war bei diesen Worten ebenfalls stehen geblieben, jetzt setzten sich beide wieder in Bewegung. Es dauerte geraume Zeit, bis Andreotti aufschloss und sich kopfschüttelnd wieder äußerte.
»Sie sind sich sicher, dass dieser Wunsch Ihr Ernst ist?«, fragte er den Anwalt. »Das ist ein Meisterwerk der Renaissance, hängt seit vielen Jahren ...«
»Seit 1869.«
»... in der königlichen Sammlung, nachdem es aus Florenz hergekommen war.«
»Das ist zweifellos richtig, aber in Zukunft soll es in der Villa Morsini in Castagnole hängen. Und zwar nur für mich! Können Sie das verstehen? Ein Kunstwerk, nur für mich!«
Morsini lief nun schneller, nachdem sie den Fluss erreicht hatten. Andreotti hatte Mühe, ihm zu folgen. Er kam leicht außer Atem. Morsini stoppte plötzlich, wandte sich um und deutete mit dem Spazierstock auf den Begleiter.
»Signor Andreotti, können Sie das für mich realisieren? Ich will dieses Bild haben und bezahle Ihnen fast jeden Betrag dafür. Die anmutige Natürlichkeit, der ganze Charakter des Bildes und der klassische Bildaufbau machen dieses Gemälde einzigartig. Für mich! Holen Sie es heraus. Bitte!«
Morsini war ins Schwärmen geraten, übergangslos wurde er wieder der nüchterne Anwalt. »Ich weiß, dass es Ihnen nicht gut geht, jetzt nach dem Krieg. Sie haben massive Probleme mit Ihrer Galerie und stehen vor dem Ruin. Sie wären auf einen Schlag saniert! Ja oder nein?«
»Aber ich müsste einen wahnsinnigen Diebstahl begehen. Ein Gemälde aus diesem gut bewachten Museum zu stehlen, ist Wahnsinn. Vergessen Sie das! So sehr mich, zugegeben, Ihr Wunsch reizt.«
»Ich war dort. Das Museum hat so gut wie kein Geld mehr, um gute Wachleute zu bezahlen. Da laufen drei, vier alte, gebrechliche Männer herum, Kriegsveteranen. Für einen einigermaßen talentierten Kriminellen dürfte das kein Problem sein.« Morsini schaute zweifelnd auf den Kunsthändler. »Sie sollten öfter ins Museum gehen, dann wüssten Sie, wie schlecht derzeit bewacht wird. Wahrscheinlich hätte ich das Bild heraus tragen können, und keiner hätte es gemerkt. Aber vielleicht sind Sie doch der falsche Partner für ein wirklich großes Geschäft.«
Andreotti fühlte sich wie in einem Schraubstock eingespannt. Entweder pleite oder Verbrecher! Pest oder Cholera. Er konnte wählen.
»Dottore, lassen Sie mir Bedenkzeit, ich muss das erst …«
»Sie hätten im Krieg sein sollen, dann wüssten Sie, was es heißt, schnell zu entscheiden«, unterbrach ihn der Anwalt schroff. Morsini blickte dabei verächtlich auf seinen Begleiter. »Aber in Ordnung. Sie überlegen sich bis in zwei Tagen, ob und wie Sie das Ganze ausführen wollen. Ich bin am Freitag wieder hier in Turin und treffe Sie am gleichen Ort wie heute gegen siebzehn Uhr. Dann wissen Sie, ob Sie sich ein gutes Geschäft durch die Lappen gehen lassen wollen oder wie Sie es machen werden. Arrivederci, Signor Andreotti! Buon giorno. Vielen Dank für Ihre Zeit.«
Morsini drehte sich ohne ein weiteres Wort um, ließ Andreotti stehen und bog mit schnellen Schritten in die nächste Querstraße ein, die vom Po wegführte.
Der Galerist verharrte bewegungslos, er wollte Morsini erst noch etwas nachrufen, ließ es dann jedoch bleiben.
»Das ist alles nicht wahr«, versuchte er sich selbst einzureden, als sein Auftraggeber um die Hausecke verschwand und nur noch das sich entfernende Klacken seines Stockes auf dem Pflaster zu hören war.
Die Galerie erreichte Andreotti nach wenigen Minuten Fußmarsch, er schloss die Ladentür auf, trat ein und ließ das Schild in der Tür auf Chiuso, Geschlossen, hängen. »Was tue ich hier? Wasche ich meine Hände schon mal in Unschuld?«, schoss ihm in den Kopf, als er in der Toilette seine nassen Hände abtrocknete. Zurück in der Galerie goss er sich zuerst einen doppelten Grappa ein, den er sofort hinunter kippte. Sein Hals brannte wie Feuer, er schnappte nach Luft und ließ sich in einen der drei bequemen Sessel fallen, die sich um einen kleinen runden Tisch gruppierten. Seine Gedanken begannen sich zu überschlagen.
Giovanni Andreotti war gewiss kein Mensch mit allzu großen Skrupeln, was Geschäfte anbetraf. Auch unsaubere. Wenn Geld zu verdienen war, gab es für ihn wenig Hemmnisse. Aber so eine Sache wie die, mit der ihn Morsini soeben konfrontiert hatte, war ein anderes Kaliber als die krummen Deals, die in der Kunstszene gang und gäbe waren. Er sollte ein Meisterwerk stehlen, das mehr oder weniger gut bewacht im Museum hing. Gut, der Moment könnte so kurz nach dem Krieg günstig sein, wie Morsini vorhin behauptet hatte. Er musste in die Akademie, er musste sich selbst ein Bild von den Gegebenheiten machen. »Und ich brauche einen Dieb«, machte er sich halblaut klar. Andreotti hatte in den vergangenen Jahren den ein oder anderen Kontakt zu zwielichtigen Zeitgenossen gepflegt, er konnte immer mal wieder auf diese Leute zurückgreifen.
Gegen acht am selben Abend verließ er die Galerie, nahm sich ein Taxi und ließ sich zur Porta Nuova, dem Rotlichtviertel der piemontesischen Hauptstadt fahren. Er musste einige besonders aufdringliche Prostituierte abwehren, bis er sein Ziel erreichte. Den Nachtclub Paradiso. Das einzige, was diese heruntergekommene Kaschemme mit dem Paradies zu tun hatte, war die weitgehende Nacktheit seiner Animierdamen. Andreotti drückte sich mithilfe eines nicht allzu kleinen Geldscheins am Türsteher vorbei und landete in einem düsteren Mix aus Schweiß, Rauch und billigem Parfüm. Warum müssen in diesen Puffs immer Hektoliter dieses widerlichen Zeugs versprüht werden, dachte er, während er sich an den Gästen vor der Bar vorbei schob. Auf der winzigen Bühne im Hintergrund des Lokals räkelte sich, begleitet von einem miserablen Pianisten, eine dunkelhäutige Tänzerin in einem noch winzigeren Kostüm aus Straußenfedern. Der Kunsthändler hatte jedoch kaum einen Blick für den Auftritt übrig, sondern suchte konzentriert nach einem ganz bestimmten Gast. In einer runden Sitzgruppe wurde er schließlich fündig. »Ciao, Marconi!«
Der Angesprochene löste sich zögernd aus der Umarmung mit einer der beiden blonden, spärlich bekleideten Schönheiten, mit denen er sich bis zu diesem Moment vergnügt hatte. Er schaute provozierend langsam hoch.
»Der Maestro! Was sucht die hehre Kunst hier? Zuhause nichts los? Oder aus Studiengründen?« Er lachte über seinen Witz.
Andreotti reagierte nicht und setzte sich ungefragt auf einen freien Sessel. »Können wir reden?«
»Wenn du nett zu diesen beiden Hühnern bist und den Schampus bezahlst«, antwortete Marconi lachend.
Der Galerist nickte.
»Gut, dann schwirrt jetzt ab, ihr beiden Hübschen!«
Die beiden Damen blickten schmollend auf ihren Gast, der schob beide von sich weg. »Haut ab! Er zahlt!«
Marconi hatte für Andreotti schon mehrere nicht ganz saubere Aufträge ausgeführt. Er benahm sich gerne wie seine großen Vorbilder, die berühmten Gangsterbosse in der New Yorker Bronx. Obwohl er nur ein kleines Licht in der Turiner Unterwelt darstellte, hatte er doch gute Kontakte zu nahezu allen Bereichen des Verbrechens. Schläger, Diebe, Betrüger, Geldeintreiber, zur Not auch noch mehr. Er konnte fast alle einschlägigen ›Dienstleistungen‹ vermitteln.
»Was brauchst du denn heute, Herr Galerist? Es muss sich schon lohnen, wenn du mich hier aus meiner Unterhaltung heraus reißt.« Er grinste und begann zu lachen. Es klang wie ein wieherndes Pferd, fand Andreotti.
Er kam ohne Umschweife sofort zum Thema. »Ich brauche einen richtig guten Dieb!«
»Oh, das hört sich mal gut an. Was willst du denn klauen, mein Freund? Die Mona Lisa?« Marconi lachte sich fast tot über seinen eigenen Witz.
Andreotti schüttelte den Kopf und bedeutete seinem Gesprächspartner nicht so laut rumzubrüllen. »Nein, aber ein Gemälde in der Accademia delle Scienze.«
Marconi richtete sich blitzschnell auf. »Was? Spinnst du?«
»Nein, ganz und gar nicht«, antwortete Andreotti und erläuterte den möglichen Auftrag. Marconi hörte schweigend zu.
Zwanzig Minuten später waren sie handelseinig. Andreotti würde Marconi das Bild in der Akademie zeigen, weitere Angaben würden folgen. Dann verließ er fluchtartig den Nachtclub. Marconi rief die Damen zurück und gönnte sich und den beiden eine weitere Flasche Champagner. »Mädels, da gibt‘s bald mehr davon!«
Andreotti ließ sich nach Hause chauffieren. Er wohnte direkt über seiner Galerie in einer weitläufigen, aber bescheiden eingerichteten Wohnung. Bereits im Taxi hatte er darüber nachgedacht, wie das Ganze ablaufen müsste. Als er die Wohnung aufschloss, hatte er die entscheidende Idee. Er wusste jetzt, was wie zu tun war. Dottore Morsinis spezieller Auftrag war ihm sicher. Er hatte die beste, aber auch teuerste Lösung dafür.
»Einfach genial«,bestätigte er sich selbst.
Am darauf folgenden Vormittag besuchte Andreotti die Accademia. Er schlenderte unauffällig durch die verschiedenen Säle wie ein ganz normaler Besucher. Vor dem Gemälde des Renaissancemalers Andrea del Sarto blieb er länger stehen. Seine eigene Idee vom Vorabend gefiel ihm zusehends besser. Während seines ganzen Rundgangs hatte er lediglich einen Wachmann erblickt, einen alten, zittrigen Mann mit einer Beinprothese. Ganz in der Nähe des Saales mit seinem Bild fand er eine Toilette, ideal als mögliches Versteck. Eine knappe Stunde später hatte er genug gesehen und verließ das Museum. Beim Rausgehen erkannte er noch, dass die Ausstellungsräume über einen direkten Zugang aus der eigentlichen Kunstakademie verfügten. Das müsste der Weg sein, um unerkannt rein zu kommen. Und wieder raus.
Freitagnachmittag traf er sich erneut mit Morsini. Sie gingen denselben Weg wie beim letzten Mal. Der Anwalt kam sofort zur Sache. »Und?«
»Es wird gehen, ich nehme Ihren Auftrag an. Ich habe eine gute und langfristig sichere Lösung gefunden, die Sie überraschen wird, wenn das Bild in Ihrer Villa hängt.«
Eduardo Morsini blickte ihn skeptisch an, Andreotti schüttelte den Kopf. »Sie werden es erleben und begeistert sein.«
»Was wollen Sie für den Auftrag?«, fragte Morsini.
»Die Aktion ist nicht einfach und ich habe hohe Ausgaben. So etwas lässt sich nicht mit Amateuren machen.«
»Deshalb komme ich zu Ihnen. Wie viel?«
»Zweihunderttausend! In bar!«
Morsini schien nachzudenken. »In Ordnung. Sobald das Bild in meiner Hand ist! Sie kennen mich, und wissen dass Sie Ihr Geld bekommen.«
Andreotti nickte nur. Dann trennten sie sich.
Der unauffällig gekleidete, kräftige Mann mittleren Alters fiel niemandem in der Akademie auf, als er am 24. Mai 1919 gegen achtzehn Uhr über einen Seiteneingang das Gebäude betrat und sich in Richtung des großen Hörsaals bewegte. Auf halbem Wege bog er rechts ab und lief den endlos langen Flur auf die Ausstellungssäle zu, welche die Sammlungen des Königshauses Savoyen enthielten. Kurz davor betrat er eine Toilette, die er erst nach mehreren Stunden wieder verließ. Er war in der Lage, sich so sicher im Gebäude zu bewegen, weil er den gesamten Weg bereits am Tag zuvor während der Mittagszeit gegangen war. Vorbereitung ist der sicherste Weg zum Erfolg, war sein Credo.
In der Zwischenzeit waren die Ein- und Ausgänge der Accademia delle Scienze verschlossen worden, ein älterer Wachmann hatte zwei Runden gedreht und lediglich ganz mechanisch einen kurzen Blick in die Gemäldeausstellung geworfen. Um die von innen abgeschlossene Toilette kümmerte sich niemand.
Kurz vor 23 Uhr trat der Mann vorsichtig ausspähend aus der Toilette auf den nur mit einem einzigen Notlicht schwach beleuchteten Flur. Er schlich zielsicher zum ersten Ausstellungssaal, durchquerte diesen in der Dunkelheit traumwandlerisch sicher und erreichte den zweiten Saal. Hier waren vor allem Meisterwerke der Renaissance ausgestellt. Ohne zu zögern ging er auf ein Gemälde zu, das trotz des ganz schwachen Lichts einen Jüngling erkennen ließ. Er hängte es vorsichtig ab und nahm es unter den Arm, machte einen Schritt von der Wand weg, dann blieb er zögernd stehen und lauschte. Nichts. Kein Geräusch war zu hören.
Plötzlich, als hätte er etwas vergessen, drehte er sich wieder der Wand zu und hängte nach kurzem Zögern ein weiteres Gemälde ab. Er schlüpfte aus seiner Jacke und wickelte beide Bilder darin ein, sie waren nicht allzu groß. Kurz darauf verließ er den Saal, ging den dunklen Flur zurück und stieg die Treppe ins Erdgeschoss hinab. Er konzentrierte sich darauf, die beiden Gemälde nicht zu verlieren, weshalb er am Fuß der Treppe nicht darauf gefasst war, unvermittelt auf den alten Wachmann zu stoßen, den er aus seinem Toilettenversteck über den Flur schlurfen sah.
Beide waren völlig überrascht, der Dieb reagierte schneller. Er ließ die Jacke mit den eingewickelten Bildern fallen und stürzte sich auf den alten Mann. Es war ein ungleicher Kampf. Der Wachmann hatte keine Chance. Er kam nicht einmal mehr zu einem Schrei, so schnell hatte ihm der jüngere und bullige Dieb mit einer blitzartigen Drehung das Genick gebrochen. Der alte Mann war tot, noch bevor er am Boden aufschlug. Der Dieb blickte nur ganz kurz auf den Leichnam, griff seine beiden Bilder, ging in aller Ruhe am leeren Büro der Wache vorbei und verließ das Gebäude durch den Nebeneingang, durch den er am frühen Abend hereingekommen war. Er verschwand unerkannt in der Dunkelheit der Via Accademia delle Scienze.
Der Bilderdiebstahl war La Stampa, der größten Tageszeitung in Turin, am nächsten Tag nur einen Bericht im Lokalteil wert.
Zwei wertvolle Gemälde entwendet, Wachmann ermordet.
In der Nacht zum Samstag wurden bei einem Einbruch im Palazzo dell‘ Accademia delle Scienze zwei wertvolle Gemälde der Renaissance gestohlen. Bei dem besonders dreisten, erst spät am Sonntag bemerkten Überfall wurde ein Wachmann, der 69 Jahre alte Maurizio Capaldi, getötet. Wie die Carabinieri Turin mitteilen, gibt es noch keine Hinweise auf den oder die Täter. Der Wachmann hinterlässt Frau und einen Sohn.Andreotti war geschockt, als er die Seite mit der Meldung aufschlug. Marconi hatte nichts davon erwähnt, als er ihm am frühen Morgen das bestellte Gemälde in die Galerie brachte. Alles wäre glatt gelaufen. Und jetzt das. Der Mord und dazu noch ein zweites Bild gestohlen, was sollte das? Der Kunsthändler war mit den Nerven am Ende. Marconi beschwichtigte ihn. »Alles in Ordnung, es gab nur ein kleines Problem. Und das zweite Bild ist ein kleiner Nebenverdienst. Geht Sie nichts an!«
Andreotti verpackte das gestohlene Gemälde und ließ sich am gleichen Tag noch von einem Taxi nach Rivodora fahren, einem kleinen Weiler oberhalb Turins.
»Wie lange werden Sie dafür brauchen?«, fragte er den Mann mittleren Alters, der ihm die Haustür geöffnet hatte und dem er in dessen Atelier das Bild entgegenhielt.
»Ich denke, fünf bis sechs Wochen.«
Sechs Wochen später, am 30. Juni 1919, spät abends gegen 23 Uhr traute der Wachmann, der den getöteten Kollegen ersetzen musste und seine zweite Runde machte, seinen Augen nicht. Er musste zwei Mal hinschauen. Der jugendliche Johannes der Täufer von Andrea del Sarto hing wieder an seinem angestammten Platz im Saal zwei der Akademie. Lediglich der Platz neben ihm blieb leer, dieses Gemälde eines holländischen Renaissancemalers blieb verschwunden. Museumsleitung und Polizei waren genauso überrascht wie ratlos, das Gemälde war eines Nachts einfach wieder da gewesen. Im richtigen Saal, am alten Platz. Die in Turin und ganz Piemont um sich greifenden Unruhen, geschürt von den Sozialisten um Gramsci auf der einen, den Faschisten auf der anderen Seite, erforderten die ganze Aufmerksamkeit der Polizeibehörden, weshalb sich niemand groß um das verschwundene und plötzlich wieder aufgetauchte Gemälde kümmerte. Es war schließlich wieder da, also, was soll‘s? Die Presse hatte andere Themen, die Menschen hatten andere Sorgen. Bilder interessierten nicht.
Am zweiten Juli wurde die übel zugerichtete Leiche des Bartolomeo de Santis, 49 Jahre alter Kunstmaler und in der Branche bekannter und geschätzter Bilderfälscher, wohnhaft im kleinen Dorf Rivodora nahe Turin am Ufer des Po, wenige Kilometer flussabwärts der Hauptstadt bei Moncalieri angeschwemmt. De Santis hatte bereits mehrere Tage im Wasser gelegen, war aufgedunsen und hinterließ keinen guten Eindruck mehr. Sein letztes Werk brachte ihm kein Glück. Das Polizeiprotokoll vermerkte lapidar ›vermutliche Todesursache Fremdeinwirkung mit einem stumpfen Gegenstand.‹ Die Ermittlungen blieben ergebnislos. Sie interessierten weder die Presse noch die Leute.
Galerist Giovanni Andreotti übergab das gestohlene Gemälde am 3. Juli seinem Auftraggeber Eduardo Morsini und kassierte zweihunderttausend Lire in bar, die er nach Abzug des Honorars für Marconi – für Bartolomeo de Santis brauchte er keines mehr – Zug um Zug in ›offiziellen Umsatz‹ verwandelte und damit die Galerie sanierte. Es hatte ihn viel Kraft gekostet, seinen Kunden Morsini von seiner genialen Idee zu überzeugen.
»Signor Morsini, Sie haben das Original. Nur für sich, wie Sie es wollten. Die Besucher in der Accademia bewundern seit drei Tagen eine exzellente Fälschung, eine Kopie.«
November 1924, Castagnole. Der Diebstahl
Es war bitterkalt geworden auf den flachen Hügeln des Roero, diesem abgelegenen Winkel Piemonts zwischen Asti und Alba. Die scharfen Böen des Nordwestwinds aus den Bergen trieben graue, feuchte Wolkenfetzen und Nebelschwaden vor sich her, die sich in den Tälern zwischen den Rebenreihen der abgeernteten Weinberge und in den tiefen Furchen der umgepflügten Äcker niederließen.
An solchen Novembertagen lag das Land da wie tot, als hätte es Angst vor dem bevorstehenden langen Winter. Die Farben des Herbstes waren einem unbestimmbaren Grauton gewichen. Die alten Leute blieben im Haus vor ihren qualmenden, schlecht ziehenden Kaminen und Kohlebecken hocken, die dunklen Räume hinter den dicken Steinmauern mit den kleinen Fenstern wurden nie richtig warm. Die Menschen hüllten sich in wärmende Umhänge, sie froren dennoch. Jetzt starben die Alten.
Die Jungen suchten ihre Chancen zum Leben in einem trostlosen Umfeld. Bereits das zweite Jahr litt die Region unter der Agitation der Sozialisten und Kommunisten. Leute wie Antonio Gramsci heizten die ohnehin aufgeladene Stimmung nach dem großen Krieg zusätzlich auf. Ständige militante Demonstrationen, Streiks, Fabrik- und Landbesetzungen waren an der Tagesordnung.
Die alten Leute verstanden die Jungen nicht mehr, die Landbevölkerung nicht mehr die Städter. Die Gegenkräfte der Fabrikund Grundbesitzer gewannen zwar zunehmend die Oberhand, das sogenannte Biennio Rosso der Linken wurde abgelöst durch das Biennio Nero der Rechten, durch die Faschisten. Was nichts besser machte im Piemont. Das Land vor den Bergen litt. Dem Roero und seinen Bewohnern ging es schlecht in diesem kalten Spätherbst.
Die beiden jungen Männer schlichen vorsichtig nach allen Seiten ausspähend auf die hohe Mauer zu, die sich vor ihnen aufbaute. Sie hatten ihren eigenen Weg des Überlebens gefunden. Sie suchten Beute in den mächtigen Villen der Fabrikanten, Weingüter, Anwälte und Großgrundbesitzer. In den Villen der ›besseren Leute‹. Dieser Schicht, die immer oben schwamm, wie sich Ernesto, der eine der beiden ausdrückte, wenn er sich am Abend in der einzigen noch existierenden Bar des kleinen Ortes Castagnole rumtrieb und sich bei wilden politischen Diskussionen das ein oder andere blaue Auge holte.
Er und sein Freund Alberto waren seit ihrer Kindheit unzertrennlich, sie waren wie Brüder, obwohl sie im Wesen grundverschieden waren. Ernesto di Rosso war erst vor vier Wochen 29 geworden, Alberto Moretti war vier Jahre jünger. Obwohl beide aus einfachen Familien stammten, gingen sie völlig unterschiedliche Wege. Alberto hatte mit Lernen wenig bis nichts am Hut, er verließ früh die Schule und schlug sich als einfacher Landarbeiter auf einem benachbarten Weingut recht und schlecht durch. Seine Welt bestand aus Glücksspiel und der Gitarre. Auf seinem alten, abgewetzten Instrument spielte und sang er sowohl die alten wehmütigen Lieder der Region als auch die aggressiven Protestlieder, die später zu Kampfgesängen der Partisanen im zweiten Weltkrieg wurden:
»Stamattina mi sono alzato
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
Una mattina mi son svegliato,
e ho trovato l’invasor.
O partigiano, portami via,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir.«
Am liebsten saß er dabei vor dem Municipio, dem Rathaus, auf der Piazza. Er war ein gut aussehender Mann, hatte eine wohlklingende, mal sanfte, mal raue Stimme und genoss das Interesse der jungen Frauen, die ihn anhimmelten, bis er von den Carabinieri davongejagt wurde. Und er genoss den Nervenkitzel harter Runden im Kartenspiel. Das Spiel war für ihn wie eine Sucht. Er zockte immer höher, reizte riskanter, gewann seltener sondern verlor öfter und brauchte ständig mehr Geld. Das er meist nicht hatte.
Ernesto war einen ganz anderen Weg gegangen. Er war ein sehr ruhiges, in sich gekehrtes Kind. Schon als Dreijähriger hatte ihm sein Onkel Adolfo, der bei der Provinzverwaltung in Alba als Sekretär arbeitete, vier Malstifte und einen weißen Papierblock geschenkt.
»Damit kannst du schön malen, dann wird vielleicht einmal ein Künstler aus dir«, hatte er lachend angemerkt.
Und Ernesto malte. Häuser, Bäume, Berge und Menschen. Zuerst nur mit seinen vier Malstiften. Später, als er farbige Pastellkreide bekam, wurden seine Bilder immer vielfältiger, anspruchsvoller. Er verlor sich regelrecht in der Malerei, saß Stunden auf einem Aussichtsplatz oder porträtierte alte Männer, die auf einer Bank an der Piazza saßen und redeten. Wobei erst sein Lehrer in der Schule das tatsächliche Talent erkannte, das in dem Jungen steckte. Er sprach mit Ernestos Eltern, die nur zögernd zustimmten, dass sich der Lehrer um ein Stipendium für Ernesto kümmern durfte. Was er dann, als Ernesto sechzehn war, auch erfolgreich tat.
Nach Abschluss der Schule und einer Lehre bei einem Kunstmaler und Buchdrucker im nahe gelegenen Ort Canale wurde der zwanzigjährige Ernesto di Rosso in die ›Accademia Albertina di Belle Arti di Torino‹ aufgenommen. Ein einschneidendes Erlebnis für den einfach gestrickten jungen Mann aus der kleinen Landgemeinde. Er musste sich plötzlich als armes, ahnungsloses Landei inmitten einer arroganten Schicht von großteils talentfreien Söhnen und Töchtern aus reichen Häusern behaupten. Als er mit seinem Rucksack, den wenigen Habseligkeiten und in seinem alten, unmodernen Anzug in der Accademia ankam, sah er sich mit einer Horde ungezügelter Kommilitonen konfrontiert, die trotz der Wirren der Nachkriegszeit eher an wilden Orgien, an Sex, Drogen und Alkohol interessiert waren als am Studieren. Sie hänselten ihn, pöbelten, heute würde man ›Mobbing‹ sagen, sie machten ihm das Leben zur Hölle.
Erst als er in eine kleine Gruppe Gleichgesinnter hinein kam, die sich besonders für die Welt der Renaissance interessierte, wurde es etwas besser. Ernesto war und blieb aber der Außenseiter. Während des ganzen Studiums.
Zudem kamen seine Eltern bei einem Zugunglück im Januar 1919 ums Leben. Ein Personenzug war kurz vor dem Hauptbahnhof Turin auf eine nicht entschärfte Bombe aufgefahren. 24 Menschen wurden bei diesem Unfall getötet. Aber Ernesto ließ sich nicht unterkriegen, er beerdigte die Eltern, boxte sich durch und beendete mit fünfundzwanzig, genau ein Jahr später, erfolgreich sein Kunststudium. Allerdings ohne jede Chance auf einen Arbeitsplatz.
In Turin gab es weder offene Stellen für Kunstlehrer noch Arbeitsplätze in Museen und Galerien. Er kehrte deshalb sehr schnell wieder in seinen Heimatort zurück und bezog 1920 alleine das kleine Elternhaus in San Pietro, einem winzigen Weiler nahe Castagnole. In den seitdem vergangenen vier Jahren schlug er sich recht und schlecht mit Auftragsarbeiten durch. Er malte, was die Leute haben wollten. Als Aquarell, Tuschezeichnung oder in Öl. Vor allem Familienporträts im Stil der Renaissance waren seine Spezialität.
Er kam auf diesem Weg immer wieder mit wohlhabenden Familien in Berührung, die sich porträtieren ließen. Ernesto schilderte dies stolz seinem Kumpel Alberto, was diesen eines Tages auf eine, wie er meinte, geniale Idee brachte, um ihrer beider wirtschaftliche Situation zu verbessern.
»Ernesto!«, meinte er, »wir rauben die aus!«
»Du spinnst ja«, hatte er Alberto geantwortet.
Der blieb hartnäckig und schaffte es nach vielen Versuchen, Ernesto zu überreden. »Du kennst die Villen, du weißt, wie man reinkommt.«
Drei Wochen später gelang ihr erster Einbruch in eine Villa nahe Alba. Fast zweitausend Lire in bar. Zwei silberne Leuchter und mehrere kleine Schmuckstücke konnten sie bei einem Hehler in Asti loswerden.
Sie waren euphorisch ob dieses Erfolgs.
»Wir werden reich, Ernesto!«
Alberto hatte seinen Anteil nach kürzester Zeit verspielt. Ernesto lieh ihm einen Teil seiner Beute, auch das war kurz darauf in anderen Händen. Villen in Canale, Canove und Asti waren die weiteren Stationen. Mit demselben Ergebnis für Alberto. Es reichte ihm nie. Seine Spielsucht trieb ihn immer häufiger ins Risiko. Also, neuer Bruch. Ernesto machte gute Miene zum bösen Spiel.
Deshalb waren sie jetzt hier. Es war kurz vor halb zehn. Die Villa Morsini war im diffusen Dunkelgrau der Herbstnacht nur schwer auszumachen. Sie hatten am Abend das Gebäude beobachtet, nachdem Alberto in der Bar Centrale mitgekriegt hatte, dass heute Abend ein Empfang beim Bürgermeister stattfinden würde. Es sollten einige Persönlichkeiten aus der Region geehrt werden, die sich an einer Spende zugunsten des Kinderkrankenhauses in Canale beteiligt hatten. Darunter maßgeblich die Familie Morsini.
Eduardo Morsini war erfolgreicher Wirtschaftsanwalt. Ein knallharter Haudegen, alter Geldadel. Im Krieg hatte er eine Einheit geführt, die in den Bergen des Aostatals am Alpenwall baute.
Ernesto und Alberto hatten beobachtet, wie er mit Frau und Sohn in seinem erst drei Jahre alten Alfa Romeo HPO ES Sport, einer Limousine mit 67 PS und 130 km/h Spitzengeschwindigkeit, weggefahren war.
Kurz darauf verließ auch das Hausmädchen die Villa. Sie traf sich am Eingangstor zum Grundstück heimlich mit ihrem Freund, der dort gewartet hatte. Kurz darauf verschwanden die jungen Leute. Die Villa stand leer.
Die beiden Einbrecher waren sicher, dass der Empfang auf keinen Fall vor dreiundzwanzig Uhr beendet sein würde. Einladungen des Bürgermeisters dauerten immer bis gegen Mitternacht. Sie erreichten die gut zwei Meter hohe Natursteinmauer, die genügend kleine Tritte bot, um hochzusteigen. Alberto kletterte vor, schaute vorsichtig in den dunklen Park und winkte Ernesto. Der folgte. Sie sprangen fast lautlos in das weiche Gras am Fuß der Mauer und gingen hinter einem riesigen Rhododendronbusch in Deckung. Nichts zu sehen und zu hören. Jede Deckung ausnützend erreichten sie hinter einem Mammutbaum vorbei die abweisende Nordseite der Villa.
Diese war Anfang des 19. Jahrhunderts im damals typischen Stil des Neoklassizismus gebaut worden. Im Sonnenlicht strahlte das Gebäude in einem warmen Gelbton, jetzt schien die Fassade dunkelgrau. Bei mehreren Umbauten waren später Elemente des Jugendstils dazu gekommen.
Alberto schlich einige Schritte nach rechts, schaute um die Hausecke und winkte Ernesto zu sich.
»Hier ist eine schmale Terrasse auf der Westseite mit einer Glastüre. Da gehen wir rein!«
Ernesto nickte. »Das ist sein Arbeitszimmer.«
Er schob sich vor Alberto, stieg die drei Stufen zur Terrasse hoch und untersuchte das Schloss der Terrassentür.
»Kein Problem!«
Mit einem selbst gebastelten Dietrich hatte er das Türschloss schon nach weniger als einer Minute geöffnet und drückte sich vorsichtig durch den halbgeöffneten Türflügel. Alberto folgte ihm sofort nach. Sie landeten in dem Arbeitszimmer, das Ernesto bereits einmal gesehen hatte, als er ein Porträt der Signora ablieferte, und umrundeten vorsichtig den überdimensionierten Schreibtisch. Sie trauten sich nicht, Licht einzuschalten, dennoch ließen sich die Einrichtung des Raumes als auch die meisten Gegenstände recht gut erkennen.
Alberto machte sich ohne zu zögern über den Schreibtisch her, Ernesto schaute sich im Raum um.
»Du machst das hier«, flüsterte er seinem Komplizen zu, »ich schaue mal in den Salon.«
Alberto zeigte an, dass er verstanden hatte. Ernesto bewegte sich umsichtig durch die über zwei Stockwerke reichende Eingangshalle und betrat den großen Salon der Villa. Die Tür quietschte etwas, er hielt kurz inne. Nichts.
Die Morsinis zeigen ihren Reichtum, dachte er und packte zwei goldene Kerzenleuchter, ein auf einem Sideboard stehendes Gefäß und zwei silberne Karaffen in seine mitgebrachte Tasche. Die an den Wänden hängenden Bilder streifte sein Blick nur kurz, es waren überwiegend zeitgenössische Motive, nichts, was ihn besonders interessiert hätte. Seine Bilderwelt war die Renaissance.
Kurz darauf verließ er den Salon und begegnete in der Diele Alberto, der ihn fragend anschaute.
Ernesto wies auf den Salon und schüttelte den Kopf. »Gibt nicht mehr her, schauen wir oben und unten nach!«
Alberto zeigte auf die breite geschwungene Treppe in den ersten Stock, Ernesto nickte und stieg selber die Stufen in das Untergeschoss hinab.
Im Gegensatz zu vielen einfachen Wohnhäusern zu der Zeit in Italien war die Villa unterkellert. Cantina, Abstellraum, das Zimmer des Hausmädchens, nichts von Interesse.
Dann stand er plötzlich vor einer verschlossenen Tür, seine Neugier war geweckt. Er benötigte etwas länger, um das Schloss zu knacken, aber dann hatte er es geschafft. Er trat vorsichtig ein. Im Untergeschoss war die Gefahr, dass Licht austreten könnte, sehr gering. Er schaltete deshalb seine kleine Taschenlampe ein, eine Daimon aus Deutschland, die er vor zwei Monaten in Asti für ein Schweinegeld erworben hatte. Der schwache Lichtkegel durchbrach die Schwärze des Raumes und blieb an zwei an der Stirnwand hängenden Bildern hängen. Ernesto war fasziniert. Das linke stellte eine Flusslandschaft in der Poebene dar, gemalt nach seiner Einschätzung in den letzten fünfzig Jahren.
Er konzentrierte sich auf das andere Bild. Er war schon oft davor gestanden und kannte es. Und er wusste, dass es eigentlich in der Accademia delle Scienze in Turin hing, was es von 1869 bis 1919 auch durchgehend getan hatte. Am 24. Mai war es dann gestohlen worden, zusammen mit einem weiteren wichtigen Gemälde der Renaissance. Sechs Wochen später war es jedoch wie von Zauberhand wieder zurück und hing an derselben Stelle. Man munkelte damals etwas von möglichen Lösegeldforderungen, aber niemand wusste etwas Genaues. Es war einfach wieder aufgetaucht, dieses Werk Andrea del Sartos. Niemand spekulierte weiter. Das zweite gestohlene Gemälde eines Holländers, über das Ernesto nicht weiter Bescheid wusste, blieb verschwunden. Man ging in Ermittlerkreisen davon aus, dass die beiden Kunstwerke eventuell im Auftrag reicher Sammler entwendet worden waren und bei dem del Sarto etwas schief gegangen war.
Ernesto traute seinen Augen nicht, er hatte tatsächlich den ›jugendlichen Johannes der Täufer‹ von Andrea del Sarto vor sich, den dieser Anfang des 16. Jahrhunderts in Florenz gemalt hatte.
Del Sarto war einer der führenden Köpfe der Malerei der Renaissance. Ernesto kannte das Gemälde wie seine Westentasche. Das Motiv war Teil seiner Prüfungsaufgaben gewesen, jeder Pinselstrich war ihm vertraut. Er lehnte sich mit dem Rücken an die Eingangswand und starrte auf das Gemälde, das langsam im nachlassenden Lichtkegel seiner Taschenlampe verschwamm. Er war noch zu überwältigt, um sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, warum das Bild eigentlich hier unten in der Villa Morsini hing. Und im Museum.
Ein Geräusch von oben ließ ihn wieder zu sich kommen, ganz automatisch, ohne nachzudenken, nahm er das etwa 90 mal 70 Zentimeter große Bild von der Wand, klemmte es unter den Arm – er war froh über das recht kleine Format – und verließ den Raum.
Im Erdgeschoss stieß er auf Alberto, der ihm den Rücken zuwandte und nur winkte. »Oben war nicht viel. Raus jetzt, lass uns abhauen!«
Ernesto folgte ihm, in der rechten Hand die Tasche, unter dem linken Arm das Gemälde. Im Park war es stockdunkel. Sie nahmen den gleichen Weg nach draußen, wie sie ins Haus eingedrungen waren, Ernesto stets hinter seinem Kumpan, stiegen wieder über die Mauer und liefen geduckt über die schmale Straße, die am Grundstück entlang führte. Von Alberto unbemerkt ließ Ernesto das Bild an der Innenseite der Mauer angelehnt zurück.
Der Rest des Weges ins Dorf zurück führte sie durch zwei Weinberge und eine Plantage mit Haselnusssträuchern. An einer verfallenen Hütte an der Straße kurz vor Castagnole machten sie Halt.
»Hat sich gelohnt heute, perfetto!« Alberto lachte und schlug Ernesto auf die Schulter.
»Hör mal zu, kannst du meinen Anteil zum Hehler mitnehmen? Wir teilen dann den Erlös«, schlug Ernesto vor.
Sein Freund schaute ihn zweifelnd an. »Du traust mir nicht zu, dass ich dich bescheiße?«
Ernesto grinste. »Ich traue dir alles zu! Nein, ich vertraue dir, das weißt du, also?«
Sein Gegenüber zuckte mit den Schultern, nickte und leerte zuerst Ernestos Tasche, danach seine aus.
»Da haben wir eine Menge Zeugs, leider kein Bargeld außer diesen paar Münzen. Was meinst du? Können wir tausend rausschlagen? Für jeden, meine ich!«
Ernesto lachte. »Wenn du gut bist.«
Alberto ballte die Faust. »Das weißt du doch!«
Damit packte er die Wertsachen zusammen in seinen Rucksack.
»Ciao Amico, wir sehen uns erst in drei Tagen, ich bin übermorgen in Asti. Verkaufen! Geschäfte!«
»Verspiel wenigstens nur deinen eigenen Anteil!«, rief Ernesto ihm nach.
Bei diesen Worten drehte sich Alberto um, warf den Rucksack auf den Rücken, winkte und eilte in Richtung Dorf. Ernesto schaute ihm lange nach, setzte sich anschließend hinter die Rückwand der Hütte und drehte sich eine Zigarette.
Erst jetzt wurde ihm ganz allmählich die Tragweite dessen klar, was er getan hatte und was das bedeuten könnte. Wobei er sich die entscheidende Frage nicht beantworten konnte. Warum gab es dieses Bild zweimal? Original und Fälschung? Das war doch nicht möglich? Wenn doch, welches war das echte Gemälde? Hatte er es in der Hand oder hing es in der Akademie? Wobei, würde sich der reiche Morsini, den Ernesto ohnehin für kriminell hielt, eine Kopie in einen abgeschlossenen Kellerraum hängen? Sicher nicht.
»Der hat das Original.« Er war sich fast sicher. Was das allerdings bedeuten würde, konnte er noch nicht erfassen. Eines jedoch war sonnenklar. Die Morsinis würden ihnen in jedem Fall die Hölle heiß machen, falls sie jemals rauskriegen sollten, wer für den Bilderdiebstahl verantwortlich wäre. Im ersten Moment hatte er sogar daran gedacht, das Bild sofort wieder zurückzubringen, was er aber verwarf. Dann kam er auf die Idee, die Morsinis zu erpressen. Die sollten für die Rückgabe des Gemäldes und sein Schweigen zahlen. Das würde allerdings nur funktionieren, wenn Morsini wirklich das Original hätte. Dann wurde ihm aber bewusst, dass er das niemals überleben würde. Das Bild durfte nie gefunden werden, zumindest nicht in den nächsten Jahren, bis vielleicht irgendwann mal Gras über die Sache gewachsen wäre und er das Gemälde an einen reichen Kunstliebhaber loswerden könnte. Oder an das Museum zurückgeben.
Ernesto grübelte eine Weile, er musste jedoch im Moment keine Entscheidung treffen. Aber wohin mit dem Bild, wo verstecken? Es gibt keinen Platz dafür wurde ihm sehr schnell klar. Man würde es finden. Und dann wuchs eine zuerst vage Idee in seinem Kopf zu einem realen Plan: Er müsste das Bild übermalen. Egal, ob es echt oder gefälscht war. Mit einem ganz banalen Motiv. So, dass es in einiger Zeit wieder zu öffnen und noch gut zu sanieren wäre.
Er hatte viel über die Möglichkeiten gehört, Übermalungen von Ölgemälden zu beseitigen, es würde gehen, die Techniken dafür wurden immer mehr verfeinert. Aber vor allem musste er sich jetzt beeilen, spätestens morgen früh würde der Einbruch und damit auch der Diebstahl entdeckt werden.
Er sprang auf, warf den Zigarettenstummel weg und nahm den selben Weg zurück zur Villa Morsini, wo das Bild unverändert an der Mauer lehnte. Er klemmte es wieder unter den Arm und lief über einen Feldweg, der sich am Hügel entlang wandte, den knappen Kilometer zu seinem Elternhaus im kleinen Weiler San Pietro di Castagnole zurück. Unbemerkt erreichte er das Haus und stieg auf Zehenspitzen unhörbar die Treppe hoch, obwohl das Haus außer ihm keine weiteren Bewohner aufwies.
Ernesto stellte das Gemälde auf den kleinen Tisch neben der Tür und lehnte es an die Wand. Ganz vorsichtig und leicht fuhr er mit dem Zeigefinger über die Oberfläche der Malerei.
»Bist du echt?«, fragte er den jungen Mann auf dem Bild und starrte unbeweglich darauf. Oder könnte das tatsächlich eine Fälschung sein. Wobei, die Signatur war eindeutig, es musste von del Sarto sein.
»Oder doch nicht?«, murmelte er. »Ich muss dich übermalen. Es geht nicht anders.«
Ernesto hatte Angst vor dem ersten Pinselstrich. Nachdem er diese überwunden hatte, lief es. Er konzentrierte sich auf die Bereiche, die er vollständig verändern musste. Dort setzte er teilweise recht pastose Pinselstriche. Einzelne Bildbereiche konnte er ohne große Mühe nützen und nur leicht anpassen. Ein Experte würde die Übermalung entdecken, aber dieses Risiko musste er eingehen.
Die Petroleumlampe auf seinem altersschwachen Tisch brannte fast die ganze Nacht durch. Am nächsten Morgen hing ein frisches Ölgemälde an der Rückwand seines kleinen Zimmers im Dachgeschoss. Das Halbporträt eines jungen Landarbeiters in der Po-Ebene. In einem ganz einfachen Holzrahmen, den er angepasst hatte. Der wertvolle Rahmen, der das Gemälde ursprünglich umfasste, war zertrümmert und hinter dem Haus eingegraben worden. Gemalt hatte er das Bild im eher grob gehaltenen Realismus eines zeitgenössischen Malers. Ein Held der Arbeit, wie ihn die an die Regierung gekommenen Faschisten so liebten. Mussolini, ihr neuer Regierungschef, würde begeistert sein. Sicher nur, solange er nicht wusste, was unter dem einfachen Landarbeiter zutage treten könnte.
Ernesto schlief bis gegen Mittag, wachte gerädert auf und arbeitete danach am Porträt eines Fabrikanten aus Alba weiter, das er zum Ende des Monats abliefern sollte.
In Castagnole war derweil die Hölle los. Bei der Familie Morsini war eingebrochen worden. Die Leute tuschelten, die Carabinieri waren mit der Aufnahme des Verbrechens beschäftigt, die gestohlenen Gegenstände wurden aufgelistet.
Von einem fehlenden Gemälde war keine Rede. Und Eduardo Morsini war auffällig zurückhaltend.
November 1924, Castagnole. Die Folter
Die beiden folgenden Tage waren geprägt von Gerüchten und aufgeregten Gesprächen in der Bar Centrale. Jeder der meist arbeitslosen Männer, die den winzigen schmalen Raum vor der Theke bevölkerten, wusste irgendetwas Neues. Draußen auf der Piazza tauschten die Frauen nach dem Einkauf oder Kirchgang die neuesten, meist falschen Erkenntnisse über den ungeheuerlichen Einbruch beim Dottore.
Die Familie Morsini gehörte seit vielen Generationen zu Castagnole. Mit wenigen Ausnahmen standen die Einwohner der Familie zurückhaltend entgegen. Man achtete sie, aber mochte sie nicht. Man grüßte korrekt, wollte aber nichts mit ihnen zu tun haben. Lediglich die Menschen, die mit den Morsinis Geschäfte machten, versuchten immer, aktiv ihre Zuneigung und Hochachtung zu zeigen, machten ihre Bücklinge.
Der jetzige Padrone, Advocato Eduardo, galt als hartherzig, man ging ihm am besten aus dem Weg. Allerdings war dies nicht besonders schwierig, da er sich außer am Sonntag in der Kirche so gut wie nie in der kleinen Stadt zeigte.
Castagnole lag gut einhundert Meter hoch über dem breiten Tal des Tanaro, dem aus den ligurischen Bergen entspringenden Fluss, der später in den Po mündet, auf einem Höhenrücken mit schöner Aussicht auf die nahe gelegenen Hügel der Langhe. Glücklicherweise hatte Castagnole im Krieg keine nennenswerten Schäden davongetragen. Es lag im Hinterland, zu weit von den Schlachtfeldern entfernt. Die alten Steinhäuser mit ihrem typischen, teilweise abblätternden Putz drängten sich eng um die Ortsmitte, die Piazza, auf der sich neben der Bar Centrale das Leben abspielte. Die Alten saßen auf den Steinbänken, die sich am Municipio und der Kirche entlang zogen. Die Jungen präsentierten sich zögernd oder herausfordernd dem anderen Geschlecht. Die kleine Piazza war Mittelpunkt des Geschehens.
Am oberen Ende des Platzes residierte der Bürgermeister mit seiner Verwaltung in einem Gebäude, bei dem der Versuch, einen klassizistischen Baustil nachzuempfinden, gründlich in die Hose gegangen war. Das untere Ende der Piazza wurde durch die Kirche Santa Catarina gebildet, einem eher unscheinbaren Gebäude aus unterschiedlichen Stilepochen. Der frei stehende Campanile mit seiner Natursteinfassade und den beiden großen, nach außen ragenden Glocken wurde als romanisch eingestuft. Die rechte Seite des Platzes nahmen die Bäckerei, der Metzger, die Bar Centrale, der ›Sale e Tabacchi‹ Laden sowie das Ortsbüro der Partei ein. Links schloss sich hinter einer hohen Mauer der Park des barocken Palazzos aus dem 17. Jahrhundert an. Er gehörte ursprünglich der Familie Falletti, einer der einflussreichsten Adelsfamilien in Alba und Umgebung. Erbaut wurde der Palast von dem berühmten Architekten Guarini, der auch das königliche Schloss im benachbarten, wenige Kilometer entfernten Govone geplant hatte.
Inzwischen, genau seit Oktober 1918, war der Palazzo zum Kommandoposten der Carabinieri geworden, die damit einen guten Blick über den Ort und auf die Piazza hatten. Die Carabinieri waren zwar eine militärische Organisation, nahmen jedoch alle klassischen Polizeiaufgaben wahr. Die Polizia Locale, die Ortspolizei, befasste sich lediglich mit kleinen Verstößen gegen Verordnungen, kontrollierte die den Ort umgebenden Weinberge und Felder, schlichtete Streitereien unter den Jugendlichen und half bei größeren Veranstaltungen. Zum Ärger der fast 3200 Bewohner Castagnoles war der Park rund um den Palazzo zum militärischen Sperrgebiet erklärt worden, und nur ganz selten trauten sich ein paar Jugendliche über die Mauer in die dichten Büsche des Schlossparks. Als Mutprobe oder als idealem Ort für heimliche Rendezvous. Die Carabinieri nahmen es meist gelassen und schauten weg. Oder auch interessiert hin.
Die Theke in der Bar war an diesem Vormittag, zwei Tage nach dem Einbruch, dicht umlagert von den alten Männern des Ortes, die sich wenigstens ein Gläschen des regionalen Weißweins leisten konnten. Dem Roero Arneis, einer alten Rebsorte, die nur hier zwischen Canale und Alba angebaut wurde und kaum zu vermarkten war. Die Arneistraube galt als schwierig. Der größte Teil des Ertrags ging deshalb als Verschnittwein zu den wenigen noch aktiven Weingütern der Langhe, die damit die Tanninhärte des roten Nebbiolo und des Barolo etwas senken konnten.
Die Luft im Raum war zum Schneiden dick, es roch muffig, nach feuchten Klamotten, nach Rauch und Schweiß. An den Wänden hingen Plakate einer Boxveranstaltung in Asti, eines Radrennens in Canale, Werbetafeln von Cinzano und Fotos eines Festes in Castagnole. Hinter der Theke zeigte eine vergilbte Liste die schon lange nicht mehr aktuellen Preise der verschiedenen Getränke an. Der Wirt verströmte die Freundlichkeit eines angeschlagenen Preisboxers. Der Mann, der nie lachte. Insgesamt bot die Bar das Ambiente einer Bahnhofswartehalle, nur kleiner.
Kurz vor zwölf verstummten plötzlich die Gespräche, als der Carabinierikommandant die Bar betrat. Er baute sich majestätisch vor dem Pulk der Männer auf, ließ zuerst seinen scharfen Blick über die Reihen der Köpfe schweifen, dann legte er los.
»Wie ihr alle wisst, ist bei der ehrenwerten Familie Morsini …«, ein Raunen und ein hämisches Lachen aus dem Hintergrund unterbrachen ihn kurz, »… vor zwei Tagen eingebrochen worden. Wir haben bisher keine Erkenntnisse, dass es sich bei den Verbrechern um Leute aus Castagnole handeln könnte. Trotzdem …«, er machte eine bühnenreife Pause, »… trotzdem, falls einer von euch etwas darüber weiß, oder meint, zu wissen, soll er zu uns kommen. Die Familie Morsini hat eine Belohnung ausgesetzt. Einhundert Lire!«
Er schaute sich in der Runde um. Desinteressierte, harte, ausdruckslose Gesichter blickten ihn an. »Das war‘s!«
Er leerte noch schnell das vom Wirt angebotene Glas, verließ die Bar und hinterließ eine Menge an Gesprächsstoff, zumeist ablehnender Art.
»Keiner aus dem Dorf«, äffte ihn eine Stimme nach, ein paar lachten.
Als er auf das Pflaster der Piazza trat, das von einem zwischen den grauen Wolken hervorstechenden Sonnenstrahl an einzelnen Stellen aufgehellt wurde, begegnete ihm Ernesto, der nur kurz mal in die Bar reinhören wollte, ob es etwas Neues gab. Er schaute am Capitano vorbei, grüßte nur im Vorbeigehen ganz kurz »Salve, Capitano«, und betrat die Bar.
Der Carabiniere blickte ihm nach, wandte sich aber schnell wieder ab und stieg die lange Treppe zu seinem Büro im Palazzo hoch. Immer noch wunderte sich der Capitano darüber, dass Morsini eine recht interessante Belohnung ausgesetzt hatte für Informationen, die zu dem oder den Tätern führen könnten. Eigentlich hatte der Einbrecher doch nur jederzeit leicht ersetzbare, nicht besonders wertvolle Dekorationsgegenstände mitgehen lassen und so gut wie kein Bargeld. Er fand das merkwürdig.
Alberto Moretti war mit dem gemeinsamen Diebesgut schon am Morgen nach Asti, der kleinen Provinzstadt nordwestlich von Castagnole, aufgebrochen, um seinen Hehler zu treffen. Es regnete leicht. Die ersten zehn Kilometer musste er zu Fuß gehen, dann hatte er Glück und ein Lastwagen, der mit Eisenteilen beladen war, nahm ihn bis Palucco, kurz vor Asti mit. Es war eine uralte Karre von vor dem Krieg, noch ohne Frontscheibe. Neue, moderne Lastwagen konnten sich in diesen Nachkriegsjahren nur sehr wenige Speditionen leisten.
Alberto fror erbärmlich in dem kalten, feuchten Fahrtwind. Dem Fahrer schien es nichts auszumachen. Den restlichen Weg ging er wieder entlang der Hauptstraße zu Fuß über die Felder. Der Hehler hauste in einem winzigen Laden mitten in Astis Altstadt, er verkaufte offiziell Haushaltswaren. Seinen eigentlichen Gewinn machte er jedoch mit anderer Ware: Diebesgut aus der ganzen Region war sein Hauptgeschäft. Er war praktisch konkurrenzlos und konnte die Preise nach Gutdünken diktieren. So auch gegenüber Alberto.
Er winkte ihn in ein enges, mit Kisten und Kartons vollgestopftes Hinterzimmer und warf nur einen kurzen Blick auf die kleineren Teile, die Alberto aus dem Rucksack packte. Er nahm einen der Kerzenleuchter in die Hand, drehte ihn hin und her, dann schaute er missmutig auf Alberto.
»Das Zeug ist nicht viel wert, mein Lieber. Alles in allem vierhundert Lire.«
»Du spinnst«, tobte Alberto mit verzerrter Miene wütend. »Das kann nicht sein! Das müssen mindestens zweitausend werden!«
»Vergiss es, mein Freund! Dann nimm den Plunder wieder mit, buongiorno!«
»Gib mir wenigstens achthundert!«, jammerte Alberto kleinlaut.
»Gut, weil du‘s bist fünfhundert und Schluss! Das muss ein Arbeiter erst mal verdienen. Basta!«
Moretti verdrehte die Augen, stimmte aber widerwillig zu und steckte die fünf Hunderter ein. Eine halbe Stunde später saß er in einer der dunklen Bars, in denen schon mittags gespielt wurde.
Es würde kein guter Tag für ihn werden.
Kurz bevor der Capitano in der Bar Centrale die Belohnung verkündete, trafen sich Eduardo Morsini und sein Sohn, der 22-jährige Ricardo, im Arbeitszimmer der Villa und berieten hinter verschlossenen Türen.
Eduardo stand, eine Zigarre rauchend, vor der gläsernen Terrassentür, durch die der Einbruch erfolgt war und schaute über die Weinberge und die angrenzenden Felder ins Tanarotal hinab. Die Lage der Villa bot einen fantastischen Fernblick bis zu den Ausläufern der Alta Langa, jenem wilden Hügelland, bevor die Berge Liguriens begannen. Als sein Sohn Ricardo eintrat, drehte er sich nicht um.
»Setz dich!«
Ricardo studierte Jura und sollte in den kommenden Jahren die Kanzlei des Vaters übernehmen. Allerdings lagen seine Interessen recht weit vom eigentlichen Studiengang Jura entfernt: Schnelle Autos und schöne Frauen. Am liebsten war er von Beruf Sohn. Er raste gerne mit seinem Bugatti Typ 30 mit Achtzylindermotor halsbrecherisch über die engen und schlecht geschotterten Straßen der Region.
Eduardo Morsini war alles andere als glücklich über die Allüren seines Sohnes, bremste ihn jedoch selten ein. Jetzt jedoch musste er ihn eindringlich zur Vorsicht aufrufen. Als Eduardo vorgestern Morgen den Diebstahl seines exklusiven Gemäldes entdeckt hatte, war er völlig konsterniert gewesen. Er verfiel in Schockstarre.