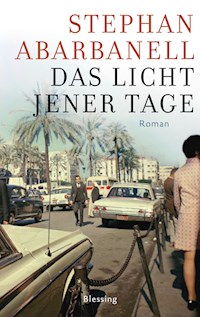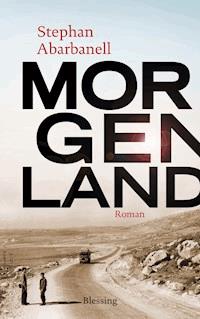
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großes Panorama der Zeit, als in der Welt alles auf Anfang stand.
1946: Lilya Wasserfall ist im Widerstand gegen die britische Mandatsmacht in Palästina aktiv und hofft darauf, bei der nächsten großen Sabotageaktion eingesetzt zu werden. Doch sie bekommt einen ganz anderen Auftrag: Im zerstörten Deutschland soll sie nach dem verschollenen jüdischen Wissenschaftler Raphael Lind suchen. Nach Angaben der Briten ist er in einem Konzentrationslager ermordet worden, sein Bruder in Jerusalem hat jedoch Hinweise darauf, dass er noch lebt. Für Lilya beginnt eine abenteuerliche Reise, und bald merkt sie, dass ihr nicht nur der britische Geheimdienst auf den Fersen ist, sondern auch ein mysteriöser Verfolger, der mit allen Mitteln verhindern will, dass sie Raphael Lind findet.
Von den staubigen Straßen Jerusalems über das zerstörte London, von einem amerikanisch verwalteten München über das überfüllte Flüchtlingslager Föhrenwald, von Offenbach bis nach Berlin und in die Lüneburger Heide folgen wir einer so entschlossenen wie liebenswerten Protagonistin bei ihrer spannenden Spurensuche. Ein epischer Roman über die Welt im Schatten einer Katastrophe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Ein großer Roman über die Zeit, als in der Welt alles auf Anfang stand.
1946: Lilya Wasserfall ist im Widerstand gegen die britische Mandatsmacht in Palästina aktiv und hofft darauf, bei der nächsten großen Sabotageaktion eingesetzt zu werden. Doch sie bekommt einen ganz anderen Auftrag: Im zerstörten Deutschland soll sie nach dem verschollenen jüdischen Wissenschaftler Raphael Lind suchen. Nach Angaben der Briten ist er in einem Konzentrationslager ermordet worden, sein Bruder in Jerusalem hat jedoch Hinweise darauf, dass er noch lebt. Für Lilya beginnt eine abenteuerliche Reise, und bald merkt sie, dass ihr nicht nur der britische Geheimdienst auf den Fersen ist, sondern auch ein mysteriöser Verfolger, der mit allen Mitteln verhindern will, dass sie Raphael Lind findet.
Von den staubigen Straßen Jerusalems über das zerstörte London, von einem amerikanisch verwalteten München über das überfüllte Flüchtlingslager Föhrenwald, von Offenbach bis nach Berlin und in die Lüneburger Heide folgen wir einer so eigensinnigen wie sensiblen Protagonistin auf ihrer Spurensuche, die für sie auch eine Suche nach sich selbst ist.
Der Autor
Stephan Abarbanell, 1957 in Braunschweig geboren, wuchs in Hamburg auf. Er studierte Evangelische Theologie sowie Allgemeine Rhetorik in Hamburg, Tübingen und Berkeley (USA), und nahm am Creative-Writing-Kurs bei Walter Jens teil. Heute ist Abarbanell Kulturchef des rbb. Morgenland ist sein erster Roman. Der Autor, Vater dreier Kinder, unternahm viele Reisen nach Israel, auch auf den Spuren seiner eigenen Familie, und lebt mit seiner Frau, der Übersetzerin Bettina Abarbanell, in Potsdam-Babelsberg.
Stephan Abarbanell
MORGENLAND
Roman
Blessing
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und
enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.
Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch
unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder
öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form,
ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten,
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese
nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt
der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
1. Auflage
Copyright © 2015 by Stephan Abarbanell und
Karl Blessing Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin,
unter Verwendung eines Motivs von © akg-images
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-16583-3
www.blessing-verlag.de
Meinen Eltern
Es ist, als sei der Raum zwischen uns Zeit:
etwas Unwiderrufliches.
– William Faulkner Als ich im Sterben lag
JAFFA ROAD
1
Sie hob den Kopf und streckte sich. Seit die Festung von Latrun hinter ihnen lag, blickte sie aus dem Fenster. Am Straßenrand kauerten zerschossene Jeeps, daneben stand ein ausgebrannter Lastwagen mit weit geöffneten Türen. An der Böschung entdeckte sie Reifenfetzen und stumpfes Metall, das sie für Geschosshülsen hielt. Die Küste tief unten im Tal war kaum mehr als ein dünner, wie mit Bleistift gezogener Strich. Dahinter erstreckte sich das Meer, das in seiner trügerischen Unendlichkeit so gar nicht zu dem kargen Streifen Land passen wollte, der unter der flimmernden Hitze zu schlafen schien, als läge er im Frieden.
Der Bus kroch zitternd die Straße hinauf, nahm Kurve um Kurve, wie Gewehrschüsse sprangen Steine unter seinem Reifen weg, durch sein Rückfenster war nichts zu sehen als eine Wolke aus Staub und Gestein.
Sie blickte von ihrem Sitz in der letzten Reihe über die Köpfe der Mitreisenden hinweg, sah Hüte, durchgescheuerte Hemdkragen, und in den Gepäcknetzen Koffer mit Aufklebern aus Rotterdam, Marseille, Valparaiso und Hamburg. Es roch nach Kampfer, schal gewordenem Eau de Cologne, Schweiß. Und Angst.
Es dämmerte bereits, als der Wagen an einer Senke zwischen Deir Ajub und Bab el-Wad hielt. Der Fahrer schlug mit der flachen Hand aufs Lenkrad, sprang von seinem Sitz und griff nach einem Kanister mit Wasser. Er riss die Haube des Dodge auf und versuchte mit einem Taschentuch den zischenden Kühler zu öffnen. Keiner der Reisenden sprach ein Wort. Nur das Geräusch von fächelnden Zeitungen und das Zirpen der Grillen durchbrachen die Stille. Fliegen hatten den Weg durch die geöffnete Tür gefunden und die Hitze, die sich in diesen Junitagen von der Erde zu lösen schien, als würde sie zu einem eigenständigen, körperlosen Wesen.
Sie blickte den Abhang hinauf und suchte die Felsen ab, das Gestrüpp, die wie Sterbende sich krümmenden Bäume. Schweiß lief ihr an den Schläfen herunter, sie umfasste mit der einen Hand ihre Haare und band sie mit einem ledernen Riemen zusammen. Dann griff sie wieder nach der Mütze, die sie auf den Schoß gelegt hatte. In der Ferne auf dem Kamm entdeckte sie einen Hirten mit seinem Sohn. Ein dürrer Hund mit fehlfarbenem Fell schlich um sie herum. Hirten waren Späher, hatte man ihr in der Ausbildung gesagt. Behalte sie im Blick, sie nutzen sie für ihre Zwecke.
Wenige Meter darunter, hinter einer aus Felssteinen aufgeschichteten Mauer, befand sich ein britischer Posten, immerhin. Aber bei einem Angriff wären die Engländer kaum rechtzeitig hier. Der erste Schuss, sie würden ihn dort oben kaum hören; beim zweiten würden sie aufwachen, beim dritten hätte endlich ein verschlafener Sergeant den Feldstecher hervorgefingert. Scharfstellen, Gucken. Warum war der Bus dort unten stehen geblieben? Dann der vierte Schuss, fünf, sechs, sieben. Welcher würde ihr gelten?
Die britischen Soldaten würden mit dem Karabiner im Anschlag ausrücken und den Abhang herunterkommen. Und nur noch die Toten zählen.
»Ein Leck im Kühler oder der Radiator. Egged sollte unsere Busse besser warten. Aber es fehlt ihnen das Geld. Und die Geduld.«
Der Mann saß neben ihr und hatte bis eben noch geschlafen. Er mochte ein wenig älter sein als sie, sie schätzte ihn auf Mitte zwanzig, und musste irgendwann zugestiegen sein.
»Ein paar weniger Waffen in den Händen der falschen Leute wären mir auch recht«, sagte sie und blickte wieder den Abhang hinauf.
»In Händen der Araber«, sagte er. »Und? Hast du da oben etwas entdeckt, Genossin, von dem auch ich wissen sollte?«
Nichts war zu sehen. Auch der Hirte war hinter der Kuppe verschwunden.
»Wir bräuchten einen Plan, wie wir aus diesem Gefährt wieder ein bewegliches Ziel machen könnten. Und zwar schnell«, sagte sie.
»Einen Plan. Gute Idee.«
Der Mann lächelte. Er hatte sie »Genossin« genannt.
Sie hatte ihn bislang nicht beachtet. Als der Bus am Carmel-Markt in Tel Aviv gehalten hatte und sie zugestiegen war, hatte sie die unbesetzte Reihe entdeckt und sich ausgebreitet: Rucksack, Mütze, eine Blechflasche mit Wasser, ein Buch aus der Kibbuzbibliothek. Alles war auf einmal so schnell gegangen. Hinter Petach Tikwa waren ihr die Augen zugefallen. Hatte sie geschlafen? Durch die geschlossenen Augen hatte sie Licht gesehen, ein Flackern, wie ferne Leuchtzeichen, bei einem Gangwechsel war ihr Kopf gegen die Scheibe gestoßen.
Der Mann erhob sich, ging nach vorne und stieg aus. Durch die Frontscheibe sah sie, wie er mit dem Fahrer sprach, der, die Hände in die Seiten gestützt, vor der geöffneten Motorhaube stand. Der Fremde zog das Hemd aus der Hose, wickelte den Stoff um seine Hand und öffnete mit schnellem Griff den Kühler. Mit der anderen nahm er den Kanister. Kurz darauf sprang der Motor an. Der Bus setzte sich in Bewegung. Fahrtwind kam durch die Fenster, einer der Passagiere murmelte ein Gebet. Der Fremde setzte sich wieder neben sie. Er hatte helle Zähne, einen dunklen, wüsten Schopf und ein schönes Profil. Er strich sich die nassen Haare aus der Stirn und rieb sich an der Hose die Hände ab.
»Shaul Avidan«, sagte er, »ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich hoffe, es war in Ordnung, dass ich dich einen Moment allein gelassen habe – mit unserem Plan.«
»Ich denke, und der Mann schraubt. So ähnlich hatte ich es mir gedacht«, sagte sie.
Der Fremde lachte.
»Und wie heißt die große Denkerin?«
»Lilya«, sagte sie und reichte ihm die Hand.
»Lilya, und weiter?«
»Wasserfall.«
Er betrachtete sie, als wartete er noch auf etwas. Wie oft hatte sie das erlebt? Bist du keine Hebräerin, keine von uns, würde er jetzt denken, keine mit einem richtigen Namen?
Sie seufzte.
»Lilya Tova Wasserfall.«
Er lächelte.
»Schöner Name. Passt.«
»Danke«, sagte sie.
Er blickte auf ihren Schoß. Erst jetzt merkte sie, dass sie die Mütze noch immer fest umklammert hielt. Sie versuchte die dunklen Flecken, fast schwarz waren sie, zu verdecken. Es war offensichtlich, dass es kein Schweiß war. Er zog ein sauberes, ordentlich gefaltetes Taschentuch aus der Hosentasche und reichte es ihr. Sie bedankte sich, drückte es an Stirn und Schläfen, dann rieb sie sich Hals und Haaransatz ab. Er schien sie dabei zu beobachten, nicht mit dem sehnsüchtigen, oft gierigen Blick, den sie von Männern kannte, eher neugierig und mit einer Art sachlichem Interesse, als wolle er prüfen, ob das Tuch seinen Dienst tat.
Der Bus nahm eine Gerade, die Steigung war jetzt sanfter, immer wieder drehte der Fahrer den Kopf zur Seite, beugte sich mit dem Oberkörper vor und lauschte dem Motor.
»Und nun raus aus der Ackerfurche und hinauf in die heilige Stadt? Du kennst Jerusalem?«, fragte er und ließ das Tuch wieder in der Hosentasche verschwinden.
»Durchaus.«
»Wie wär’s mit einem kleinen Rundgang, Genossin, und wir unterhalten uns ein wenig? Du wirst staunen, wie unsere Stadt trotz all der Gewalt wächst. Es gleicht einem Wunder.«
»Wunder sind etwas Schönes. Nur geschehen sie meist nicht da, wo man sie erhofft. Bis auf wenige Ausnahmen vielleicht …« Lilya versuchte ihrer Stimme Leichtigkeit zu geben.
»Danke«, sagte der Fremde und lächelte.
Sie hatte es sehr wohl bemerkt, er hatte unsere Stadt gesagt, obwohl es doch nicht stimmte. Irgendwann, auch am Ende ihres Weges, würde es niemals nur ihre Stadt sein.
Der Fremde wandte sich ihr wieder zu und blickte auf ihre Stiefel, die voller Erde und Dreck waren.
»Die Idiotie des Landlebens. Geschichte wird in den Städten geschrieben. Wir scheinen das manchmal zu vergessen.«
»Karl Marx«, sagte sie. »Nur hatte der, soweit ich mich erinnere, nicht unsere Kibbuzim im Sinn, als er von der Unbildung der Landleute sprach.«
Der Mann formte mit dem Mund ein stummes »O!«
»Aber hätte er diesen Hort der Zukunft gekannt …«
»… hätte die Weltgeschichte einen völlig anderen Verlauf genommen«, ergänzte sie, »und Stalin wäre heute Bananenpflücker in Ashkelon.«
Sie wusste nicht, was sie von diesem Shaul halten sollte; es gefiel ihr, mit ihm zu reden, sich ablenken zu lassen. Sie hätte das Gespräch gerne fortgesetzt, sich treiben lassen – Gedanken, Sätze, schwerelos wie der Wind dort oben über der Kuppe – und spürte zugleich, wie viel Anstrengung es sie kostete. Sie blickte wieder zum Fenster hinaus, die Sonne war fast gänzlich verschwunden. Zwischen den Hügeln tauchten die ersten Häuser auf, schwarz und schattenlos. Es war nicht mehr weit bis in die Stadt.
Der Mann sah wieder nach vorn. Sie versuchte einen Blick auf seine Hände zu erhaschen. Seit sie mit dem lebte, was sie mittlerweile ihren »Zustand« nannte, betrachtete sie Hände. Die Hände Fremder. Die Hände Shimon Ben Gedis, den sie in Tel Aviv aufgesucht hatte, die Hände des Busfahrers, die Hände des Mannes, der ihr angeboten hatte, den Rucksack in den Wagen zu tragen.
Der Bus wurde langsamer, der Fahrer hielt das Lenkrad mit gestrecktem Arm und zog es kraftvoll nach rechts, sie bogen in den Busbahnhof ein. Schon erhoben sich die Leute, zerrten an Koffern und Taschen, schoben, drängelten, wurden durch das Schaukeln des noch immer rollenden Fahrzeugs hin und her geworfen. Mit einem Ruck hielt der Wagen, ohne dass Lilya erkennen konnte, ob sie am Haltesteig angekommen waren. Noch einmal erzitterte der Motor, dann verstummte er. Der Fahrer stieß die Tür auf und sprang hinaus.
Lilya und der Fremde waren die Letzten, die den Wagen verließen. An der Tür angekommen, drehte er sich noch einmal zu ihr um. Sein Blick war jetzt verändert, seine Augen kalt wie Marmor.
»Shalom, Genossin, ich hoffe auf ein Wiedersehen«, sagte er, fixierte sie, wie ihr schien, eine kleine Ewigkeit, wandte sich ab und verschwand mit federndem Schritt im Gedränge.
Sie sah sich am Busbahnhof um, den Rucksack über der Schulter. Jetzt galt es wachsam zu sein, sie würde später darüber nachdenken können, wer dieser Shaul war und was der Hinweis auf ein Wiedersehen und dieser Blick zu bedeuten hatten. Über die am Boden hockenden Händler hinweg, die Falafel, Kaffee, Gewürze und Schmuck anboten, hielt sie nach den Uniformen britischer Patrouillen Ausschau. Zeitungsverkäufer fuchtelten mit den Abendblättern vor ihren Augen herum, arabische Kinder liefen mit ausgestreckten Händen neben ihr her. Der Geruch von Diesel, Ruß und verbranntem Hammelfleisch lag in der Luft. Geschichtenerzähler, Vorleser und fliegende Zahnärzte saßen am Straßenrand. Die schwach beleuchtete Jaffa Road führte Lilya in die Stadt.
Elias Lind. Morgen würde sie ihn treffen, die Sache hinter sich bringen und die Stadt wieder verlassen. Der vergessene Schriftsteller. Den Mann aufzusuchen, war ein Befehl von Shimon Ben Gedi. Sie hatte sich zu wehren versucht, ohne Erfolg. Es hatte ihr an Kraft gefehlt, und Ben Gedi hatte das gewusst.
Den Mahane-Jehuda-Markt ließ sie rechts liegen, wie abgehängte Theaterkulissen schienen die Stände, Buden und Ladentore auf den nächsten Tag zu warten. Katzen schnupperten an leeren Blechdosen. Beduinen aus der Altstadt kamen ihr entgegen, mit Körben und Taschen auf dem Weg zu ihrem Lager außerhalb der Stadt. In der Ferne suchte sie bereits den geflügelten steinernen Löwen hoch oben auf dem Dach der Generali-Versicherung. ASSIC V RAZIONI, hatte sie als Kind stets die Buchstaben vor dem Firmennamen gelesen, das wie ein V geschriebene U für irgendeine Art Trennzeichen gehalten. Vater hatte ihr abends vor dem Einschlafen immer wieder Geschichten vom Löwen Assic Razioni erzählen müssen. »Assic und …« fingen seine Geschichten zumeist an, »der Wolf«, »der Sultan«, »der Dichter«, »der Zauberer«. »Der Löwe Assic und das lächelnde Kamel« war ihre liebste gewesen, weil der Löwe das kleine Kamel vor anderen Löwen beschützt hatte. Jetzt kamen ihr die Geschichten vor, als stammten sie aus einer fernen, fremden Welt und der steinerne Löwe thronte auf einem Mausoleum der Sicherheit, die es schon lange nicht mehr gab.
Hinter dem Generali-Bau und der Hauptpost fiel die Straße ab und führte auf die Altstadt und das Jaffa-Tor zu. Sie musste sich jetzt rechts halten. Die Wohnung war in einer Seitenstraße in Nahalat Shiva, es konnte nicht mehr weit sein. Vater hatte sie ihr beschrieben, kaum mehr als ein Wohn- und Esszimmer, hatte er gesagt, dazu ein Schlafraum. Sie lag in einem Hinterhof, der im Frühjahr nach Kühle und Fäulnis roch und in Sommernächten Fledermäusen ein Zuhause bot. Als ihre Eltern die Stadt verlassen hatten, um in Netanja ihr »neues Leben« zu beginnen, hatten sie dieses kleine Quartier für wenig Geld angemietet und es scheinbar wahllos mit Dingen aus ihrem großen Haus in Rehavia angefüllt. Alles, was sie in der Stadt zurücklassen wollten, Nützliches und Nutzloses, beherbergte nun diese kleine Wohnung. Ein Pied-à-Terre sollte sie sein, eine Anlaufstelle, Heimat und Speicher zugleich, und Lilya vermutete, dass ihre Eltern selbst bislang noch kein einziges Mal hier übernachtet hatten. »Unser Caidal«, hatte Vater mit hängenden Schultern gesagt und dabei ein wenig gelächelt, nachdem er am Tag vor ihrer Abreise den Mietvertrag mit einem Handschlag besiegelt hatte. Caidal, das Fest- und Königszelt der Beduinen, dieser Name, so unsinnig wie grotesk, war mit der unerklärlichen Beständigkeit des Vorläufigen geblieben. Sie selbst würde ein paar Nächte dort Unterschlupf suchen, in dieser Kaschemme mit königlichem Namen, und die Stadt dann wieder verlassen.
Der Schlüssel lag in dem verabredeten Versteck, und ihre Hände zitterten, als sie schließlich in der Dunkelheit das Schlüsselloch fand. Noch einmal zögerte sie, dann öffnete sie die Tür und ging hinein.
2
Sie zählte zehn, oder waren es zwölf? Das Morgenlicht fiel durch dünne Schlitze ins Zimmer und zeichnete helle Streifen an die Wand. Vom Bett aus konnte sie in die Küche sehen, irgendwann hatte sie auf der Seite liegend angefangen, die Balken zu zählen. Sie streckte die Finger aus, als wären es die Saiten eines Instruments. Fast war es eine Gewohnheit geworden, zunächst Unsinniges zu tun, wenn allzu Sinniges, Wichtiges, Ernstes, Unabwendbares auf sie wartete. Aber was war schon sinnig oder unsinnig? Die Dinge schienen mehr und mehr zu verschwimmen, ihre Konturen lösten sich auf, die Wahrheit war ein amphibisches Wesen, Menschen hatten recht und unrecht zugleich, sie war dabei, den Überblick zu verlieren. Mit der Wahrheit war es wie mit der Schuld. Trug sie Schuld, war Yoram schuldig geworden? Konnte man handeln, ohne sich schuldig zu machen? Nur Träumen war gefahrlos, Träume hatten immer recht, auch wenn sie trogen. Vielleicht war das Paradies nichts anderes als ein Garten für wandelnde Träumer, darin Bänke mit der Aufschrift: »Für Nichtträumer verboten«. Oder: »Handelnde unerwünscht.«
Sie richtete sich auf, strich sich das Haar zurück, spürte auf ihren Schultern die sanfte Berührung der Spitzen, für einen Moment waren es Hände, Lippen, ein wandernder Kuss. Sie setzte die Füße auf den Boden, er war kühl.
Sie versuchte ihre Uhr zu lesen, hielt sie gegen das Licht. Um zehn würde sie der Schriftsteller im Café Lewandowski erwarten. Elias Lind. Sie hoffte im Stillen, dass er vielleicht nicht kommen würde, obwohl Ben Gedi bei ihrer Begegnung gesagt hatte, auf diese Möglichkeit brauche sie erst gar nicht zu bauen. Er hatte sie in ein Geheimbüro nach Tel Aviv zitiert, was sie nach ihrer Flucht und all den Monaten im Norden gänzlich überraschte. Seine Nachricht war ein Zettel in einer Streichholzschachtel, nicht mehr. Sie hatte den Zettel gelesen und ihn verbrannt, ihre Sachen gepackt und den Kibbuz Hanita, ihr Versteck, verlassen. Noch einmal war sie an die höchste Erhebung gegangen, war dort auf den aus Beton gefertigten Eingang eines unterirdischen Bunkers geklettert, in ihrem Haar den Wind, in ihrem Rücken den Libanon, und hatte durch die Bäume hindurch weit unten das Tal gesehen, das Meer, auf dem die Sonne zu tanzen schien. Sie wollte nicht weg von hier, noch nicht. Sie hatte sich nach Yorams Tod in dieser Welt aus Feldarbeit, Liedern, Lagerfeuern und traumlosen Nächten eingerichtet, einem Leben ohne Zukunft und Vergangenheit, einem Kokon aus reiner Gegenwart. Sie wusste, nun würde er zerbrechen.
Die Fensterläden waren noch immer geschlossen, sie hörte einen Hund bellen und arabische Stimmen im Innenhof, irgendwo auf der Straße iahte ein Esel. Der Wind hatte zugenommen, sie spürte, der Chamsin würde kommen. Sie sah sich im Zimmer um. Am Abend zuvor hatte sie nur Konturen erkennen können, eine Welt ohne Tiefe. Eine Kerze hatte den Raum notdürftig erhellt, sie wollte nicht gesehen werden. Jetzt öffnete sie einen der Läden, Licht flutete herein. Das also war Vaters Caidal. Ein Tisch, sie kannte ihn aus der Küche ihres Elternhauses, eine Vitrine mit schadhaften, aber noch brauchbaren Tellern, Gläsern und zwei Karaffen, an der Wand ein Regal mit Büchern. Sie konnte nicht erkennen, nach welchem Prinzip ihre Eltern sie ausgewählt hatten, hebräisch-, englisch- und deutschsprachige standen ungeordnet nebeneinander. Vielleicht waren welche darunter, mit denen sie ihr Deutsch Mal um Mal verbessert hatte, Tonio Kröger, Fabian, den Nachsommer hatte sie nach wenigen Seiten weggelegt, Vicki Baum hatte sie verschlungen, Menschen im Hotel, Tanzpause, Welt ohne Sünde. Sie stand auf und berührte die Bücher. Sie waren mit einer Staubschicht bedeckt, die rau war wie Sand. War es das, was von ihnen, der Familie Wasserfall, in dieser Stadt geblieben war?
Hier ganz in der Nähe, in der King George Street, hatte sie mit ihren Eltern und Yoram gewohnt, bevor sie zusammen in das große Haus in Rehavia gezogen waren, das war 1934, und sie war zehn. Die neue Wohnung lag im ersten Stock, sie war groß und hatte hohe Decken. Das Haus in der Haran Street gehörte einem entfernten Onkel ihres Vaters, und er hatte es ihnen für eine bezahlbare Miete überlassen. Vater und Mutter waren stets frühmorgens aus dem Haus gegangen, beide arbeiteten als Ärzte für den Gewerkschaftsbund Histadrut. Sie stammten aus Posen, 1920 hatten sie die Alya gemacht, nachdem sich die Nachrichten von im Osten stattfindenden Pogromen wieder gemehrt hatten. Sie waren nach Palästina gekommen und hatten es zu etwas gebracht. Juden brauchten ein eigenes Land, sie sahen keinen anderen Weg. Zugleich dachten sie, von Herzls Ideen eines politischen Zionismus erfüllt, sie würden Europa einfach mitnehmen und es hier wieder auspacken.
Sie hatten das Haus von Anfang an geliebt, und doch überkam sie oft auch Wehmut, weil es so europäisch war, so gar nicht in dieses karge Land am Rand der Wüste zu passen schien; und sie empfanden Scham, da die Wohnung mit ihren vielen Zimmern voll Licht und Luft nicht ihren Idealen entsprach, und manchmal wollten sie Freunde und Kollegen, ärmere oder noch radikalere Sozialisten als sie selbst, nicht zu sich einladen, weil sie Privilegien wie diese, die andere einfach nur Glück genannt hätten, für so etwas wie Unrecht hielten.
Sie hatten bald gelernt, dass Palästina nicht Europa war, wenngleich auch nicht Arabien, sondern irgendetwas dazwischen. Aufgewacht waren sie wohl erst, als ihre Freunde, die Lippmans, 1931 bei einem Feuergefecht zwischen arabischen Kämpfern und der britischen Polizei ums Leben kamen. Sie waren unschuldig und ahnungslos in diese Sache hineingeraten, und Yoram Lippman, ihr Sohn, damals zehn, hatte es mit ansehen müssen und als Einziger überlebt.
Für ihre Eltern stand schnell fest, dass sie das Kind ihrer Freunde wie einen eigenen Sohn aufnehmen würden. Yoram war verstört und wortkarg, wollte kaum etwas essen, und jeden Morgen wechselte Lilyas Mutter seine eingenässten Laken. Er bekam ihre ganze Aufmerksamkeit, sie schleppten ihn zu dem greisen Seelenarzt Dr. Kitteler, der einst in Breslau ein berühmter Psychoanalytiker gewesen war und dem Knaben stumm lauschte, aber auch keinen Rat wusste. Yoram hier und Yoram dort, sie hatte es bald nicht mehr ertragen können. Ihre Eltern gaben ihr weiterhin alle Liebe, aber die Sorge – und die schien oft größer – gehörte ihrem neuen Bruder. Und mit den Ereignissen schienen Vaters Humor, seine Ironie und sein Sinn für die Komik des Lebens still zu welken, als fehle seiner Seele Wasser, Licht und frische Luft. Er wurde von Tag zu Tag ernster. Ihre Mutter, eine Melange aus Liebe, Wärme und pommerscher Gewissenhaftigkeit, neigte mehr und mehr zur Strenge; hatte sie Vater früher noch oft zu bremsen versucht, wenn er vor den Kindern wieder einmal Hitler oder Mussolini spielte oder Lilya abends am Bett absurde, komische, aus ihrer Sicht völlig unglaubwürdige Geschichten von zaubernden Mäusen, lächelnden Kamelen und geflügelten Löwen erzählte, so hatte sie sich mit den Jahren ganz auf die Seite der Vernunft und der zwingenden Beherrschbarkeit der Dinge und Lebensumstände geschlagen, auch der in ihrem Land. Dabei war sie klug genug, um zu wissen, dass gerade deren Unbeherrschbarkeit sie auf diesen trockenen Pfad der Rechtschaffenheit gelockt hatte. Nur selten noch hörte Lilya ihre Mutter lachen, und doch, was sie zu sagen hatte, war wohl erwogen und stets vom Herzen her gedacht.
Doch Yoram war hübsch, mit Verwirrung und später mit Neugier sah sie, wie er ein Mann wurde, las und lernte, Freunde gewann, mit der Sache Palästinas rang. Nur selten noch überkam ihn die Schwermut, und Lilya spürte immer öfter ein Ziehen im Bauch oder ein Kribbeln im Nacken, wenn er in ihrer Nähe war oder sie gar berührte. Sie mochte seine Verschlossenheit und hielt sie für Tiefe. Und irgendwann, die Männer und Jungen hatten längst begonnen, ihr mit der unstillbaren Sehnsucht von Hunden nachzublicken, war sie sich sicher, dass nur sie allein, Lilya Tova Wasserfall,in der Lage und dazu bestimmt war, diese Tiefe zu durchdringen und zu erschließen. Yoram war von einer Ernsthaftigkeit, die sie erregte. War es Liebe? Irgendwann ja. Eine Liebe ohne Erlösung, die sie zugleich für alle anderen Männer unsichtbar machen sollte.
Sie wollte den Gedanken Einhalt gebieten. Es wäre besser, jetzt aufzustehen, sich anzuziehen und zu gehen. Stattdessen sank sie auf das Kissen zurück, schloss die Augen und rollte sich zusammen. Leben. Vor, zurück, Stillstand. Leben. Tod.
Wie oft hatte sie in diesen Jahren in Rehavia versucht, ihre Empfindungen, die Bilder, Gerüche und Berührungen zu speichern, die sie mit Yoram verbanden, sie festzuhalten, irgendwo in ihrem Inneren, damit sie in den Zeiten der Dürre und des Wartens nach ihnen greifen, sie zu sich rufen konnte. Sie sah sich im Garten hinter dem großen Haus auf einer Decke liegen, vor sich ein Buch, das Kinn auf die Hände gestützt. Die Bäume hier waren kräftig und standen dicht beieinander, sie bildeten ein schützendes Dach. Irgendwo im Haus war das Klappern einer Schreibmaschine zu hören. Ärzte, Professoren und Künstler wohnten in der Haran Street, das aber war Vater an seiner Maschine. Unermüdlich formulierte er in seiner freien Zeit eine Petition, eine Eingabe, ein Konzept für den gemeinsamen Staat Palästina. Aus dem Fenster des Nebenhauses drang Klaviermusik, wenig später war von der anderen Seite des Grundstücks der hohe Ton einer Violine zu hören. Läufe, Phrasen, Auftakte.
»Bach links, Debussy rechts. Das kann nicht gut gehen. Einer muss nachgeben«, sagte Yoram.
Er hockte neben ihr im Gras, vor ihm lag ein Stapel Zeitungen – Palestine Post, Davar, Jedioth Achronoth, Haaretz und die arabischsprachige Al-Difa. Mit einer großen Schere schnitt er Artikel aus.
»Und wer gewinnt?«, fragte sie.
Yoram lachte, ohne aufzusehen. »Der Bessere. Ofer, er ist der Größte.«
Das Klavier verstummte.
»So soll es sein«, sagte Yoram, »die Musen sind gerecht. Bach bleibt.«
Sie sah zu ihm hoch. Seine dunklen, fast schwarzen Haare hingen ihm ins Gesicht, sein Hemd war bis zur Hälfte aufgeknöpft und gab seine gebräunte Brust frei, seine schönen Hände fuhren mit der Schere geschickt um die ausgewählten Artikel herum. Er roch nach Leder und Zitrone. Die Sehnen seiner Rechten spannten sich. Wenn er aufblickte, würde er bemerken, dass sie ihn anstarrte. Bei dem Gedanken wurde sie rot. Vielleicht hatte er es längst bemerkt, zeigte es aber nicht.
Sie drehte sich auf den Rücken.
»Das schwarze und das weiße Buch … Was machst du, wenn eins von beiden voll ist?«
»Ich besorge mir ein neues. Und noch eins, bis …«
Yoram sammelte Artikel aus den Zeitungen, die Ehud gelesen und in einer Ecke des Hausflurs aufgestapelt hatte. Er blätterte darin, schnell und mechanisch, bis er gefunden hatte, was er suchte. Alle Artikel über Anschläge, Überfälle, Verhaftungen und Entführungen. Polizeireporte, Hintergrundberichte, Fahndungsaufrufe, Kommentare und Bilder von Autoexplosionen, eingestürzten Häusern, Verwundeten, Toten, Verstümmelten. Das schwarze Buch enthielt Artikel über Angriffe arabischer Gruppen, aber auch über Attacken, Razzien und Übergriffe der Engländer; das weiße Buch Artikel über die Aktionen von Irgun und anderen jüdischen Aktivisten. Er schnitt sie aus, klebte sie in ein Heft und schrieb das Datum dazu.
»Die Engländer wollen die Prügelstrafe in Palästina abschaffen«, sagte er. »Achtzehn Schläge und achtzehn Monate Haft, das war einmal. Stattdessen wollen sie achtundzwanzig Monate Haft, und zwar unter verschärften Bedingungen. Das nenne ichGerechtigkeit.«
Sie konnte nicht heraushören, ob er wütend war oder nur auf verzweifelte Weise traurig. Beides, dachte sie. Und die Wut wird siegen.
Sie setzte sich auf und hob den Arm. Auch wenn sie wusste, dass es falsch war, strich sie ihm die Haare aus dem Gesicht. Er erstarrte. Ihr Herz pochte. Sie beugte sich vor.
Er erwiderte ihren Kuss, zaghaft, dann heftig. Fasste sie um die Taille, zog sie an sich. Ganz unvermittelt ließ er sie wieder los und wandte sich ab.
»Ich bin dein Bruder«, sagte er.
»Bist du nicht«, erwiderte sie.
»Lilya …«
»Du bist Yoram Lippman.«
»Lippman gibt es nicht mehr. Ehud und Deborah sind meine Eltern, und du bist meine Schwester.«
Sie bemerkte ein leichtes Beben in seiner Stimme, eine Unsicherheit, und durch diese kleine Lücke schlüpfte Hoffnung. Er liebt mich, dachte sie, er wird mich, er muss mich lieben, es ist unser Glück.
Sie hatten nicht bemerkt, dass auch die Geige verstummt war.
Als Ofer Kis wenig später mit dem Geigenkasten unter dem Arm in den Garten kam und nach Yoram rief, nahm sie schnell wieder ihr Buch zur Hand.
»Sie haben die Synagogen angezündet. In Deutschland, gestern Nacht«, sagte er ein wenig außer Atem, legte den Kasten ins Gras und ließ sich kraftlos neben sie fallen.
In einem der Schränke fand sie Tee, ein kleiner Gaskocher war schnell angeworfen. Sie streifte ihre Kleidung über – eine ausgediente Uniformhose und ein dazugehöriges Hemd aus dem Kibbuz – und nahm die Wohnung näher in Augenschein. Die Muschel. Zwischen zwei Buchstützen lag sie, fast bekam Lilya einen Schreck. Vorsichtig nahm sie die Muschel in die Hand, sie war leichter, als sie es in Erinnerung gehabt hatte, hielt sie sich unter die Nase und atmete tief ein. Damals, als sie Vater ihren Fund zum Dank geschenkt hatte, hatte sie nach Meer und Salz gerochen. Jetzt war dieser Duft verflogen.
Ganz allein war Ehud mit ihr gewandert, fünf Tage lang, Jam el Jam, von Meer zu Meer. Da war sie sechzehn gewesen, und Yoram hatte gerade das Haus verlassen, um in Haifa eine Ausbildung bei einer Bewässerungsfirma anzufangen. Mutter wollte intervenieren, hatte gesagt, es sei zu gefährlich und sie sollten zumindest die arabischen Dörfer meiden. Ohne Frage hatte sie recht gehabt, aber Vater hatte abgewinkt und sich schließlich durchgesetzt. Vom Kineret, dem galiläischen Meer, bis ans Mittelmeer waren sie gewandert, am Ende hatte sie schief gelaufene Schuhe. Sie redeten, schwiegen, sangen und lachten, nie zuvor und nie wieder danach hatte sie ihren Vater so für sich gehabt. Am letzten Tag lag der Karmel vor ihnen, und als sie auf dem höchsten Punkt angekommen waren, bevor das kleine Gebirge zur Küste hin abfiel, sahen sie das Meer. Sie umarmten sich, und Vater schien sie nicht wieder loslassen zu wollen. Südlich von Haifa gelangten sie ans Meer, dort fand sie im Sand eine besonders schöne Muschel, hell wie Marmor aus Carrara und mit dunklen Linien überzogen, als sei sie von Hand bemalt. Sie hob sie auf, sog ihren Duft ein und schenkte sie Vater.
Erst kurz vor ihrer Rückkehr musste sie mit einer gewissen Bitterkeit begreifen, dass ihr Vater mit dieser gemeinsamen Zeit auch Absichten verband, dass er sich wie ihre Mutter Sorgen um Yoram machte. Der hatte angefangen, an den Abenden nach der Arbeit an den Waffen zu üben und mit Leuten zu verkehren, denen die Ungeduld ins Gesicht geschrieben stand und die Ze’ev Jabotinskys kalten Lehren folgten. Wie dieser Zelot Menachem Begin, den Vater verachtete. Ein junger Mensch muss Hebräisch sprechen und eine Waffe tragen. Sonst nichts. Das war der Kern dieser sogenannten Lehre. Ob sie vorhabe, Yoram auf seinem Weg zu folgen, wollte ihr Vater wissen, ob auch sie irgendwann allein auf Gewalt setzen würde. Bald werde sie das Haus verlassen, um die Universität zu besuchen, dann werde vielleicht auch sie mit diesen Leuten in Kontakt kommen.
Um kurz vor zehn verließ sie die Wohnung, ging durch den Innenhof und trat hinaus auf die belebte Straße.
Das Café von Ascher Lewandowski lag am oberen Ende der Ben-Jehuda-Straße, ganz in der Nähe der King George Street. Das Haus, in dem es sich befand, war unter der Herrschaft der Osmanen gebaut worden und über die Jahre heruntergekommen. Die Scheiben waren schlierig, die Decken niedrig, und es war längst nicht so berühmt und gut besucht wie das wenige Hundert Meter entfernt gelegene Café Europa an der Jaffa Road im prächtigen Sansour-Haus oder das auch bei den Engländern beliebte und als bohemienhaft verschriene Atara, ebenfalls kaum einen Steinwurf entfernt. Es hatte sie nicht überrascht, dass Elias Lind gerade dieses Café für ihr Treffen gewählt hatte. Hier, am Ende der Straße, war die Zeit stehen geblieben. 1925, 1930, 1936, irgendwann vor dem Krieg. Sie schrieben jetzt das Jahr 1946, und eine Welt war untergegangen. Allerdings nicht im Café Lewandowski, dem Treffpunkt der Jeckes: Man sprach Deutsch, debattierte über Europa und Deutschland, Bamberg, Hamburg und Königsberg, versuchte die abgescheuerten Hemdkragen zu verdecken, die in Breslau oder Trier zum letzten Mal ausgebessert worden waren, nippte stundenlang an einer Tasse Filterkaffee, raunte und lauschte, hielt Vorträge über deutschen Kaffee und Schwarzbrot, über heimischen Kuchen und Krapfen und gab zum Besten, was man gehört hatte – das heißt, was Mendel erzählt hatte, der es von Levi wusste, der es wiederum aus sicherer Quelle habe.
In den vergangenen Monaten war es nichts Gutes gewesen. Auch wenn die Zeitungen vielleicht oft übertrieben, mochte manch einer denken, nun konnte man nicht mehr anders, als ihnen zu glauben. In der Buchhandlung Steimatzky hingen sie aus, auch die amerikanischen, englischen und französischen Blätter. Vieles hatte bittere Bestätigung erfahren, Eltern, Geschwister, Vettern und Cousinen, Freunde, Schulkameraden, sie waren tatsächlich verschwunden. Das ganze Ausmaß dessen, was in Deutschland und Europa geschehen war, wurde nach und nach deutlich, und das Wissen um die Ungeheuerlichkeiten brandete auch an die Eingangstür des Cafés. Aber diesesWissen war noch immer zu unermesslich, man konnte es nicht fassen. Zeichne ein Ungeheuer auf einen Bierdeckel, und es bleibt immer noch ein daumengroßes Tier.
Sie ging die Ben Jehuda Street hinauf, es war jetzt sicher nicht mehr weit.
Gestern erst hatte sie den Auftrag erhalten, es kam ihr vor wie vor einer kleinen Ewigkeit. Sie sah Shimon Ben Gedi vor sich, er stand über einen Tisch gebeugt, als sie hereinkam. Das Geheimbüro lag in einem unscheinbaren Haus in der Hayarkon Street in Tel Aviv, oberhalb der Straße. Er hatte sich verändert seit ihrer Ausbildung, als er sie und die anderen darin unterrichtete, wie man mit redlichen Mitteln für die rechte Sache kämpft, mit List, Härte und aller Art Waffen. Nur kurz sah er zu ihr auf, und sein Blick schien zu sagen, ich wusste, dass du kommen würdest. Er begrüßte sie mit einem kurzen »Shalom«, dann beugte er sich wieder über die Papiere.
Sie betrachtete ihn. Seine Schultern wirkten hart und kantig, als hätte die Zeit an seinem Körperbau gearbeitet. Seine Wangenknochen schienen gewachsen zu sein, seine Augen lagen tief in den Höhlen, als wolle der Schädel sie verschlucken. Obwohl deutlich über vierzig, war er noch immer athletisch. Er trug ein offenes weißes Hemd, dessen Ärmel achtlos hochgekrempelt waren, und dazu Kakishorts. Zum Lesen brauchte er neuerdings eine Brille. Hatte sie ihn gemocht? Nicht sonderlich, aber sie hatte Ben Gedi stets respektiert, er war der Sache Palästinas hingegeben wie kaum ein anderer, mit Augenmaß, Beweglichkeit, Härte und Geschick. Und er war ihr ein guter Lehrer gewesen, vielleicht der beste, den sie hätte haben können. Wäre die Hagana eine richtige Armee, hatte sie oft gedacht, Shimon Ben Gedi wäre einer ihrer obersten Generäle. Die Engländer fürchteten ihn und suchten zugleich seine Nähe. Sie wussten, dass sie ihm nicht trauen konnten, aber in diesem Wissen um seine Unberechenbarkeit lag auch eine Art Verlässlichkeit, man wusste, woran man bei Ben Gedi war.
Der Tisch vor ihm war mit Stapeln von Papier bedeckt, irgendwelchen Akten, dazu Karten und Büchern. Es sollte, wenn es entdeckt werden würde, aussehen wie das Büro eines Anwalts oder Steuerprüfers, nicht wie der kahle, ungedeckte Tisch des Verrats und des Geheimnisses. Hinter dem halb geöffneten Fenster hörte sie das Meer, mit samtener Hand streichelte es das Ufer. In der Ferne erklang das Heulen einer Militärpatrouille. Eine feuchte, vom Meer gesalzene Hitze lag über Tel Aviv und ließ die Schwere und Unausweichlichkeit des nahenden Sommers erahnen.
Er bat sie, zu ihm an den Tisch zu kommen, betrachtete sie kurz, lächelte und sagte »Danke«. Dann wies er auf die vor ihm liegende Karte. »Deutsches Reich« stand oben rechts, darunter war ein Hakenkreuz. Im unteren Teil der Karte hatte Ben Gedi Kringel eingezeichnet, er tippte mit einem Bleistift auf das Papier. Deutschland sei ein großer Wartesaal, sagte er und wies auf die markierten Stellen. Vor allem Überlebende aus dem Osten retteten sich jetzt nach Bayern. In Landsberg, Feldafing und Föhrenwald seien große Flüchtlingslager entstanden. Es gebe in der Nähe von Wolfratshausen eine Wohnanlage der IG Farben, feste Häuser mit Zentralheizung, die von den Deutschen einst für die Arbeiter in der nahe gelegenen Munitionsfabrik gebaut worden waren. Die Lage spitzte sich zu. Aus Russland und Polen würden gravierende Vorfälle gemeldet, er befürchte eine weitere jüdische Massenflucht aus Osteuropa nach Deutschland. Die UNRRA bekomme keine neuen Leute, die Amerikaner seien willig, aber schwerfällig, es fehle an allem. Aber sie hätten in Palästina zu wenig Kenntnis, wie die Situation in den Lagern wirklich sei. Er benötige einen Bericht, und zwar aus dem größten Lager, aus Föhrenwald. Mit sehr konkreten Empfehlungen. Er erwarte, dass ihre Expertise mit dem Skalpell geschrieben sei. Wer sie lese, solle Schmerzen spüren.
Bericht, Expertise, Deutschland, Skalpell? Bevor sie recht verstanden hatte, worum es ging, und sie ihn fragen konnte, ob das heiße, dass er sie nach Deutschland schicken wolle, legte er einen Ausweis auf den Tisch. American JOINT Distribution Committee, kurz JOINT. Auf einem Foto von ihr bedeckte ein Stempel ihre halbe Wange wie eine Tätowierung. Sie starrte das Papier an.
»Herzlich willkommen beim JOINT, Commissioner Wasserfall«, sagte Ben Gedi.
JOINT war eine der wichtigsten Hilfsorganisationen für die jüdischen Flüchtlinge und würde Lilya unter ihre Fittiche nehmen. »Alles legal«, erklärte er, »und bereits vorbereitet.« Und die Engländer würden sie aus Palästina ausreisen lassen, mit diesem Stempel als Abschiedskuss. In wenigen Wochen würde sie zurück sein, niemand würde es merken, und wer sie im Norden wähnte – er sah sie über die Brille hinweg an und beide wussten, dass ihre Eltern gemeint waren –, würde sie weiterhin gut und sicher aufgehoben wissen.
Am liebsten wäre sie aufgestanden und hätte den Raum verlassen. Auch wenn sie in ihrer Ausbildung gelernt hatte, dass Anweisungen der Vorgesetzten zu befolgen und nicht zu hinterfragen waren, weil ohne eine verlässliche Befehlsstruktur ihr Kampf nicht zu gewinnen war, fiel es ihr noch immer schwer, sich damit abzufinden. Sie wäre gern von Ben Gedi gefragt worden, ob sie überhaupt bereit war, nach Deutschland zu reisen, besonders nach allem, was geschehen war und was er von ihr wusste. Mit keinem Wort hatte er zudem erwähnt, was sie in den Tagen vor seiner Nachricht in ihrem Versteckim Norden für ihn erarbeitet und ihm über Boten hatte zukommen lassen. Konzepte, Entwürfe, Pläne für die Zeit nach der großen Aktion, von der sie dort gehört hatte: Operation Markolet, die Zerstörung aller Brücken und Zufahrtswege in Palästina, ein spürbarer Schlag gegen England. Sie war fest davon ausgegangen, dass er sie deswegen zu sich beordert, dass er ihr Material gelesen und für gut befunden hatte. Sie, die zukünftige Königin der Kommunikation, Expertin für Kassiber, Codes und Pamphlete, Manifeste und Eingaben, Kryptogramme und tote Fährten aus Papier und Buchstaben. Sie war eine Handwerkerin des Wortes, hatte er immer gesagt, es gäbe bald keine Bessere, wenn sie so weitermache.
Und nun wollte er sie, eine seiner Besten, nach Deutschland schicken, um sie einen »Bericht« schreiben zu lassen! Das hatte sie schnell entschlüsselt, auch ohne Chiffriermaschinen,Lochwalzen oder ein Handbuch der Kryptografie. Klartext. Für die bevorstehende Operationhielt er sie offensichtlich noch für zu schwach. Nicht einsatzfähig, nicht hinreichend belastbar. Er ging davon aus, dass sie ein Verhör hinter britischen Mauern nicht überstehen würde. Er hatte sie aussortiert, zumindest vorübergehend. Lilya Tova Wasserfall war in seinen Augen ein zu großes Risiko!
Oder trieb auch ihn die Angst um, sie könne aus dem Norden statt Gelassenheit nur Wut, statt Trauer Hass, statt in den Nächten ausgearbeitete Papiere Konstruktionspläne für Bomben mitgebracht haben und ein Herz aus Stein?
»Setzen Sie sich, Sie sehen nicht gut aus«, hatte er gesagt, mit Mühe nur konnte sie ihm noch folgen. Er hatte ihr ein Glas Wasser gebracht, eine Pause gemacht, sie eine Weile angesehen. Sie hatte es verlernt, seinen Blick zu deuten. Es hatte einen Wortwechsel gegeben, sie konnte sich an Einzelheiten nicht mehr erinnern, irgendwann hatte sie das Wort »Befehl« vernommen, wie eine kalte Klinge zerschnitt es die Luft. Dann hatte er sich gesetzt, sie lange betrachtet und begonnen, ihr die »Sache Lind« auseinanderzusetzen.
Elias Lind hatte wenige Tage zuvor von zwei Vertretern der englischen Mandatsmacht die Nachricht erhalten, dass sein Bruder Raphael, ein renommierter Wissenschaftler, von den Nazis ermordet worden sei. Lind jedoch hatte Hinweise darauf, dass Raphael noch lebte. Die Nachricht vom Tod seines Bruders hatte ihn misstrauisch gestimmt, und er hatte Ben Gedi in Tel Aviv aufgesucht. Sie kannten sich noch von früher und waren sich in der Jewish Agency wieder begegnet.
»Treffen Sie sich mit Elias Lind«, hatte Ben Gedi schließlich gesagt, »vielleicht finden Sie in Deutschland etwas heraus, was wir gegen die Engländer nutzen können. Es könnte überaus hilfreich für unsere Sache sein, wenn wir wissen, was mit Raphael Lind tatsächlich passiert ist. Die Zeiten werden härter werden nach der Operation Markolet, wir werden neue Waffen brauchen, andere, ungewöhnliche, unsichtbare. Und Sie, Lilya, geben Sie uns vielleicht eine solche in die Hand.«
Nur wenige Meter vor dem Eingang des Café Lewandowski hörte sie laute Stimmen. Britische Polizisten kamen die Straße heruntergelaufen, ihr entgegen. Weitergehen, langsam, sieh nicht hoch, sagte sie sich. Passanten blieben stehen. Die Rufe in ihrem Rücken wurden lauter, es waren hebräische und englische Wortfetzen. Sie hatte das Café erreicht. Ein Jeep hielt auf der anderen Straßenseite, Soldaten mit Karabinern kletterten aus dem Fahrzeug. Sie stieß die Tür zum Café auf und zog sie gleich hinter sich zu, erst als sie im Gastraum stand, drehte sie sich um und spähte durch das Fenster hinaus. Die Soldaten verschwanden und kamen kurz darauf mit einem jungen Mann in Handschellen zu dem Jeep zurück. Er trug ein zerrissenes, offenes Hemd und blickte zu ihr herüber, die Hand eines Soldaten umfasste seinen Nacken. Sie erkannte ihn, es war Yorams Freund Ofer Kis, der Musiker. Er musste sie gesehen haben, hau ab, Lilya, und verschwinde, schnell, sagten seine Augen. Dann stießen sie ihn in das Fahrzeug.
Ascher Lewandowski stand hinter der Theke, ein Geschirrhandtuch über der Schulter, und sah sie an. Sie wandte sich ihm zu.
»Einfach so«, sagte sie, »sie nehmen ihn einfach mit. Ich kenne ihn. Er ist der beste Kumpel Beethovens. Sonst nichts.«
Ascher legte einen Finger an den Mund und sah sie mit fast väterlicher Sorge an.
»Und alle hier sehen dabei zu und unternehmen nichts. So ein stolzes Volk. Soll das immer so weitergehen? Weiter und weiter?«
Sie spürte, dass jemand hinter ihr stand.
»Ich folge Ihrer Betrachtungsweise, junge Frau. Nur in diesem Moment, denke ich, können wir nicht viel ausrichten. Jedenfalls nicht mit unseren Waffen.«
Sie wandte sich um. Der Fremde war groß, vielleicht ein wenig älter als ihr Vater, sie schätzte ihn auf Mitte fünfzig, die Zeiten schienen ihn hager gemacht zu haben. Er hatte sie in Jeckes-Hebräisch angesprochen, die Konsonanten und Vokale quadratisch und zu handhabbaren Worteinheiten verfugt. Langsam und deutlich sprach er, als lese er aus einer Fibel. Er trug eine ungewöhnlich schwere Brille aus Schildpatt, seine Augen dahinter waren so groß, als blicke er durch die Böden von Milchflaschen. Aber sein Haar war voll, dicht und nur leicht ergraut. Der ein wenig abgetragene graue Anzug war etwas zu weit, von europäischem Schnitt und wohl einst maßgeschneidert worden. Er hielt einen Stock in der Hand, der selbst für einen Gang durch die Stadt zu dünn war, doch seine Haltung war aufrecht. Auf seinem Gesicht, das trotz der dicken Brille und der Furchen, die das Leid und die Jahre, die Wüstensonne und das einsame Ringen in der Schreibstube darauf hinterlassen hatten, von erstaunlicher Lebendigkeit war, hatte sich ein Lächeln ausgebreitet.
»Ich habe Ascher gebeten, uns Plätze am Fenster frei zu halten«, sagte er. »Ich brauche Licht, wissen Sie, viel Licht. Und Sie können von dort aus beobachten, ob die Straße ein Ort weiteren Unrechts wird. Ich fürchte allerdings, darauf werden wir nicht lange warten müssen.«
Lilya sah ihn wortlos an.
»Kommen Sie. Schließlich haben wir eine Verabredung. Der Kaffee ist schon bestellt.«
Elias Lind führte sie zu seinem Tisch am Fenster und berührte auf seinem Weg durch den Raum fast jeden Stuhl, besetzt oder nicht, mit dem Stock. Er streckte die Arme danach aus, als seien die Stühle Bojen in einem für sie unsichtbaren Meer, von Ascher Lewandowski zu seiner Orientierung ausgesetzt.
Er zog einen Stuhl vom Tisch ab, wartete, bis sie sich gesetzt hatte, und nahm ihr gegenüber Platz. Ascher brachte ihnen Kaffee und zwei Gläser Wasser. Elias Lind lehnte den dünnen Stock an den freien Stuhl neben sich, auf dem bereits eine schwarze Aktentasche lag.
»Mein drittes Auge. Doktor Abramssohn hat mir den Stab verschrieben. Er prognostiziert eine weitere, nicht unerhebliche Verschlechterung meiner Sehfähigkeit. Gewöhnen Sie sich an ihn, hat er gesagt, tasten, fühlen, klopfen Sie Ihre Umgebung damit ab.«
Er nahm ihn kurz zur Hand und klopfte gegen das Tischbein.
»Und? Was sagen Sie? Zeder? Vielleicht auch Föhre. Auf jeden Fall ein Nadelbaum. Ein Auge wird er jedenfalls nie werden.«
Lilya sah ihn aufmerksam an und war unschlüssig, was sie von ihm halten sollte. Das also war der große, heute fast vergessene Schriftsteller Elias Lind? Sie wusste, dass er als junger Mann vor vielen Jahren Deutschland verlassen hatte, nachdem er im ersten großen Krieg im Westen für sein Land gekämpft und sich danach, verwundet und verändert, von ihm abgewandt hatte. Ihre Eltern hatten ihr vor wenigen Jahren seinen Joseph Sternkind gegeben, nachdem sie ihn beide selbst gelesen hatten. Wochenlang hatte das Buch zwischen Landkarten, Schulheften und ihrem Tagebuch herumgelegen, und als sie den Roman schließlich eher beiläufig zur Hand genommen hatte, konnte sie ihn nicht wieder weglegen. Sie war in diesen traumdurchwirkten Wochen selber dieser Josephgewesen, das Findelkind mit seinen seherischen Kräften, das durch die Heilige Stadt zog und kleine Wunder vollbrachte. Anderen Glück schenkte und doch nie selber von ihm besucht wurde.
»Das Holz der Libanon-Zeder hat übrigens fast keinen Geruch, allenfalls einen sehr schwachen, leicht aromatischen. Hier, riechen Sie mal.«
Er beugte sich vor und schnupperte am Holz der Tischplatte. Lilya neigte ebenfalls den Kopf, hielt aber auf halbem Weg inne, ohne dass Lind dies bemerkte.
»Und?«, sagte er und sah wieder auf. »Nicht viel, oder? Aber genug von alledem, lassen Sie uns jetzt über mein Anliegen reden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob es zu unserem gemeinsamen Anliegen werden kann. Sie sind als freier Mensch gekommen und sollen als solcher auch wieder gehen.«
»Shimon Ben Gedi hat mir erzählt …«
Er sah sie halb belustigt, halb ernst an und verzog die Mundwinkel.
»Ben Gedi, mein Gott ja, er hat natürlich sogleich einen Plan entwickelt, ein Konzept. Und es ist noch nicht einmal eine Woche her, seit ich bei ihm war, schon sitzen Sie vor mir. Ihn treibt dabei gewiss nicht Selbstlosigkeit an, aber er hilft mir, und dafür bin ich ihm dankbar und stelle keine weiteren Fragen.«
»Sie gehen davon aus, dass die Engländer Sie belogen haben, als sie bei Ihnen waren, mit der Nachricht von Ihrem Bruder?«
»Belogen? So würde ich es nicht nennen. Ich denke, sie haben ihre Wahrheit gesagt, und ich suche die meine«, sagte er.
»Aber es kann nur eine Wahrheit geben. Entweder Ihr Bruder Raphael ist tatsächlich umgekommen, wie die Engländer behauptet haben, oder er lebt noch. Irgendwo in Deutschland.«
Lind hob die Augenbrauen und lächelte Lilya nachsichtig an.
»1941 haben sie gesagt«, fuhr er fort, ohne auf Lilyas Bemerkung einzugehen, »im Oktober oder wenig später.«
Sie wartete darauf, dass er weitersprechen würde, aber er nahm die Aktentasche vom Stuhl, öffnete sie, zog ein flaches Päckchen heraus und legte es auf den Tisch. Umständlich versuchte er den Knoten der Schnur zu lösen, griff erneut in die Tasche und förderte eine Lupe von der Größe eines Walauges zutage. Die Lupe in der einen, den Faden in der anderen Hand, bekam er den Knoten gelöst.
»Von einer Freundin aus Deutschland«, sagte er und nickte in Richtung Päckchen, »sie hat mir einen reizenden Brief dazugelegt, ich fürchte nur, ich habe ihn auf meinem Schreibtisch vergessen. Amerikanischer Sektor, Berlin, dort hat sie ihn abgeschickt. Bitte, sehen Sie sich das Päckchen einmal an.«
Lilya wendete es hin und her. Die Adresse war mit großen, weit ausladenden Buchstaben geschrieben, Lilya musste an Blumen denken, irgendetwas Ornamentales. Sie zeugten von Leichtigkeit, Großherzigkeit und Selbstbewusstsein.
»Wie lange hat es gebraucht?«
»Keine drei Wochen.«
Sie pfiff anerkennend. »Darf ich hineinsehen?«
»Deswegen sind wir hier.«
In dem Papier lag ein dünnes, in schwarzes Leder gebundenes Buch, auf dem Einband befand sich ein goldenes Wappen. Sie fuhr mit dem Finger darüber. Eine Eule mit geschlossenen Augen hockte auf einem Postament, das aus drei aufgestellten Buchrollen bestand. Zu ihren Füßen stand in Großbuchstaben C. F. LIND.
ENDE DER LESEPROBE