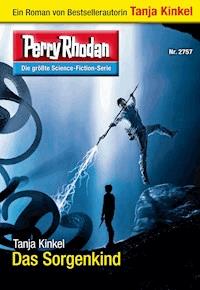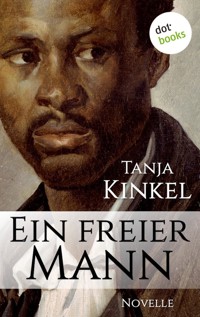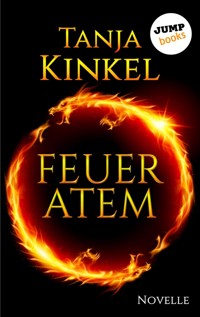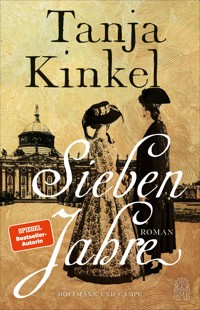Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Frauenschicksal in der blutroten Zeit der Reconquista Die prachtvolle Alhambra Ende des 15. Jahrhunderts: Der Sitz des Emirs von Granada ist ein Paradies aus Marmor, Springbrunnen, kunstvollen Gärten … und Schauplatz von Neid und Intrigen. Die beiden Frauen des Herrschers – die eine Christin, die andere Muslima – kämpfen erbarmungslos darum, ihre Söhne zum Nachfolger Abdul Hassan Alis zu machen. Auch Layla, die Tochter des Emirs, wird gezwungen, Partei zu ergreifen … mit schrecklichen Folgen. So kommt es, dass sie die Welt des spanischen Islam, der in seinem Niedergang noch einmal seine volle Pracht und Schönheit entfaltet, verlassen muss, um sich dem Hof der christlichen Herrscher Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon anzuschließen. Doch alles, was Layla dort erlebt, jede schicksalshafte Entscheidung, die sie treffen muss, führt sie doch immer wieder zur selben Frage: Auf welcher Seite wird sie am Ende stehen? »Dieser Roman zeichnet sich aus durch eine Fülle großartiger Bilder: Prunk und Elend, höfische Pracht und der Tod im Kampf. Die Autorin erweist sich als Meisterin des lebendigen Dialogs. Ein spannendes Lesevergnügen.« Berliner MorgenpostTanja Kinkels Bestseller »Morgenröte über der Alhambra«, auch bekannt unter dem Titel »Mondlaub«, über Blüte und Niedergang des spanischen Islam; für alle Fans der Bestseller von Noah Gordon.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die prachtvolle Alhambra Ende des 15. Jahrhunderts: Der Sitz des Emirs von Granada ist ein Paradies aus Marmor, Springbrunnen, kunstvollen Gärten … und Schauplatz von Neid und Intrigen. Die beiden Frauen des Herrschers – die eine Christin, die andere Muslima – kämpfen erbarmungslos darum, ihre Söhne zum Nachfolger Abdul Hassan Alis zu machen. Auch Layla, die Tochter des Emirs, wird gezwungen, Partei zu ergreifen … mit schrecklichen Folgen. So kommt es, dass sie die Welt des spanischen Islam, der in seinem Niedergang noch einmal seine volle Pracht und Schönheit entfaltet, verlassen muss, um sich dem Hof der christlichen Herrscher Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon anzuschließen. Doch alles, was Layla dort erlebt, jede schicksalshafte Entscheidung, die sie treffen muss, führt sie doch immer wieder zur selben Frage: Auf welcher Seite wird sie am Ende stehen?
»Dieser Roman zeichnet sich aus durch eine Fülle großartiger Bilder: Prunk und Elend, höfische Pracht und der Tod im Kampf. Die Autorin erweist sich als Meisterin des lebendigen Dialogs. Ein spannendes Lesevergnügen.« Berliner Morgenpost
Über die Autorin:
Tanja Kinkel, geboren 1969 in Bamberg, studierte und promovierte in Germanistik, Theater- und Kommunikationswissenschaft. Sie erhielt acht Kultur- und Literaturpreise, Stipendien in Rom, Los Angeles und an der Drehbuchwerkstatt der HFF München, wurde Gastdozentin an Hochschulen und Universitäten im In- und Ausland sowie Präsidentin der Internationalen Feuchtwanger Gesellschaft. 1992 gründete sie die Kinderhilfsorganisation Brot und Bücher e. V, um sich so aktiv für eine humanere Welt einzusetzen (mehr Informationen finden Sie auf der Website brotundbuecher.de). Tanja Kinkels Romane, die allein in Deutschland eine Gesamtauflage von über sieben Millionen erzielten, wurden in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt und spannen den Bogen von der Gründung Roms bis zum Amerika des 21. Jahrhunderts.
Bei dotbooks veröffentlichte Tanja Kinkel ihre großen Romane »Die Puppenspieler«, »Die Löwin von Aquitanien«, »Wahnsinn, der das Herz zerfrisst«, »Die Söhne der Wölfin«, »Die Schatten von La Rochelle« und »Unter dem Zwillingsstern«, die Novelle »Ein freier Mann« sowie ihre Erzählungen »Der Meister aus Caravaggio«, »Reise für Zwei« und »Feueratem«, die auch in gesammelter Form vorliegen in »Gestern, heute, morgen«.
Die Autorin im Internet: tanja-kinkel.de
***
eBook-Neuausgabe Mai 2025
Dieser Roman erschien bereits unter dem Titel »Mondlaub«, 1997 bei Goldmann und 2021 bei dotbooks.
Copyright © der Originalausgabe 1997 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Neuausgabe 2021, 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Lu Mikhaylova, Anna Pogulyaeva, Khalikov und eines Gemäldes von Samuel Colman »Alhambra«
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-666-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Tanja Kinkel
Morgenröte über der Alhambra
Roman
dotbooks.
Für Klaus
Prolog:DIE SAAT
Ich verbarg mich vor meiner Zeit im Schatten ihrer Schwingen. Mein Auge sieht diese Zeit, sie aber sieht mich nicht.
Fragt man die Tage, was mein Name sei, sie wissen ihn nicht,
Noch weiß der Ort, da ich weile, wo ich bin.
Ibn al Arif, »Mahasin al-Madjalis«
Im Frühling des Jahres 876, Anno Domini 1471, wurde der Knabe Abu Abdallah Muhammad, Sohn des Emirs von Granada, von seinem Sklaven Ibrahim geweckt, als es noch dunkel war. Muhammad war zwölf Jahre, alt genug, um nicht mehr bei den anderen Kindern zu schlafen und seine eigenen Räume zu haben, und überdies war er der Kronprinz. Eigentlich hätte er auf niemanden mehr Rücksicht zu nehmen brauchen; dennoch kleidete er sich mit Ibrahims Hilfe so leise wie möglich an, fast geräuschlos, nachdem er die morgendlichen Waschungen und Gebete in aller Eile zelebriert hatte. Er war sehr aufgeregt, denn sein Vater hatte versprochen, ihn mit auf die Falkenjagd zu nehmen, und Muhammad würde heute zum erstenmal seinen eigenen Falken fliegen lassen, den er selbst abgetragen hatte.
Der Junge rannte fast, als er in dem Vorhof eintraf, wo die Pferde bereits gesattelt standen. Sein Vater, der Emir Abul Hassan Ali, war gerade dabei, einen der Falken zu beruhigen, die aus dem Verschlag gebracht wurden. Er streichelte ihn mit einer Feder und stieß leise, monotone Laute aus. Muhammad sah ihm schweigend zu – er wußte es besser, als jetzt etwas zu sagen – und fuhr dann zusammen, als sich von hinten eine Hand auf seine Schulter legte.
»Du vergeudest wahrhaftig keine Zeit, Junge.«
Beim Klang der Stimme entspannte sich Muhammad. Er drehte sich um und begrüßte seinen Onkel, der denselben Namen wie er trug, aber von allen nur al Zaghai genannt wurde, »der Tapfere«. Schon bald nach seinen ersten Kämpfen hatten ihn seine Männer mit diesem Beinamen geehrt, und Muhammad konnte sich nicht erinnern, daß man seinen Onkel je anders angesprochen hatte. Lediglich der Fürst von Granada nannte seinen Bruder gelegentlich Muhammad.
»Heute«, sagte Muhammad der Jüngere leise, mit unterdrückter Erregung, »werde ich Zuleima das erstemal frei fliegen lassen.«
Sein Onkel nickte verständnisvoll. »Dein erster Falke, wie? Wahrlich ein besonderer Tag.«
»Und er hat lange genug darauf gewartet«, meinte Muhammads Vater, der seinen eigenen Falken inzwischen sicher auf dem Block vor seinem Sattel abgesetzt hatte, lächelnd. »Ich habe ihm gesagt, ein Falke gehört dem Jäger nur dann, wenn er ihn selbst zähmen kann, etwas, was viele erwachsene Männer nicht fertigbringen, weil es ihnen an Geduld fehlt – aber Muhammad hat es geschafft.«
Wohlwollender Stolz und Anerkennung lagen in seiner Stimme, und Muhammad versuchte, nicht zu erröten. Lob von seinem Vater war hoch geschätzt und selten. Er überspielte seine verlegene Freude, indem er selbst ins Falkenhäuschen ging, um Zuleima nach draußen zu bringen. Drinnen war es fast vollkommen dunkel, nur eine sorgfältig abgeschirmte Öllampe glühte vom Dachbalken herab. Aber Muhammad brauchte kein Licht, um Zuleima zu finden. Er kannte den Weg inzwischen so gut wie den scharfen, durchdringenden Geruch nach Vögeln und schmutzigem Stroh, der den Verschlag durchzog. Hier hatte er gestanden, manche Nacht lang, mit verkrampften Beinen und schmerzendem Rücken, und hatte darauf gewartet, daß das Wanderfalkenweibchen brach, daß es von seinem Handschuh kröpfte. Es hatte eine Ewigkeit gedauert, und mehr als einmal war Muhammad nahe daran gewesen, aufzugeben oder einzuschlafen. Aber der Gedanke an die verächtliche Stimme seines Vaters, die sagte: »Wer einschläft, ist es nicht wert, einen Falken auch nur anzusehen«, hielt ihn immer wieder wach. Und als Zuleima schließlich von seiner Hand gekröpft hatte, war es ihm wie ein überwältigender Triumph erschienen.
»Zuleima«, flüsterte er jetzt und lockerte langsam den geschlitzten Riemen, der den Vogel an den dünnen Ständer band. »Du Wunder.«
Als er mit dem Falken nach draußen kam, saßen sein Vater und al Zaghai bereits im Sattel. Muhammad dachte, daß sie sich sehr ähnlich sahen: Beide hatten die scharfgeschnittenen, unerbittlichen Züge der Banu Nasr, ihrer Familie, beide waren groß und von der Sonne und Wind gebräunt. Aber während al Zaghals Mund dünn und streng wie eine Damaszenerklinge war, neigte der Abul Hassan Alis, großzügig und sinnlich, sich häufig dem Gelächter und den Freuden des Lebens zu.
Sie hatten die Stadt bald hinter sich gelassen, und aus der Morgendämmerung schälten sich die schneebedeckten Berge hervor wie ungeheure Ifrits, die Luftgeister der Märchen, aus den Wolken. Es würde ein wunderbarer Tag werden, und Muhammad war entschlossen, jede Minute davon zu genießen. Sein Onkel indessen hatte an diesem Morgen mehr als nur die Falknerei im Sinn. Al Zaghai drängte sein Pferd näher an das des Fürsten von Granada heran und signalisierte ihm, etwas zurückzubleiben.
»Bruder«, sagte al Zaghai unvermittelt in seiner rauhen Stimme, »was glaubst du, warum ich aus Malaga hierhergekommen bin?«
»Um mich zu besuchen, hoffe ich«, erwiderte Ali lächelnd. Al Zaghai machte eine ungeduldige Handbewegung. »Zwölftausend Dinare«, sagte er. »Wie lange noch? Wie lange willst du diesen Tribut noch zahlen, zu dem unser Vater sich von den Christen hat zwingen lassen? Wie lange werden wir uns noch demütigen müssen vor den Ungläubigen?«
Ali seufzte. »Du weißt genau, daß unser Vater die Christen nur so aufhalten konnte – mit Geld. Sie hatten den Jabal Tariq erobert, verwüsteten bereits unser Land. Sie waren stärker.«
»Damals.« Al Zaghai stieß einen verächtlichen Laut aus. »Vor zehn Jahren. Aber jetzt hat der König von Kastilien die Wahl zwischen zwei Weibern als Nachfolger, seine Edlen sind untereinander zerstritten, der König von Aragon bekriegt sich mit dem König von Portugal – nun ist der richtige Moment gekommen, Ali! Hör auf, den Tribut zu zahlen. Hol unsere Brüder aus Fez zu Hilfe, und ich sage dir, die Anhänger des Propheten werden al Andalus ein zweites Mal erobern!«
»Unsere Brüder aus Fez«, wiederholte der Fürst von Granada gedehnt. »Kannst du dich nicht erinnern, Bruder, was das letztemal geschah, als ein Emir von Granada das versuchte? Sie kamen, ja, und sie blieben und entthronten ihn, und er mußte mit Hilfe der Ungläubigen seinen Thron zurückerobern. Schande!«
»Aber«, unterbrach al Zaghai, doch Abul Hassan Ali war noch nicht fertig. »Und was die Ungläubigen selbst angeht – sie mögen jetzt zerstritten sein, zumindest die Kastilier, aber wenn wir sie angriffen – weißt du, was geschehen würde? Sofort wären sie wiedervereint. Sie betrachten es als heilige Sache, uns völlig aus al Andalus zu vertreiben, und das werde ich nicht zulassen.«
Al Zaghai setzte zu einer hitzigen Antwort an, aber Ali hob die Hand. »Genug davon. Die erste Falkenjagd meines Sohnes ist nicht der Ort für ein solches Gespräch.«
Muhammad hatte mehr von dem Gespräch verstanden, als sein Vater und sein Onkel beabsichtigt hatten, und er machte sich seine Gedanken. Seine Lehrer hatten ihn mit der Geschichte seiner Heimat vertraut gemacht. Damals, als Tariq der Eroberer und Musa ben Nusair die alte römische Provinz Hispania von den Westgoten erobert und sie al Andalus genannt hatten, waren sie bis Narbonne in Gallia vorgedrungen. Lange Zeit hatte das große Gebirge al Andalus die natürliche Grenze im Norden dargestellt. Doch inzwischen, siebenhundert Jahre nachdem Tariq das Land an der nach ihm benannten Stelle – Jabal Tariq – zum erstenmal betreten hatte, war von al Andalus nur Granada geblieben. Wie war das den Christen gelungen, obwohl sie einander ständig befehdeten, wie es zur Zeit wieder geschah?
Er wußte, daß der König von Kastilien, Enrique, der seinem, Muhammads, Großvater den Tribut abgezwungen hatte, keinen Sohn hatte. Stattdessen besaß er eine Schwester, Isabella, und eine Tochter, Juana. Beide erhoben Anspruch auf die Thronfolge, und beide fanden unter den Granden Unterstützung. Wenn sich, wie sein Vater prophezeite, die Christen dennoch einigen würden, um gegen Granada zu kämpfen, mußte ihnen der Haß gegen die Moslems wirklich das Wichtigste sein, was Muhammad nicht ganz verstand. Schließlich hatte kein moslemischer Herrscher in al Andalus je versucht, den Christen ihren Glauben zu nehmen und sie mit Gewalt zum Islam zu bekehren. »Siehe, sie, die da glauben, und die Juden und die Nazarener – wer immer an Allah glaubt und an den Jüngsten Tag und das Rechte tut, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn, und Furcht kommt nicht über sie, und nicht werden sie traurig sein.«
So lehrte es der Koran. Muhammad entschied, daß ihn die Christen zu sehr verwirrten, um weiter über sie nachzugrübeln. Schließlich war heute der Tag, sein Tag, und es war an der Zeit, die Falken fliegen zu lassen.
Die Treiber hatten inzwischen eine Schar Rebhühner aufgestöbert, und Muhammad biß sich vor Aufregung auf die Lippen. Sein Vater lächelte ihn an. »Du zuerst«, sagte er. Muhammad schluckte. Nun kam die letzte, die endgültige Prüfung für einen Falkner: Würde der Falke zu ihm zurückkehren? Mit bebenden Händen entfernte er die Haube von Zuleimas Kopf. Der Falke schüttelte sich, spreizte das Gefieder. Die gelben Augen blinzelten. Muhammad holte tief Luft. Dann hob er seine Faust. Er spürte, wie Zuleima sich ein wenig ausbalancierte. Dann entfaltete sie ihre Flügel, peitschte die Luft und stieg in einem hohen, schrägen Bogen geradewegs in das Licht der Morgensonne auf.
Muhammad stieß den angehaltenen Atem aus. Sein Vater und al Zaghai sagten nichts. Stumm beobachteten sie den makellosen Flug des Falken, seine schwebende Eleganz. Aber der Vogel machte keine Anstalten, die Rebhühner zu verfolgen, auf die er ihn angesetzt hatte. Auf Muhammads Stirn begann eine kleine Ader zu pochen. Hatte er den Falken verloren?
Da veränderte sich Zuleimas Flug. Al Zaghai sagte etwas, doch Muhammad hörte ihn nicht. All seine Sinne waren auf den Falken gerichtet, den Falken, der sich nun herabstürzte auf etwas, das sich außerhalb ihrer Sichtweite befand. Pferdegetrappel drang an sein Ohr, und plötzlich wurde ihm bewußt, daß etwas nicht stimmte.
Al Zaghai fluchte. »Welcher Dummkopf kann das sein? Der verscheucht uns noch das ganze Wild und macht die Vögel nervös.«
Ali sagte nichts, aber seine Brauen zogen sich unheilverkündend zusammen. Ein Schatten fiel auf Muhammad, und er konnte gerade noch rechtzeitig den Arm ausstrecken, um Zuleima in Empfang zu nehmen. Er war so glücklich über ihre Rückkehr, daß er erst beim zweiten Hinsehen erkannte, was sie ihm gebracht hatte.
»Eines der Rebhühner! Sehr gut«, sagte sein Vater beifällig. Schnell, wie er es gelernt hatte, schnitt Muhammad den Kopf des Rebhuhns ab und stopfte den Körper in seine Satteltasche. Dann gab er Zuleima ihre vorbereitete Belohnung und beobachtete strahlend, wie der gierige Vogel sich auf das Fleisch stürzte. Sein Herz hämmerte. Sie war zu ihm zurückgekehrt!
Sein Vater war gerade dabei, die Haube seines eigenen Falken abzunehmen, als das Geräusch von vorhin lauter wurde und näher kam. Ali hielt inne. Er mußte nicht lange auf die Störenfriede warten. Auf der Lichtung erschienen in rascher Folge ein christlicher Edelmann und seine Begleiter, offensichtlich, wie das erlegte Reh auf einem ihrer Lasttiere bewies, ebenfalls auf der Jagd.
Muhammads Augen weiteten sich. Granada befand sich seit einiger Zeit nicht im Kriegszustand mit einem der christlichen Staaten, doch der Junge hatte noch nie die Gelegenheit gehabt, Christen kennenzulernen, die weder Sklaven noch Botschafter waren. Er studierte die merkwürdige Kleidung, die seltsame Art zu reiten, so steif, so gezwungen. Al Zaghai sog hörbar den Atem ein. Abul Hassan Ali befestigte erst den Falken wieder auf seinem Bock, bevor er sich den Neuankömmlingen zuwandte, die über die Begegnung offensichtlich ebenso verblüfft waren wie die Araber.
»Was«, fragte er ungehalten in schwerem Kastilisch, »wollt Ihr hier? Ich sehe, daß Ihr nicht in kriegerischer Absicht kommt, aber die Grenze ist mehr als eine Tagesreise entfernt, und niemand zieht so weit ins Landesinnere ohne Erlaubnis des Fürsten.«
Der christliche Edelmann hatte sich inzwischen wieder gefangen. Er war etwa so alt wie al Zaghai, vierschrötig und muskelbepackt. Er warf einen Blick auf seine Begleiter. Ihre Anzahl übertraf die der Moslems, die er vor sich sah. Sein Gesicht glänzte in der Sonne, als er herausfordernd antwortete: »Welches Fürsten? Euer Emir ist doch nur ein Vasall unseres Herrn, und seine Erlaubnis haben wir!«
Al Zaghai straffte sich und wollte sich auf ihn stürzen, doch Ali hielt ihn zurück. »Ach, wirklich?« fragte er mit sanfter Stimme. »Nun, dann brauche ich Euch nicht als Gast zu behandeln. Sprechen wir von Jäger zu Jäger. Ihr seid hier durch den Wald geprescht wie eine Horde Wildschweine und habt mein Wild verscheucht, ganz zu schweigen von den Falken, die Ihr verstört habt. Jeder Jäger weiß, wie man sich zur Jagdzeit in den Wäldern zu verhalten hat. Ich muß also annehmen, daß Ihr entweder bodenlos dumm seid oder daß es Euch ernsthaft an Erziehung mangelt, etwas, was Euer König sicher gerne behoben sehen möchte. Ich bin ein großzügiger Mensch. Würdest du ihre Erziehung beenden, Bruder?«
»Mit dem größten Vergnügen«, knurrte al Zaghai. Der Kastilier war irritiert. Er schaute unsicher von dem lächelnden Ali zu dem irgendwie bedrohlich wirkenden al Zaghai. Einige der arabischen Treiber waren inzwischen zurückgekehrt und lösten sich aus dem Gebüsch, was das Mehrheitsverhältnis ein wenig veränderte. Alis Lächeln vertiefte sich, und plötzlich beschloß Don Juan de Vera, Abkömmling edlen kastilischen Geblüts, daß es sich nicht lohnte, mit einer Handvoll Heiden jenseits der Grenze einen Streit mit ungewissem Ausgang vom Zaun zu brechen. Er nickte seinen Begleitern zu, machte kehrt und ritt ohne ein weiteres Wort davon.
Al Zaghai lehnte sich in seinem Sattel zurück und lachte. Er lachte noch, als Ali ruhig aufs neue seinen Falken auf den Handschuh nahm und die Haube löste.
»Erinnere dich immer daran, Neffe«, keuchte er, als er wieder zu Atem gekommen war, »so riecht der Angstschweiß der Christen!«
Der Rest des Tages verging ohne weitere Störungen. Sie jagten, genossen den Frühling Granadas, und als sie am Abend in die Alhambra zurückkehrten, müde und zufrieden, dachte Muhammad nicht mehr an den Zwischenfall. Er nahm ein Bad, speiste mit seiner Mutter, der Sejidah Aischa, konnte es nicht unterlassen, vor einigen seiner jüngeren Halbgeschwister mit den Heldentaten seines Falken zu prahlen, und ging dann rundherum glücklich ins Bett.
Meilen entfernt, in der Stadt Baza, bereitete sich an diesem Abend ein Mädchen ebenfalls auf den Schlaf vor. Sie war nur zwei Jahre älter als Muhammad, lebte seit etwa eineinhalb Jahren fern ihrer Heimat und war eine Sklavin. Als Tochter eines Granden, des Don Sancho Ximenes de Solis, hatte sie seit ihrer Entführung ihre wechselnden Herren immer wieder beschworen, sie nicht zu verkaufen, sondern ihren Vater um Lösegeld zu bitten. »Er wird bezahlen, was immer Ihr verlangt«, hatte sie gefleht; sie hatte abwechselnd gebettelt und mit seiner Rache gedroht. Doch allmählich fing sie an, zu begreifen, daß es keine Rolle mehr spielte, daß sie Isabel de Solis war, Nachfahrin einer langen Reihe von kastilischen Edelleuten. Sie hätte genausogut ein Bauernmädchen sein können, seit jenem Herbsttag, an dem einer der abenteuerlichen Sklavenhändler Granadas wieder einmal einen Streifzug über die Grenze unternommen hatte.
Isabel war mit den Geschichten über die blutrünstigen Heiden aufgewachsen, hatte ihren Vater immer wieder sagen hören, daß es die Pflicht jedes Christen sei, sie zu vernichten, und daß der König nie hätte Frieden mit ihnen schließen dürfen. Aber niemand hatte sie darauf vorbereitet, daß sie den Schreckgespenstern ihrer Kindheit in die Hände fallen könnte. In all den Liedern über den Cid Campeador und seine heroischen Kämpfe gegen die Mauren war nie erwähnt worden, welches Schicksal die Prinzessinnen erwartete, die nicht aus ihren Türmen gerettet wurden. Nun, Isabel hatte es herausgefunden.
Ihr derzeitiger Herr, der dritte bereits, war ein Eunuch, was Isabel zuerst zu einem Dankgebet veranlaßt hatte, bevor sie entdecken mußte, daß auch Eunuchen Mittel und Wege finden konnten, um sich zu befriedigen. Gestern hatte er angekündigt, daß er Isabel Weiterverkäufen würde, »möglicherweise an einen großen Herrn«, wie er geheimnisvoll bemerkte. Das hatte Isabel aus der Apathie gerissen, in die sie seit einiger Zeit wieder verfallen war, und sie zu einem letzten verzweifelten Appell veranlaßt, doch bitte ihren Vater zu benachrichtigen. Sie hatte seither nichts mehr gegessen; ausgehungert, dachte sie, konnte man sie nicht Weiterverkäufen, und der Eunuch mißhandelte sie zumindest nicht; wer konnte wissen, was nach ihm kommen mochte. Sie schrak auf, als die Tür zu dem kleinen Raum sich öffnete, in den man sie ihrer Halsstarrigkeit wegen gesperrt hatte. Es war ihr Herr; er stand im Türeingang und betrachtete sie stumm. »Habt Ihr an meinen Vater geschrieben?« fragte sie mit zitternder Stimme, vergeblich bemüht, sie fest klingen zu lassen.
Der Eunuch seufzte und setzte sich zu ihr, ohne sie zu berühren. »Törichtes Mädchen«, sagte er. Seine Stimme klang noch nicht einmal unangenehm, sondern melodisch und schwingend. »Glaubst du denn, dein Vater möchte dich zurückhaben – so, wie du jetzt bist? Sofort nach deiner Entführung, ja; aber welcher Mann mit etwas Stolz will zugeben, daß man seine Tochter zur Hure gemacht hat?«
Er sprach sachlich, ohne Schärfe. »Allah weiß, wenn die Narren, die dich gefangen hatten, in meinen Diensten gestanden wären, sie hätten dich nicht angefaßt. Jungfrauen sind selten und kostbar. Aber jetzt – was glaubst du, warum ich mich so lange bemüht habe, aus dir eine Frau mit etwas Fleisch und Erfahrung zu machen? Auch das ist wertvoll, und wenn du klug bist, kannst du weit mit dem kommen, was ich dir beigebracht habe. Wenn du klug bist und nicht darauf bestehst, dich zu verunstalten. Sei vernünftig morgen, wenn mein Freund aus der Hauptstadt kommt.«
Damit stand er auf, klopfte ihr einmal auf die Schulter und ging. Sie starrte ihm nach. Vor noch nicht einmal achtzehn Monaten war Isabel ein Kind gewesen, das vom Leben immer nur das Beste erwartete, aufgewachsen in einer privilegierten Umgebung. Ihr kam es vor, als läge diese Zeit so weit zurück, daß sogar die Erinnerung daran schwerfiel. Mittlerweile hatte sie gelernt, daß niemand ihr zu Hilfe kam, wenn sie schrie, daß es niemanden kümmerte, was aus ihr wurde … sogar ihren Vater nicht. Der Eunuch hatte recht. Er würde sich ihrer schämen, wäre wahrscheinlich froh über ihren Tod.
Sie begann wieder zu weinen, wie sie es in den letzten achtzehn Monaten so oft getan hatte, doch sie bemerkte es kaum noch. Ihre Tränen schienen nur noch ein Echo ihrer Vergangenheit zu sein, genau wie ihre Verzweiflung und ihre Hoffnungen. Zögernd griff sie nach dem Brot, das sie bisher verschmäht hatte. Ihr Magen revoltierte nach dem ersten Bissen, und sie brauchte eine Stunde, bis sie tatsächlich in der Lage war, Nahrung und Wasser bei sich zu behalten, doch in dieser Stunde hatte sie einen Entschluß gefaßt, der ihr altes Selbst unter sich begrub.
Niemand würde sie retten, wenn sie sich nicht selbst rettete.
Kapitel 1:GRANADA
Gott segne sie, die schöne Zeit, verlebt in der Alhambra.
Verging die Nacht, so gingst du hin, zum Stelldichein bereit.
Der Boden schien dir dann von Silber, doch wie bald schon hüllte die Morgensonne die Sabika in ihr goldnes Kleid.
Ihn Malik
Zwillinge, so lehrte der große Ibn Sina, sind von Geburt an weniger lebensfähig. Einige seiner Kommentatoren fügten hinzu, Zwillinge seien außerdem dazu bestimmt, Unglück nicht nur für sich, sondern auch für ihre gesamte Umgebung heraufzubeschwören. Für die Zwillinge, die in der roten Burg Granadas, al qual’a al-hamra, zur Welt kamen, hatte das Unglück schon lange vorher begonnen: an dem Tag, als Abul Hassan Ali, der Herrscher von Granada, zum erstenmal Isabel de Solis sah.
Der oberste Eunuch hatte einige neue Sklavinnen für den Harem seines Herrn erworben. Das war in diesen schwierigen Zeiten zwar nicht alltäglich, besonders, da der Harem nicht übermäßig groß war und Ali an seiner Gemahlin, Aischa al Hurra, hing, aber es war auch nicht so ungewöhnlich. Ungewöhnlich war nur eines. Abul Hassan Ali sah Isabel de Solis und verliebte sich in sie.
Er gab ihr eigene Räume und eine eigene Dienerschaft und überhäufte sie mit Geschenken. Nicht länger besuchte er die anderen Konkubinen seines Harems, und nicht länger teilte er das Bett mit seiner Gemahlin Aischa al Hurra. Die neue Leidenschaft des Fürsten versetzte die Alhambra in Aufregung, sorgte für Wogen des Klatsches, die sogar in die christlichen Königreiche überschwappten. Aber immer noch nahm man an, es handle sich um ein zwar erstaunliches, aber kurzlebiges Phänomen, wie eine Sternschnuppe.
Doch Aischa war erbittert und zornig. Sie war keine Konkubine, die man beiseite schieben konnte, wenn einem die Laune danach stand. Sie war die rechtmäßige Gattin des Herrschers von Granada, die Tochter eines seiner Vorgänger auf dem Thron, die Mutter seines Erben, in ihren Adern floß das Blut des Propheten, und sie würde nicht zulassen, daß eine christliche Sklavin soviel Zeit und Aufmerksamkeit ihres Gemahls in Anspruch nahm. Sie begann, Isabel bei jeder Begegnung zu schikanieren und zu demütigen.
Isabel verbeugte sich, wie Aischa es verlangte, fiel auf die Knie, bediente sie im Bad. In ihrem Innern fing sie an, Aischa zu hassen, aber noch mehr als die gegenwärtige Feindseligkeit von Abul Hassan Alis Gemahlin beunruhigte sie der Gedanke, was Aischa mit ihr tun würde, wenn die Leidenschaft des Fürsten einmal erlosch. Wenn Isabel einfach eine vergessene Konkubine mehr war. Sie hatte es satt, immer nur ein Opfer zu sein, und sie war nicht weniger willensstark als Aischa.
Isabel handelte. Sie trat zum Islam über und nahm den Namen Zoraya an, »Morgenröte«. Und dann verwandelten sich die Wellen des Klatsches um die neue Favoritin des Emirs in ein Erdbeben. Abul Hassan Ali verkündete, er würde sie zu seiner zweiten Gemahlin machen. Seine Ratgeber, Hauptleute, Freunde protestierten, und das Volk schrie auf den Straßen von Granada: »Tod der fremden Frau!« Der Koran gestattete einem Mann zwar vier legitime Frauen, doch seit den ersten Jahrzehnten nach der Eroberung von al Andalus hatte kein Herrscher eine Christin, selbst wenn sie sich zum rechten Glauben bekannte, zu seiner Frau gemacht. Zu seiner Konkubine, ja – als Sklavinnen waren die Kastilierinnen sogar recht begehrt –, aber niemals zu seiner rechtmäßigen Gemahlin.
Ali tat es, gegen alle Ratschläge und Drohungen.
Ein Jahr später brachte seine neue Gemahlin Zwillinge zur Welt, ein Mädchen und einen Jungen. Er ließ sie den Namen für ihre Kinder wählen, und um ihm zu gefallen, wählte sie zwei Namen aus der arabischen Geschichte: Tariq und Layla. Als Aischa davon hörte, lachte sie verächtlich.
»Tariq, in der Tat«, sagte sie. »Die Christin will ihren Sohn also nach dem Eroberer von al Andalus nennen? Weiß sie nicht, daß der arme Tariq ein Freigelassener war und für seine Eroberung nur Undank von seinem Kalifen erntete? Wahrlich, ein gutes Vorzeichen für einen Sohn. Und Layla? Will sie, daß die Freier ihrer Tochter wahnsinnig vor Liebe werden und sich umbringen, wie der arme Narr, der diese rührseligen Gedichte auf Layla schrieb?«
Es dauerte nicht lange, bis diese Äußerungen Isabel hinterbracht wurden, und sie schlug sofort zurück. »Merkwürdig ist es«, sagte sie, »daß Aischa al Hurra sich solche Sorgen um die Namen meiner Kinder und sowenig um die Namen ihres eigenen macht. Waren Abdallah und Muhammad nicht die Namen zweier Fürsten, die abgesetzt wurden und ihre Tage im Elend beschlossen, im Gefängnis?«
Aischa war zunächst sprachlos über soviel Frechheit, doch dann machte sie sich zum erstenmal Sorgen. Was, wenn die Christin mit ihrer Äußerung über die entthronten Fürsten mehr im Sinn hatte als nur einen Schlagabtausch? Sie ließ erkunden, wann Zoraya die Gärten besuchte, und erschien zur selben Zeit.
Die Sommermonate mit ihrer erbarmungslosen Hitze, die sich wie eine Schlinge um den Hals der Menschen legte, hatten den Hof schon längst veranlaßt, in die Sommerpaläste des Generalife umzuziehen. Der Generalife war ein Bestandteil der riesigen roten Festung, die über Granada regierte, aber in diesem Teil der Alhambra huldigten die wenigen Gebäude, die es gab, nur den Pflanzen und dem Wasser. Das Geländer der Treppe, an der sich die Gemahlinnen des Emirs trafen, bestand aus einer hohlen Rinne, die das Wasser aus den Bergen in die tiefer gelegenen Becken des Generalife leitete. Um den Hof, zu dem diese Treppe führte, hatte man ein Labyrinth aus Sträuchern angelegt, so daß Aischa und ihre Rivalin nahezu ungestört waren.
Isabel, der Aischas Fragen nicht verborgen geblieben waren, hatte sich entschlossen, nichts dem Zufall zu überlassen, und trug ihren Sohn Tariq auf dem Arm; die Amme der Zwillinge, Fatima, folgte ihr mit dem Mädchen Layla und schrak unwillkürlich zusammen, als sie Aischa gewahrte, obwohl man die Sejidah erwartet hatte. Aischa, Tochter eines Emirs (selbst wenn dieser nicht weniger als viermal entthront worden war) und Gemahlin eines Emirs, neigte mit ihren markanten Zügen und ihrer großen, stattlichen Erscheinung dazu, die Menschen selbst dann einzuschüchtern, wenn sie es nicht darauf anlegte. Isabel de Solis, kleiner, zierlicher, vor allem aber jünger, spürte die gebieterische Ausstrahlung der Frau sehr wohl, doch sie hatte nicht die Absicht, sich noch einmal vor Aischa zu demütigen. Sie nahm die Gegenwart der Alteren nur mit einem kurzen Nicken zur Kenntnis. Die Zeiten, in denen sie sich vor Aischa – oder überhaupt jemandem – hatte verbeugen müssen, waren vorbei.
Aischa warf einen eisigen Blick auf die Kinder. »Zwillinge«, sagte sie laut und deutlich, »gelten bei uns als Unglücksbringer. Sie leben meist nicht sehr lange.«
Die Amme Fatima konnte einen erschrockenen Ausruf nicht unterdrücken. Isabel stand sehr still. Dann hob sie das Kinn und sah Aischa direkt in die Augen.
»Es ist Euer Sohn, Sejidah, nicht meiner«, entgegnete sie ebenso klar, »von dem es heißt, daß er Granada zu Fall bringen würde. Vielleicht wäre es gut, wenn er nie auf den Thron käme.« Kein Laut kam von Fatima oder Aischas Gefolge. Die beiden Frauen standen da, in der Nachmittagssonne, und rührten sich nicht. Sie schauten einander nur an, endlos. Beide hatten verstanden, was gesagt worden war. Es war Aischa, die sich zuerst abwandte.
»Hütet Eure Schritte«, sagte sie und ging. Isabel de Solis blieb an jenem Nachmittag noch lange in den Gärten. Als sie in den Palast zurückkehrte, begann sie mit ihrem Feldzug, um Tariq an die Stelle Muhammads zu setzen.
Die Zwillinge wußten nichts von den Weissagungen oder Prophezeiungen, als sie anfingen, sich ihrer Umgebung bewußt zu werden, nichts von Ibn Sinas naturwissenschaftlicher Skepsis noch von den Gerüchten, die besagten, daß Aischas Sohn Muhammad laut seinem Geburtshoroskop der letzte Emir von Granada sein würde. Sie wußten zunächst überhaupt nichts von einer Welt außerhalb der roten Festung; denn die Alhambra war groß genug, um in sich Moscheen, Friedhöfe, Bäder, Schulen und Bibliotheken zu bergen. Es bestand gar keine Notwendigkeit, die Stadt zu betreten.
Für Layla, die eher als Tariq begann, den Dingen einen Namen zu geben, war die kühle Eleganz der Säulenhöfe lange das, was die Amme als »Paradies« und »Sitz Allahs« bezeichnete, und es bereitete ihr Schwierigkeiten, sich Wälder vorzustellen, die nicht mit Springbrunnen und allgegenwärtigen Wasserbecken zu einer einzigartigen Landschaft aus Pflanzen und Steinen verschmolzen. Lediglich die Berge der Sierra Nevada überragten die Alhambra und erschienen ihr wie unbekannte, geheimnisvolle Riesen, die sie nicht einordnen konnte. Zunächst glaubte sie, es handle sich um die Dschinn oder Ifrits aus Fatimas Geschichten, und als man ihr sagte, daß es sich dabei um ähnliche Orte handelte, wie der rote Hügel, auf dem die Alhambra stand, nur eben höher, empfand sie ein Gemisch aus Neugier und Furcht. Von da an wartete sie darauf, daß etwas aus den Bergen kommen würde.
Don Juan de Vera, der im Auftrag seiner jungen Königin kam, um den jährlichen Tribut einzufordern, wünschte sich überallhin, nur nicht in die Halle der Botschafter, wo ihn Abul Hassan Ali empfing. Ein Blick hatte genügt, um in ihm den Mann wiederzuerkennen, der ihm Vorjahren in den Wäldern begegnet war. Seine Kleidung erschien ihm plötzlich zu schwer für die Jahreszeit und die Gegend, er begann zu schwitzen und heftete seinen Blick starr auf die prächtige Decke über Abul Hassan Ali, während er mit monotoner Stimme seine Forderung überbrachte.
Es wäre mir, dachte Don Juan, tausendmal lieber gewesen, der Königin meine Treue auf dem Schlachtfeld zu beweisen. Don Juan de Vera gehörte zu den Granden, die nicht unglücklich waren, daß nach dem Tod König Enriques ein Bürgerkrieg zwischen den Parteien der Tochter des Königs, Juana, und der Schwester des Königs, Isabella, ausgebrochen war. Die Gelegenheit zum Austragen längst überfälliger Fehden war nie günstiger gewesen, und de Vera hatte sich schon deshalb für die Seite Isabellas entschieden, weil es dabei auch gegen seine Intimfeinde, die Familie Ponce de Leon, ging. Doch statt sich mit Rodrigo Ponce de Leon schlagen zu können, sah er sich gezwungen, zu den Ungläubigen nach Granada zu gehen und höflich zu erbitten, was der Krone von Rechts wegen zustand. Und was Königin Isabella und ihr Gemahl, der aragonische Thronfolger Fernando, zur Zeit dringender denn je benötigten.
Alis Miene blieb ruhig und undurchdringlich. Er hörte sich die Rede des Botschafters an und schwieg, als de Vera schließlich stockte. Die plötzliche Ruhe in der großen Halle irritierte den Ritter. Er sah sich gezwungen, seine Augen von den filigranen Gittern abzuwenden und Ali direkt anzuschauen.
»Das… hm… das wäre alles, Hoheit«, äußerte er endlich unbehaglich.
Ein dünnes Lächeln ohne die geringste Heiterkeit umspielte Alis Lippen. »Gut«, erwiderte er. »Dann richtet Euren Herrschern aus, daß die Emire von Granada, die Tribute an die kastilische Krone zahlten, tot sind. Gegenwärtig kommen aus unseren Prägeanstalten keine Münzen, sondern Klingen und Lanzenspitzen.«
Don Juan de Vera erstarrte. Die Hitze des Tages schien sich in Eis verwandelt zu haben. Zum erstenmal in seinem Leben fühlte er sich wirklich hilflos, und er haßte dieses Gefühl, haßte den ungläubigen Hund, der es ihm vermittelte. Es war ihm völlig klar, was Alis Antwort bedeutete; und ebenso klar war, daß man im Moment nichts dagegen tun konnte. Seit Erzbischof Carillo sich auf die Seite Juanas geschlagen hatte, sah es um Isabellas Sache nicht gut aus. Die Königin brauchte das Geld aus Granada, aber sie konnte es sich nicht leisten, Truppen zu schicken, um es mit Gewalt einzutreiben. Und genau damit mußte der verdammte Maure gerechnet haben.
Don Juan verbeugte sich steif, machte auf dem Absatz kehrt und verließ die Halle der Botschafter. Er kochte vor Zorn und wäre wohl auch im Laufschritt aus der Alhambra gestürmt, hätte ihn nicht das grelle Sonnenlicht daran erinnert, daß ihm entsetzlich heiß war und er noch einen langen Ritt vor sich hatte – mit einer solchen Nachricht für seine Königin. Er blieb inmitten des Säulenwaldes stehen, der den Löwenhof bildete, und beschloß, den Brunnen zu nutzen, um sein Gesicht abzukühlen und etwas zu trinken.
Wie es der Zufall wollte, befanden sich einige junge Männer in der Nähe, die entweder nicht den Rang oder das Alter besaßen, um am Empfang des kastilischen Botschafters teilzunehmen. Sie kamen jetzt neugierig näher, um sich den Christen anzusehen. Don Juan de Vera fühlte sich von neuem provoziert, und diesmal, bei Gott, würde er etwas dagegen unternehmen.
»Was starrt ihr mich an, ihr verdammten Heiden?« fragte er herausfordernd. Die jungen Leute waren nicht weniger streitlustig als er; einer entgegnete: »Ich habe ja gehört, daß die Christen stinken wie die Schweine, aber daß es gleich so schlimm ist…«
Es war eine willkommene Gelegenheit für alle Beteiligten. Don Juan zog sein Schwert. »Sag das noch einmal, du maurischer Götzenanbeter!«
Einen Moslem als Götzenanbeter zu bezeichnen, war die schwerste Beleidigung, die er hätte finden können. Der Löwenhof hallte von dem Geklirr der Waffen wider, als Abul Hassan Ali aus der Halle kam, um herauszufinden, was es mit dem Tumult auf sich hatte. Er erhob seine Stimme nur einmal.
»Aufhören, sofort! Die Waffen nieder!«
In einem leiseren Tonfall fuhr Ali fort: »Der Botschafter steht unter meinem Schutz … Solange er sich in meinem Reich aufhält, lasse ich jeden köpfen, der ihn anrührt.«
Einer der jungen Männer, der aus der Familie der Banu Sarraj stammte, welche nach den Banu Nasr die mächtigste in Granada war, zögerte; dann senkte auch er sein Schwert. Ali bemerkte es und vergaß es nicht. Die Banu Sarraj hatten seinen Vater auf den Thron gebracht, indem sie ihm halfen, den vorhergehenden Herrscher zu stürzen, der seinerseits Aischas Vater gestürzt hatte; dieser wiederum war nur durch die Unterstützung der Banu Sarraj zur Herrschaft gelangt. Es konnte sein, daß sie eines Tages nicht mehr damit zufrieden waren, die Banu Nasr nur gegeneinander auszuspielen, und selbst über Granada herrschen wollten, zumal er selbst, Ali, ihre Hilfe für seine Machtergreifung nicht nötig gehabt hatte. Außerdem hatten sie Verbindungen nach Marokko – etwas, mit dem man rechnen mußte.
Don Juan de Vera sah sich einem Mann verpflichtet, den er von Minute zu Minute mehr verabscheute, und brachte mit Mühe einige höfliche Sätze heraus. Sein Abgang wäre ohnehin nicht der ruhmreichste gewesen, aber dieses Ereignis machte den Aufenthalt in Granada vollends zu einem Flecken auf seiner Ehre. Ihm blieb nur, auf einen Krieg mit den Mauren zu hoffen, sobald der Bürgerkrieg in Kastilien beendet war. Er erhoffte ihn bald.
Abul Hassan Ali beendete die Tributzahlungen an Kastilien nicht nur, weil die Zeiten dafür günstig waren. Er hatte nach wie vor Bedenken, aber einerseits konnte sich Granada einen Tribut in dieser Höhe kaum mehr leisten, und zum anderen brauchte er dringend eine Geste, die seine schwindende Beliebtheit beim Volk wiederherstellte und bewies, daß er nicht unter christlichem Einfluß stand. In der Tat war die Bevölkerung begeistert – schon allein, weil der jährliche Tribut zum großen Teil aus ihren Steuern gezahlt wurde –, und der Aufruhr über die zweite Ehe des Fürsten ebbte ein wenig ab.
Innerhalb des Palastes, in dem weichen, dämmrigen Licht, das durch Bögen und kunstvolle Gitter in die Alhambra fiel, hatte der Krieg erst angefangen. Es gab keine Toten, aber die Zwillinge wuchsen in einer Verstrickung aus Schönheit und Gift auf, die jederzeit tödlich werden konnte. Sie erkannten sehr bald, daß sie anders waren; ihre Halbgeschwister und die Kinder der Adligen mieden sie, und wenn sich ein gemeinsames Spiel nicht umgehen ließ, endete es regelmäßig in einem Streit.
Tariq litt unter ihrer verwirrenden Andersartigkeit mehr als Layla. Er war von Natur aus großzügig und schloß leicht Freundschaften, aber da er schneller in Zorn geriet, als ein getrocknetes Pergament Feuer fing, hielten sie nie lange. Früher oder später machte jemand eine Bemerkung über seine Mutter, die Fremde, die den Platz der wahren Fürstin usurpiert hatte, und das war gewöhnlich das Ende der wenigen Freundschaften, die sich trotz der Umstände ergaben.
Layla, die sich sehr rasch eine verletzende Überheblichkeit zugelegt hatte, um sich gegen das Gefühl der Zurückweisung zu schützen, beschloß bald, zufrieden mit der Lage der Dinge zu sein, denn so hatte sie Tariq ganz für sich. »Wir brauchen sie nicht«, sagte sie einmal zu ihm. »Sie sind sowieso alle nur eifersüchtig, weil der Emir Mama geheiratet hat und nicht ihre Mütter.«
Die Zwillinge vergötterten ihre Mutter, wogegen ihr Vater, den sie nicht sehr häufig sahen, eine distanzierte, ehrfurchtgebietende Erscheinung für sie war – der Fürst, den Vater zu nennen ihnen nicht einfiel, bis ihre Mutter ihnen sagte, daß es dem Emir gefallen würde. Als die Zwillinge fünf Jahre alt wurden, war es Zeit für Tariqs ersten Lehrer. Jedermann war unangenehm überrascht, als er sich weigerte, ohne seine Schwester unterrichtet zu werden.
Es entsprach nur dem Brauch, in diesem Alter die allmähliche Trennung von Mädchen und Jungen einzuleiten, und der erste Schritt sollte Tariqs Unterricht sein. Es war so offenkundig logisch, daß sich niemand die Mühe gemacht hatte, es den Kindern zu erklären. Doch die Zwillinge, die sich sonst so leicht von ihrer Mutter lenken ließen, begriffen das Offensichtliche nicht. Sie aßen nichts, schrien und tobten stundenlang und blieben unansprechbar, bis Isabel nachgab. Sie wußte sehr gut, daß die Zwillinge eigentlich nur sich selbst hatten, auch wenn sie es nicht gerne zugab. Auch Abul Hassan Ali wußte es, und er ließ sich von ihr überreden.
Also wurden die Zwillinge gemeinsam unterrichtet und blieben zusammen, auch wenn Fatima, die Amme, zuversichtlich äußerte, sie würden sich in ein paar Jahren schon ohne Mühen voneinander trennen lassen. Der Lehrer, der ihnen lesen und schreiben und schließlich die Anfangsgründe der Wissenschaften beibringen sollte, hatte das auch schon bei den älteren Prinzen getan; da aber sein weiterer Verbleib bei Hofe durch die Favoritin Zoraya gesichert worden war, stand er ihr – und ihren Kindern – nicht feindlich gegenüber.
In die Geheimnisse der Schrift einzudringen, machte die Unterschiede zwischen Tariq und Layla einmal mehr offensichtlich und stärkte in ihrer Umgebung die Verwunderung über das enge Band zwischen ihnen. Layla verfügte über die schnellere Auffassungsgabe, und sie konnte der Versuchung nicht widerstehen, das gelegentlich deutlich werden zu lassen. Sie vergaß nichts und niemanden, vor allem keine Kränkung, während Tariq zwar sehr schnell aufbrauste, aber ebenso rasch vergaß und vergab. Er machte leidenschaftlich gern Geschenke und wäre als Sohn jeder anderen Frau wahrscheinlich der Liebling seiner Halbgeschwister gewesen. Doch zu seinem Unglück sah er noch nicht einmal wie ein Araber aus.
Er war ein wenig pummelig, wenn auch nicht eigentlich dick, und erinnerte seine Mutter mit seinen hellbraunen Locken, der Stupsnase und den Grübchen an die Engelsdarstellungen, die sie in ihrer Kindheit in Kapellen gesehen hatte. Einige der Jungen neckten ihn gerne damit, daß er das Mädchen sei, nicht seine Schwester, doch da Tariq verbissen daran arbeitete, stärker und schneller als alle seine Altersgenossen zu werden, hörte die Neckerei nach einigen schmerzhaften Prügeleien bald auf.
Layla sah zwar keineswegs wie ein Junge aus, aber sie wußte schon bald, daß sie nach den Maßstäben aller Menschen, die sie kannte, häßlich war. Ihre Nase war zu lang und zu dünn, sie hatte schmale Lippen und ein spitzes Kinn, und was Tariq zuviel an Gewicht hatte, fehlte ihr. Nur die Augen der Zwillinge glichen sich vollkommen; sie hatten beide die großen dunkelblauen Augen ihrer Mutter und ihre geraden, kräftigen Brauen. Für Layla war ihre Mutter der Inbegriff der Schönheit, und ihre eigene Unzulänglichkeit wurde ihr zum erstenmal während eines weiteren Zusammenstoßes zwischen Isabel-Zoraya und Aischa bewußt.
Isabel und Layla befanden sich im Bad, ein beliebter Ort, denn durch die Fenster mit ihren kunstvollen Holzgittern im zweiten Geschoß konnte man fast alles sehen, was sich in den Höfen abspielte, ohne selbst gesehen zu werden. Das Bad war nur durch den Harem erreichbar, nicht von außen, und es machte Layla Spaß, sich im Wasser zu entspannen und dabei alle möglichen Menschen zu beobachten.
Sie plätscherte noch vor sich hin, während ihre Mutter sich von einer Sklavin abtrocknen ließ, als die sorglose Stimme von Aischa über die Wasserdämpfe hinweg zu ihnen drang: »Ein Junge, der wie ein Mädchen aussieht, und ein Mädchen, das aussieht wie eine verhungerte Katze – eigentlich kann man nur Mitleid mit ihr haben.«
Aischa kam niemals in das Bad, wenn Isabel dort war, und Layla, die das wußte, erstarrte. Ihre Mutter beugte sich zu ihr nieder und legte ihr den Finger auf den Mund. Sie bedeutete auch der Sklavin, zu schweigen, und da erst bemerkte Layla, daß sie in ihrer Nische von Aischa aus nicht zu sehen waren. War sie zufällig hier, oder war es Absicht? Layla schaute zu ihrer Mutter, die sich langsam ankleiden ließ, und jetzt drang der Inhalt dessen, was Aischa gesagt hatte, in ihr Bewußtsein. Erst kürzlich hatte Layla Fatima nach dem Alter ihrer Mutter gefragt, und die Amme hatte die Achseln gezuckt. »Zwanzig, einundzwanzig, was weiß ich.« Layla fand, ihre Mutter wirkte noch jünger und verkörperte mit ihrer schlanken Gestalt, den makellosen Brüsten und dem langen Haar, das ihr bis über die Hüften reichte, alles, was die Dichter in den Liedern, die sie täglich hörte, priesen. Sie schreitet stolz einher in grünem Kleide/Sich wiegend wie im Blätterschmuck der Ast/Ihr Blick wirkt wie des Schwertes scharfe Schneide/Ihr Antlitz strahlt des vollen Mondes Glast…
Das Mädchen zweifelte daran, jemals auch nur etwas von diesem Glanz zu besitzen. War ihre Mutter sehr enttäuscht darüber? Sie wirkte nicht beunruhigt oder verärgert durch Aischas plötzliches Erscheinen oder die Bemerkungen der ersten Frau, nur etwas angespannt. Layla blieb im Wasser, ohne sich zu bewegen, aber es hatte seinen Zauber verloren. Ihr war kalt.
Eine Weile hörte man nur Flüstern und Wispern, dann erhob sich Aischas Stimme von neuem aus dem ebenmäßigen Gemurmel. »Also gut, ich will es euch verraten«, sagte sie heiter. »Mein Gemahl und ich haben beschlossen, Muhammad mit einer von Ali al Atars Töchtern zu verheiraten. Er kommt ja bald zurück, und dann wird die Vermählung stattfinden.«
Einige der anderen Frauen schrien entzückt auf. Durch Laylas Mutter ging ein Ruck. Dann, als wäre ihr eine Idee gekommen, begann sie schnell, sich wieder auszuziehen, bedeutete ihrer Sklavin aber gleichzeitig, Layla aus dem Wasser zu holen und anzukleiden. Währenddessen ging die Unterhaltung im gegenüberliegenden Bereich des Bades weiter.
»Morayma«, antwortete Aischa auf die Frage nach dem Namen der Braut. »Mein Sohn könnte es kaum besser treffen. Sie ist von makelloser Abstammung, und Ali al Atar gehört zu den Mächtigsten in Granada.«
Isabel war fertig. Sie gab der Sklavin ihre Sachen, nahm Layla bei der Hand und ging so, wie sie war, zu Aischa hinüber. Wie immer, wenn die beiden Gemahlinnen des Herrschers sich begegneten, schwieg alles, was sich im Raum befand. Layla hatte nicht oft die Gelegenheit, Aischa zu sehen, aber irgendwie gelang es der Fürstin jedes dieser wenigen Male, dem Mädchen instinktive Furcht einzuflößen, auch diesmal, als sie nackt auf einer Bank lag und sich massieren ließ.
Aischa, stellte Layla für sich fest, war um einiges älter als ihre Mutter, und man sah es, aber niemand hätte sie als alte Frau bezeichnet. Ihre Augen – schwarz und groß, wie der Prophet es als Ideal forderte – waren von Kälte und Triumph zugleich erfüllt, als ihre Rivalin vor ihr stehenblieb. Sie hat gewußt, daß wir hier sind, dachte das Kind. Langsam setzte die Fürstin sich auf.
Laylas Mutter machte eine kurze anerkennende Geste mit der Hand. »Meinen Glückwunsch, Sejidah«, sagte sie, »zu der Hochzeit Eures Sohnes … und seiner Rückkehr.«
Aischa zog die Brauen hoch. »Das scheint überraschend für Euch zu kommen«, erwiderte sie honigsüß. »Hat mein Gemahl Euch noch nichts von unseren Plänen erzählt?«
Isabel ließ Layla los und verschränkte beide Hände hinter ihrem Kopf, eine Bewegung, deren sinnliche Herausforderung Layla erst später klar wurde. Sie dehnte sich ein wenig, fuhr mit den Fingern durch ihr langes Haar und sagte mit gutgelaunter, träger Stimme: »Ach, wißt Ihr, er hat es wahrscheinlich vergessen… wir hatten so viele andere Dinge… zu bereden.«
Dann drehte sie sich um, nahm Layla wieder bei der Hand und verließ das Bad, während alle anwesenden Konkubinen, Sklavinnen und Aischa empört hinter ihr herstarrten.
Isabel schickte Layla fort, als sie sich wieder in ihren Gemächern befanden, und das Mädchen machte sich auf die Suche nach Tariq. Sie brauchte nicht lange, um ihn zu finden. Er stand auf der Nordmauer und schaute zur Sabikah hinüber, dem Übungsplatz der jungen Krieger.
»Wir haben Aischa im Bad getroffen«, sagte Layla und schlüpfte neben ihn.
Tariq schauderte unwillkürlich ein wenig, dann grinste er. »Hat sie versprochen, dich bei lebendigem Leib zu fressen?« fragte er. »Sie mag fettes Fleisch lieber«, entgegnete seine Schwester und wich einem Rippenstoß aus. »Du, sie hat erzählt, daß Muhammad zurückkommt.« Sie schwiegen beide.
Die Zwillinge kannten Muhammad nicht. Vor zwei Jahren war er nach Fez aufgebrochen, angeblich, um seine Erziehung zu vervollkommnen. Aber die Diener erzählten etwas von einem heftigen Streit zwischen Muhammad und seinem Vater; einige behaupteten sogar, der Streit habe zwischen Muhammad und ihrer Mutter stattgefunden. In jedem Fall waren die Zwillinge noch zu jung, um sich an die Zeit vor zwei Jahren erinnern zu können. Doch die anderen Kinder hatten genug von Muhammad erzählt, um ihn wie einen Helden aus dem Märchen erscheinen zu lassen: wie fabelhaft er ritt, wie er jedes Turnier gewann, wie belesen und gelehrt er schon als kleiner Junge gewesen war. Und er war Aischas Sohn.
Und Aischa haßte ihre Mutter.
»Ich habe eine Idee«, verkündete Tariq plötzlich. »Wir bereiten ein Willkommensgeschenk für Muhammad vor. Dann wird er unser Freund, und Aischa kann nicht länger böse auf uns sein. Vielleicht werden sogar Mutter und Aischa Freundinnen.«
Insgeheim zweifelte Layla daran. Doch Tariqs Begeisterung übertrug sich auf sie; die Vorstellung, ganz allein den Familienzwist zu beenden und so selbst zu Helden zu werden, erschien auch ihr unwiderstehlich.
Während die Zwillinge ihren Willkommensplänen nachhingen, schmiedete Isabel ihre eigenen Pläne. Muhammads Heirat mit der Tochter des mächtigsten Adligen von Granada, eines Verbündeten der Banu Sarraj, würde seine Position ungeheuer stärken, wie Isabel sehr genau wußte. Zornige Erbitterung fraß an ihr, aber sie ließ sich nichts davon anmerken, als Ali am Abend zu ihr kam. Sie begrüßte ihn liebevoll, servierte ihm Speisen, die er schätzte, und erst später, als sie beide zufrieden zwischen den seidenen Kissen ruhten, sagte sie beiläufig:
»Du hast mir noch gar nichts von der Rückkehr deines Sohnes erzählt. Und von seiner Heirat.«
Ali strich über ihr dunkles Haar. »Es sind jetzt zwei Jahre, Zoraya. Und wahrhaftig, eine Verbindung mit Ali al Atar könnte die Banu Sarraj zu Verbündeten machen.«
»Zu Verbündeten für Muhammad«, sagte sie schärfer, als sie beabsichtigt hatte, und fügte deshalb mit sanfterer Stimme hinzu: »Ich mache mir Sorgen um dich, mein Geliebter. Muhammad ist jetzt ein Mann, kein Junge mehr, und Männer sind ehrgeizig.«
»Er ist mein Sohn«, erwiderte Ali und ließ sie los. Sie rührte sich nicht. In der Dunkelheit war ihre körperlose Stimme zärtlich wie eine Umarmung: »Wie viele Söhne, Vettern, Brüder deiner Familie sind gewaltsam auf den Thron gekommen, mein Gebieter? Ich glaube, ich kann mich nur an zwei Emire Granadas erinnern, die nicht von ihren Verwandten entthront wurden.«
Ali antwortete nicht. Er starrte in die Nacht, mit weit geöffneten Augen, und fand noch lange keinen Schlaf.
Der sechste Geburtstag der Zwillinge kam und ging. Das Jahr näherte sich seinem Ende, als Abu Abdallah Muhammad, Kronprinz von Granada, zurückkehrte. Die Zwillinge hatten, vom Fieber der Erwartung gepackt, kaum geschlafen und waren schon sehr früh auf die äußeren Mauern geklettert, um die Ankunft ihres Halbbruders nicht zu verpassen. Zu ihrer Überraschung hatte ihre Mutter sie kommentarlos begleitet. Layla drückte sich zwischen zwei Zinnen und starrte auf die weiß würflige Stadt, die sich an die Alhambra schmiegte, hinab. Sie schaute zur Kuppel der großen Moschee, denn aus dieser Richtung drangen die Jubelrufe des Volkes, das Muhammad begrüßte.
»Wie ein Triumphzug«, stieß Isabel zwischen den Zähnen hervor. Tariq hörte sie nicht, und auch Layla ignorierte zum erstenmal in ihrem Leben ihre Mutter völlig; die Zwillinge beobachteten beide gebannt Muhammad. Alle drei schwiegen, bis der Kronprinz das erste Tor der roten Festung passiert hatte.
Fatima hat nicht gelogen, dachte Layla, er sieht aus wie ein Held aus dem Märchen. Mit dem Bewußtsein, selbst nicht schön zu sein, war in ihr eine Verehrung für Schönheit gewachsen, und wenn ihre Mutter für sie das Inbild der weiblichen Schönheit war, so erblickte sie jetzt in ihrem unbekannten Bruder den Inbegriff männlicher Schönheit. Er trug eine helle Zihara, und der gelbe Tailasan, der um seinen Kopf geschlungen war, ließ sein Gesicht völlig frei – ein Gesicht mit regelmäßigen, edlen Zügen, das fast zu vollkommen für einen Mann war. Er schaute zum Palast hoch, und es schien Layla, daß er ihr zulächelte. Sie hätte um ein Haar gewinkt wie die Leute dort unten, aber auf die Entfernung hätte er es nicht sehen können. Außerdem erinnerte sie sich wieder, daß ihre Mutter neben ihr stand.
»Hast du sein Schwert gesehen?« fragte Tariq aufgeregt. »Das ist aus Damaskus, ganz bestimmt! Vielleicht hat er noch mehr dabei. Glaubst du, er gibt mir…«
Layla stieß ihn ärgerlich in die Seite. Noch galt es, den Versöhnungsplan vor ihrer Mutter geheimzuhalten. Vorsichtig blickte sie zu Isabel auf und erkannte, daß diese nichts bemerkt hatte. Sie beachtete die Zwillinge nicht; auch sie beobachtete unausgesetzt Muhammad.
Die Zwillinge nahmen nicht an dem Begrüßungsfest teil, was auf eine taktvolle Entscheidung ihres Vaters zurückging. Tariq war enttäuscht, nicht nur Muhammads wegen. Auch al Zaghai würde auf dem Fest sein, und al Zaghai war das kriegerische Idol des ganzen Reiches, ohne besonderen Wert darauf zu legen. Seine barsche Art sorgte dafür, daß er Anhänger hatte, aber keine Freunde. Nur mit seinem Bruder verband ihn eine enge Beziehung.
Doch um al Zaghai zu sehen, würde es noch andere Gelegenheiten geben. Was Muhammad anging, so beschlossen die Zwillinge, ihn abzufangen, wenn er das Fest verließ; eine Begegnung zu dritt wäre ohnehin günstiger für ihr Geheimnis. Es fiel ihnen nicht weiter schwer, Fatima zu täuschen; darin hatten sie Übung. Isabel befand sich auf dem Fest, denn ihre Abwesenheit hätte wie eine Niederlage gewirkt.
Die Zwillinge richteten sich darauf ein, eine Ewigkeit warten zu müssen, aber Muhammad kam schon sehr bald aus der Halle. Er ging sehr zielgerichtet, und sie folgten ihm leise. Bald merkten sie, daß er nicht zu seinen oder Aischas Räumen wollte, sondern zum Falkenhaus. Das war noch besser, als sie gehofft hatten, denn dort befand sich um diese Zeit mit Sicherheit niemand mehr. Sie folgten ihm so geräuschlos wie möglich. Als sie das Falkenhaus betraten, verwirrte sie das Schweigen der Vögel etwas: Fatima hatte erzählt, daß die Vögel in der Nacht, wenn kein Mensch sie hören konnte, miteinander sprachen.
Sie kannten sich dort nicht so gut aus, und das Licht war bereits gelöscht, aber Muhammad wies ihnen selbst den Weg. Sie hörten ihn mit einem der Falken sprechen.
»Zuleima… Zuleima… erkennst du mich, Schöne?«
Layla glitt auf dem Stroh aus und stürzte. Muhammad wirbelte herum. »Wer ist da?«
»Wir sind’s nur«, sagte Tariq schnell, half seiner Schwester auf und zerrte sie etwas unsanft vorwärts, »wir haben ein Willkommensgeschenk für dich, aber sie haben uns schon ins Bett geschickt, also geben wir’s dir heimlich.«
Muhammad hatte sich inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt und konnte die Kinder, die vor ihm standen, recht gut sehen. Er lächelte. »Das ist nett von euch.« Ein wenig bitter fügte er hinzu: »Ich hätte nicht gedacht, daß mich hier jemand erkennt. Mein Hund hat mich vergessen und mein Lieblingsfalke auch, scheint es.«
»Vielleicht sind sie einfach alt«, sagte Layla schüchtern, »für Tiere, meine ich.«
Muhammad lachte. »Das wird es sein. Aber gehen wir lieber nach draußen, ich bin neugierig auf euer Geschenk.«
Später fragte sich Layla, für wen er sie wohl gehalten hatte – für Sklavenkinder, für Sprößlinge einer der Konkubinen, für die Kinder eines Gastes?
Sie verließen das Falkenhaus mit ihm. Der Generalife war nicht weit, und ohne nachzudenken, schlugen alle drei diese Richtung ein. Tariq fragte Muhammad nach seiner Reise, und dieser erzählte von riesigen Wellen, von Sandstürmen und der goldenen Stadt Fez. Wie ein guter Märchenerzähler alter Tradition übertrieb er etwas, und die Zwillinge waren gebührend begeistert.
»Und hast du auch welche von den Dschinn gesehen? Einen Ifrit?« Muhammad schüttelte den Kopf. Aus der Nähe betrachtet sah er, fand Layla, nicht so vollkommen aus, dafür aber menschlicher, wärmer. Er hatte den Tailasan längst abgenommen und griff sich manchmal unbewußt ans Ohr, eine Angewohnheit, die auch ihr Vater hatte. Seine Haare waren etwas zerzaust, obwohl kein Wind in dieser lauen Spätherbstnacht wehte.
»Nein, aber ich sah die Stelle bei Mekka, wo der Prophet den Dschinn begegnet ist.«
»Mekka«, sagte Tariq tief beeindruckt. Ehrfürchtig fragte Layla: »Dann hast du die heilige Pilgerfahrt gemacht, den Hadsch?« Muhammad blieb stehen und schaute über den Generalife hinweg auf die Berge, die im Vollmond klar zu erkennen waren; das Mondlicht ließ ihre schneebedeckten Spitzen aufleuchten wie die Dächer des Albaicin, des alten Stadtviertels, das sich tief unter ihnen befand.
»Ja. Aber die ganze Zeit wußte ich, daß das Paradies sich hier befindet. Und daß es zum Sterben verurteilt ist.«
»Was?« fragte Tariq verunsichert. Muhammad zuckte die Achseln und ließ sich auf dem Rand eines Springbrunnens nieder. Er hob die Zwillinge nacheinander hoch, damit sie neben ihm sitzen konnten.
»Vergiß es, ich rede nur dummes Zeug. Wo ist nun das versprochene Geschenk, ihr zwei?«
Tariq holte aus seinem Burnus das Pergament hervor. Es handelte sich um ein Schutzamulett, das er und Layla mit einer Sure aus dem Koran beschrieben hatten, sehr sorgfältig, um nichts falsch zu machen, abwechselnd, jeder einen Vers. Solche Schutzamulette waren eigentlich nur dann wertvoll, wenn sie von einem Iman gesegnet wurden, aber die Zwillinge hatten sich darauf geeinigt, daß Muhammad es selbst segnen lassen würde, wenn es ihm gefiel.
Sie hatten eine kleine Ansprache über die Versöhnung zwischen ihren Müttern vorbereitet, doch Tariq war so nervös, daß er Muhammad das Schutzamulett einfach nur in die Hand drückte.
»Wir haben es selbst geschrieben«, sagte Layla hastig.
»Dann ist es um so wertvoller.«
Muhammad lächelte die Kinder an und las laut vor:
»Oh, du beruhigte Seele,
Kehre zurück zu deinem Herren zufrieden, befriedigt,
Und tritt ein unter meine Diener,
Und tritt ein in mein Paradies.«
Er schwieg einen Augenblick und senkte den Kopf. Dann sagte er: »Ihr beschämt mich. Ihr macht mir dieses Geschenk, und ich kann mich nicht mehr an eure Namen erinnern, so sehr ich es auch versuche, die ganze Zeit schon.«
»Das macht nichts«, meinte Tariq großzügig, »du warst ja zwei Jahre weg. Ich bin Tariq, und das ist Layla.«
»Weißt du«, unterbrach Layla ihn, weil ihr die vorbereitete Rede wieder eingefallen war und Tariq sie offensichtlich nicht halten würde, »wo wir doch jetzt Freunde sind – wir haben gedacht – deine Mutter und unsere Mutter – wir könnten die beiden auch versöhnen – und dann ist alles wieder in Ordnung.«
Es war nicht ganz der sorgfältig ausgearbeitete Vortrag, den sie geplant hatten; Layla geriet ins Stocken, weil Muhammad sie von Sekunde zu Sekunde immer seltsamer ansah. Er blickte zu Tariq, dann wieder zu ihr.
»Ihr seid«, sagte er schließlich mit fremder Stimme, »ihr seid – ihre Kinder?«
Unwillkürlich rückte Layla ein wenig von ihm ab und wäre dabei beinahe in den Brunnen gefallen. Er hielt sie fest, aber der Griff war hart, als wollte er ihr Schmerz zufügen.