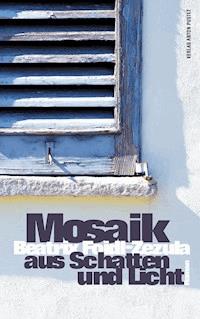
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Anton Pustet Salzburg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Laura hat ihr Leben genossen und bislang alles gemeistert. Sie hat früh geheiratet, hat sich durchgesetzt, hat gearbeitet, geliebt, getanzt, musiziert, neben ihren zwei Töchtern eine Ausbildung gemacht, und später sogar noch Psychologie studiert. Jetzt arbeitet sie als Psychologin. Sie haut so schnell nichts um. Doch dann kommt die Diagnose „Gehirntumor". Nach dem ersten Schock reist sie ohne ihre Familie für zwei Wochen auf eine griechische Insel zum Nachdenken. Dort, im Haus einer Freundin, kommen sie, die Dämonen der Vergangenheit und wollen nochmals mit Laura kommunizieren. Die Autorin Beatrix Foidl-Zezula schildert uns ein scheinbar normales Frauenschicksal, so normal, wie Lebensgeschichten wohl sind. Und auch wieder nicht …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beatrix Foidl-Zezula
Mosaik aus Schatten und Licht
Mit Dank an Daniell Porsche für die freundliche Unterstützung.
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2015 Verlag Anton Pustet5020 Salzburg, Bergstraße 12Sämtliche Rechte vorbehalten.
Bildnachweis:Umschlagbild: © lkpro 2015, mit Genehmingung von shutterstock.com
Grafik, Satz und Produktion: Tanja KühnelLektorat: Martina Schneider
ISBN 9783702580117
19
18
17
16
15
5
4
3
2
1
www.pustet.at
Die Kunst zu leben … will für mich auch bedeuten, sich immer weiter zu entwickeln, nie aufzugeben, sich auch zu verändern, neue Wege einzuschlagen, Dinge untereinander und miteinander zu verbinden, um daraus neue Kräfte und Möglichkeiten zu schöpfen …
Daniell Porsche
PROLOG
Die Patientin mittleren Alters schritt langsam, als müsste sie über spitze Steine balancieren, auf den Ausgang zu. Sie war wie betäubt. Es fühlte sich anders an als die Zustände, welche sie seit ungefähr vier Monaten erlebte und die ihr immer unheimlicher wurden. Seltsam, diese Ohnmachtsgefühle, die sie immer wieder überfielen, verbunden mit leichter Übelkeit, Gleichgewichts- und Sehstörungen, ohne dass sie aber jemals wirklich umgekippt wäre. Und das in den unmöglichsten Situationen: Während eines Restaurantbesuches im Sitzen, während eines Einkaufsbummels im Gehen oder im gemütlichen Liegen beim abendlichen Fernsehen. Ganz zu schweigen in Arbeitssituationen, wo es sich ganz besonders zu beherrschen galt – sie war nirgends und nie davor sicher. Passierte es ihr auf der Straße, hatte sie es sich schon zur Gewohnheit gemacht, eine Stütze zu suchen oder sich notfalls kurz auf den Gehsteig zu setzen. Passanten registrierten dies zwar mit eigenartigen, verständnislosen Blicken, doch Laura bevorzugte diese Reaktionen, statt womöglich tatsächlich vor den Leuten umzufallen. Da in den letzten Wochen auch noch Ohrgeräusche mit dem Gefühl drohenden Hörverlustes hinzugekommen waren, hatte sie schon vage an eine Durchuntersuchung gedacht. Obwohl – vielleicht hing alles doch nur mit dem Bandscheibenvorfall zusammen, welcher im November diagnostiziert worden war. Sie erinnerte sich mit Gänsehaut an die furchtbaren Schmerzen, die starke Bewegungseinschränkung und das Gefühl, ihr Kopf würde explodieren. Bei der Magnetresonanztomografie stellte sich heraus, dass die oberen Halswirbel betroffen waren und die instabile Halswirbelsäule für ihren Schwindel, Ohrensausen und Übelkeit verantwortlich sein könnte. Von einer Operation in diesem Bereich riet ihr der Neurochirurg ab, was ganz in ihrem Sinne war. Auf manuelle Therapie reagierte sie mit extremen Ohrenund Kopfschmerzen und so blieb vorerst nichts anderes übrig, als dem eindringlichen Rat der Ärzte zu folgen: Stress vermeiden, entspannen, sich selbst Gutes tun und vor allem sich schonen, schonen, schonen – nebst medikamentöser Behandlung. Sie hatte selbst gespürt, dass sich etwas verändert hatte.
Bis vor einem Jahr hatte sie sich noch voll leistungsfähig gefühlt – eine Powerfrau. Sie hatte so viel Kraft in sich gehabt, hatte verschiedene Dinge fast zeitgleich durchleuchten, organisieren, erledigen können. Wie aus heiterem Himmel waren ihr diese Kräfte plötzlich abhandengekommen. Immer öfter fühlte sie eine eiserne Klammer um ihre Brust, als ob diese ihr die Luftzufuhr abschneiden wollte. Unerklärliche körperliche Schmerzen kamen hinzu, plötzlich aufsteigende tiefe Traurigkeit ebenso wie das Gefühl, unter Starkstrom zu stehen. Doch das Schlimmste waren die Albträume, die sie plagten. Darin tauchten traumatische Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit auf. Sie hatte doch alles gut überstanden, innerlich damit abgeschlossen. Also warum brachen diese Erinnerungen nun wieder so plötzlich über sie herein? Aus diesen Albträumen erwachte sie jedes Mal mit Herzrasen und Ängsten, die sich nicht wirklich definieren ließen und sich nur langsam wieder legten. An einen erholsamen Schlaf war danach jedenfalls nicht mehr zu denken.
Anfangs versuchte sie, ihren Energieabfall wieder auszugleichen, indem sie sich noch mehr engagierte – in der Arbeit, in der Familie, bei Freizeitaktivitäten. Kein Mensch, der sie je gekannt hatte, würde nachempfinden können, wie schwach sie sich zunehmend fühlte. Sowohl körperlich, seelisch, als auch geistig, denn sogar sich zu konzentrieren fiel ihr immer schwerer. Letzteres und ein Gewichtsverlust von sieben Kilo hatten sie endgültig zur Gesamtabklärung im Krankenhaus veranlasst. Die Untersuchungen zogen sich über zwei Tage hin, wobei sie abends einen Revers unterschrieb, um nach Hause gehen zu dürfen. Auf keinen Fall wollte sie, dass ihr Mann oder die Kinder davon erfuhren, da wahrscheinlich ohnehin alles in Ordnung war.
Nun hatte sie gerade das abschließende Arztgespräch hinter sich, mit einer sehr netten und einfühlsamen Ärztin, doch sie fühlte sich – wie betäubt. Zumindest innerlich, denn äußerlich drängten Tränen in ihre Augen, die sich trotz krampfhafter Unterdrückungsversuche nicht zurückhalten ließen. Der Chefarzt kam dazu, was die Patientin gerade in diesem Moment der Schwäche als äußerst peinlich empfand. Gemeinsam versuchten die beiden Neurologen, sie zu beruhigen. Es wäre nur ein kleiner Tumor in ihrem Hinterkopf, ein stummer Tumor, der mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch nicht bösartig werden würde. Allerdings könnte er für den Schwindel, die Sehstörungen und andere gesundheitliche Probleme verantwortlich sein. Der Gehirndruck könnte steigen, sollte er zu wachsen beginnen. Sie brauche sich aber vorläufig keine Sorgen zu machen, müsse nur zuverlässig spätestens in einem halben Jahr wieder zur Kontrolle kommen, besser wäre schon in drei Monaten. Laura hatte die Gewalt über ihre Emotionen wieder erlangt, dankte den Ärzten, versprach, sich zur erneuten Untersuchung einzufinden, lehnte aber eine zusätzliche medikamentöse Behandlung ab und verabschiedete sich.
So freundlich ihr alle in dieser Situation begegnet waren, sie war froh, als sie draußen war. Es war ein verregneter Februartag, doch sie empfand den Weg zum Parkplatz als erfrischend, spürte ihre Lebensgeister wieder zurückkehren, atmete ganz tief die feuchtkalte Luft ein, verlängerte ihren Weg, indem sie abbog und den Park durchquerte und kam dabei zu folgender Einsicht: Nie und nimmer würde ein Tumor in ihrem Kopf ihr gefährlich. Daran zugrunde zu gehen passte nicht zu ihr. Sie fasste sich an die rechte Hinterkopfhälfte, strich sanft über die Stelle, wo sie das Gewächs vermutete und teilte diesem ihre Gedanken mit. Sie musste dabei über sich selbst lächeln, hatte aber doch das Gefühl, mit diesem Teil kommunizieren zu können. Schließlich gehörte er zu ihrem Körper, also warum sollte man über den Geist nicht eine Verbindung dazu herstellen können. Bei ihrem Auto angelangt, merkte sie beim Herausnehmen des Schlüssels, dass sie zitterte. Mit weichen Knien stieg sie ein und lehnte sich schwer in ihren Sitz zurück. Zweierlei Gefühle durchströmten sie: Nervöse Angst vor der Zukunft, aber auch Zuversicht. Und so überwogen nach einigen Tagen und Nächten voller Angst, Trauer, Trotz und anderer widersprüchlicher Gefühlswallungen der Optimismus und ihre Lebenslust. Sie wusste, woran sie war, hatte Erklärungen für ihre Beschwerden und ob diese nun von der Halswirbelsäule oder von ihrem stummen Tumor ausgelöst wurden, änderte nichts an der Entscheidung, die sie traf. Schließlich war sie krisenerprobt. Schon seit ihrer Kindheit hatte sie sich Strategien zurechtgelegt, welche sie immer wieder ausgebaut hatte. Aus diesem Repertoire konnte sie sowohl im privaten, als auch später im beruflichen Bereich schöpfen. Ihr Umfeld kannte sie als Ansprechpartnerin und Wegbegleiterin in und aus scheinbar aussichtslosen Situationen. Nun galt es, diese Ressource für sich selbst zu nützen: Zum einen würde sie niemandem von dieser Diagnose erzählen, da sie – vor allem familiäre – Sorge nicht ertragen konnte. Sollte sich tatsächlich etwas Lebensbedrohendes daraus entwickeln, wäre immer noch Zeit genug, die Familie davon in Kenntnis zu setzen. Doch wozu jetzt schon das Leben ihrer Lieben und sich selbst damit belasten.
Zum anderen beschloss sie, ihr Leben ab heute so richtig auszukosten – die ohnehin schon vor dem letzten Befund gegebenen Ratschläge der Ärzte würden ab jetzt umso mehr befolgt, die eigenen Bedürfnisse besser wahrgenommen und nach Möglichkeit auch befriedigt. Zu allererst müsste sie ihr Arbeitspensum radikal einschränken. Sie wollte versuchen, jeden Tag zu genießen, ihre Umwelt in den Genuss mit einzubeziehen und Träume – schöne Träume als Gegengewicht ihrer Albträume – wahr werden zu lassen. Der Zeitfaktor schien ihr sehr wichtig, aber nicht mehr im Raffer, sondern in Zeitlupe. Sich Zeit geben, Zeit lassen, Zeit auskosten, das war es, was sie verwirklichen wollte, ab diesem Moment, ein halbes Jahr vor Vollendung ihres fünfzigsten Lebensjahres.
Bei diesem Gedanken schauderte sie kurz. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, da sie ein solch »hohes Alter« nicht mal in Erwägung gezogen hatte.
Fünf Monate später erhielt sie einen Anruf aus der Klinik. Die freundliche Oberärztin von damals wollte sie an ihren Kontrolltermin erinnern. Laura teilte ihr mit, dass sie diesen noch nicht wahrnehmen werde, da ihr Zustand sich sogar gebessert hätte, und sie sicher sei, dass keine Notwendigkeit bestünde. Die Neurologin war damit nicht einverstanden, musste aber ihre Entscheidung akzeptieren und bot an, jederzeit im Fall einer Meinungsänderung erreichbar zu sein. Laura bedankte sich, legte den Hörer auf und strich sanft über die rechte Seite ihres Hinterkopfes.
Dieses Jahr würde sie vielleicht sogar ihre Jahrhunderthälfte beenden und feiern können, und dann … ja, dann würden Träume wahr gemacht.
2. Oktober
Ein strahlend blauer Himmel spannt sich über den alten, teilweise eingefallenen Dächern der Steinhäuser des chiotischen Dorfes. Seit fünf Tagen genieße ich es, eines dieser Steinhäuser ganz allein für mich zu haben, und wie jeden der letzten fünf Tage sitze ich auf der Dachterrasse im Schatten der Schilfüberdachung. Neben mir steht das Tablett mit Kaffee, Schokokeksen und einem Joghurt – so wie jeden Tag. Und wie jeden Tag blicke ich über diese Dächer genüsslich in den wolkenlosen Himmel, lausche in die Stille und auf das, wovon sie gelegentlich durchbrochen wird. Mal ist es ein krähender Hahn (offensichtlich wie ich ein Spätaufsteher), mal das Zirpen einer einzelnen Grille, mal ertönen kurzfristig aus einem Nachbarhaus griechische Radioklänge, dann wieder laute und schnelle Gespräche zwischen den alten, schwarz gekleideten Frauen, welche tagsüber in den Gassen vor ihren Häusern sitzen. Diese Wortwechsel enden jeweils genauso abrupt, wie sie begonnen haben, und ich verstehe kein Wort.
Ich verstehe KEIN Wort – dieser Satz klingt in mir nach. Hinhören, dabei nichts verstehen und infolgedessen auch keinerlei Gedanken auf den Inhalt des Gesprochenen verwenden zu können, empfinde ich als Hochgenuss – beinahe wertgleich mit den Schokoladekeksen.
Wie lang träume ich schon von so einer Gelegenheit? Ich – ganz allein in einem fremden Land, wo ich mich zwar notfalls verständigen könnte (wozu gibt es Hände, Füße und Englisch), aber nichts verstehe. Wo ich tun und lassen kann, wonach mir auch immer ist.
Wo ich keinerlei Tagesablauf beachten und auf niemanden Rücksicht nehmen muss. Wo ich schlafen, lesen, Musik hören, schreiben, Löcher in die Luft schauen kann, ohne über Zeitverschwendung nachzudenken. Wo es kein Telefon gibt und nur ich entscheide, wann, mit wem und wie oft ich zur Telefonzelle spaziere, um mit meinen Lieben Kontakt aufzunehmen (das ist noch das Einzige, bei dem es mir etwas schwer fällt, es nicht zu tun!). Wo ich meine eigene, ganz intime kleine Bühne habe, auf der ich die wildesten Tänze hinlegen, Grimassen schneiden, erhabene, dümmliche oder geistig hochwertige Monologe führen kann.
Wo ich in den bequemsten Klamotten oder auch nackt herumlaufen kann (es stehen hier auch kaum Spiegel).
Wo ich mein Essen in Art, Weise, Quantität und Qualität von keiner Tageszeit oder selbst ernannten Ernährungsspezialisten abhängig machen muss und nur meinen ureigenen Bedürfnissen nachgeben kann.
Das nenne ich Freiheit – und diese Freiheit habe ich mir nun endlich genommen. Was heißt genommen – ich habe sie mir geschenkt. Es ist mein ganz privates Geburtstagsgeschenk an mich, zur Vollendung meiner ersten Jahrhunderthälfte.
Nie hätte ich früher gedacht, dass ich dieses große Ereignis tatsächlich einmal erleben würde. Mein Leben hörte in meinem damaligen Bewusstsein zwischen 47 und 49 Jahren auf. So lange ich denken kann, waren dies die magischen Zahlen, zwischen denen sich mein erwartetes Lebensende bewegte.
In den ersten beiden Jahrzehnten begründete ich meine Vorahnung damit, dass ich nie einen Status erreichen wollte, wo ich möglicherweise hässlich, krank und gebrechlich sein würde, und darunter verstand ich offensichtlich ein Lebensalter ab 47.
Später, im Lauf des dritten Jahrzehnts, nahm ich einfach das »Gefühl« meines auf diese Zahl begrenzten Lebens zur Kenntnis. Es machte mir nie Angst, aber ich wollte meine Zeit mit all dem füllen, was ich an Wünschen, Talenten und eigenen Anforderungen an mich in mir spürte.
Nicht, dass ich nun die ganze Zeit über an mein bevorstehendes Ende gedacht hätte, absolut nicht. Ich genoss es zu leben, aber in Momenten von Chancen, Krisen und möglichen Veränderungen in meinem privaten und beruflichen Werdegang stand mir immer wieder mein zu erwartendes »nahes« Ende vor Augen. Meine Entscheidungen wurden dadurch – vor allem in der Spontaneität – deutlich beeinflusst. Das erste wichtige Ereignis passierte allerdings völlig unerwartet.
Mein begonnenes Jura-Studiumsjahr in Graz ging gerade dem Ende zu, als der Hausarzt meines Heimatdorfes meiner Mutter und mir den seit drei Monaten bestehenden Verdacht einer Schwangerschaft bestätigte. Seit einiger Zeit befand ich mich in Behandlung eines renommierten Grazer Frauenarztes, der mir versichert hatte, ich könne gar nicht schwanger sein – bei meiner unterentwickelten Gebärmutter – es wäre eine hormonelle Störung, leichtens mit Gestagen zu behandeln. Nun ja, da hatte sich unsere weibliche Intuition – im Gegensatz zum Fachurteil über mehr oder weniger gebärfähige junge Frauen – nicht täuschen lassen und so war ich bereits am Ende des vierten Monats. Der Vorteil war, dass ich mir nun nicht mehr wie andere werdende Mütter Gedanken machen musste oder Erfahrungen und Ratschläge anzuhören brauchte, wie man den unangenehmen Nebenwirkungen der ersten Schwangerschaftsmonate begegnen könne. Ich hatte auf diese Art und Weise Übelkeit, Erbrechen, depressive Anwandlungen einfach »übersehen«.
In mir wuchs also ein Baby – ich war 19, so was von aufgeregt, unheimlich stolz auf meine also doch ausreichend große Gebärmutter und voller Abenteuerlust. Erst dann fiel mir ein, dass da ja noch ein zweiter daran beteiligt gewesen war: der Mann (für mich war er trotz seiner ebenfalls knappen 19 Jahre tatsächlich ein Mann), in den ich seit eineinhalb Jahren verliebt war, der ganz nach meinem Geschmack aussah (groß, sexy, dunkelhaarig, blauäugig – vielleicht etwas zu dünn), der mich so liebte, dass er meinen Umzug nach Graz gar nicht guthieß, aus Angst mich durch die fast 300 Kilometer Entfernung zu verlieren. Gerade seine Angst beflügelte meine Grazer Studienpläne noch mehr. So konnte es sich doch beweisen, wie stark unsere Liebe war. Und nun – war sie mit unserem gemeinsamen Produkt, unserer »Liebesfrucht«, besiegelt. Ich konnte es kaum erwarten, ihm davon zu erzählen, malte mir aus, wie seine blauen Augen strahlen würden, sein Schnurrbärtchen vor Rührung etwas zitterte. Ich sah uns als Brautpaar im Kreis einer uns beneidenden Verwandten- und Bekanntenschar.
Ich sah mich mit unserem Zwerg beim Klingeln der Haustür ihm entgegenlaufen und ihm strahlend öffnen (als Räumlichkeit musste in meiner Fantasie meine derzeitige Studentenwohnung herhalten). Er nahm mich in seine Arme, küsste mich und hievte gleichzeitig unser krähendes Kleines auf seine Schultern (das alles mit nur zwei Armen? Egal, man kann sich’s ja zumindest vorstellen!). Doch eine Weile musste ich mich noch gedulden, da mein Liebster sich gerade 120 Kilometer weit entfernt auf seine bevorstehende Matura vorbereitete. Ich wollte ihm diese Sensation aber nur persönlich mitteilen – schließlich freute ich mich darauf, das Leuchten seiner Augen »live« zu erleben. Also vereinbarten wir telefonisch ein Treffen am Wochenende genau in der Mitte der uns trennenden Heimatorte. Diese wurden von einem Berg und weiteren je 15 Kilometern auf beiden Seiten des Passes geteilt. Auf meiner Seite des Berges liegt ein netter Ort mit Café und Hallenbad. Dort vereinbarte ich unser Treffen – vielleicht würde er mich ja im Badeanzug schon als werdende Mutter erkennen. Und wenn nicht, dann wenigstens meine unverbildete Figur noch einmal so richtig genießen können. Der von mir vorgeschlagene Treffpunkt erschien ihm am Telefon sehr ungewohnt (war er auch), und mit misstrauischem Unterton fragte er nach dem »Warum«. Doch ich blieb ganz geheimnisvoll. Ob er wohl glaubte, ich wolle ihm einen neuen Freund gestehen? Und wenn, dann würde er nach drei Tagen der Angst um mich umso begeisterter von meiner sensationellen Neuigkeit sein.
Zu Hause wusste es vorerst nur meine Mutter, und ich verbot ihr, es meiner bei uns wohnenden Großmutter und meinem Vater zu erzählen. Ich wollte dies selbst tun und zwar gemeinsam mit dem werdenden Vater meines Babys.
Meine Schwestern, die ohnehin weit entfernt wohnten – eine in Paris, eine in Münster– weihte ich unter dem Siegel der Verschwiegenheit am Telefon ein. Doch das war ein Fehler! Denn nun wurde ich – so ganz subtil – plötzlich damit konfrontiert, dass mein Liebster vielleicht gar nicht Vater werden wollte!
Meine in Paris lebende, verheiratete Schwester, Mutter zweier Kinder, versicherte mir, dass ich keine Angst zu haben brauche – Angst? Ich könne zu ihr ziehen, in Paris studieren und sie würde sich während dieser Zeit meines Babys annehmen.
Meine in Münster lebende, verheiratete Schwester, Mutter einer Tochter, versicherte mir, dass es kein Problem sei, das Baby zu bekommen – was? Etwa NICHT bekommen? – ich könne zu ihr ziehen, bei ihrem Mann als Zahnarztassistentin arbeiten und die Erziehung meines Kindes ohne Sorge ihr überlassen.
Zweierlei Gefühle erzeugten diese Angebote: a) Überraschung und Rührung darüber, dass beide Schwestern mich und mein Baby bei sich haben wollten, und b) Wut und Kränkung darüber, dass sie auch nur daran denken konnten, mein Liebster wolle mich und das Baby nicht.
Als auch noch meine Mutter, welcher ich von den Reaktionen meiner Schwestern erzählte, meinte, es werde schon alles gut gehen (sie mochte meinen Liebsten sehr), wenn aber nicht, könne ich ohne Probleme in Graz weiterstudieren und sie würde mir in Bezug auf mein Baby hilfreich zur Seite stehen, war es so weit: Ich zog nun tatsächlich in Betracht, dass mein Geliebter zwar mich wollte, aber womöglich nicht das Baby unter meinem Herzen.
Ich war so stolz auf meine Familie und so dankbar, dass sie alle für mich da sein wollten. Aber ich wäre nicht ich gewesen, hätte ich diese Hilfsangebote angenommen. Nein, das würde ich ganz allein schaffen. Ich würde allen zeigen, dass ich niemanden brauchte – außer vielleicht hin und wieder, um auch mal ausgehen zu können. Wozu braucht mein Baby einen Vater, wenn es doch mich hat, eine Mutter, die ihm alle Liebe der Welt geben würde, die für es sorgen und mit der es so richtig lustig und schön würde. Ganz elend wurde mir, als sich nun mein Fantasiebild des mit Freude erwarteten nach Hause kommenden Vaters in ein reines Mutter-Kind-Szenario verwandelte. Obwohl, so verinnerlicht hatte es schon auch etwas für sich: eine junge, stolze, hübsche, vor Kraft strotzende Mutter mit süßem, strahlendem, allerliebstem Kind …
Und da war sie: die Zahl 47.
In aller Ruhe rechnete ich nach, wie alt mein Baby dann wäre. Sehr gut, 28 Jahre, das hieße, es könnte dann selbstständig leben, hätte wahrscheinlich eine eigene Familie und ich würde mich sogar noch als Großmutter erleben – eine zufriedenstellende Vorstellung. Welch Glück, dass ich in diesen jungen Jahren schon befruchtet worden war!
Ich war so in meine Gedanken vertieft, dass ich erstaunt bin, wie spät es schon ist. Meine nachmittägliche Dachterrassenruhe wird jäh gestört von den harten Glockenschlägen der Dorfkirche. Drei Schläge, das bedeutet, es ist vier Uhr. Als ich den ersten Tag hier war, hatte mich die Glocke, die immer eine Stunde zu wenig schlug, total verunsichert.
Gewissenhaft hatte ich auf dem Flug nach Athen bereits meine Uhr eine Stunde vorgestellt – sie bei der Zwischenlandung in Athen auch noch überprüft. Und hier in Chios, wo ich bislang nirgends Uhren entdecken konnte – das finde ich ja grundsätzlich angenehm – schlägt die Kirchenuhr die Stunde, aber eben immer eine weniger als meine Armbanduhr anzeigt.
An sich spielt das keine Rolle, nur muss ich noch vor meinem Abflug von hier herauskriegen, wie spät es nun tatsächlich ist. Wenn ich auf die Dorfkirchenuhr vertraue, diese sich aber als falsch erweisen und ich deshalb den Flug versäumen würde, könnte ich dies allerdings als ein Zeichen ansehen – ein Signal, dass ich noch bleiben soll. Diese Variante werde ich überdenken, bis dahin möchte ich aber doch auf Nummer sicher gehen, und ich nehme mir vor, nach Uhren Ausschau zu halten. Ist einfacher, als das Wörterbuch auszupacken, um nachzufragen. Hier im Haus kann ich keine Uhr entdecken. Offensichtlich lebt auch meine Freundin, der dieses wunderschöne, alte, liebevoll renovierte Steinhaus gehört und als Sommerresidenz dient, zeitlos.
Ich habe mir die von der Lufttemperatur schon etwas angenehmere Zeit im September und Oktober ausgesucht, um ihr Angebot, hier meinem Wunsch nach Alleinsein und Ruhe nachzukommen, anzunehmen.
Ich schenkte mir diese Zeit – die ersten zwei Wochen in meiner zweiten Jahrhunderthälfte – und den Flug, sie schenkte mir die kostenlose Benutzung dieses Refugiums zum Geburtstag.
So sehr ich mich schon seit Monaten auf diese zwei Wochen freute, der Abschied von meinem Mann am Bahnhof fiel mir nicht leicht. Gerade hatte er mir noch – gemeinsam mit unseren Töchtern – so ein wunderschönes Geburtstagsfest arrangiert, und ich spürte in den letzten Tagen eine innige Liebe zu ihm, die schon länger nicht mehr so intensiv gewesen war.
Auch wusste ich, dass er mir diese zwei Wochen zwar gönnte, mich aber gleichzeitig darum beneidete. Umso mehr, als bei uns das Wetter immer kälter und trüber wurde und er ohnehin nie gerne ohne mich zu Hause blieb oder mich allein wegfahren ließ.
Mit Wehmut winkte ich aus dem fahrenden Zug. Mit schwerem Koffer und schon etwas weniger Wehmut stieg ich später in die S-Bahn um. Und als ich am Flughafen den schweren Koffer aufgegeben hatte, war mit diesem Gewicht auch die Last gewichen und ich konnte später im Flugzeug bereits den Duft der Freiheit riechen. Ich weiß, dass ich meinen Mann sehr liebe, aber ich weiß auch, dass ich ihn umso mehr liebe, wenn ich hin und wieder auch meine Freiheit lieben und leben kann.
Wir trafen uns damals, vor über 30 Jahren, im Hallenbad. Die drei Tage des Wartens waren schnell vergangen, denn sie waren voller Gedanken wie:
Will er mich?
Will er uns?
Will ich ihn?
Und Plänen mit ihm, ohne ihn …
Mein Badeanzug-Outfit offenbarte ihm nichts und nach spannungsgeladenen Schwimmrunden zu zweit mit Geküsse und Geknutsche in, unter und über Wasser landeten wir endlich im Café. Ich war immer für den direkten Weg (was mir schon in der Schule so manche Lehrerrüge eingebracht hatte) und eröffnete ihm: »Nur dass du es weißt, wir bekommen ein Baby!«
Nach einer kurzen, aber wirklich nur ganz kurzen Atempause – na, wer sagt es – strahlten mich seine blauen Augen an und er antwortete: »Super, dann heiraten wir!«
Es war das selbstverständlichste der Welt und genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte – vor den Telefonaten mit meinen Schwestern.
Wir waren beide ganz aufgeregt, wussten, wir würden heiraten und bald eine kleine Familie sein. Der Zeitplan für dieses Vorhaben war schnell fixiert: Es war April, im Mai sollte mein werdender Mann maturieren, im Juni wollten wir heiraten und Ende August wurde das Baby erwartet. Genaueres zu Wie, Wann und Wo wurde einstweilen offen gelassen, da wir es nun so schnell wie möglich unseren Eltern mitteilen wollten. Als erstes sollten es meine Eltern erfahren, vor allem mein Vater, der ja noch nichts von den Neuigkeiten wusste. Ich war seinetwegen ziemlich nervös, denn mein Vater war zeitlebens ein Choleriker, worunter vor allem meine Mutter, aber auch wir Kinder sehr zu leiden hatten. Meine Beziehung zu ihm war stark von Angst geprägt. Doch ich hatte mir meine eigenen kindlichen Strategien gegen dieses lähmende Gefühl zurechtgelegt. Mal versuchte ich ihm mit trotzigem Gegenüberstehen und möglichst wildem Augenausdruck standzuhalten – immer in der Angst, dass mich sein wilder Blick gleich tot umfallen ließe (ich überlebte es jedes Mal unbeschadet), mal versuchte ich, eine äußerst gespannte Atmosphäre mit überdrehtem Gelächter, Späßen und mich in Szene setzen zu entschärfen (was meist mit einem Abgang seinerseits gelang), mal sperrte ich mich in der Toilette im ersten Stock unseres Hauses ein, von wo mir immer noch das winzige Fenster auf das Dach als Fluchtweg blieb (ich musste es nie benutzen, er beruhigte sich vorher). Als ich älter wurde, veränderte sich auch meine Vorgangsweise. Entweder leistete ich offenen Widerstand, was mir von meiner Großmutter und Mutter den Beinamen »Xanthippe« einbrachte, oder ich ging mit einer Mischung aus Eigensinn und Charme vor, womit ich interessanterweise den größten Erfolg bei meinem Vater, aber gehässige Eifersucht bei meinen Schwestern erntete.
Für das Unternehmen »Kinderkriegen-Heirat« wählte ich schon im Voraus eine Strategienmischung aus der Kindheit und aus meinem Erwachsenendasein. Meinem Liebsten gegenüber hatte ich darauf bestanden, dass ich selbst es meinem Vater sagen wollte.





























