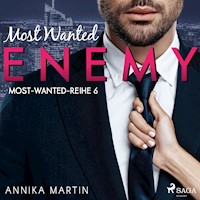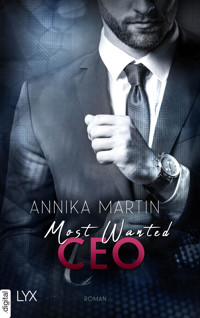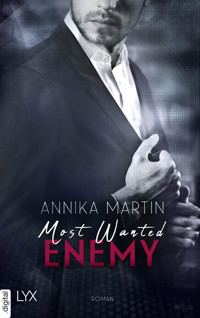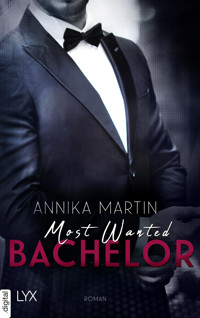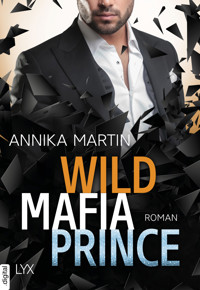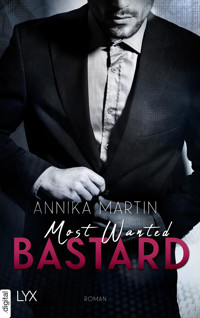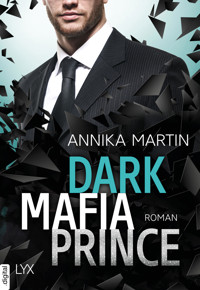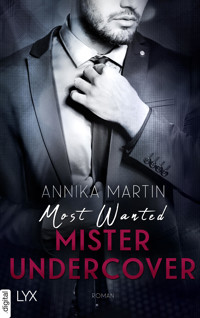
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Most-Wanted-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein Milliardär undercover
Wie erniedrigend! Bei seiner Antrittsrede wird der frisch ernannte CEO Jaxon von Henningsly in einer Telefonkonferenz vor der gesamten Belegschaft bloßgestellt. Das kann der Milliardär nicht auf sich sitzen lassen! Wie besessen versucht er, die Identität der Frau aufzudecken, die es gewagt hat, sich über ihn lustig zu machen. Da kommt ihm eine außergewöhnliche Idee: Er schleicht sich in sein eigenes Unternehmen ein. Doch was als eine Undercover-Mission beginnt, um seinen Ruf wiederherzustellen, entwickelt sich schnell zu weitaus mehr. Denn in der attraktiven Modedesignerin Jada Herberger findet der Playboy die erste Frau, die ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Aber Jada verbirgt ein Geheimnis, das ihre Beziehung beenden könnte, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat ...
»Diese Geschichte ist leicht und unerwartet und macht einfach glücklich. Die perfekte Lektüre, um dem Alltag zu entfliehen!« ALL ABOUT ROMANCE über MOST WANTED ENEMY
Band 7 der MOST-WANTED-Reihe von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Annika Martin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Epilog
Die Autorin
Die Romane von Annika Martin bei LYX
Impressum
ANNIKA MARTIN
Most Wanted Mister Undercover
Roman
Ins Deutsche übertragen von Michaela Link
Zu diesem Buch
Wie erniedrigend! Bei seiner Antrittsrede wird der frisch ernannte CEO Jaxon von Henningsly in einer Telefonkonferenz vor der gesamten Belegschaft bloßgestellt. Das kann der Milliardär nicht auf sich sitzen lassen! Wie besessen versucht er, die Identität der Frau aufzudecken, die es gewagt hat, sich über ihn lustig zu machen. Da kommt ihm eine außergewöhnliche Idee: Er schleicht sich in sein eigenes Unternehmen ein. Doch was als eine Undercover-Mission beginnt, um seinen Ruf wiederherzustellen, entwickelt sich schnell zu weitaus mehr. Denn in der attraktiven Modedesignerin Jada Herberger findet der Playboy die erste Frau, die ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Aber Jada verbirgt ein Geheimnis, das ihre Beziehung beenden könnte, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
1
Jaxon
Paris
Der Bevollmächtigte meiner Eltern, Barclay, wartet im Aufenthaltsraum auf mich und klammert sich dabei so fest an seinen Hut, dass er ihn verbeult.
»Ich bin mit dem ersten Flug aus Heathrow gekommen, den ich bekommen konnte. Mein aufrichtiges Beileid, Mr Henningsly.«
»Ich sollte Ihnen kondolieren«, antworte ich. »Sie haben die beiden besser gekannt als ich.« Der Mann hat wahrscheinlich täglich mit ihnen geredet, ihre Befehle ausgeführt und sie über ihr Imperium auf dem Laufenden gehalten.
Ich dagegen habe seit Jahren nicht mehr mit ihnen gesprochen.
Und das werde ich nun auch nie wieder tun können.
»Wie dem auch sei, Mr Henningsly«, sagt Barclay.
Wie dem auch sei und sehr wohl sind Phrasen, die Angestellte mir gegenüber gern benutzen. Nichtssagende Formeln, an denen alles abperlt. Manchmal denke ich, dass es ein Memo gegeben haben muss: »Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie dem schrecklichen Sohn gegenüber äußern sollen, funktioniert in den meisten Fällen sehr wohl. Anderenfalls versuchen Sie es mit wie dem auch sei.«
Dieser Mann hat bereits beide Phrasen benutzt, ein Zeichen dafür, wie extrem unglücklich er darüber ist, nun mit mir zusammenarbeiten zu müssen.
Zweifellos wünscht er, ich wäre derjenige gewesen, der mit dem Flugzeug auf dem Grund des Ärmelkanals gelandet wäre. Die meisten Menschen würden es vorziehen, wenn ich tot wäre – am besten, nachdem ich ein bisschen gelitten hätte. Es solle mir leidtun, dass ich so bin, wie ich bin und so weiter.
Damit das klar ist: Es tut mir nicht leid, wie ich bin.
Den Hut immer noch in der Hand folgt er mir über den blitzblank polierten Marmorboden. »Zwei der prächtigsten Menschen, die mir je begegnet sind.«
Dass er so etwas in der Öffentlichkeit sagt, verstehe ich. Meine Eltern haben eine Menge Arbeit in ihr Image gesteckt – ein Blendwerk, mit dem sie fast jeden mit Rang und Namen getäuscht haben. Doch ein so enger Mitarbeiter meiner Eltern müsste wissen, was sie wirklich waren. Ich mag es gar nicht, wenn man mich anlügt oder für dumm verkauft.
Wir gehen durch einen weiteren endlosen Flur. Ich hoffe, dass die Polizei, die Luftfahrtbehörde und der Rest der offiziellen Vertreter inzwischen verschwunden sind. In den vierundzwanzig Stunden seit dem Tod meiner Eltern sind unentwegt Beamte in der Pariser Residenz ein und aus gegangen.
Die jetzt meine Residenz ist. Nun, jedenfalls eine von vielen.
Wir befinden uns im überflüssigerweise so benannten Herrenhauszimmer mit hoher Decke, vergoldetem Stuck und tosendem Feuer in einem Kamin von der Größe eines Minivans. Vom Fenster aus hat man einen Blick auf die kunstvollen schmiedeeisernen Zäune, die das Grundstück umsäumen, verziert mit goldenen Spitzen und bourbonischen Lilien, als wäre es die offizielle Residenz des französischen Staatspräsidenten höchstpersönlich. Die Tore sind während der vergangenen Nacht ständig knarrend auf und wieder zu gegangen, bedient von einem nervösen jungen Sicherheitsposten, der meinen Vorschlag, sie zu ölen, schnellstens in die Tat umgesetzt hat.
»Sehr wohl, Sir, sehr wohl!«,hat er gesagt und war vor Entsetzen fast erstarrt. Als hätte ich ihm den Kopf abgerissen, wenn er nicht gehorcht hätte.
Sämtliche Behördenvertreter sind tatsächlich fort. Nur mein Cousin Charley und mein Kammerdiener Arnold sind noch zugegen. Arnold ist schon mein ganzes Leben lang bei mir. Er ist jetzt siebzig – sportliche, gesunde siebzig –, und hat einen dichten weißen Haarschopf.
»Die Security hat die Paparazzi vom gesamten Häuserblock verbannt«, sagt Arnold.
Ich nicke. Meine Eltern hatten immer eine durchaus effektive Security.
»Kommst du klar?«, fragt Charley, der meine düstere Laune vielleicht mit Trauer verwechselt.
»Es war eine lange Nacht«, antworte ich einfach.
Barclay steht da, mustert mich argwöhnisch und quetscht noch immer seinen Hut zusammen.
»Gibt es sonst noch etwas?«, frage ich.
»Es tut mir sehr leid, Sie noch weiter belästigen zu müssen … in einer so schwierigen Zeit.«
»Was liegt an?«
»Eine Bitte, Mr Henningsly. Es geht um … das Unternehmen. Der Vorstand hofft, dass Sie den Truppen ein paar optimistische und ermutigende Worte mit auf den Weg geben könnten.«
»Sie wollen optimistische, ermutigende Worte von mir?«, wiederhole ich. »Himmel hilf.«
Er blinzelt und weiß nicht recht, wie er antworten soll. Dann: »Wie dem auch sei, Mr Henningsly, es gibt eine große Anzahl von Firmen, Investmenthäusern, Einzelaktionären und verschiedenen Körperschaften rund um den Globus unter dem Dach von Wycliff Inc., die wissen müssen, dass sie sich auf Sie verlassen können, wenn es darum geht, die Tradition der Stabilität und Weisheit in der Führung fortzusetzen et cetera. Die Leute müssen hören, dass Sie vorhaben, den Kurs zu halten. Man macht sich Sorgen, wissen Sie …«
Wegen mir macht man sich Sorgen, aber das spricht Barclay nicht aus.
»Der Tod Ihrer Eltern hat eine Reihe von Unternehmen in Panik versetzt«, fährt er fort. »Es gilt, die Aktien zu bedenken, die Bewertungen sind gefährdet …«
»Dann schaffen wir sie uns vom Hals. Stoßen wir das Ganze ab.«
Barclay wirkt erschrocken. Selbst mein Cousin Charley wirkt überrascht.
»Es ist ein aufgeblähtes Imperium, das auf Betrug und Wirtschaftsspionage aufgebaut ist«, stelle ich fest. »Auch wenn ich mich allein damit wohl anfreunden könnte, hat Wycliff dabei noch dieses ganze Weltverbesserer-Image. Wenn ich schon ein raffgieriges und verdeckt agierendes internationales Unternehmen leite, dann will ich nicht, dass es eine tugendhafte Fassade vorgaukelt. Das entspricht mir einfach nicht. Ich muss an meinen Ruf denken, wissen Sie.«
»Aber Sie können nicht einfach alles hinschmeißen«, protestiert Barclay.
»Nach den Regeln des Trusts kann ich das durchaus«, widerspreche ich.
»Hunderttausende werden ihre Jobs verlieren«, gibt Barclay zu bedenken. »Das würde einen Ausverkauf entfachen. Die Aktien würden in den Keller gehen. Die Altersversorgung der Mitarbeiter könnte zusammenbrechen. Menschen auf der ganzen Welt wären davon betroffen. Die Märkte selbst …«
»Und warum genau soll mich das interessieren?«, frage ich.
Charley funkelt mich aus einem mit grünem Samt bezogenen Sessel an. Die weiße Porzellantasse in seiner Hand schimmert fast so hell wie sein blondes Haar.
Wenn man ich ist, wird man ziemlich oft angefunkelt und lernt solche Blicke so gut kennen wie alte Seebären den Wind. Es gibt den gängigen bösen Blick, der sagt, Was für ein Arschloch, ich bin schockiert, dann den hasserfüllten Blick und natürlich den mörderischen Blick, der in der Regel die amüsanteste Variante ist, vor allem, wenn er wirklich von Herzen kommt.
Charley hat den Blick perfektioniert, mit dem er sagt: Ich habe Besseres von dir erwartet – einer seiner beeindruckenden und oft geübten Blicke. »Hunderttausende, Jaxon! Kannst du nicht ein einziges Mal das Richtige tun?«
Ich zupfe die Manschetten meines Hemdes zurecht. »Eher nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt.«
Charleys Blick wird noch finsterer.
Ich schenke ihm ein Lächeln.
Barclay strafft sich. »Es sollte Sie interessieren, denn wenn Sie die Geschäfte so weiterführen wie bisher, zumindest in naher Zukunft, hätte das unendlichen Reichtum für Sie zur Folge. Statt eines plötzlichen Börsenabsturzes am Tag nach dieser … dieser Tragödie.«
»Ich bin schon jetzt reicher, als ich sein will«, halte ich dagegen. »Von meinen Eltern brauche ich nichts.«
Jetzt meldet Arnold sich zu Wort. »Aber Jaxon, wenn Sie unendlichen Reichtum hätten, könnten Sie umso leichter Ihre Feinde vernichten.«
»Mir geht’s ganz gut mit meiner gegenwärtigen Fähigkeit, meine Feinde zu vernichten«, antworte ich.
»Aber mit erheblich mehr Reichtum könnten Sie sie ungestraft vernichten«, meint Arnold.
Mit den Manschetten bin ich fertig. »Nun, wenn Sie es so ausdrücken … Straffreiheit liebe ich durchaus.«
»Dann werden Sie es also tun?«, hakt Barclay nach.
Ich seufze müde. »Na schön.«
»Ausgezeichnet, Sir«, sagt Barclay. »Wir lassen gerade den PR-Mann Ihres Vaters an der Ansprache arbeiten. Wir sorgen dafür, dass Unternehmen auf der ganzen Welt Ihre Nachricht synchron hören können. Dazu werden wir den großen Raum im zweiten Stock herrichten. Nur ein paar Minuten, dann können Sie wieder gehen. Wir werden Sie die Rede zur Mittagszeit halten lassen, was in den USA früh am Morgen und in Asien Abendessenszeit sein wird.«
Barclay und Arnold ziehen ab, wahrscheinlich, um in dem großen Raum im zweiten Stock alles aufzubauen, und Charley und ich bleiben allein zurück.
»Ach, Jaxon«, murmelt Charley und nippt bedächtig an seinem Tee.
Die meisten Leute hängen mit mir ab, weil sie dem Reichtum nahe sein wollen oder weil sie dann mit dem Bösewicht vom Dienst in Verbindung gebracht werden, wie es die europäische Boulevardpresse ausdrückt, ganz zu schweigen von sämtlichen Fans der Formel 1. Doch als gutartiger Spross eines Familienzweiges, der so wohlhabend ist wie meiner, weiß der Himmel, warum Charley hier herumhängt. Pflichtgefühl, nehme ich an. Eine ungesunde Fixierung auf familiären Zusammenhalt. Tradition. Als Jungen hat man uns auf dem Land oft zusammen Besorgungen erledigen lassen.
»Nun denn«, sagt Charley und stellt seine Teetasse beiseite. »Ich nehme an, ich sollte mich auf den Rückweg in den Gästeflügel machen.« Er sieht mich erwartungsvoll an. Das ist Charley. Immer erwartet er mehr.
»Du bleibst nicht zu einem späten Mittagessen?«, frage ich. »Vielleicht zu einer Portion Sushi?«
Charley strafft sich und sucht in meinem Gesicht nach Hinweisen, wie er darauf reagieren soll. »Wirklich?«
»Ich denke, wir könnten sie von den Rücken leise weinender Jungfrauen essen«, füge ich hinzu.
»Ach, Jaxon«, murmelt er erneut. »Immer wieder stößt du mich weg, aber du bist meine Familie. Und ich weiß zufällig, dass es hart ist, mit so etwas allein fertig werden zu müssen. Ich hatte aber immerhin meine Schwestern, als meine Eltern gestorben sind.«
»Ist das der Moment, in dem ich mich an deiner Schulter ausweine?«, frage ich ihn. »Du erinnerst dich doch wohl an die Tatsache, dass die beiden Monster waren?«
»Kein Mensch ist eine Insel, Jaxon. Oder zumindest sollte er es nicht sein«, fügt er hinzu.
»Was ist daran auszusetzen, eine Insel zu sein? Inseln sind toll. Vor allem solche, die reich an Ressourcen sind, schönes Wetter bieten und kleine Lokale, in denen man einen Drink nehmen kann. Und wo man sich nie mit dem Bullshit anderer herumzuschlagen braucht.«
»Ich werde zu der firmenweiten Ansprache wiederkommen, um dich moralisch zu unterstützen«, verspricht er.
»Bitte, tu das nicht.« Ich lasse mich auf eine unglaublich unbequeme Couch sinken.
»Eines Tages wird es dir leidtun, dass du ständig den Schurken gespielt hast, Jaxon. Eines Tages werden die Medien es satt haben, dich vernichtende Dinge über Royals und Prominente sagen zu hören, und dann werden nicht einmal mehr deine falschen Freunde zu deinen Partys kommen.«
Ich seufze. »Mach dich nicht lächerlich. Falsche Freunde müssen zu meinen Partys kommen. Das gehört praktisch zur Stellenbeschreibung.«
»Du hattest Pech in Sachen Familie, Jaxon, aber ich bin hier«, entgegnet Charley.
»Oh, darüber dass das Pech war, bin ich mir nicht sicher«, sage ich. »Die Familie, die ich hatte, hat mir eine Menge Illusionen über die menschliche Natur erspart.«
Charley presst die Lippen zusammen, ein Zeichen, dass er noch etwas in petto hat. Es wird etwas über Jenny sein, meine alte Nanny. Er kann es nicht erwarten, die Rede auf sie zu bringen. Die freundliche, süße, liebevolle Jenny, die mitten in der Nacht davongelaufen ist.
Er wird es nicht wagen – nicht, wenn ich ihn so anfunkle wie jetzt.
2
Jaxon
Zwei Stunden später sitzen wir in dem großen Raum im zweiten Stock, dem geschichtsträchtigen Ort, von dem aus mein Vater sein Geschäftsimperium geleitet hat. Im Raum steht ein Schreibtisch mit modernstem Sendeequipment.
Ich beäuge seinen sehr königlichen Stuhl. Es ist schlimm genug, dass ich eine Ansprache vorlese, die sein PR-Typ geschrieben hat, um das Imperium zu beruhigen, das er aufgebaut hat. Auf keinen Fall werde ich auf seinem Stuhl sitzen. Das wäre ein zu platter Abklatsch meines Vaters. »Dieser Stuhl, nein. Holen Sie mir einen aus dem Esszimmer.«
Diener huschen davon.
Charley hat sich auf den Lehnstuhl vor dem tosenden Kamin gesetzt. »Hat denn niemand Onkel Cliff von der neumodischen Erfindung namens Zoom erzählt?«, fragt Charley.
»Er hätte keine Verwendung für Zoom gehabt«, antworte ich. »Das hätte es nötig gemacht, sein Gesicht zu zeigen und andere zu sehen und zu hören.«
»Autsch«, murmelt Charley und zeigt sein gewohntes gutmütiges Grinsen.
Ein PR-Mann reicht mir einen Bogen Papier. »Die Ansprache, Mr Henningsly.«
Ich überfliege sie und runzle die Stirn. »Wir dürfen nicht verzweifeln, sondern müssen weiter tapfer für eine bessere Zukunft kämpfen?«,lese ich vor. »Wer bin ich, Churchill?«
»Diesen Stil hat Ihr Vater bevorzugt. Man hat ihn zutiefst bewundert«, versichert mir der PR-Typ – ein dezenter Seitenhieb.
Ich starre auf die Worte hinab und denke an selbstgefällige, hochtrabende Proklamationen wie diese, die früher an mich gerichtet waren. Ein Teil seines aufgesetzten Images des Gutmenschen, auf das jeder hereingefallen ist. Es hat mich in meiner Jugend verrückt gemacht, dass alle meinen Vater bewundert haben, während ich die Wahrheit kannte. Nicht einmal Charley hat es kapiert.
»Das ist Bullshit«, lautet mein Urteil.
»Das ist der Stil, an den die Leute gewöhnt sind«, beteuert Barclay. »Die Umstände machen ihn erforderlich.«
»Wenn du es nicht richtig machen willst, warum dann überhaupt die Mühe?«, meldet Charley sich zu Wort.
»Fünf Minuten Ihrer Zeit«, sagt Barclay. »Sie halten den Aktienpreis schön hoch für den Moment, in dem Sie verkaufen wollen.«
»Ja, das Konzept verstehe ich«, erkläre ich.
»Es ist gut, dass du das machst«, behauptet Charley. »Dass du eine helfende Hand ausstreckst.«
»Tu nicht so, als wäre ich etwas, das ich nicht bin«, knurre ich, rücke das Mikrofon zurecht und hasse mich dafür, dass ich dies tue.
3
Jada
»Zwanzig Minuten!«, ruft jemand.
»Wir kriegen das hin«, sage ich.
Unsere hervorragende Schneiderin Renata – im Rockabilly-Look – schiebt eine Stecknadel in das Nadelkissen an ihrem Handgelenk, bevor sie schnell einen Abnäher absteckt und dabei aufpasst, dass sie Tina nicht pikst. Tina ist dank ihrer fantastischen Proportionen, ihrer Fähigkeit, still zu stehen und ihrer Klatschkompetenz das beliebteste Passformmodel eines jeden in Manhattan angesiedelten Designhauses. Man möchte sie auf keinen Fall piksen.
Wir sind seit fünf Uhr morgens hier und hetzen uns ab, um unser zweiteiliges Muster für Damenlaufbekleidung anzupassen. Die Sachen müssen so schnell wie möglich zur Angebotsabgabe in der Fabrik sein, sonst verpassen wir unsere Chance bei Target.
Renata ruft ein paar Zahlen, und ich greife nach dem Tablet und korrigiere das Schnittmuster.
Wir hätten das schon vor Tagen erledigt, wenn Bert Johnston, unser schrecklicher neuer CEO, nicht vergessen hätte, ein paar wichtige Infos weiterzuleiten, auf die wir gewartet hatten.
Bert ist von dem gesichtslosen riesigen Unternehmen eingestellt worden, das letzten Winter unsere Firma aufgekauft hat. Er weiß rein gar nichts über die Bekleidungsindustrie, und er hat viele unserer besten Mitarbeiter rausgeschmissen.
Der Aufstieg zum Senior Designer war schon lange mein Traum, aber ich wollte ihn mir durch harte Arbeit verdienen und nicht dadurch, dass meine geliebten Mentoren gefeuert werden.
Dave aus der Buchhaltung kommt mit einer Auswahl an Energyriegeln aus dem Automaten zu uns. Dave glaubt an die Macht von Energyriegeln, als wären sie magisch, und er möchte so gern helfen. Jeder in der Designabteilung weiß, wie wichtig diese Sache ist.
»Ich werde essen, wenn ich tot bin«, flüstere ich, während meine Finger über den Bildschirm fliegen.
»Ihr zwei rockt total!«, meint Dave. »Heftig.«
Renata schnauft. Dave ist so süß. Alle hier sind süß. Wir sind wie eine Familie, und nichts, was Bert tut, wird uns das nehmen.
Es sei denn, er schafft es, die Firma zu zerstören. Manchmal macht es den Eindruck, als wäre das sein Ziel. Aber warum sollte man absichtlich den Betrieb sabotieren, den zu führen man engagiert worden ist?
Renata macht einen schnellen Knoten. »Gut?«
Ich werfe einen Blick darauf. »Gut.«
»Bin dran.« Lacey ändert die Zuordnung der Stoffe.
Aufgebrachtes Gemurmel und SMS kursieren plötzlich im Büro.
»Nie und nimmer«, sagt Renate.
»Nein, nein, nein, nein!«, flüstere ich.
»Bert-Alarm«, verkündet Dave mit leiser Stimme und geht schnurstracks zu seinem Schreibtisch zurück. Bert-Alarm bedeutet, dass Bert auf dem Weg hierher im Flur gesichtet wurde. Leute huschen umher, um beschäftigt zu wirken, wie Vögel, die hektisch vor einer hereinbrechenden Flutwelle davonflattern. Wenn Bert denkt, man würde nicht arbeiten, kriegt man eine Abmahnung. Wenn man drei Abmahnungen hat, wird man gefeuert – kein Arbeitslosengeld, keine Krankenversicherung, kein gar nichts.
Bert verhält sich die ganze Zeit schon wie ein Mann mit einer Mission und hat reihenweise Abmahnungen verteilt.
»Konferenzraum!«, blafft er, als er durch die Tür stürzt. »Für die ganze Belegschaft obligatorisch. Sofort.«
Lacey geht zu Bert, umklammert dabei ihr Notizbuch und sieht bis zu den Wurzeln ihres purpurnen Haares erschrocken aus. »W-worum geht es denn?«
»Eine neue Generation der Eadsburg von Henningslys übernimmt jetzt Wycliff, und gleich gibt es eine wichtige Vorstellungsansprache«, sagt Bert, dessen breite Wangen im grellen Neonlicht glühen. Er ist ein kräftiger Mann, ein ehemaliger Footballspieler mit Bürstenschnitt und intensiv geschrubbt aussehenden rosigen Wangen, die bei bestimmten Lichtverhältnissen fast wie aus Porzellan wirken.
»Ähm … wer sind die Eadsburg von Henningslys?«, fragt Lacey.
Ich zucke zusammen. Mir ist klar, was Lacey tut – sie versucht, Bert hinzuhalten, versucht, uns Zeit zu verschaffen, um die Sache hier zu Ende zu bringen und das Päckchen dem Fahrradkurier zu übergeben, der gegenwärtig unten auf der Straße wartet.
»Die Familie, der das Wycliff-Unternehmen gehört? Der Mutterkonzern von SportyGoCo? Auch bekannt als Ihr Arbeitgeber?«, blafft Bert in einem Tonfall, der andeuten soll, dass sie die größte Närrin aller Zeiten ist.
»Eine neue Generation?«, hakt Lacey nach. Sie stellt sich dumm.
»Der Sohn übernimmt. Irgendein europäischer Rennfahrer.« Bert klatscht in die Hände. »Kommt schon, Leute, rein da mit euch.«
Mitglieder des Designteams huschen vorbei und hoffen, Berts Zorn zu entgehen.
Das ist der Punkt, an dem Bert seine Aufmerksamkeit auf Renata und mich richtet. »Dies ist keine freiwillige Veranstaltung.«
Ich arbeite weiter. »Wir machen nur schnell diese Lieferung fertig. Fünfzehn Minuten. Das ist unser Hauptgeschäft für …«
»Nicht freiwillig«, unterbricht er mich. »Abmahnung für jeden, der nicht in zwei Minuten da ist.«
»Können wir das hier im Konferenzraum fertig machen, während wir uns die Ansprache anhören? Wenn wir die Frist nicht einhalten, war all diese Arbeit umsonst.«
»Und wessen Schuld ist das?«, fragt Bert scharf.
Es ist, als forderte er mich heraus zu sagen: Ihre. »Nur für Angestellte.« Er wendet sich an Tina. »Raus mit Ihnen.«
Tina wirft mir einen mitfühlenden Blick zu und geht davon, um sich umzuziehen. Ich schlucke meine Tränen herunter. Unser eigentlich sicherer Fuß in die Tür bei Target: Futsch.
»Tut mir leid«, flüstert Renata mir zu und steht auf. Sie kann sich keine weitere Abmahnung leisten – sie hat bereits zwei.
Genau wie ich.
In Berts Augen schimmert ein spöttischer Glanz. »Dreißig Sekunden.«
Am Boden zerstört schnappe ich mir mein Handy und folge dem Rest des Personals in den Konferenzraum.
Monatelange Arbeit. Mein erstes Vorzeigeprojekt.
Geplatzt.
Die komplette Designabteilung – das geschlagene Dutzend – hat sich um den Tisch im Konferenzraum versammelt. Es herrscht Totenstille, und die Mienen sind finster.
Bert sieht selbstgefällig zu, ein Vampir, der sich an unserer Niedergeschlagenheit labt, dann geht er davon, vermutlich, um dafür zu sorgen, dass die übrigen Abteilungen ebenfalls daran gehindert werden, irgendetwas Produktives zu leisten.
Am gegenüberliegenden Ende des Tisches wird getuschelt, und ich kann die Worte deutlich hören: Ich muss hier raus und Scheiß drauf.
Vor der Wycliff-pokalypse war SportyGoCo der allerbeste Ort zum Arbeiten.
Es geht das Gerücht um, sie würden das Unternehmen schließen, wenn sich unsere Verkaufszahlen nicht binnen Wochen bessern.
Der Lautsprecher knistert. Wir haben schon öfter solche Ansprachen gehört – sie sind lächerlich und grotesk. Irgendein alter Knacker, der den Klang seiner eigenen Stimme liebt, und man soll wohl auch noch dankbar dafür sein.
»Wir haben dieses Unternehmen aufgebaut, und wir können es retten. Wir sind eine Familie«, sage ich.
Keine Reaktion.
Die Leute wirken einfach nur mutlos.
Mein Herz krampft sich zusammen. Diese Truppe hier hat mir öfter den Arsch gerettet, als ich zählen kann, vor allem als ich damals neu in die Stadt kam, naiv und verwirrt. Und als klar wurde, dass ich als Schauspielerin nie wirklich meinen Lebensunterhalt verdienen würde, haben sie mir geholfen, meine Leidenschaft für coole Klamotten zu einem Beruf zu machen.
Abgesehen von Bert würde mir jeder dieser Menschen sein letztes Hemd schenken, und ich würde ihnen meins geben.
Oder besser gesagt, ich würde eines nähen, das noch besser ist, mit Pailletten und Glitzer, und ihnen das geben.
»Eine neue Generation übernimmt das Ruder«, sage ich. »Vielleicht ist das eine gute Neuigkeit. Vielleicht macht die jüngere Generation alles besser.«
»Ja, das hat in Nordkorea auch großartig funktioniert«, meint Shondrella. »Oh, Moment mal, ähm …«
»Ein milliardenschwerer europäischer Rennwagenfahrer«, murmelt Lacey auf unserer Seite des Tisches. »Ich meine, ernsthaft?«
»Es spielt keine Rolle, wer diesen Laden führt«, bemerkt Renata. »Diese Art von Menschen besitzen so viele Unternehmen, dass sie nicht mal all deren Namen kennen. Es wird sich nichts ändern.«
»Aber wir haben immer noch die Unicorn Wonderbag«, erkläre ich. »Wir werden an Wonderbag arbeiten, und alles wird sich fügen.«
Wieder knistert der Lautsprecher. Ein Mann kündigt an, dass es eine Ankündigung geben werde. Er redet darüber, wie gut es sei, in Zeiten von Turbulenzen eine ruhige Hand zu haben.
»Welche Turbulenzen?«, brummt jemand. »Es gibt so viele.«
»Wer behält da schon den Überblick?«, witzelt jemand anderer.
Die Stimme im Lautsprecher spricht über die Firmengeschichte und stellt schließlich Jaxon Harcourt Eadsburg von Henningsly vor. Bei dem fünfteiligen Namen verdrehen etliche Anwesende die Augen.
Jaxon Harcourt Eadsburg von Henningsly, unser furchtloser neuer Anführer, beginnt seine Ansprache in einem wunderschönen Bariton. Ein Jammer, dass die Dinge, die diese wunderschöne Stimme sagt, genauso schwülstig und lächerlich sind wie alle anderen Ansprachen der milliardenschweren Wycliff-Eigentümer – oder »Würggriff«-Eigentümer, wie wir unseren Mutterkonzern gern nennen.
Ich verliere allen Mut, als der Sohn Phrasen drischt wie: »Im Angesicht von Widrigkeiten tapfer weiterkämpfen« und »Nicht verzweifeln, sondern mutig in die Zukunft blicken.«
Damals, als das böse, gesichtslose Wycliff-Unternehmen die Führung an sich gerissen und angefangen hat, diese lächerlichen Ansprachen zu halten, haben die Leute Gesten gemacht, als wollten sie sich einen Finger in den Hals stecken oder sich selbst erdolchen.
Und ich sah sie tadelnd an, weil ich inzwischen die Dienstälteste war, die Mutter der Designabteilung.
Jetzt machen sie sich nicht einmal mehr die Mühe mit solchen Gesten. So mutlos sind wir alle geworden.
Im wirklichen Leben bin ich nicht so ernst oder mütterlich. Zu Hause kann ich mit meinen Freundinnen albern sein, aber eine Sache ändert sich nie, und das ist meine Arbeitsmoral. Ich möchte immer etwas erreichen, sei es, dass ich Videos von unserem Wohnhaus drehe oder eine kleine Rolle in einer der Wochenendaufführungen meiner Freunde spiele oder Mahlzeiten zubereite oder diese Firma und meine Karriere als Modedesignerin rette.
Professionalität ist ein Muskel, den jeder aufbauen kann – das behaupte ich immer. Tu so, als ob. Nicht wahr? Aber ich sorge immer dafür, dass ich irgendetwas Glitzerndes trage, eine Anstecknadel oder einen Gürtel oder eine Verzierung am Schuh.
Jaxon Was-auch-immer von Henningsly labert weiter darüber, dass er die Führung fortsetzen werde, die wir zu respektieren und zu bewundern gelernt hätten.
Ich kann förmlich spüren, wie die Arbeitsmoral in die Tiefe saust, wie tausend Ambosse von tausend Road-Runner-Klippen. Ein weiterer ätzender, abgehobener Eigentümer, Welten entfernt.
Zum Fremdschämen.
Es hieß, dieser Sohn sei Europäer, aber er hat definitiv einen amerikanischen Akzent. Machen reiche Leute das so? An verschiedenen Orten leben? Ich würde niemals einfach die Zelte abbrechen und umziehen. Ein Mensch braucht Wurzeln. Er braucht seine eigenen Leute.
Er faselt weiter: »Wir werden den Blick auf eine produktive Zukunft richten, voller Stolz und Verheißung und gemeinsamem Wohlstand.«
Es ist ungeheuerlich, wenn man bedenkt, dass sie diese Firma zerstören.
Shondrella macht eine halbherzige Handbewegung, als wollte sie sich selbst abstechen. Ihre Geste sagt, warum sich überhaupt mit einer solchen Geste abmühen? Shondrella ist seit vier Jahrzehnten in der Designbranche tätig und sagt, sie habe noch nie erlebt, dass es mit einem Modehaus so schnell bergab gehe.
»Indem ich die vorbildliche Führung fortsetze …«
Ich bemerke Laceys Blick. Sie ist erschöpft. Sie sieht aus, als würde sie gleich weinen. Von uns allen hier hat sie am meisten zu verlieren.
Mit einem Mal reicht es mir. Meine Grenze ist überschritten.
Ich weiß nicht, was in mich fährt, aber ich fange an, die Worte stumm mitzusprechen, und tue so, als würde ich das sagen, was dieser selbstherrliche Sohn sagt.
»Weiterkämpfen durch dick und dünn«, äffe ich den Sprecher nach – schlecht. Ich setze eine dümmliche Miene auf.
Lacey schnaubt und schlägt sich eine Hand auf den Mund.
Tatsächlich folgt Gelächter. Das ist Musik in meinen Ohren. Wann habe ich bei SportyGoCo das letzte Mal Lachen gehört?
Ich tue noch weiter so, als würde ich die Ansprache halten, und plötzlich lachen alle. Es muss ein Schock für sie sein, dass ich bei der Arbeit meine witzige Seite zeige, denn das ist ganz untypisch für mich.
Trotzdem. Ich habe schon zu lange kein Lachen mehr in diesem Büro gehört. Es ist, als würden Leben und Kameradschaft in die Menschen zurückströmen. Ich schaue zu der geschlossenen Tür. Nun, was schadet es, mit etwas Albernheit die Moral zu stärken, um das verheerende Target-Debakel von heute zu mildern?
Der Sohn labert weiter.
Ich recke den Zeigefinger in die Luft und wackle mit dem Kopf. Es ist dämlich, aber wen schert das? Die Ansprache ist dämlich! Ich schneide eine Grimasse und klappere mit dem Kiefer.
Die anderen lachen. Shondrella wälzt sich praktisch auf dem Boden.
Es ist fast traurig, als der Schickimicki-Eigentümer seinen Schickimicki-Konferenzanruf beendet.
Das Team sieht noch immer mich an, und die Leute wollen mehr. Also mache ich weiter, äffe den Typen jetzt unverhohlen nach und sage all die Dinge, die mir einfallen, die reiche Leute sagen würden. »Außerdem werde ich jedem Büro ein Glas Grey-Poupon-Senf schicken, als Belohnung dafür, dass Sie so tapfer weiterkämpfen!« Ich lasse nun endgültig meine innere Schauspielerin heraus, bis hin zu dem Bariton.
»Drücken Sie bitte die Schultern durch und putzen Sie alles Widrige hinfort, so wie ich mir die Zähne mit meiner silbernen Zahnbürste putze!« Ich habe eine alberne Aussprache hinzugefügt. Der Sohn hat eine ganz nette Stimme, aber der Vater hatte die typische Aussprache der Oberschicht, und die ist lustiger.
»Bitte, verzweifeln Sie nicht«, fahre ich fort. »Ich werde in der Tat die schlimmsten Führungspersonen für Sie engagieren, und nicht einmal das wird Sie daran hindern, vortrefflich zu sein.« Ich sehe mich gründlich um. »Moment mal, wo ist mein Grey Poupon? Ich bin Milliardär, ich brauche meinen Grey Poupon!«
Es ist total bescheuert, aber die Kollegen lachen sich schlapp. Dave liegt rücklings auf dem Konferenztisch vor Lachen.
Ich zermartere mir das Hirn auf der Suche nach weiteren Dingen, die reiche Menschen sagen würden. »Bringen Sie mir bitte mein silbernes, diamantenbesetztes Nasenhaargerät. Ich werde dieses Unternehmen durch dick und dünn führen, aber nicht ohne mein Nasenhaargerät!«
Renata schlägt mir auf die Schulter. »Was ist das überhaupt?«
Ich habe keine Ahnung, aber das hält mich nicht auf. »Still, Gesindel!«
Sie schlägt mich abermals – kräftig. An den Wochenenden macht sie bei einer Rockabilly-Roller-Derby-Mannschaft mit und ist stärker, als ihr bewusst ist.
»Schnell, holen Sie die Dienstboten, ich brauche jetzt etwas Riechsalz. Wo ist mein Halstuch? Wo ist mein fescher seidener Krawattenschal?«
Ich spüre förmlich das Zusammengehörigkeitsgefühl in dem Gelächter. Ich kann die Liebe spüren, die Kameradschaft. Deshalb sind wir geblieben. Wir sind eine Familie.
»Wenn ich meinen feschen Ascot 3000 nicht im NASCAR-Rennen fahren kann, werde ich wirklich verzweifeln!«, fahre ich fort.
»Was ist ein fescher Ascot 3000?«, fragt Lacey.
»Das ist ein Rennwagen«, verkünde ich dramatisch. »Damit werde ich zum gemeinschaftlichen Erfolg brausen.«
In dem Moment dröhnt eine Stimme durch den Lautsprecher. »Was zur Hölle?«
Wir erstarren.
Die Stimme gehört Jaxon Harcourt Eadsburg von Henningsly.
»Ich weiß nicht, was da los ist«, sagt jemand im Umfeld des Eigentümers.
»Scheiße!«, flüstert Dave in einem Ton, der fast ein Brüllen ist, als er sich auf den Tisch stürzt und auf die Tasten der Telefonanlage schlägt.
Keiner von uns rührt sich. Wir sind ein Konferenzraum voller Salzsäulen.
»Ist das wirklich gerade passiert?«, wispert Renata, fast ohne die Lippen zu bewegen. »Denn ich glaube, das war der neue Eigentümer.«
Ich schlucke. Kein Laut ertönt, und außer dem Summen in meinen Ohren ist da nur das schreckliche Schweigen aller anderen.
»Ich muss mich auf die Freisprechtaste gesetzt haben, als ich auf dem Tisch gelegen habe«, murmelt Dave.
»Moment mal! Es ist alles gut!«, sagt Lacey. »Das ist nicht über die ganze Firma gelaufen. Ganz bestimmt nicht.«
»Oh, wunderbar, nur der Eigentümer und seine Leute haben es gehört«, bemerkt Dave.
»Es tut mir so leid«, melde ich mich zu Wort.
»Wir haben alle gelacht«, sagt Renata. »Wir sitzen alle in der Tinte.«
Zwei Dutzend Augen richten sich auf die Tür. Bert wird davon hören und jeden Moment hereinkommen, um jemanden zu entlassen.
»Wir sind dermaßen am Arsch«, stellt jemand fest.
»Ich werde gestehen«, sage ich. »Ich werde alle Schuld auf mich nehmen. Ich werde nicht zulassen, dass einer von euch dafür den Kopf verliert.«
»Nein, hör zu«, schaltet Lacey sich ein. »Sie können uns das nicht anhängen – so funktioniert dieses Telefonsystem nicht.« Sie setzt sich wieder – in letzter Zeit wird sie schnell müde. »Bei einem Rückruf nach Europa wird im Display die zentrale Nummer von SportyGoCo Inc. angezeigt. Sie werden nicht wissen, aus welcher Abteilung wir kommen. Es gibt zehn Abteilungen und fünfhundert Angestellte in diesem Gebäude. Sie werden niemals dahinterkommen, dass wir es waren.«
»Irgendwie werden sie es herausfinden«, widerspricht Renata. »Dieser Anruf war so typisch für uns.«
Ich schlinge die Arme um mich. »Gott, was habe ich getan?«
»Es war die witzigste Sache aller Zeiten!«, meint Renata.
»Außerdem, wirklich, diese vornehme Aussprache!«, sagt Lacey.
»Zum Teufel mit denen. Niemand hier wird etwas verraten«, erklärt Dave entschieden. »Wir geben dir Rückendeckung, Jada.«
»Ein Pakt!«, ruft Renata. »Ein feierlicher Pakt. Wir werden das niemals ausplaudern. Es wird nie diesen Konferenzraum verlassen, dass es Jada war.«
Ich stöhne.
Shondrella legt noch nach. »Du bist immer so professionell und positiv, dass Bert es niemals erraten wird. Niemand hier wird etwas sagen. Und niemand dort wird darauf kommen – verstanden?«
»Wir brauchen einfach nur gar nichts zu tun«, erinnert Renata alle. Sie holt ihren blutroten Lippenstift hervor und trägt eine schöne dicke Schicht auf. »Es wird sie verrückt machen. Es wird ein Riesenspaß werden.« Sie drückt die Verschlusskappe auf den kleinen Stift, und es klingt wie ein Satzzeichen.
4
Jaxon
Die PR-Leute sind überglücklich über die Ansprache; alle sind glücklich – sogar Arnold und Charley.
Barclay sieht dem Ganzen billigend zu und denkt vielleicht, dass der missratene Sohn beschlossen habe, sich zu ändern und so zu tun, als wäre er artig.
Weil man sich niemals anmerken lassen will, dass einem etwas nahegeht, starre ich auf mein Handy und scrolle durch einen Haufen Nichts, aber in Wirklichkeit würde ich mir am liebsten Eispickel durch die Ohren rammen. Einen für jedes Ohr, und sie sollten vorzugsweise in den Teil meines Gehirns eindringen, der für die Erinnerung zuständig ist. Oder vielleicht würde eine gute, altmodische präfrontale Lobotomie es auch tun.
Es ist wieder genau wie bei diesem Foto auf dem Rasen in Türenbourg.
Ein einziger Moment der Schwäche. Ich hätte dem hier nicht zustimmen sollen – nichts von alledem. Mich derart in die Enge treiben zu lassen.
Plötzlich schaltet sich der Feed mit einer Reihe von Klicks und einem aus Übersee stammenden Klingelton wieder ein. Stimmen plärren aus dem Lautsprecher.
Vor allem die Stimme einer Frau.
»Drücken Sie bitte die Schultern durch und putzen Sie alles Widrige fort, so wie ich mir die Zähne mit meiner silbernen Zahnbürste putze!«
Barclay schaut sich verwirrt im Raum um.
Die Stimme schwafelt etwas von Grey Poupon. Macht da irgendjemand eine Comedy-Nummer aus meiner Ansprache?
Die Stimme imitiert nun eine hochgestochene Aussprache und redet immer weiter.
»Schnell, holen Sie die Dienstboten, ich brauche jetzt etwas Riechsalz. Wo ist mein Halstuch? Wo ist mein fescher seidener Krawattenschal? Wenn ich meinen feschen Ascot 3000 nicht im NASCAR-Rennen fahren kann, werde ich wirklich verzweifeln!«
»Was zur Hölle?«, sage ich.
»Ich weiß nicht, was da los ist.« Barclay schlägt auf Tasten auf dem Telefon, während die Stimme weiterredet. Es ist beinahe eine außerkörperliche Erfahrung. »Es scheint eine Telefonnummer in den USA zu sein.«
Arnold zieht einfach den Stecker aus dem ganzen System.
Totenstille.
Man starrt mich an und wartet ab, was ich tun werde. Man starrt mich ständig an und fragt sich, welche schrecklichen Dinge ich tun werde.
Schließlich fühle ich mich wieder wie ich selbst.
Arnold versucht es mit einem zaghaften Lächeln. »Ein wenig Ausgelassenheit«, murmelt er.
Barclay tut die spottenden Stimmen mit einer Handbewegung ab. »Ihr Anruf war ein großer Erfolg. Ich bekomme jetzt bereits Mitteilungen und SMS, in denen man Ihnen gratuliert und sich bei Ihnen bedankt.«
Ich bekomme besagte Mitteilungen und SMS gezeigt, und es scheint, als wäre die ganze Welt von meiner Rede begeistert.
Bis auf die Grey-Poupon-Frau.
Charley steht auf. »Was mich betrifft, ich bin reif für einen Cocktail.«
»Ich auch«, erkläre ich.
»Und was die Person betrifft, die dafür verantwortlich ist, sie wird natürlich aufgespürt und fristlos entlassen werden«, beteuert Barclay.
»Nicht nötig. Ich werde mich selbst darum kümmern«, stelle ich fest.
Alle sehen mich verblüfft an.
»Was?«, fragt Charley.
»Finden Sie heraus, wer es ist. Danach werde ich die Sache selbst in die Hand nehmen«, füge ich hinzu.
»Wie meinen Sie das?«, fragt Barclay.
»Ich meine, identifizieren Sie die Person und berichten Sie mir, um wen es sich handelt«, verlange ich. »Und ich werde mich dann um die Bestrafung kümmern.«
Charley wirkt verwirrt. »Was hast du vor?«
»Wonach mir verdammt noch mal der Sinn steht«, antworte ich lässig.
»Das war zweifellos und eindeutig Insubordination«, urteilt Barclay nervös. »Irregeleitet, wenn nicht gar zutiefst beleidigend, daran besteht kein Zweifel. Aber so weit zu gehen, sie persönlich zu feuern …«
»Ich habe nicht gesagt, dass ich sie feuern würde«, unterbreche ich ihn.
Barclay wirkt erleichtert.
»Ich sagte, ich würde sie bestrafen. Vielleicht lasse ich sie strecken und vierteilen. Vielleicht hänge ich sie an den Daumen auf. Und dann wäre da immer noch das Becken mit den Piranhas. Es gibt viele Methoden, jemanden zu vernichten. Besorgen Sie mir einen Namen, Barclay.« Ich gehe zur Tür hinaus.
Charley holt mich ein. »Komm schon«, sagt er.
Ich werfe ihm einen Blick zu und gehe weiter.
»Du bekommst den Namen und was dann? Du wirst doch diese arme Frau nicht wirklich vernichten?«
»Warum nicht?«, entgegne ich. »Mein Terminkalender ist noch ziemlich leer.«
»Reicht es nicht, dass jeder hier auf dem Kontinent dich hasst? Musst du auch noch Streit mit den Amerikanern suchen? Hör doch mal, wie du klingst, Jaxon. Es wäre verabscheuungswürdig, gegen diese Frau vorzugehen!«
»Das brauchst du mir nicht auszureden, Charley, mein Entschluss steht fest.«
Er schnaubt. »Du trauerst, Jaxon. Kleinliche Ablenkungen wie diese werden deinen Schmerz nicht lindern.«
»Wenn man bedenkt, dass meine Trauer gleich null ist, kann der Schmerz dann weniger sein als null?«, frage ich ihn. »Wäre eine negative Bezifferung des Schmerzes gleichbedeutend mit Vergnügen? Wie dem auch sei, es war immer eins meiner Lieblingshobbys, den Namen meiner Familie durch den Schmutz zu ziehen. Ich kann Wycliff zwar noch nicht mit der Axt angreifen, aber das hier funktioniert erst mal.«
»Denk darüber nach, was du tust. Kannst du nicht einfach sagen: ›Wen schert diese x-beliebige sarkastische Person? Ich werde mein eigenes Leben leben‹?«
»Und wo genau bliebe da der Spaß?«
Sein Mund verzieht sich zu einer grimmigen Linie.
5
Jada
Ich kauere in meiner Arbeitsnische gegenüber der von Renata. »Was habe ich mir bloß dabei gedacht!«, murmle ich. »Was …«
»Hör auf damit«, befiehlt Renata und richtet das gepunktete Band um ihr pechschwarzes Haar. »Nie im Leben wird Bert es aus irgendjemandem herauslocken. Was im Konferenzraum passiert, bleibt im Konferenzraum.«
Ich lasse mich tiefer auf meinen Stuhl sinken und tippe meine E-Mail an die Fabrik, in der ich erkläre, dass die Lieferung sich verzögert, und ich sie anflehe, das Angebot für Target zu beschleunigen. Sie werden auf keinen Fall Ja dazu sagen, aber versuchen muss ich es wenigstens.
»Es wird ihn auf die Palme treiben«, bemerkt Renata. »Es wird Spaß machen und überaus unterhaltsam sein, ihn schäumen zu sehen.«
»Es sei denn, er kündigt uns allen.«
»Du hast Lacey gehört. Er kann nicht wissen, dass es diese Abteilung war.«
»Er wird es vermuten«, kontere ich. »So ein Verhalten passt sehr gut zu der Designabteilung.«
»Oder zum Marketing«, ruft sie mir ins Gedächtnis, dann verzieht sie das Gesicht. »Nur dass es im Marketing Petzen gibt und bei uns nicht. Aber hey! Lass ihn ruhig vermuten. Außerdem arbeitest du viel zu hart. Es hat Spaß gemacht, einmal deine alberne Seite zu sehen.«
»Meine alberne Seite hat bei der Arbeit nichts zu suchen, erst recht nicht jetzt, da ich Chefdesignerin bin. Aber wart’s ab. Ich gehe keine weiteren dummen Risiken ein. Ich werde von jetzt an zu tausend Prozent professionell sein.«
»Du bist professionell.«
Was Renata nicht begreift, ist, dass man, wenn man winzig und blond ist, doppelt so professionell sein muss wie die Kollegen, wenn man ernst genommen werden will. »Tausend Prozent professionell. Kein Herumalbern mehr.«
»Jeder weiß, dass dieser Laden ohne dich zusammenbrechen würde. Die meisten Leute hätten an deiner Stelle den Job bei deiner Freundin mit der Schaufenstergestaltung angenommen. Sie wären gegangen, ohne noch mal zurückzublicken.«
»Du nicht.«
»Für einen solchen Merchandising-Job? Machst du Witze? Weißt du, man sollte ein sinkendes Schiff verlassen. Das wird allgemein empfohlen.«
»Ich werde es niemals verlassen«, verkünde ich und schicke die E-Mail ab.
»Bert-Alarm«, murmelt Dave im Vorbeigehen.
Ich halte ihn am Handgelenk fest, und er bleibt wie angewurzelt stehen. »Lacey ist im Pausenraum.«
»Ich kümmere mich drum.«
Laceys schreckliche Erschöpfung treibt sie dazu, am späten Nachmittag ein Nickerchen zu brauchen. Die Ärzte sagen, es sei alles in Ordnung mit ihr, aber wir wissen es besser, und wir arbeiten zusammen, um ihr Ruhepausen zu ermöglichen.
»Folgendes«, erklärt Bert, der im vorderen Teil des Raums steht, mit zornig geröteten Wangen unter seinem graumelierten Bürstenschnitt. »Wir wissen, dass es jemand aus dieser Abteilung war. Jeder Einzelne von Ihnen wird wegen Insubordination gefeuert, wenn ich nicht den Namen der Person bekomme, die das getan hat.«
Ich verstecke mein Handy unter dem Schreibtisch und schicke Renata eine Nachricht.
Jada: Ich muss mich stellen.
Renata: Er blufft nur. Er muss einfach bluffen.
Jada: Und wenn er nicht blufft?
Renata: TU ES NICHT.
Shondrella steht auf. Sie ist eine elegante Mittfünfzigerin, eine Veteranin der Modebranche mit einer weißen Strähne vorn in ihrem pechschwarzen Haar und Beziehungen überall in der Stadt. »Können Sie uns ein paar mehr Details nennen? Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden.«
Bert beäugt sie argwöhnisch. »Nach der Firmenansprache hat es einen versehentlichen Rückruf gegeben, bei dem man gehört hat, wie sich Mitarbeitende über Mr von Henningsly lustig gemacht haben. Nachdem der offizielle Anruf beendet war, haben sie ihn durch den Kakao gezogen. Ich versichere Ihnen, dass er nicht amüsiert ist. Er hat persönlich um Informationen gebeten.« Bert schaut auf seine Armbanduhr. »Sie haben genau eine Minute, um mir einen Namen zu nennen, sonst fange ich mit meinem Hausputz an.«
Mein Herz hämmert. Ich muss es tun. Ich spüre Renatas Blick auf mir, ihr berühmtes, warnendes Stirnrunzeln. Wage es nicht – sagt der finstere Blick.
»Ist das Gespräch aufgezeichnet worden?«, fragt Shondrella. »Wenn wir die Aufnahme hören könnten, könnten wir die Stimmen vielleicht identifizieren.«
Genial von Shondrella, dass sie versucht herauszufinden, ob sie eine Aufnahme haben.
»Dreißig Sekunden«, sagt Bert.
Eine Nachricht unter meinem Schreibtisch.
RENATA: NEIIIIIIIIIIN
Ich stehe auf. Ich muss ein Geständnis ablegen.
Bert mustert mich streng. »Jada?«
Lacey kommt zu mir herübergeschlendert, legt beiläufig ihr Handy auf meinen Schreibtisch und tippt mit einem langen, rosa lackierten Fingernagel auf das Display. Ich schaue hinab und sehe eine Nachricht von Bruce aus der Versandabteilung.
Bruce: Er sagt jeder Abteilung, dass er weiß, dass sie es waren. REINER BLUFF.
»Jada?«, blafft Bert.
Ich schlucke. »Warum hätten wir nach dem Anruf noch hierbleiben und rumalbern sollen, obwohl wir diesen Zweiteiler fertigstellen mussten?«
Bert kommt auf mich zu. »Ist das Insubordination? Ist es das?«
Ich straffe mich. »Ich weise nur darauf hin …«
Er sieht mir für eine unbehaglich lange Zeit in die Augen, und ich erwidere seinen Blick, ganz verwirrt und besorgt. Weiß er, dass ich im Begriff war, ein Geständnis abzulegen? Manchmal habe ich das Gefühl, als hätte er böse hellseherische Fähigkeiten. »Wir werden die Ohren offen halten«, piepse ich.
»Sie werden die Ohren offen halten, ja?«, wiederholt er.
Ich schenke ihm ein höfliches Lächeln. »Jepp.«
»Niemand?« Bert sieht sich um.
Es folgt weiteres Schweigen.
»Letzte Chance.« Er richtet den Blick auf Lacey, die aussieht, als wäre sie gerade aufgewacht. Mit ihren beiden Abmahnungen und ihren gesundheitlichen Problemen ist sie verletzlich, und er weiß es. Natürlich würde jeder, der hilft, mich zu enttarnen, eine Belohnung bekommen.
Lacey schüttelt den Kopf.
»Was denken Sie, würde passieren, wenn ich die Aufnahme für eine Stimmenanalyse zu einem Labor schicken würde? Werde ich herausfinden, dass es jemand aus dieser Abteilung war? Werde ich herausfinden, dass Sie alle genau wissen, wer es war, und sich weigern, es mir zu verraten?« Er schlendert durch den Raum und sieht uns der Reihe nach an. »Sie sollten besser hoffen, dass ich das nicht tun werde.« Er hält inne, damit die Worte zu allen durchdringen, dann geht er.
»Nie im Leben hat der eine Aufzeichnung«, murmelt jemand. Mehrere Personen stimmen ihm zu. Auf keinen Fall.
»Selbst wenn er eine hat«, überlegt Renata laut. »Hier arbeiten Hundert Frauen. Würde er von jedem von uns Stimmproben nehmen? So ein Quatsch.«
»Gott, es tut mir so leid!« Ich lasse mich auf meinen Stuhl sinken. »Von jetzt an werde ich mich nur noch ums Geschäftliche kümmern. Ich werde todernst sein!«
»Mensch, das war es wert!«, sagt Dave.
»Ja, Bert so abgehen zu sehen?« Shondrella lacht. »Unbezahlbar.«
»Die Familie«, erklärt Renata, indem sie den Paten imitiert. »Legst du dich mit einem von uns an, legst du dich mit allen an.«
»Das hat niemand je im Paten gesagt«, bemerkt Dave.
»Vielleicht hätte es gesagt werden sollen«, kontert Renata. »Jedenfalls gilt das in unserer Familie.«
6
Jaxon
Vier Wochen später: London
Arbeiter huschen umher und packen alles aus der Londoner Residenz meiner Eltern zusammen. Charley hat sich auf einem unbezahlbaren Sofa breitgemacht und überlegt, es in eine seiner Residenzen bringen zu lassen. Arnold kommt mit einem großen gerahmten Foto herein.
»Christie’s«, entscheide ich.
»Jaxon, nein!«, ruft Charley. »Es ist der erste signierte Druck. Eine Danbery-Ikone. Und sieh dir an, wie glücklich du da bist!«
Ich betrachte mit funkelndem Blick das Foto, das die Welt genarrt hat, aufgenommen von einem prominenten Fotografen, den meine Eltern für viel Geld engagiert hatten. Mom, Dad und ich auf einer Picknickdecke, und wir lächeln alle drei in die Welt hinaus. Der reichste kleine Richie-Rich-Junge mit seinen hingebungsvollen Eltern, das prachtvoll gepflegte Grundstück unserer Türenbourg-Burg im Hintergrund.
Total verlogen.
Arnold kommt mit einem Original-Ölgemälde meiner Eltern in ihren besten Jahren herein.
»Christie’s«, lautet auch diesmal mein Urteil.
»Behalt es wenigstens für deine Kinder«, schlägt Charley vor und steht vom Sofa auf.
»Als würde ich diesen Von-Henningsly-Bullshit einer weiteren Generation aufbürden.«
»Merk dir meine Worte, eines Tages wirst du eine Familie wollen.«
Ich deute auf das Gemälde. »Christie’s.«
Charley glaubt immer noch an das Märchen. Seine ganze Familie tut es, eine Tatsache, die ich im Laufe der vielen Weihnachtsfeste bezeugt habe, die ich dort verbracht habe. Immer lachen sie, klammern sich aneinander und erschaffen ihre eigenen Traditionen. Sie setzen Weihnachten eine alte Dolly-Parton-Puppe auf die Baumspitze und führen dann einen Tanz zu dem Lied »We are the Champions« auf. Am ersten Weihnachtstag sehen sie sich immer Gruselfilme an und kuscheln sich dabei eng aneinander. Die lächerlichen Legenden und Traditionen, die sie im Laufe der Jahre entwickelt haben, scheinen diese Illusion von Zusammengehörigkeit erschaffen zu haben, an die sie sich klammern.
Wer kann ihnen einen Vorwurf daraus machen? Man wird allein geboren, und man stirbt allein. Es ist nicht leicht, sich dieser Wahrheit zu stellen.
Charley seufzt und lehnt sich an eine Wand in der Nähe, während er beobachtet, wie Arnold das Porträt für die Versteigerung in eine Kiste packt. »Übrigens, herzlichen Glückwunsch, dass du die Aktienkurse wieder in die Höhe getrieben hast«, sagt er. »Aber dieser aufgeblasene Redenschreiber …«
»Nie wieder«, verkünde ich. »Du kannst mich erschießen, wenn ich jemals wieder so klinge wie mein Vater.«
»Wirst du Wycliff jetzt verkaufen?«
»Irgendwann, ja. Zuerst muss ich immer noch diese Frau vernichten, die sich auf die Lautsprechertaste gesetzt hat.«
»Was?« Charley stößt sich von der Wand ab und richtet sich auf. »Ich dachte, du hättest diese ganze schmutzige Sache fallen lassen.«
»Natürlich nicht. Dem Management ist es nicht gelungen, die Missetäterin zu identifizieren, daher werde ich die Ermittlung jetzt selbst in die Hand nehmen. Ich werde dort unter einer falschen Identität eine Stelle antreten und die Schuldige selbst finden.«
Charley blinzelt mich verwirrt an. »Eine Stelle?«
»Eine Stelle in dem Unternehmen«, erkläre ich. »Einen Job. Wenn man will, dass eine Sache richtig gemacht wird, muss man sie, wie es scheint, selbst machen. Ich lasse Soto das Ganze arrangieren.« Mr Soto ist meine rechte Hand. Barclay, der Assistent meiner Eltern, hat kurz nach dem Konferenzgespräch gekündigt.
»Das ist doch Wahnsinn«, protestiert Charley. »Du kannst keinen Job annehmen.«
»Warum nicht?«, gebe ich zurück.
Er starrt mich an, als könne er die Frage nicht begreifen. »Vergiss das Unternehmen. Komm mit raus zu meiner Villa, Jaxon. Da kannst du den Kopf frei kriegen. Der Verlust beider Eltern ist etwas Gewaltiges, ob du es zugibst oder nicht.«
»Soto hat mir bereits eine Stelle verschafft. Bürohelfer beziehungsweise Versandassistent. Ich werde undercover dort arbeiten.« Ich grinse. »Was sagst du dazu?«
»Dass du nicht klar denken kannst«, antwortet Charley. »Du hast keine Ahnung, wie ein Büro funktioniert. Du besitzt keine wirklichen Qualifikationen. Du hattest in deinem ganzen Leben noch nie einen Job.«
»Das ist nicht wahr«, widerspreche ich. »Ich hatte einen Job.«
»Motorsport ist etwas anderes als ein Job«, sagt er.
»Wie meinst du das? Ich habe ein Team aufgebaut und bin zu einer festgelegten Zeit aufgetaucht, um meine festgelegte Aufgabe zu erfüllen.«
Die Leute dachten, ich hätte nicht genug Disziplin, um Fahrer für ein Formel-1-Team zu werden. Ich wäre zu wild, zu hitzköpfig, nicht diszipliniert genug für die langen Stunden auf der Bahn und im Fitnessstudio, aber ich habe bewiesen, dass sie unrecht hatten.
»Sie haben dich wegen einer tätlichen Auseinandersetzung rausgeworfen«, ruft Charley mir ins Gedächtnis.
»Gundrun hat es verdient«, antworte ich.
»Viele Leute verdienen es. Wenn du in irgendein Büro gehst, wirst du einen Haufen Leute finden, die Prügel verdienen. Du wirst vielleicht am Ende einen Boss abkriegen, der es verdient, ein wenig zurechtgestutzt zu werden, aber weißt du was? Du wirst dasitzen und lächeln müssen. Prügeleien verboten. Du wirst das keinen Tag lang aushalten.«
»So wenig Vertrauen. Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, ziehe ich es normalerweise durch«, stelle ich fest.
»Ein Büroangestellter? Die Leute sind nicht dumm, Jaxon …«
»Ich gehe ja nicht dorthin, um zu arbeiten. Ich werde mich unters Volk mischen, bis ich meine Antwort habe.«
»Und was ist, wenn dich jemand erkennt? Dein Foto ist überall. Auch Amerikaner haben eine Klatschpresse, weißt du.«
»Ich bin nicht jemand, den die amerikanische Klatschpresse im Auge behält. Den amerikanischen Boulevardzeitungen geht es mehr um Filmstars und britische Royals, nicht um unbedeutende Promis vom europäischen Festland. Sie denken wahrscheinlich, der Grand Prix sei ein Radrennen.«
»Formel-1-Rennen werden dort drüben immer populärer.«
»Nun, sie haben sich vor zehn Jahren noch nicht dafür interessiert«, wende ich ein. »Ich bin eine historische Gestalt. Ich bin ein Herbert Plumer.«
»Der Clip von der Prügelei wird immer noch geteilt.«
»Niemand sieht sich da mein Gesicht an, nur den großartigen und wohlverdienten linken Haken.«
»Du hast streckenweise in Manhattan gelebt und kennst da immer noch Leute.«
»Ich bin nicht mehr dort gewesen, seit ich zwölf war. Du wirst mir das nicht ausreden.«
»New York ist eine internationale Stadt. Du kannst mir nicht erzählen, sie sei nicht international. Du brauchst nur eine einzige Person zu erwischen, die Zeit in den Nachtclubs von Monte Carlo verbracht hat, dann hast du ein Rudel Paparazzi am Hals.«
Das gibt mir tatsächlich zu denken. Als Arnold das nächste Mal vorbeikommt, instruiere ich ihn, nach jemandem zu schicken, der mein Aussehen verändern kann.
»So habe ich das nicht gemeint«, murmelt Charley gedehnt und unglücklich.
Einige Stunden später taucht eine Maskenbildnerin namens Bev auf. Sie schlägt einen neuen Haarschnitt mit Mittelscheitel vor.
»Ich will eine Verkleidung, nicht bloß eine neue Frisur – ich bin ein Amerikaner, der einen Mindestlohnjob macht.« Auf der Suche nach typisch amerikanischen Haarschnitten finde ich mich schon bald auf einer Website wieder, die Sav-R-Mart Fashion Fails heißt. »Da haben wir’s. Das hier.« Ich zeige auf ein Foto. »Geben Sie mir das da.«
»Nein, Jaxon!«, protestiert Charley.
»Das ist kein moderner Haarschnitt«, sagt Bev nervös. »Gegelte Stacheln mit gebleichten Spitzen sind seit den Neunzigern nicht mehr in.«
»Perfekt. Sie werden mir die Frisur verpassen. Außerdem will ich auch diese getönte rechteckige Brille und das kurzärmlige Hemd. Was ist das überhaupt für ein Hemd? Tragen Männer so was wirklich?«
Arnold kommt mit einem weiteren Erbstück zurück, das ich nicht haben will. Er späht auf den Bildschirm. »Ist das ein Hawaiihemd?«
Bev schaut ebenfalls hin. »Nein, auf Hawaiihemden sind Blumen. Das da würde ich als Partyboyhemd aus den Neunzigern bezeichnen.«
Ich sehe genauer hin. Es ist ein neonblaues Oberhemd mit Unmengen pinkfarbener und gelber Dreiecke und Kringeln darauf.
»Besorgen Sie mir solche Hemden.«
Angestellte werden in Läden geschickt. Ich nehme Platz und weise Bev an loszulegen.
Mit zitternden Händen drapiert sie einen Umhang über meine Schultern und hält dann inne. Sie wirkt besorgt.
»Was ist los?«, frage ich.
»Die Spitzen Ihrer Haare zu bleichen, Mr Henningsly … Ich würde es nicht empfehlen.«
»Umso besser. Tun Sie es«, verlange ich.
»Ich möchte Sie einfach nur wissen lassen, dass ich davon abrate.«
»Werden wir noch irgendwann in diesem Jahrhundert anfangen?«
Eine Stunde später ist die Frisur komplett. Bev tritt zurück und sieht mich unsicher an. »Es tut mir leid, aber das ist das, worum Sie gebeten haben«, murmelt sie.
Charley lacht nur. »Hilfe! Ich habe *NSYNC-Flashbacks!«
Bev reicht mir einen Spiegel. Ich sehe wie ein anderer Mensch aus – beinahe. »Ich bin begeistert.«
Bev grinst überrascht.
»Aber das reicht nicht. Sie schminken Leute fürs Theater. Haben Sie künstliche Narben oder so was, die ich ausprobieren kann?«
»Darf ich vorschlagen, dass du lieber eine andere bizarre und verstörende Marotte anprobierst?«, fragt Charley.
»Wir können Ihnen noch etwas geben.« Bev stöbert in ihren Koffern und klingt jetzt etwas mutiger. »Eine Verkleidung besteht aus zwei Teilen – dem, was Sie verstecken, und dem, was Sie als Ablenkung hinzufügen. Das hier ist vielleicht etwas extrem, aber wenn Sie wirklich nicht erkannt werden wollen, müssen Sie den Leuten etwas anderes bieten, was sie ansehen können.« Sie holt ein schwarzes Ding von der Größe eines Radiergummis heraus und befestigt es an meiner Wange. »Bitte schön. Es ist ein Bühnenmuttermal, dazu gedacht, vom Publikum gesehen zu werden.« Sie tritt zurück. »Es ist etwas krass.«
Charley schüttelt nur den Kopf. »Es ist zu krass!«
»Aber es lenkt das Auge ab und gibt seinem Gesicht einen anderen Charakter.«
»Es ist nicht im Mindesten realistisch!«, sagt Charley. »Niemand hat so ein Muttermal!«
»Da haben Sie recht – niemand hat so ein Muttermal. Es ist ein Muttermal für die Bühne. Es ist nicht dazu gedacht, realistisch zu sein, aber die Leute werden es akzeptieren«, hält Bev dagegen. »Die Leute konzentrieren sich viel mehr auf sich selbst und auf die Beherrschung ihrer eigenen Reaktionen, als Ihnen vielleicht klar ist. Und wenn sie sich auf das Muttermal konzentrieren, dann um Geschichten darüber zu erfinden, die es erklären.«
»Wie die Frage, warum er es nicht hat entfernen lassen«, gibt Charley zu bedenken. »Die meisten Menschen würden es entfernen lassen.«
Ich halte den Spiegel hoch. Das Ding ist riesig und extrem, aber ich stelle fest, dass es mir gefällt. »Ich würde es nicht entfernen lassen«, knurre ich.
»Natürlich nicht«, erwidert Charley. »Du würdest ihm einen Namen geben und vorschlagen, dass es in den Ritterstand erhoben wird.«
Der Rest der Accessoires ist inzwischen geliefert worden, und ich probiere das ganze Ensemble an – die Brille von vor zwei Jahrzehnten, das unerträglich grelle Hemd. Ich wuschle mir durch die Frisur, die alle zu hassen scheinen.
»Aber irgendwie ruinieren all diese Dinge dir trotzdem nicht dein gutes Aussehen«, jammert Charley. »Sie sollten dein Aussehen stärker ruinieren.«
»Mein Aussehen ist mir scheißegal. Ich will nicht belästigt werden, das ist alles. Probieren wir’s mal aus.« Ich schnappe mir mein Handy und gehe nach unten. Wie immer, wenn ich nach draußen gehe, mache ich mich darauf gefasst, dass mir jemand auf die Pelle rückt oder versucht, ein Zitat oder ein Foto zu bekommen. Oder wenn ich einen Hut und eine Sonnenbrille trage, dass jemand meine Verkleidung als solche erkennt und versucht, sie mir mit mehr oder weniger Erfolg abzunehmen.
Auf dem Weg um den Block werde ich nicht erkannt. Manche Leute starren auf mein Muttermal und wenden dann den Blick ab. Manche betrachten mich flüchtig und gehen weiter. Ich weiß nicht, ob es an der Frisur oder der Brille, dem Oberhemd oder dem Muttermal liegt, oder vielleicht am Gesamtpaket, aber die Leute meiden meinen Blick. So etwas habe ich noch nie erlebt.
Es ist, als wäre ich … unsichtbar.
Ich schlendere weiter um den Block und genieße das Gefühl.
»Es ist großartig«, sage ich, als ich zurückkomme.
7
Jaxon
New York City
SportyGoCo belegt die drei obersten Stockwerke eines heruntergekommenen Gebäudes in einem wenig bemerkenswerten Teil des Garment Districts. Anscheinend wird dort Sportbekleidung entworfen und vermarktet, die dann in großen Läden verkauft wird. Nach einer Reihe mäßig erfolgreicher Jahre ist es mit dem Geschäftserfolg der Firma rapide bergab gegangen.
Der Himmel weiß, warum meine Eltern den Laden gekauft haben, obwohl es viel wahrscheinlicher ist, dass sie gar nicht wussten, dass sie das getan hatten. Es ist schwer zu sagen, wie viel sie mit Wycliff Inc. zu tun hatten, abgesehen davon, dass mein Vater das Unternehmen als gebanntes Publikum für seine selbstgefälligen Reden benutzte.
Ich melde mich im Personalbüro, wo ein Mann namens Derek Unterlagen und Formulare für mich bereithält, die ich mit meinem neuen Namen ausfüllen soll – Jack Smith. Er lächelt mich an, hält den Blick aber meistens auf die Formulare und Unterlagen gerichtet, um nicht auf mein Muttermal zu starren.
Verdammt genial.
Er führt mich in die Designabteilung hinauf, meinem neuen Heimatstützpunkt, setzt mich aber darüber in Kenntnis, dass man mich dort mit dem Versand teilen muss.
Perfekt. Wer immer erfolglos versucht hat herauszufinden, wer diese Telefonkomikerin war, hat die Designabteilung ganz oben auf seine Liste der Verdächtigen gesetzt, zusammen mit der Versandabteilung. Auf diese Weise werde ich Kontakt zu beiden haben.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Sache mehr als ein oder zwei Tage in Anspruch nehmen wird. Die Menschen geben mir immer, was ich will.
Man teilt mir mit, dass der CEO selbst mir eine Mappe bringen werde. Mit diesen Worten werde ich in der Designabteilung zurückgelassen, bei der es sich um einen großen Raum mit greller Beleuchtung und reihenweise Bürozellen handelt. Das Ganze wirkt wie eine Filmkulisse.
Eine Frau mit dunklem Haar und einem Outfit, das nach den Vierzigerjahren aussieht, stellt sich als Renata vor und führt mich nach hinten. Dabei erklärt sie mir Dinge über die Abteilung, aber ich höre gar nicht zu, denn der ganze Laden ist ein Meer von Bürozellen. Menschen sitzen tatsächlich in Zellen? Ich dachte, so etwas gäbe es nur im Film.
Auch der Soundtrack ist wie aus einem Film mit dem leisen Raunen von Stimmen und dem Geklapper von Tastaturen, das von leisen Pieptönen unterbrochen wird. Ist das wirklich echt?
Renata hält inne und stellt mir eine zierliche blonde Frau mit Puppengesicht vor, die wahllos Bleistifte in ihrem unordentlichen Dutt stecken hat. »Das ist Jada. Sie ist unsere Chefdesignerin.«
Jada mustert mich mit einem durchdringenden Blick und kerzengerader Haltung, um das meiste aus ihrer eher kleinen Gestalt herauszuholen. Während Renata und der Typ aus der Personalabteilung sichtliche Mühe hatten, nicht auf mein Muttermal zu starren, sieht Jada mir direkt in die Augen, als wollte sie sich ein Bild von mir machen. »Freut mich, dich hier zu haben, Jack«, begrüßt sie mich. »Wir waren ziemlich unterbesetzt – Gott sei Dank haben sie uns jemanden zum Helfen geschickt.«
Ich schnaube. »Jemand zum Helfen ist vielleicht eine übertriebene Formulierung.«
»Ha«, wirft Renata ein. »Du wirst total hilfreich sein, das weiß ich.«
»Nein, Moment mal, ich will wissen, was das bedeutet.« Jada betrachtet mich mit einer tiefen Falte zwischen den Brauen. »Vielleicht eine übertriebene Formulierung? Bist du nicht hier, um zu helfen?«
Ich betrachte sie mit einem unbeschwerten Lächeln. Also habe ich jetzt den hauseigenen humorlosen Kontrollfreak kennengelernt, denke ich.
»Nicht, wenn ich es vermeiden kann«, sage ich.
Jadas entzückendes Stirnrunzeln vertieft sich zu einem angewiderten Ausdruck mit Schmollmund. Ich sollte versuchen, weiterzugehen und den Rest der Leute kennenzulernen, aber ich bringe es nicht fertig. Es ist eine fast physische Unmöglichkeit. Sie ist genau die Art von Person, die ich nicht ausstehen kann, und sie kann mich nicht ausstehen, und das ist fantastisch.
Ich reagiere auf ihr Stirnrunzeln mit einem noch breiteren Lächeln, und ihr Verdruss ist ein herrlicher Anblick.
»Großartig. Genau das, was wir brauchen.« Sie schaut wieder auf ihren Bildschirm und tippt ärgerlich drauflos.
»Oh, ich bitte dich, ich glaube, du bist ein echter Scherzbold, Jack«, sagt Renata laut.
Jada brummt etwas Unverständliches und tippt weiter vor sich hin. Sie ist offensichtlich nicht die Telefonkomikerin, aber Renata könnte es sein.
»Dann komm mal mit.« Renata führt mich zu einer Zelle, die ein wenig hinter der von Jada liegt, und fummelt an einem Computer aus einem anderen Jahrzehnt herum. »Ich werde dich ins Intranet einloggen. Dein Benutzername ist dein Name ohne Leerzeichen, und dein Passwort ist ›passwort‹, ohne Großbuchstaben.« Sie tritt beiseite und sieht mich erwartungsvoll an. »Home sweet home.«
»Da soll ich sitzen?«, frage ich.
»Wo denn sonst?«
»Eine echte Bürozelle«, bemerke ich.
Renata lacht. »Hier bei SportyGoCo kriegen wir nur das Beste!«
»Leute!« Jada wirbelt herum und sagt etwas über irgendeinen Alarm, und dieser eine knappe, scharfe Befehl lässt das ganze Büro verstummen. Das zeugt von einer beeindruckenden Macht seitens dieser Mischung aus Spaßbremse und Kontrollfreak.
»Mach einen wachen Eindruck!«, rät Renata mir, bevor sie sich in ihre eigene Zelle in der Reihe gegenüber setzt.
Jada wirft mir einen durchdringenden Blick zu, dann dreht sie sich wieder zu ihrem Monitor um.
Jetzt fällt mir auf, dass ein Schopf dunklen, kurzen Haares am anderen Ende des Raums aufgetaucht ist, aber mehr kann ich nicht sehen, dank der Tatsache, dass ich in einer waschechten Bürozelle sitze. Der Kopf kommt näher. Schon bald tauchen ein paar Knopfaugen auf und seltsam glänzende Wangen.
Eine weitere Bürospaßbremse – das ist sofort klar.
Meine Wärterin Renata meldet sich zu Wort. »Das hier ist Jack Smith, unser neuer Bürohelfer beziehungsweise Versandassistent. Wir arbeiten ihn gerade ein. Jack, das ist dein neuer Boss, Bert Johnston, CEO von SportyGoCo.«
Bert funkelt mich und mein Muttermal auf die denkbar entnervteste Art an, als würde es ihn aktiv beleidigen. Mein neues Muttermal entzückt mich doch immer wieder.