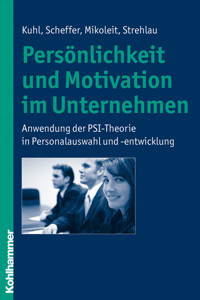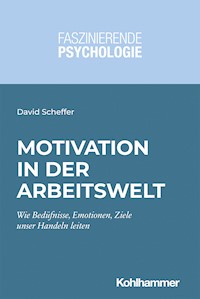
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In Zeiten großer Unsicherheit und Komplexität, bedingt u. a. durch dringliche globale Krisen, neue Produktionsformen, technologischen und demografischen Wandel, müssen sich Individuen, Unternehmen und Gesellschaften in einem nie zuvor gekannten Tempo verändern und - bestenfalls - anpassen. Dazu ist viel Motivation nötig. Die moderne empirische Motivationspsychologie wurde in gut 100 Jahren entwickelt und getestet. Sie ist in der Lage, die Initiierung von adaptiven Verhaltensänderungen zu beschreiben, zu erklären und vorherzusagen. Sie ist praxisnah, evidenzbasiert und verständlich. Über ihre Geschichte, ihre theoretische Besonderheit und ihre praktischen Leistungen will das Buch informieren und dabei die Leserinnen und Leser als Lernende einbeziehen. Der Autor beleuchtet das Phänomen Motivation aus einer empirischen Perspektive, er erklärt die wichtigsten Begriffe und verdeutlicht die Auswirkungen von Motivation immer wieder an konkreten Beispielen. Den Abschluss des Bandes bildet ein Kapitel zum Spannungsfeld von Motivation und Ethik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Prof. Dr. David Scheffer studierte Psychologie an der Universität Osnabrück und promovierte dort bei Heidi Keller und Julius Kuhl zu dem Thema »Entwicklung und Messung impliziter Motive aus einer evolutions- und persönlichkeitspsychologischen Perspektive«. Es folgte eine Tätigkeit als Wissenschaftlicher Assistent bei Ansfried Weinert im Fachbereich Personal und Organisationspsychologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Anschließend arbeitete er als Unternehmensberater und Gründer in der angewandten Psychologie. Seit 2010 ist er Professor und Studiengangsleiter für Wirtschaftspsychologie an der Nordakademie, Hochschule der Wirtschaft.
David Scheffer
Motivation in der Arbeitswelt
Wie Bedürfnisse, Motive, Emotionen und Ziele unser Handeln leiten
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-036583-4
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-036584-1
epub: ISBN 978-3-17-036585-8
Geleitwort zur Reihe »Faszinierende Psychologie«
Warum gehen manche Menschen mit Krisen besser um als andere? Wie nehmen wir etwas wahr, wie lernen wir effektiv? Wie können Unterschiede in der Persönlichkeit von Menschen beschrieben, erfasst und verstanden werden? Wie entstehen Vorurteile und Stereotype und was kann man dagegen tun? Antworten auf solche Fragen untersucht die Psychologie – eine faszinierende Wissenschaft, die sich mit dem menschlichen Erleben und Verhalten beschäftigt. Ihr vielfältiges Themenspektrum reicht von Grundlagenthemen (z. B. Entwicklung, Motivation, Persönlichkeit, Lernen) über die großen Anwendungsbereiche Gesundheit und Arbeit bis hin zu Bildung bis hin zu interdisziplinären Themen wie Forensik, künstlicher Intelligenz oder Gerontologie. Ausgangspunkt ist immer der Mensch in seinen Entwicklungsphasen und sozialen Bezügen und unter Berücksichtigung der Situationen, in denen wir uns befinden, da unser Verhalten immer eine Interaktion zwischen uns und unseren Umwelten ist. Jeder Band widmet sich einem eingegrenzten Thema (z. B. Motivation, Klinische Diagnostik, Führung), das für eine breite Leserschaft von Interesse ist, sowohl für das Studium der Psychologie und andere Studiengänge als auch für Anwendungskontexte und interdisziplinäre Arbeit. Eine große Rolle spielen auch die eingesetzten Methoden, von alltagsnahen Beobachtungen über Laborexperimente und Computersimulationen, von Interviews über Tests, Fragebögen und Tagebuchstudien bis hin zum Data Mining und Deep Learning. Die Erkenntnisse werden durch verschiedene Disziplinen gespeist (z. B. durch Pädagogik, Medizin oder Soziologie) und bereichern ihrerseits wiederum andere Fächer.
Die neue Lehrbuchreihe nimmt das Faszinosum Psychologie unter die Lupe: Die Bände greifen spannende Themen auf – theoretisch und empirisch fundiert und dennoch verständlich dargestellt von einschlägigen Expertinnen und Experten. Die Reihe richtet sich insbesondere an Studierende und Lehrende der Psychologie sowie benachbarter Disziplinen (z. B. Medizin, Pädagogik, Wirtschafswissenschaften, Lehramt etc.). Grundlegendes und aktuelles Wissen wird kompakt und anschaulich vermittelt, sodass die Reihe für eine breite Leserschaft interessant ist.
Die Bände zeichnen sich durch ihr elaboriertes didaktisches Konzept aus. Dieses soll die Arbeit sowohl für die Lernenden als auch die Lehrenden ansprechend und effektiv machen. Jedem Band liegt eine Rahmenstruktur mit detaillierten Strukturierungshilfen zugrunde. Durch die Rahmenstruktur finden die Leserinnen und Leser beim Aufschlagen der Bände viele Elemente, die zum Lesen einladen, wie z. B. Verweise auf Medieninhalte, Praxis- und Fallbeispiele, Internetquellen, Abbildungen, Kästen, Zusammenfassungen, Fragen und mehr. Jeder Band steht für sich und ist weitgehend voraussetzungsfrei zu lesen. Methodische und sonstige Exkurse, die zum Verständnis nötig sind, werden in Kästen eingefügt.
Wir wünschen Ihnen viele Erkenntnisse und Freude bei der Lektüre!
Birgit Spinath, Martin Kersting, Hanna Christiansen
Didaktische Hinweise
Um die Bände optisch aufzulockern und visuelle Anker zu setzen, wird im Buchlayout mit wiederkehrenden Strukturierungshilfen und zugehörigen Piktogrammen aus der untenstehenden Palette gearbeitet. So werden z. B. Definitionen, bedeutsame Studien und Anwendungsbeispiele sowie besonders wichtige Erkenntnisse hervorgehoben.
Zu Beginn der einzelnen Kapitel werden Lernziele formuliert und am Ende jeweils einige Literaturempfehlungen zur Vertiefung der Thematik gegeben. Zur kognitiven Aktivierung und zur Überprüfung des Verstehens werden zwischendurch und am Kapitelende Fragen an die Lesenden gestellt, damit diese ihr Wissen direkt nach der Lektüre überprüfen können.
Piktogramme
Lernziele
Video
Definition
Medienbeispiel
Studie
Mythen und Fehlkonzepte
Diagnostikum
Dos and Don’ts
Fragen
Unbelievable
Literaturempfehlungen
Gut zu wissen
Selbststudium
Rechtliche Aspekte
Anwendungsbeispiel
Ausblick
Inhalt
Geleitwort zur Reihe »Faszinierende Psychologie«
Didaktische Hinweise
1 Einführung
1.1 Motivation: Definition und Abgrenzung von anderen Begriffen
1.1.1 Motivation und Volition
1.1.2 Motivation und Lernen
1.1.3 Motivation und Motive
1.1.4 Motive und Bedürfnisse
1.1.5 Motivation und Emotionen
1.2 Systemtheorien der Motivation
1.2.1 Persönlichkeits-System-Interaktions-Theorie von Kuhl (PSI-Theorie)
1.2.2 Das Wertequadrat und das Konzept des Inneren Teams
1.2.3 Weitere Systemtheorien der Motivation
1.2.4 Extrinsische und intrinsische Motivation
1.2.5 Die Zielsetzungstheorie von Locke und Latham
1.2.6 Implementierungsabsichten
1.3 Ebenen der Motivation: Individuum, Gruppe, Organisation und Gesellschaft
1.3.1 Die Bedeutung von Narrativen
1.3.2 Wettbewerb und Konflikte
1.3.3 Organisationale Energie und Zielgerichtetheit
1.3.4 Die ASA-Theorie
1.3.5 Empowerment
2 Messung und Anregung von Motivation und Motiven
2.1 Qualitätssicherung und -optimierung in der Diagnostik von Motivation
2.1.1 Anforderungs- und Anreizanalysen
2.2 Zentrale Erkenntnisse aus der Motivforschung
2.2.1 Der Operante Motivtest (OMT)
2.2.2 Anregungsbedingungen für das Machtmotiv
2.2.3 Anregungsbedingungen für das Bindungsmotiv
2.2.4 Anregungsbedingungen für das Leistungsmotiv
2.2.5 Das Konsistenzparadox
2.3 Automatisierte Inhaltsanalysen von geschriebenem oder gesprochenem Text
2.3.1 Datenverarbeitung
2.3.2 Merkmalskonstruktion
2.3.3 Algorithmus- bzw. Modellauswahl
3 Ausgewählte Anwendungsbereiche der Motivation
3.1 Vergütung und extrinsische Anreize
3.1.1 Vergütung im Kontext des Bindungsmotivs
3.1.2 Vergütung im Kontext des Leistungsmotivs
3.1.3 Vergütung im Kontext des Machtmotivs
3.2 Veränderungsprozesse in Organisationen und der Gesellschaft
3.2.1 Agilität und Nachhaltigkeit
3.2.2 Das Transformationsmodell von Kotter
3.3 Führung
3.3.1 Transaktionale und Transformationale Führungsstile
3.3.2 Die Dunkle Triade
3.3.3 Coaching und Organisationsentwicklung
3.4 Verkauf und Marketing
3.5 Motivation und Ethik
Literatur
Stichwortverzeichnis
1 Einführung
Motivation ist ein Begriff aus der Alltagssprache, der auf das lateinische Verb movere (bewegen, antreiben) zurückgeführt werden kann. Motivation steht also für Bewegung, was immer auch etwas mit Energie zu tun hat. Aber diese Energie muss auch eine Richtung haben, wenn wir von Motivation sprechen wollen. Motivation gibt uns also Energie und Richtung, deshalb ist sie für uns so wertvoll. Wir brauchen Motivation dringend, auch und gerade in der Arbeitswelt. Wie Motivation entsteht und qualitativ gestaltet wird, damit beschäftigt sich dieser Band.
Dabei werden auch große philosophische Fragen gestreift wie z. B. die nach der Qualität von Motivation: Die Richtung der Motivation kann zu einem motivspezifischen Anreiz hingehen, sie kann aber auch weg von etwas Schädlichem verlaufen (McClelland, 1987). Es gibt also Annäherungs- und Vermeidungsmotivation. Erstere ist auf Belohnungen bzw. Anreize ausgerichtet, letztere auf die Vermeidung von Bestrafung bzw. auf das, was Skinner (1982) mit negativer Verstärkung gemeint hat. Eine Strafe zu vermeiden bzw. eine negative Emotion zu dämpfen (vgl. Kuhl, 2001) stellt nach Skinner eine mächtige Belohnung dar, die das Verhalten von Menschen in der Arbeitswelt seit jeher stark beeinflusst. Kahneman (2012) hat in diesem Zusammenhang auch von der motivierenden Kraft der Verlustaversion geschrieben – wenn etwas Negatives nicht eintritt oder abgewendet werden kann, dann verstärkt dies den Staus Quo, was eine wichtige Erklärung dafür ist, dass Menschen so resistent gegenüber Veränderungen sind bzw. erst andauernde negative Erfahrungen zu einer signifikanten Veränderung der Gewohnheiten führen. Wir werden uns also auch den Fragen stellen, ob wir Motivation in der Arbeitswelt qualitativ so gestalten können, dass sie positive Anreize anstrebt, statt Bestrafung zu vermeiden, und dass die Motivation von innen, aus den eigenen Bedürfnissen und Motiven herrührt, statt von außen bzw. extrinsisch bestimmt zu sein.
Lewin (1926) hatte sich die Repräsentationen dieser Annäherungs- und Vermeidungsgradienten der Motivation als eine Art psychologisches Feld vorgestellt, das durch Vektoren aufgespannt wird. Das war für die damalige Zeit erstaunlich weitsichtig. Heute wissen wir, dass sich Motivation im Gehirn entlang neuronaler Zellverbände abspielt, die räumlich sowohl horizontal als auch vertikal verlaufen. Vertikale »Vektoren« stammen aus den evolutionär alten, tiefergelegenen Schichten des Gehirns, bspw. im Hirnstamm und im limbischen System, die insbesondere Schultheiss (2008; 2013) für Motive nachgewiesen hat. Sie werden von höher gelegenen kortikalen Zentren empfangen, teilweise gehemmt, teilweise verstärkt. Sind solche verstärkenden Annäherungs- und hemmenden Vermeidungsvektoren etwa gleich stark, dann kann es passieren, dass die Person sich entweder gar nicht mehr bewegt oder aber, wie der Esel von Buridian, zwischen zwei Heuhaufen verhungert, weil sie sich nicht entscheiden kann, welcher attraktiver ist. Wenn sich zwei oder mehrere solcher Vektoren im psychologischen Feld gegenseitig auslöschen, und das kann auch horizontal zwischen den beiden Hemisphären des Gehirns geschehen, dann tendiert die gerichtete Energie bzw. Motivation gegen Null. Diesen Zustand hat Kuhl (1994; 2001) als Lageorientierung bezeichnet.
Die damit verbundene Unfähigkeit, sich zwischen Alternativen zu entscheiden, kann unterschiedliche Ursachen haben. Manche Menschen haben keinen guten Zugriff auf ihre in den tiefen Schichten des Gehirns repräsentierten Bedürfnisse, Motive und Emotionen, so dass ihnen nichts wirklich dringlich erscheint, sie also antriebslos sind. Andere haben diesen Zugang zwar, aber sie finden keine Verbindung zu ihrer intuitiven Handlungssteuerung, können ihre Antriebe also nicht in Handlung umsetzen. In beiden Fällen ist gerichtete Energie nicht möglich. Dieser Zustand mangelnder Motivation ist gefährlich und gilt als eine wichtige motivationale Ursache für die Entwicklung einer Depression, die wir als eine Art Nullpunkt der Motivation auffassen können (Kuhl & Helle, 1986).
Aber nicht nur sehr geringe Motivation ist für Einzelne und Organisationen schädlich, sondern auch zu viel Motivation. Bereits 1908 haben Yerkes und Dodson erkannt, dass extreme Erregung bzw. Energie die Performanz motivationaler Prozesse verringert, Motivation und Performanz also in einer umgekehrt U-förmigen Beziehung zueinanderstehen, die der Normalverteilung ähnelt.
Unter Motivation verstehen wir in diesem Buch also gerichtete Energie von Menschen bei der Arbeit und in Organisationen, deren Intensität von sehr gering bis sehr hoch variieren kann, wobei das adaptive Optimum in der Regel im mittleren Bereich der Verteilung liegt. Mit der Methode und den Abbildungen des Wertequadrats, das auf Aristoteles und Schulz von Thun (2002) zurückgeht, werden wir diesen Umstand, dass insbesondere Übermotivation sehr negative Folgen haben kann, immer wieder an konkreten Beispielen verdeutlichen. Vieles, was dazu zu sagen sein wird, lässt sich auch sehr gut auf private Aspekte des Lebens übertragen, aber der Fokus soll hier klar auf gerichtete Energie in der Arbeitswelt gelegt werden.
Motivation muss nicht immer im Verhalten offensichtlich sein. Sie kann sich auch sehr subtil bspw. im mimischen Ausdruck und sogar in nicht beobachtbaren inneren Vorgängen im Gehirn ausdrücken, wenn etwa aktivierende und hemmende Vektoren bzw. Nervenverbände gegeneinander um Einfluss auf das Verhalten wetteifern. Heckhausen und Heckhausen (2018) definieren daher den Prozess von der Wahrnehmung des Bedürfnisses bis zu dessen Erfüllung durch Handeln als Motivation und postulieren, dass Handlungen dann am wahrscheinlichsten sind, wenn das Produkt von der Erwartung, die Handlung umsetzen zu können, und der Wert der Handlung maximal sind. Aber nicht immer muss dieser Prozess schon abgeschlossen sein, so dass wir ihn einfach im Handeln der Akteure beobachten können. Dennoch wollen wir das Phänomen Motivation in diesem Buch aus einer empirischen Perspektive beleuchten, was bedeutet, dass wir Motivation im Verhalten beobachten, durch Tests messen und durch Befragungen erkunden können. Dass die drei Komponenten dieses »diagnostischen Dreiecks« (Schuler, 2002) nicht immer sehr hoch untereinander korrelieren müssen, gehört zum komplexen Phänomen der Motivation dazu. Dennoch wird in diesem Buch viel Wert darauf gelegt, dass die Verfahren für die Diagnostik von Motivation in ihrer Qualität kontrolliert und optimiert werden können, und zwar nach Kriterien, welche sich auch in anderen Bereichen der Diagnostik bewährt haben (Kersting 2006). Dazu gibt es ein eigenes kurzes Kapitel, das interessierte Leserinnen und Leser auf die Möglichkeit der Nutzung von Modellen verweist, die auf Entwicklungen in der Künstlichen Intelligenz beruhen.
Zunächst wollen wir uns der Definition von wichtigen Begriffen zuwenden. Wir wollen Motivation abgrenzen können von häufig in ähnlichen Kontexten oder sogar synonym verwendeten Begriffen wie Volition und Lernen. Auch wollen wir den Unterschied zwischen Motivation und Motiven, Bedürfnissen und Emotionen klären. Als Advanced Organizer soll die Persönlichkeits-System-Theorie (PSI-Theorie, Kuhl, 2001) eingeführt werden. Die PSI-Theorie verschafft einen Überblick über Begriffe, Bilder, Grafiken, Strukturelemente und Prozesse der Motivation, wie sie bspw. im Rubikon-Modell der Handlungssteuerung später ausführlich dargestellt wird.
Zum Schluss werden wir uns ausgewählten Anwendungsfeldern zuwenden. Ich denke, die Implikationen einer rein auf motivationspsychologischen Gesetzmäßigkeiten beruhenden Betrachtungsweise sind überraschend und mögen teilweise sogar radikal anmuten. Dies gilt zumindest für die Themen Vergütung, Veränderungsmanagement, Führung sowie Verkauf und Marketing. Da Motivation an sich betrachtet weder gut noch böse ist, allerdings an beiden Enden der Normalverteilung eine verheerende Wirkung auf Individuen, Organisationen und ganze Gesellschaften haben kann, bedarf es ganz am Schluss noch eines Kapitels zum Spannungsfeld Motivation und Ethik.
Bei allen Kapiteln werden zu Beginn Lernziele formuliert und am Ende weiterführende Literatur, in der Sie diese Themen weiter vertiefen können. Bei der Auswahl der Literatur habe ich darauf geachtet, dass sie auf der einen Seite einen Überblick über die Historie der Motivationsforschung, beginnend mit dem großen Werk von Darwin 1859, liefert, andererseits auch viel aktuelle Literatur enthält, wo möglich auch Metaanalysen, die die empirische Evidenz vieler Studien zusammenfasst.
1.1 Motivation: Definition und Abgrenzung von anderen Begriffen
Lernziele
Sie haben nach dem Lesen von Kapitel 1.1 den Unterschied zwischen den folgenden Begriffen verstanden und Praxisbeispiele kennengelernt.
1. Motivation versus Volition,
2. Motivation versus Lernen,
3. Motivation versus Motive,
4. Bedürfnisse versus Motive,
5. Motive versus Emotionen.
Motivation äußert sich in sehr unterschiedlicher Weise. Mal ist sie deutlich im Verhalten sichtbar, mal äußert sich Motivation aber auch still und von anderen unbemerkt, wobei sich auch diese subtilen Erscheinungsformen der Motivation in Form von Emotionsausdrücken im Gesicht, in Erregungszuständen des Gehirns und in Lernvorgängen messen ließe. Trotz der unterschiedlichen Erscheinungsformen von Motivation gibt es eine allen Formen der Motivation gemeinsame Definitionsgrundlage, die Bischof (1985) und darauf aufbauend Scheffer und Kuhl (2006) vorgeschlagen haben. Lebewesen sind motiviert, wenn sie eine Abweichung eines angestrebten Zustandes, auch Soll-Wert genannt, von einem aktuellen Zustand oder Ist-Wert wahrnehmen und daraufhin durch gerichtete Energie versuchen, diese Diskrepanz zu beseitigen. Motivation ist also das Streben nach einem Gleichgewichtszustand aus inneren Bedürfnissen und äußeren Anreizen, was Murray (1938) als needs und presses bezeichnet und damit den starken Einfluss von Umwelteinflüssen auf Bedürfnisse und Motive betont hat. Die Umwelt erzeugt deswegen einen so starken Druck auf das Individuum, weil Abweichungen vom inneren Gleichgewichtszustand, den Cannon (1932) Homöostase nannte, sogar tödlich enden können und daher zum Einsatz von gerichteter und ausdauernder Energie führen müssen, bis das Lebewesen das Gleichgewicht bzw. die Homöostase wiederhergestellt hat.
Motivation kann als Diskrepanz zwischen einem aktuell wahrgenommen Ist-Zustand eines Organismus und dem wahrgenommenen Soll-Zustand definiert werden, wobei letzterer sich aus den Bedürfnissen, Motiven, Zielen und Werten bewusst oder unbewusst ableitet.
Für Bedürfnisse wie Hunger und Durst leuchtet die Dringlichkeit von Soll-Zuständen unmittelbar ein, denn unbefriedigt endet die Ist-Soll-Diskrepanz für den Organismus tödlich. Aber auch psychologische Bedürfnisse, insbesondere Motive, die unbefriedigt bleiben, können tödlich enden. Das zeigen die traurigen Schicksale von Kindern aus Heimen, die zwar versorgt wurden, aber keine affektive Bindung bekamen und letztlich daran starben, worauf als Erster Harlow aufmerksam gemacht und mit Experimenten mit kleinen Affen auch den empirischen Nachweis gebracht hat: Ohne Wärme und Nähe verkümmern und sterben unsere nächsten Verwandten (Harlow, 1958). Das Gleiche gilt für junge Ratten (Hofer, 1987; 1990). Primäre Bezugspersonen befriedigen bei vielen Säugetieren elementare, physiologische und soziale Bedürfnisse, wozu auch Körperkontakt und körperliche Wärme gehören, und unterstützen den Nachwuchs so in der Aufrechterhaltung der Homoöstase.
Dass auch ein unbefriedigtes Motiv nach Kontrolle tödlich enden kann, hat Seligman (1999) in seinem Lebenswerk empirisch demonstriert: Sein Konzept der erlerntenHilflosigkeit besagt, dass Lebewesen, wie z. B. Hunde, in einen letztlich tödlichen Zustand tiefer Depression verfallen können, wenn sie ihre Umwelt nicht mehr kontrollieren, weil sie keinerlei Kontingenz mehr zwischen eigenen Handlungen und Erfolgen erkennen können. Das Bedürfnis nach Kontrolle spielt sowohl beim Leistungs- als auch beim Machtmotiv eine Schlüsselrolle, da durch den Erwerb von Kompetenzen und den Einfluss auf Ressourcen das Überleben gesichert werden kann.
Es gibt klare empirische Hinweise, dass die Kontrollmotive (Leistungs- und Machtmotiv) sich erst dann voll entwickeln können, wenn zuvor das Bindungsmotiv befriedigt wurde (Ainsworth, 1979). Bleibt die Bindung unsicher, dann kann das Kind auch nicht so mutig explorieren, erweitert dadurch weniger seine Kompetenzen und kann dadurch auch nicht autonom werden (Bischof, 1985).
Nach Damasio, Tranel und Damasio (1991) helfen bei der Ausrichtung des Verhaltens somatische Marker bzw. Emotionen, die den Gesamtzustand der Homöostase des Körpers repräsentieren und darüber informieren, welche Bedürfnisse und Motive die größte Dringlichkeit haben. Wie McClelland (1987) erkannt hat, bedeutet Motivation daher die Allokation von Zeit und Energie zwischen verschiedenen Lebensbereichen. Eine sehr treffende Definition von Motivation in diesem Sinne findet sich bei Rheinberg und Vollmeyer (2012).
Rheinberg und Vollmeyer (2012, S. 15) definieren Motivation als »aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzustand.«
Der Begriff Motivation wird oft im Zusammenhang mit anderen Begriffen verwendet, die sich zum Teil nicht so einfach voneinander abgrenzen lassen. Bspw. prägten Heckhausen und Heckhausen (2018) die Vorstellung, dass Motivation und Handeln sehr eng zusammenhängen. Das ist absolut richtig, aber dennoch können und müssen wir Motivation und Handlung voneinander abgrenzen, was wir im Rahmen des »Rubikonmodells« auch tun werden. Ähnliches gilt für das Begriffspaar Motivation und Emotion. So sehr Emotionen die Motivation befeuern, wie insbesondere Damasio (1994) aus einer neurowissenschaftlichen Sicht betont, nach der ohne Emotion gar keine Richtung möglich ist, und damit, wie eingangs erwähnt, eine notwendige Komponente der Motivation fehlt, so erscheint es doch auch denkbar, dass Motivation ohne Emotion auskommen kann. Ein Beispiel dafür ist das in der klassischen Ökonomie äußerst einflussreiche Menschenbild des Homo Oeconomicus, nach dem zumindest echte Kaufleute systematisch alle verfügbaren Informationen über Produkte, Märkte und Zielgruppen sammeln, diese rational – und damit explizit unemotional – analysieren, um mit dem Ziel der Optimierung des Eigennutzens die aussichtsreichste Alternative auszuwählen. Dieses Agens hat große Ähnlichkeiten mit dem von Kahneman (2012) beschriebenen langsamen Denken, das auch oft als System 2 bezeichnet wird und uns noch oft in diesem Buch begegnen wird.
Das Konzept des HomoOeconomicus ist der Versuch, Motivation ohne Emotion zu definieren. Demgegenüber steht das Konzept des Homo Reciprocans, der praktisch völlig unter Kontrolle von schnellem Denken nach Kahneman (2012) bzw. System 1 steht und der fast wie eine andere Spezies wirkt. Mischel (2015) hat dafür den Ausdruck heißes Denken geprägt, um die emotionale Getriebenheit von System 1 zu verdeutlichen.
Homo Oeconomicus und Homo Reciprocans (vgl. Falk, 2001)
Definitionsmerkmale Homo Reciprocans:
Strebt immer nur nach ausreichender Information auf der Basis von Prototypen, Heuristiken und Stereotypen.
Entscheidet überwiegend unter dem Einfluss von »System 1« (Kahneman, 2012), also schnell, energieschonend, automatisiert, intuitiv, impulsiv, affektiv, unbewusst.
Handelt konsistent nach den Regeln der Reziprozität, fundamental sozial, kontextbezogen, situativ wechselnd.
Definitionsmerkmale Homo Oeconomicus:
Strebt immer nach möglichst vollständiger Information, vergleicht Objekte in Bezug auf mehrere Merkmale, beachtet Details und geht systematisch vor.
Entscheidet gründlich, wohlüberlegt und langsam, wägt viele Optionen überwiegend unter dem Einfluss von »System 2« (Kahneman, 2012) bewusst ab.
Handelt konsistent eigeninteressiert, mit dem Ziel in jeder Situation den eigenen Nutzen zu maximieren; hat keine wechselnden Präferenzen.
Natürlich sind Homo Oeconomicus und HomoReciprocans idealisierte Typen, die in Reinform niemals anzutreffen sind. Insbesondere Damasio (1994) hat auf neurologischer Ebene ausgeschlossen, dass Entscheidungen ohne Emotionen getroffen werden können. Auch in der Betriebswirtschaftslehre wird inzwischen anerkannt, dass es den reinen Homo Oeconomicus nicht gibt, was aber dazu führen müsste, dass viele Lehrbücher umzuschreiben wären. Dennoch kann schon aus der alltäglichen Erfahrung im Wirtschaftsleben davon ausgegangen werden, dass insbesondere viele Manager, Einkäufer, Controller etc. kühl, emotionslos und rational gesteuert sind und doch ziemlich motiviert wirken.
Zu Beginn soll hier die begriffliche Unterscheidung zwischen Motivation und Volition unternommen werden. Das Rubikonmodell von Heckhausen und Gollwitzer (1987) wird dabei helfen, die bei den Lernzielen aufgeworfenen Fragen zu beantworten.
1.1.1 Motivation und Volition
Wie erwähnt soll die PSI-Theorie als advanced organizer dienen. Meine Bitte ist daher, dass sich Leserinen und Leser immer wieder Abbildung 1.1 anschauen (Abb. 1.1). In ihr wird skizziert, was sich im Kopf eines Menschen während der Motivation abspielt. Es sind in ihr die zwei Gehirnhälften erkennbar, wobei in Blickrichtung rechts die rechte Gehirnhälfte der motivierten Person liegt. Die rechte Gehirnhälfte ist nach Kuhl (2001) darauf spezialisiert, vernetzt und ganzheitlich den Ist- und Soll-Zustand des Organismus wahrzunehmen, wobei Emotionen und das Fühlen hier eine entscheidende Funktion haben, um die vielfältigen Bedürfnisse und Motive, die in Abbildung 1.1 ebenfalls dargestellt werden, zu erkennen, und zwar in den tieferen, evolutionär älteren Schichten des Gehirns wie bspw. dem limbischen System (Gotts et al., 2013). Fühlen wir in diesem »Erfahrungszentrum« eine Ist-Soll-Diskrepanz, dann beginnt der Prozess der Motivation, was im Rubikonmodell als Abwägephase bezeichnet wird. Danach folgt die Planungsphase in der analytischen linken Gehirnhäfte, die bei den meisten Menschen stärker auf Sprache und abstraktes Denken spezialisiert ist (Buchweitz et al., 2009). Anschließend übernimmt die Intuition, die in der rechten Hinhälfte angesiedelt ist, die Umsetzung der Pläne in der Handlungsphase, eine Form von schnellem Denken und automatisiertem Handeln, wobei immer Wahrnehmungs- und Urteilsfehler sowie daraus abweichende Zielabweichungen entstehen, die dann in der Bewertungsphase durch spezifisches Empfinden (»Sensing«) kritisch geprüft werden müssen, um in einem erneuten Handlungszyklus dem angestrebten Soll-Zustand näherzukommen.
Das Rubikonmodell untergliedert also den Weg von der Wahl eines Handlungsziels bis zur Zielrealisation in vier eigenständige Phasen (Heckhausen & Gollwitzer, 1987). In der ersten Abwägungsphase, die zu den zwei motivationalen Phasen gerechnet wird, geht es um die Zielbildung, d. h. die Wahl zwischen verschiedenen Handlungsalternativen. Hier muss die von McClelland (1987) beschriebene Allokation von Zeit und Energie zwischen verschiedenen Lebensbereichen vorgenommen und eine Entscheidung getroffen werden, auf welches Ziel der gesamte momentane Lebensvollzug ausgerichtet werden soll.
Der Name des Modells wurde durch die Entscheidung von Julius Cäsar inspiriert, der den Fluss Rubikon mit seinen Truppen überschreiten wollte, um danach Rom einzunehmen und Alleinherrscher des Römischen Reiches zu werden, was unweigerlich mit Bürgerkrieg verbunden war. Natürlich hätten Heckhausen und Gollwitzer für das Modell auch weniger kriegerische Beispiele aus dem Leistungs- oder Bindungsmotiv nehmen können, aber im Fall von Cäsar kam es aus dem Machtmotiv. Daran wird deutlich, dass in der Abwägephase, die auch prädezisionale Phase genannt wird, die Wahrnehmung von Soll-Werten in Form von Motiven und Bedürfnissen besonders wichtig ist.
Eine bedeutende Definition ist die nachfolgend dargestellte Definition von Persönlichkeitsmerkmalen bzw. auf englisch Traits: Während Motivation ein situativ schwankender Zustand ist, werden Motive als ein Persönlichkeitssystem bzw. nach Allport (1937) als ein Trait angesehen (Scheffer & Heckhausen, 2018; Schultheiss & Brunstein, 2010).
Nach Allport (1937) sind Traits bzw. Persönlichkeitsmerkmale neuropsychologische Systeme, die viele Reize funktional äquivalent verarbeiten und so konsistente Verhaltensmuster einleiten und aufrechterhalten. Sie haben also eine neurophysiologische Struktur, die im Gehirn nachgewiesen werden kann. Diese Struktur sorgt dafür, dass eingehende Umweltreize immer auf die gleiche Art und Weise verarbeitet, interpretiert und handlungsleitend werden.
In Abbildung 1.1 wird diese Systemtheorie bzw. der Aspekt der Handlungssteuerung von Kuhl illustriert (Abb. 1.1). Ich bin mir bewusst, dass diese Abbildung sehr komplex und erklärungsbedürftig ist. Insofern wird diese Abbildung an vielen Stellen des Buches wieder aufgegriffen. Insbesondere die sog. Makro-Systeme Thinking, Feeling, Sensing und Intuition sind nach Jung (1986) und Kuhl (2001) Persönlichkeitssysteme im Sinne von der obigen Definition von Allport (1937). Auch die »Großen Drei« Motive, Bindung (B), Leistung (L) und Macht (M) werden dort als Traits aufgefasst. Ebenso Extraversion vs. Introversion, das als Bedürfnis nach positiver Stimulation durch die Außenwelt beim extravertierten Pol interpretiert wird, und Judging vs. Perceiving, das als Bedürfnis nach Sicherheit beim Judging-Pol gedeutet wird (Scheffer & Manke, 2017). Ich übernehme hier die international äußerst verbreitete Bezeichnung der Skalen und die entsprechenden Buchstaben, die bspw. auch durch den Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI) oder den frei im Netz nutzbaren Test 16 Personalities verwendet werden, auch wenn ich um die Kritik an diesen beiden Tests weiß. Ich bin der Meinung, dass der Vorteil einer extremen Verbreitung dieser Terminologie auf der ganzen Welt die Nachteile überwiegt. Nur um Verwirrungen zu vermeiden: Intuition wird mit dem Buchstaben N abgekürzt, weil das I schon durch Introversion »vergeben« war. Es ist aus meiner Sicht sinnvoll und unterhaltsam, einmal im Internet nach den zahlreichen, äußerst liebevoll beschriebenen Charakteren dieser Typologie zu suchen, bspw. die Helden aus »Harry Potter« oder »Der Herr der Ringe«.
Das Feeling im Erfahrungszentrum wird auch Extensionsgedächtnis genannt, weil es extensive Verbindungen zu den evolutionär alten Teilen des Gehirns, bspw. Hirnstamm und limbisches System, aufweist, worauf, das werden wir später noch detaillierter nachweisen, bei den meisten Menschen die rechte Gehirnhälfte spezialisiert ist (Kuhl, 2001). Daher wird in der Abbildung auch der Kopf von hinten gezeigt, so dass dieses Persönlichkeitssystem rechts vorne lokalisiert wird. Die für die rechte Gehirnhälfte typische implizite, d. h. unbewusste, und parallele Informationsverarbeitung ist Teil des von Kahneman (2012) als System 1 bezeichneten schnellen oder heißen Denkens, weil es sehr viel Input aus Bedürfnissen, Motiven und Emotionen schöpft. Das muss ja auch so sein, denn wie alle Lebewesen müssen Menschen extrem komplexe Berechnungen anstellen, welche Soll-Werte gerade zu priorisieren sind, wobei natürlich Kontextbedingungen bzw. die Ist-Werte der momentanen oder auch zukünftigen Situation berücksichtigt werden sollten. Bewusst ist eine solche komplexe Berechnung alleine nicht zu bewerkstelligen (Bischof, 1985; Damasio, 1994). Somatische Marker müssen dabei helfen, den emotionalen Wert aller möglichen Handlungsalternativen zu berechnen (Damasio, Tranel & Damasio, 1991). Dabney et al. (2020) haben in einer in Nature publizierten Studie gezeigt, dass die dopaminergen Nervenverbände, die an dieser Berechnung beteiligt sind, tatsächlich sämtliche mögliche Handlungsalternativen berücksichtigen, was eine wirklich enorme Verarbeitungskapazität voraussetzt, die schon an die Leistung von Quantencomputern heranreicht.
Dass solche überaus komplexen Berechnungen, die auch noch in kürzester Zeit stattfinden müssen, nicht mehr bewusst vorgenommen werden können, ist klar. Darum ist es wichtig, dass die auf Ideenfindung, Kreativität, Überblick und emotionalen Gehalt ausgerichtete Entscheidungsfindung in der Abwägephase durch das ganzheitliche Fühlen in der Planungsphase oder auch präaktionalen Phase durch das analytische Denken unterstützt wird. Und diese Phase wird nun als volitionale Phase der Zielsetzung bezeichnet, und sie weist entscheidende Unterschiede zur motivationalen Phase der Abwägung auf (Scheffer & Kuhl, 2009).
In der volitionalen Phase muss ein durch eine Entscheidung herbeigeführtes Ziel spezifiziert und realisiert werden. Nachdem Cäsar sich für die Überschreitung des Rubikon und damit für Krieg entschieden hatte, mussten eine Vielzahl weiterer Entscheidungen bezüglich der Allokation von zeitlichen und materiellen Ressourcen getroffen werden. Wann sollte Rom eingenommen werden? Wie konnten die Truppen verpflegt werden? Welche Ressourcen konnten genutzt werden? Diese Fragen betreffen alle die volitionale Phase. Damit das gewählte Ziel auch tatsächlich Zugang zum Verhalten erlangt, muss es in eine konkrete Absicht umgewandelt werden. In der Persönlichkeits-System-Theorie von Kuhl (2001), die uns abgekürzt als PSI-Theorie noch oft in diesem Buch begegnen wird und in Abbildung 1.1
Abb. 1.1: Das Handlungssteuerungsmodell von Kuhl (2001) als Teil der Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (mit freundlicher Genehmigung von P. Klein, ScanUp)
skizziert wurde (Abb. 1.1), ist hierfür ein bestimmtes Persönlichkeitssystem zuständig, das große Ähnlichkeit mit dem System 2 von Kahneman (2012) hat. Kuhl nennt dieses Persönlichkeitssystem das Intentions- oder Absichtsgedächtnis, weil es die Funktion erfüllt, die in der motivationalen Abwägephase durch eine Entscheidung gewählte Alternative in konkrete, spezifische und umsetzbare Absichten zu verfeinern. Auch hierfür sind natürlich Entscheidungen notwendig, allerdings sind das vergleichsweise »Mikro-Entscheidungen«. Ein Unterschied zwischen Motivation und Volition ist also der, dass erstere die großen, lebenswichtigen Entscheidungen betrifft, Volition dagegen das »Mikro-Management«. Oder wie es die Managementvordenker Kaplan und Norton (1996) ausgedrückt haben, entspricht Motivation der Strategie und Volition der Exekution, der aus dieser Strategie abgeleiteten Ziele.
Da es zur PSI-Theorie einen zwar älteren, aber immer noch in der Praxis weit verbreiteten Vorläufer gibt, sollen auch die Bezeichnungen von Jung bzw. Myers-Briggs und Myers (2015) eingeführt werden. In Abbildung 1.1 entspricht das Intentionsgedächtnis dem Thinking im Planungszentrum (Abb. 1.1). Dieses durch Analytik, Logik, Planen und Bewusstsein geprägte langsame Denken hat die Funktion, nach der Entscheidung zwischen Alternativen konkrete Intentionen und Pläne zu erarbeiten, diese bei auftretenden Schwierigkeiten im Gedächtnis zu behalten und eine vorschnelle Umsetzung zu verhindern. Hierbei handelt es sich um ein Persönlichkeitssystem, d. h. Menschen unterscheiden sich darin, wie kompetent und oft sie dieses System benutzen. Das Absichtsgedächtnis braucht einen klar strukturierten Zeitrahmen. Ziele sollten messbar und konkret definiert und objektiv beurteilbar sein.
In der ersten volitionalen Phase, der sog. präaktionalen Phase, werden also Ziele (den Krieg noch vor Wintereinbruch gewinnen) in Absichten (Marsch auf Rom nach Überquerung des Rubikon) und Meilensteine (Eroberung von Vorposten Roms) des Handelns zerlegt, die dann in der zweiten volitionalen Phase, der aktionalen Phase, der Reihe nach bis zur Zielrealisation abgearbeitet werden sollen.
Damit diese Umsetzung geschehen kann, muss das Absichtsgedächtnis jedoch mit seinem Bestreben gestoppt werden, alles perfekt durchzuplanen, denn dann würde gar nichts passieren. Damit nicht alles zeitraubend bis in letzte Detail geplant und abgesichert wird, dadurch das bekannte Pareto-Prinzip verletzt wird, nach dem gerade die letzten 20 % Detailplanung 80 % der Zeit und Energie kosten können, muss nun ein anderes Persönlichkeitssystem übernehmen, das Kuhl (2001) als Intuitive Verhaltenssteuerung bezeichnet. Jung (1986) nannte das System schlicht Intuition.
Dieser Übergang vom durch langsames Denken und detailliertes Planen geprägten Absichtsgedächtnis zum intuitiven Umsetzen ist eine der großen Herausforderungen sowohl für Individuen als auch für Organisationen. Wenn dieser Übergang nicht gelingt, dann weiß das Individuum oder die Organisation zwar, was die richtigen Ziele sind, und in der Theorie auch, wie diese umgesetzt werden könnten, bringt aber nicht den Mut oder die Energie auf loszulegen. Dies ist eine andere Form der Lageorientierung als die, die wir weiter oben schon kennengelernt haben, bei der wir nicht einmal wissen, was wir wollen, uns also von unseren Bedürfnissen entfremdet haben (Kuhl, 1994).
Durch die Intuitive Verhaltenssteuerung (IVS bzw. Jungs Intuieren) werden durch die Wahrnehmung in Form einer plötzlichen, kaum erklärbaren Erkenntnis, Chancen und Möglichkeiten erkannt, die ausgearbeiteten Ziele umzusetzen. Menschen, die dieses System oft und kompetent benutzen, brauchen gar keine zu detaillierten Ziele, sondern eher Zielkorridore oder »Leitplanken«, die sie bei der Zielverfolgung nicht zu stark festlegen und Raum für spontane Anpassungen lassen. Die Umsetzung der Ziele in Handlungen vollzieht sich dadurch, von außen betrachtet, spielerisch und leicht, wie von selbst. Der von Csikszentmihalyi (1975) geprägte Begriff »Flow« entspricht der intuitiven Umsetzung im Leistungsbereich (Baumann & Scheffer, 2010; 2011).
Das Problem mit der Intuitiven Verhaltenssteuerung ist allerdings, dass sie so ganzheitlich und spontan ist, dass viele Fehler entstehen. Gigerenzer et al. (1996; 2002) haben dieses schnell arbeitende, mit Heuristiken und Daumenregeln arbeitende intuitive System ausführlich beschrieben und seine adaptiven wie auch fehlerhaften Merkmale dokumentiert. Adaptiv an diesem System ist, dass es in vielen Alltagssituationen erstaunlich gut funktioniert. Es wählt aus einer Vielzahl von Umsetzungsmöglichkeiten instinktiv die richtige aus und ähnelt daher dem Fühlen. Entsprechend ist es auch in Abbildung 1.1 (Abb. 1.1) ebenfalls in der rechten Hemisphäre angesiedelt. Es ist genauso durch implizite und parallele Informationsverarbeitung charakterisiert. Wie schon Kuhl (2001) postuliert hat und Dabney et al. (2020) mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz von Deep Mind nachweisen konnten, arbeitet dieses eng mit unserem Belohnungssystem verbundene Persönlichkeitssystem fast schon wie ein Quantencomputer, indem es alle Möglichkeiten parallel repräsentiert und die jeweils am besten zur situativ angemessenen Umsetzung passenden auswählt.
Aber natürlich hat die Intuition nichts Magisches an sich, sondern verarbeitet nur in parallel distribuierten neuronalen Netzwerken eine ungeheure Menge an Information. Dabei ist Schnelligkeit wichtiger als Genauigkeit und die Fehler, die sie macht, hat Kahneman (2010) ausführlich beschrieben. Sie arbeitet mit Stereotypen, Vorurteilen, primitiven Daumenregeln, sie fällt auf Priming-, Halo- und Ankereffekte herein, womit wir uns später noch ausführlicher beschäftigen werden. Wir wollen hier aber nicht vergessen: Für die Motivation bei der Arbeit und in Organisationen, also die Praxis, ist die Intuition unabdingbar. Sie ist nicht perfekt und strebt das auch gar nicht an, aber sie sorgt dafür, dass wir den Alltag mit seinen Tausenden von kleinen Absichten, die umgesetzt werden müssen, überhaupt bewältigen können. Wenn wir das alles bis ins Letzte planen müssten, kämen wir nicht mal hin bis zur Arbeitsstelle.
Da die Intuition nun aber einmal Fehler macht, muss es in einer anschließenden Phase eine kritische Bewertung geben, ob das Zielstreben erfolgreich war. Und hier kommt nach der PSI-Theorie erneut ein Persönlichkeitssystem ins Spiel, das als Objekterkennungssystem oder bei Jung als analytisches Empfinden bezeichnet wird. Durch das Objekterkennungssystem (Jungs analytisches Empfinden bzw. Sensing) wird das Handlungsergebnis kritisch und im Detail genau geprüft, durch Abstraktion von Kontexteinbettungen wird festgestellt, welche konkreten Einzelheiten und Objekte die »Wirklichkeit« ausmachen und ob die Ziele durch die Intuitive Verhaltenssteuerung auch wirklich erreicht wurden. Menschen, die dieses Persönlichkeitssystem oft und kompetent benutzen, sind in der präaktionalen Phase ganz besonders angewiesen auf spezifische, realistische und klar strukturierte Ziele, deren Erreichung objektiv und eindeutig messbar sind.
Sensing im »Kontrollzentrum« unterstützt also das Feeling im »Kraftzentrum« darin, die wirklich richtigen und dringlichsten Entscheidungen zu treffen, indem es die Diskrepanzen zwischen den aktuellen Ist-Werten mit den im Extensionsgedächtnis gespeicherten Soll-Werten erkennt bzw. empfindet. Eine solche Diskrepanz ist natürlich schmerzhaft bzw. negativ, was in Abbildung 1.1 (Abb. 1.1) durch ein Minuszeichen symbolisiert wird. Wird durch optimistisches Handeln – das »Handlungszentrum« muss optimistisch, risikobereit und positiv gestimmt sein, daher hier auch das Plussymbol – die Ist-Soll-Diskrepanz aufgelöst, wobei natürlich nur das Fühlen entscheiden kann, ob das wirklich angesichts aller Motive, Bedürfnisse und Emotionen der Fall ist, dann verschwindet die negative Stimmung, was in Abbildung 1.1 (Abb. 1.1) durch das Minussymbol in Klammern angedeutet wird.
Die Acht in Abbildung 1.1 symbolisiert die Übergänge zwischen den Persönlichkeitssystemen bzw. den Phasen des Rubikonmodells. Letztlich ist es die Funktion des Prozesses, möglichst allen dringlichen Bedürfnissen und Motiven, die durch Emotionen an das Fühlen kommuniziert werden, einigermaßen gerecht zu werden.
Kommen wir noch einmal zu den Unterschieden zwischen Motivation und Volition: Für erstere ist die größere Offenheit in der Zielbildungs- gegenüber der Umsetzungsphase charakteristisch (Heckhausen & Kuhl, 1985), die durch die parallele Distribution in neuronalen Netzwerken ermöglicht wird (Kuhl, 2001). Nach kritischer Prüfung durch das Objekterkennungssystem beginnt wieder eine neue Zielbildungsphase und der ganze Prozess des Rubikonmodells wird erneut durchlaufen. Bei der Zielbildung ist natürlich entscheidend, dass das dafür zuständige Persönlichkeitssystem auch wirklich die wahren Bedürfnisse erkennt. Das dafür zuständige System ist in der PSI-Theorie das Extensionsgedächtnis, das bei Jung als Fühlen bezeichnet worden ist. Dieses Persönlichkeitssystem kann eine immense Menge an Information in großer Geschwindigkeit unbewusst verarbeiten. Und das braucht es auch für die Funktion, Bedürfnisse und Motive richtig zu erkennen und zu priorisieren. Diese über Millionen von Jahren in der Evolution entstandenen neuronalen Netzwerke haben nach Kuhl (2001) einen Überblick über alle Bedürfnisse, Motive und die Kontexte, die darüber entscheiden, wie günstig die Bedingungen für deren Befriedigung sind.
Während Fühlen und Intuieren also implizit sind, dafür aber große Mengen an Informationen gleichzeitig und parallel repräsentieren können, ist es beim Denken und spezifischen Empfinden umgekehrt. Diese Persönlichkeitssysteme sind explizit und damit bewusst, sie können nur wenige Informationen Schritt für Schritt nacheinander verarbeiten, das dafür aber mit großer Präzision und Bewusstheit. Dieser wichtige Unterschied in der Menge, Qualität und Intensität der Informationsverarbeitung, den wir auch in Kahnemans Unterscheidung von System 1 und 2 wiederfinden, kann aus physiologischer Sicht so zusammengefasst werden: System 1 verarbeitet schnell und energieschonend immense Mengen an Information, der Prozess bleibt jedoch unbewusst; System 2 verarbeitet dagegen wenige Informationen langsam, bewusst und äußerst energieintensiv, d. h., die in Glukose gebundene Energie wird in sehr hohem Maße verbraucht, was zu der Tendenz führt, dass System 2 eher »faul« ist, also nur in kritischen Situationen aktiviert wird (Kahneman, 2012). Die Voreinstellung (»default mode«) ist System 1, System 2 greift nur ein, wenn Affekte und Emotionen Gefahr oder mangelnde Erfolgsaussichten bei der Zielerreichung signalisieren (Camerer, Loewenstein & Prelec, 2005).
Während also Motivation durch die von parallel distribuierten neuronalen Netzwerken ermöglichte unbewusste Verarbeitung wirklich unvorstellbar großer Mengen an Information gekennzeichnet ist – laut Zimmermann (1993) allein im visuellen Bereich 10 Millionen Bits pro Sekunde, während das bewusste System 2 nur auf ca. 40 Bits pro Sekunde kommt (was für ein gigantischer Unterschied!) –, wird Volition durch die vergleichsweise langsame, dafür aber gründliche Verarbeitung weniger Details charakterisiert. Das ist anstrengend und fühlt sich nicht leicht an, aber es ist natürlich für eine erfolgreiche Motivation notwendig.
Fassen wir zusammen: Wie Kahneman (2012) an vielen Beispielen deutlich gemacht hat, bedeutet Motivation ohne Volition, dass wir ungenau sind, uns verzetteln, viel wollen, aber wenig umsetzen. Volition ohne Motivation dagegen bedeutet, dass wir effizient das umsetzen, was wir gar nicht wollen. Auf beide Probleme kommen wir noch später zurück.
1.1.2 Motivation und Lernen
Da Motivation sich nach Lewin (1935) wie ein mit Spannung versehenes Vektorfeld verstehen lässt, ist es mit einigen Phänomenen assoziiert, die sehr eng mit Motivation zusammenhängen, aber nicht mit dieser gleichzusetzen sind. Zwar gehört Lernen im strengen Sinne nicht zu Motivation und es gibt entsprechend differenzierte Lehrbücher darüber, wie Lernen gelingen kann. Aber wir müssen Lernen, nachdem wir es von Motivation abgegrenzt haben, hier natürlich trotzdem berücksichtigen.
Das liegt schon daran, dass Gewohnheiten eine sehr starke Wirkung auf unsere tägliche Motivation haben, gerade auch im Wirtschaftsleben. Duhigg (2012) beschreibt, wie akribisch Unternehmen wie Procter & Gamble die Gewohnheiten potenzieller Konsumenten ihrer Produkte studieren, um sie zum Kauf zu motivieren. Produkte müssen an unseren Gewohnheiten andocken, sonst verkaufen sie sich nicht. Das werden wir im dritten Teil des Buches noch vertiefen. Für den Moment müssen wir uns noch einmal der Unterscheidung von Motivation und Volition widmen, um die Bedeutung von Lernen und Gewohnheitsbildung für die Motivation zu verstehen.
Vielleicht ist aufmerksamen Leserinnen und Lesern aufgefallen, dass die volitionale Phase eigentlich auch die Handlungsphase einschließt, wir aber den Unterschied zwischen Motivation und Volition insbesondere an den Unterschieden zwischen System 1 und System 2 festgemacht haben, dabei aber die Intuition als Teil von System 1 angesehen haben, das parallel distribuiert gewaltige Mengen an Informationen unbewusst verarbeitet. Was ist nun richtig?
Der scheinbare Gegensatz lässt sich auflösen, wenn wir uns die empirisch hervorragend nachgewiesene Verbindung zwischen sehr intensivem Lernen und Automatisierung klarmachen. Wenn wir eine Sache viele tausend Male wiederholen, bspw. im Sport, in der Musik oder in beruflichen Abläufen, dann läuft sie irgendwann wie ein »Flow« quasi automatisch ab, sie fühlt sich leicht an und ist dennoch nahe an der Perfektion, die natürlich nie vollends erreicht werden kann (Csikszentmihalyi, 1990).
Ericsson und Pool (2016) haben zusammengefasst, dass »Flow« bzw. »Peak-Experiences« mit Höchstleistungen assoziiert sind und durch sehr großen Trainingsaufwand, verbunden mit spezifischen und klaren Zielen sowie möglichst unmittelbarem Feedback zu diesen Zielen, erreicht werden können. Zwar stimmt es nicht, dass dies mindestens 10 000 Stunden sein müssen, wie es in der Populärliteratur dazu oft geschrieben wird, denn das kommt schon sehr auf die Komplexität des zu Erlernenden an. Bei sehr komplexen motorischen und geistigen Fähigkeiten wie Musizieren oder Komponieren jedoch sind etwa 10 000 Stunden notwendig.
Auch Gigerenzer (2008) bringt viele Beispiele aus dem Berufsleben, in denen hochgradig automatisierte sensomotorische Abläufe mit Expertise und Können gleichgesetzt werden. So können bspw. sehr erfahrene Feuerwehrleute intuitiv erkennen, wann die Gefahr des Einsturzes eines brennenden Gebäudes droht, weil sie das schon sehr oft erlebt haben. Auch extrem erfahrene Kunstkenner erkennen eine Fälschung großer Künstler meist sofort, weil sich die Fälschungen irgendwie falsch anfühlen. Menschen, die in Berufen arbeiten, in denen Feedback zu ihren Ergebnissen selten oder nie vorkommt, können dagegen nicht ein so starkes Bauchgefühl entwickeln, was auf hochgradiger Automatisierung beruht. Dadurch erleben sie seltener oder nie Flow und auf ihre Urteile ist weit weniger Verlass. Leider verlassen sich auch solche scheinbaren Experten oft auf ihr Bauchgefühl, wenn nur relativ wenig Feedback aus der Praxis hinter ihren Gewohnheiten steckt.
Gewohnheiten und Intuition müssen also auch begrifflich getrennt werden. Während wir das Persönlichkeitssystem der Intuition tatsächlich der Motivation zurechnen können, da es aus vielen Möglichkeiten unter großer Unsicherheit die bestmögliche Alternative findet und dabei in gewisser Weise um die Ecke denkt (Jung, 1986), ist die durch Automatisierung entstandene Gewohnheit ein Teil der Volition. Auch hier passt das militärische Beispiel aus dem Rubikonmodell dann sehr gut: Die Soldaten von Cäsar mussten nicht besonders motiviert sein, denn Drill, Gewohnheiten und militärische Strukturen sorgen auch so dafür, dass die Umsetzung der Ziele realisiert werden. Das ist natürlich in der Wirtschaft oft ähnlich und wird uns daher auch noch mehrfach in diesem Buch beschäftigen.
Cialdini (2006) demonstriert mit vielen Studien und Beispielen, wie subtil Einfluss ausgeübt werden kann, wenn Machthaber oder charismatische Führer die Umfeldbedingungen so gestalten, dass sie den bei Menschen aus evolutionären Gründen stark ausgeprägten Herdentrieb ausnutzen. So wollen sich Menschen bspw. gerne konsistent verhalten, weil das von anderen als vernünftig und berechenbar angesehen wird, wohingegen Inkonsistenz als Zeichen von mangelnder Zurechnungsfähigkeit gilt. Menschen verhalten sich daher oft künstlich konsistent, was ausgenutzt werden kann. So wird ein kleiner Gefallen, den wir für andere oder eine Organisation getan haben, tendenziell dazu führen, dass wir später auch bereit sein werden, ein großes Opfer zu bringen. Ganz besonders, wenn wir social proof haben, d. h. beobachten, dass viele andere, ganz »normale« Menschen das auch machen. Bandura hat bereits 1963 auf den enormen Effekt von Modelllernen hingewiesen: Wir lernen von uns ähnlichen Modellen, was wir tun sollen. Und diese Gewohnheit behalten wir oft auch dann bei, wenn sie unseren eigentlichen Bedürfnissen und Motiven zuwiderläuft.
Wie Carver und Scheier (2006) in ihrer Systemtheorie der Motivation, die wir ebenfalls noch näher behandeln werden, zeigen, ist bereits die Annäherung an einen angestrebten bzw. die Flucht vor einem schädlichen Zustand mit positiven Emotionen assoziiert, die belohnend wirken und so das gezeigte Verhalten verstärken, weil die Handlung zu einer Reduzierung der Ist-Soll-Diskrepanz beiträgt. Positive Emotionen belohnen das Lebewesen für alles, was der Reduktion der Ist-Soll-Diskrepanz dient und verstärken alle damit assoziierten Handlungsweisen im Sinne der operanten Konditionierung (Skinner, 1982).
Dabney et al. (2020) zeigen, dass die Belohnungen durch Dopamin angezeigt werden, und zwar nicht als einzelne Mittelwerte oder Prototypen, sondern in Form einer vollständigen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die dopaminergen Neuronen-Netzwerke, die wir auch als Belohnungssystem interpretieren können, repräsentieren also eine Vielzahl möglicher zukünftiger Ergebnisse gleichzeitig und parallel. In gewisser Weise arbeiten sie dadurch wie ein Quantencomputer, was wir diesen evolutionär sehr alten Netzwerken vielleicht gar nicht zugetraut hätten.
Negative Emotionen bestrafen ein Lebewesen dagegen für alles, was die Ist-Soll-Diskrepanz entweder nicht reduziert oder sogar noch vergrößert. Das Bestrafungssystem ist nach Kuhl (2001) unabhängig vom Belohnungssystem. Dies hatte auch schon Herzberg (1968) in seiner Zwei-Faktoren-Theorie der Motivation vermutet, nach der Motivatoren (Belohnungen) unabhängig sind von sog. Hygienefaktoren. Diese Hygienefaktoren motivieren nicht direkt, sondern machen nur bei Fehlen unzufrieden, weil ihre Folgen, wie bspw. ausfallende Zahlungen, mangelnde Sicherheit, mangelnder Schlaf, zu viel Lärm, Hitze oder Kälte schädlich für das Lebewesen sind.