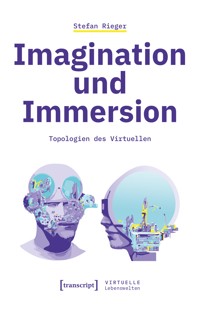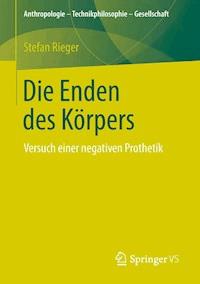11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Multitasking karikiert sich die Moderne selbst. Menschen, die unterschiedliche Dinge gleichzeitig verrichten, die telefonieren, autofahren und Kaffee trinken, stehen nicht umsonst am Pranger verfehlter Aufmerksamkeitsökonomie. Was die Wissenschaft, allen voran Psychologie und Hirnforschung, an Einwänden gegen das Multitasking vorbringt, hat gegenüber der Allgegenwärtigkeit des Phänomens kaum eine Chance. Umso mehr stellt sich die Frage, warum dessen Wirkmacht so ungebrochen ist. Es ist eine Ökonomie der Spaltung, die dies möglich macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Im Multitasking karikiert sich die Moderne selbst. Menschen, die unterschiedliche Dinge gleichzeitig verrichten, die telefonieren, Auto fahren und Kaffee trinken, stehen nicht umsonst am Pranger verfehlter Aufmerksamkeitsökonomien. Was die Wissenschaft, allen voran Psychologie und Hirnforschung, an Einwänden gegen das Multitasking vorbringt, hat gegenüber der Allgegenwärtigkeit des Phänomens kaum eine Chance. Umso mehr stellt sich die Frage, warum dessen Wirkmacht derart ungebrochen scheint. Es ist eine Ökonomie der Spaltung, die dies möglich macht.
Stefan Rieger, geboren 1963, lehrt Mediengeschichte an der Ruhr-Universität Bochum. Im Suhrkamp Verlag erschienen zuletzt: Schall und Rauch. Eine Mediengeschichte der Kurve (stw 1849) und (zusammen mit Benjamin Bühler) Das Wuchern der Pflanzen. Ein Florilegium des Wissens (es 2547).
Multitasking
Zur Ökonomie der Spaltung
Stefan Rieger
Suhrkamp
Die edition unseld wird unterstützt durch eine Partnerschaft mit dem Nachrichtenportal Spiegel Online. www.spiegel.de
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Originalausgabe
© Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältig oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Nina Vöge und Alexander Stublić
eISBN978-3-518-77230-0
www.suhrkamp.de
Multitasking
Inhalt
1 Wohlfeiler Einstieg – Karikaturen ihrer Selbst
2 Drehzahl und Heldenzeit – ein historisch-numerisches Intermezzo
3 Im Vorhof der Wissenschaft
4 Mal sehen – im Gehirnkino der Kognitionsforscher
5 Zurück in die Steinzeit
6 Flaschenhälse und was in ihnen stecken bleibt
7 Divide, impera!
Anmerkungen
1 Wohlfeiler Einstieg – Karikaturen ihrer Selbst
»Besonders des Nachts freute er sich des breiten Raumes im Bette und benutzte sehr ökonomisch diese schöne Zeit, sich für die kommenden Tage zu entschädigen und seine Person gleichsam zu verdreifachen, indem er unaufhörlich die Lage wechselte und sich vorstellte, als ob drei zumal im Bette lägen, von denen zwei den Dritten ersuchten, sich doch nicht zu genieren und es sich bequem zu machen.«
Gottfried Keller, »Die drei gerechten Kammacher«
Im Multitasking karikiert sich die Moderne selbst. Menschen, die unterschiedliche Dinge gleichzeitig verrichten, die gehend simsen, telefonierend Auto fahren und Medien nur noch als Hintergrundgeräusch bei der Hausarbeit oder auf den Laufbändern der Fitnessstudios konsumieren, werden nicht umsonst durch die kritischen Register der Feuilletons gezogen und an den Pranger verfehlter Aufmerksamkeitsökonomien gestellt. Von allen Seiten argwöhnisch beäugt, wird ihnen zum Verhängnis, dass sie zu viel und dass sie vor allem zu viel gleichzeitig tun. Das alles kann weder gut sein, noch kann es auf Dauer gutgehen. Und dass die vielfältigen Lifestyle-Produkte der Unterhaltungselektronik als Ablenkungsagenten stets mit von der Partie sind und dass sie sich in gesteigerter Form in einen Schauplatz irgendwelcher Nebenapplikationen verwandelt haben, macht die Sache auch nicht besser – Knopf im Ohr hin, Smartphone in der Hand her. Der Wunsch nach Konzentration auf das, was früher einmal das Wesentliche genannt und dadurch von Ablenkungen abgeschirmt werden konnte, scheint hoffnungslos naiv. Die gestressten Zeitgenossen haben sich mitsamt ihren Medien in Nebengebräuchen verloren – und das kulturkritische Lamento trägt nicht wirklich dazu bei, sie wieder in die Spur zu bringen. Ein Telefon etwa, das nur noch seinem griechischen Wortlaut folgt und zum Fernsprechen benutzt wird, ist ein markttechnischer Atavismus – ebenso wie ein menschlicher Fernsprecher, der ganz in seinem Tun aufgeht und nicht doch noch irgendetwas nebenbei erledigt, der unter den Bedingungen verkabelter Telefonapparate Männchen kritzelt und Einkaufslisten schreibt oder den Gewinn an schnurloser Freiheit nutzt, um den Geschirrspüler auszuräumen und Wäsche aufzuhängen. So ernst erscheint die Lage, dass die Sorge um das Multitasking längst das Gesundheitssystem und namentlich die Krankenkassen erreicht hat. Die Hauspostille der privaten Krankenversicherung DKV – DKV impulse – warnt in ihrer ersten Ausgabe des Jahres 2011 eindringlich vor den Gesundheitsrisiken des »Multi-Tasking« und propagiert bei ihren Mitgliedern die alte Kunst des systematischen Hinter- und geordneten Nacheinanders.1
Das an dieser Stelle stereotyp angebrachte Argument verweist auf einen unaufhaltsamen Trend zur Selbstökonomisierung, dem die Menschen zunehmend unter- oder gar erliegen. Selbst der Schlaf, so redet man uns inzwischen ein, sei davon betroffen, ist er doch laut der einschlägigen Literatur jene Phase, in der, wenn sonst schon nichts passiert, wenigstens das Gewicht reduziert, Fremdsprachenkenntnisse erweitert oder nachträglich noch die Qualifikation zum Betriebswirt erworben werden soll. Flankiert von unterschiedlichen Theorieangeboten nicht zuletzt der Soziologie, ist es der Typus des unternehmerischen Selbst, den seine eigene Inbetriebnahme und Bewirtschaftung unter jenen Druck setzt, dem er durch Strategien der Gleichzeitigkeit zu genügen sucht.2 Die parallele Abarbeitung unterschiedlicher Tasks, wenn man schon hier die Terminologie der Informatik aufgreifen möchte, sichert ihm Effizienzressourcen, ohne die er gegenüber der Schar anderer unternehmerischer Selbste ins Hintertreffen gerät. Die Folgen dieser Haltung sind so vielfältig beschrieben worden, dass es gleichermaßen wohlfeil wie überflüssig wäre, sie in Exempeln noch eigens vor Augen zu führen.
Abb. 1: Multitasker I (tierisch), gepostet von »Janet« auf dem Blog Do it Better.
An dieser Stelle genügt daher vielleicht der Verweis auf eine entsprechende Ikonografie, die das Multitasking in der Bilderwelt vielgliedriger Gottheiten verortet und mit dem Lotussitz die lokale Herkunft dieser Referenz visuell untermauert.3 Googelt man den Begriff Multitasking unter Zuhilfenahme der Bildfunktion, wird angesichts der Dominanz solch krakenhafter Wesenheiten allerdings noch etwas anderes deutlich: Es sind nicht mehr nur die Zuschreibungen von außen, die in dieser Ikonografie ihre probate Veranschaulichung finden, sondern sie bestimmt mittlerweile in hohem Maße Selbstwahrnehmung und Selbstbild der Betroffenen – wie freimütige Einschätzungen im Internet zeigen.
Abb. 2: Multitasker II (weiblich) (Stock-Fotografie).
Entsprechende Einträge folgen dabei ganz der Geschlechterkonvention und weisen das Multitasking als reine Frauensache aus. Ein Herr gesteht dort unumwunden ein, dass er schon durch die bloße Gleichzeitigkeit von Babybetreuung und Notdurftverrichtung überfordert sei, wohingegen die zugehörige Kindsmutter in der gleichzeitigen Abwicklung von Routinen glänze, so dass bei ihr neben sämtlichen Obliegenheiten der Kleinkinderbetreuung auch noch das Ausfüllen von Steuererklärungen und sogar die Durchführung von Herzoperationen ihren Platz fänden. Wie wirkmächtig das Klischee ist, dem zufolge vor allem Männer an den Anforderungen der Gleichzeitigkeit scheitern, stellt mustergültig eine animierte Bildfolge vor Augen, die der wechselseitigen Ausschließlichkeit von Körperhygiene und Toilettengang bei Männern gewidmet ist – mitsamt ihren verheerenden Folgen für ein derart benutztes Badezimmer.
Abb. 3: Multitasker III (männlich), in animierter Form auf einem portugiesischen Blog gefunden.
Für die Kontextualisierung multitaskingfähiger Wesenheiten taugt jedoch nicht nur der Alltag. Nicht zuletzt ist auch das Reich bloßer Fantasien sachdienlich, wenn dort etwa die genetischen Folgen von Atombombenexplosionen durchgespielt und für alternative Baupläne von Organismen ausgeschöpft werden. In Arno Schmidts Gelehrtenrepublik, einem im Jahr 1957 veröffentlichten Kurzroman aus den Roßbreiten, sind unkontrollierte Mutationen längst dystopische Realität: Mehrgliedrigkeit wie die Hexapodie und artenübergreifender Sex waren in der damals noch fernen Zukunft des Jahres 2008 handlungsleitend – jedenfalls am Ort des Geschehens, einem von Hominiden bevölkerten Streifen im Westen der USA, in dem die bizarren Resultate durch Radioaktivität verursachter Mutationen sorgsam unter Quarantäne gehalten werden.4 Wollte man lieber innerhalb einer natürlichen Natur verbleiben, so fände man auch hier mit vielarmigen Kraken oder vielgliedrigen Tausendfüßlern Protagonisten, die sich zur Veranschaulichung anböten.5 Das Reich der Übertiere hält seine Pforten geöffnet – ebenso wie die technischen Rüstkammern, die ihrerseits mit imposanten Organvervielfältigungen aufwarten. Spidermans Kontrahent Doc Ock (für Octopus) ist eine solche parallel arbeitende Kampfmaschine – bestückt mit einer Batterie unabhängig voneinander einsetzbarer Gliedmaßen, die seine Durchschlagskraft entsprechend potenzieren.
Versucht man, solche Bilder und das Feuilletonwissen über den Alltag überlasteter Multitasker wissenschaftlich zu erfassen, zeichnet sich ein Typus ab, der sich keineswegs in der Kasuistik irgendwelcher Fallgeschichten und Typenkarikaturen erschöpft – um das all(ge)fällige Gender-Argument vom Multitasking-Monopol der Frauen gar nicht erst weiter zu strapazieren.6 Man könnte in ihm mit dem Soziologen Niklas Luhmann nicht weniger als das Resultat eines großangelegten sozialen Wandels sehen, an dessen Ende das aufgeklärte Individuum in seiner vollen Strahlkraft zum Erscheinen kommt. Die für die Systemtheorie Luhmanns alles entscheidende Frage, warum um alles in der Welt ein Individuum identischer mit sich und damit individueller als andere sein können soll, wird, vielleicht nicht in der Theorie, sehr wohl aber in der Praxis, häufig operativ entschieden – auf Kosten und mithilfe konsequenter Zeitnutzungen. Ausgehandelt wird die Individualitätszumutung, die den Übergang von hierarchischen zu funktional ausdifferenzierten Gesellschaftsformationen markiert und damit den Weg in die Moderne ebnet, über Steigerung und Zeitoptimierung, über Strategien der Selbstüberbietung und der mehr oder weniger passgenauen Taktung. Und weil an diesem Punkt die Ausprägung individueller Lebensstile und die Ökonomie der Selbstbewirtschaftung in ihrem theoretischen Anliegen in dieselbe Richtung zielen, erschöpft sich diese Geschichte keineswegs in der erwartbaren Einsinnigkeit lebensweltlich lokalisierbarer Leistungszumutungen. Sie ist gerade nicht auf einzelne Bereiche wie eine im Wandel begriffene Arbeitswelt einzuschränken, die, wie es in einer unlängst ausgestrahlten Fernsehserie hieß, Deutschland unter Druck setzt, sondern sie betrifft das Leben in seiner ganzen Fülle – auch und gerade in der Freizeit, der vormaligen Oase der Regeneration. Warum also ist die Wirkmacht der Mehrfach- und Parallelverarbeitung so ungebrochen, wenngleich sogar die wissenschaftlichen Begleitprogramme durchaus skeptisch sind und inzwischen wieder verstärkt der Serialität das Wort reden – einem Prinzip, das andernorts in seinen Schwächen zunehmend erkannt und durch Alternativen ersetzt worden ist? Längst sind wir es gewohnt, dass die einsinnige Linearität der Schrift durch Strukturen wie den Hypertext ergänzt bzw. verdrängt wird, wir nutzen Wissen in veränderten medialen Applikationen, Organisationsformen und Verweisstrukturen. Warum scheinen solche Parallelaktionen am Menschen zunehmend zu scheitern, und warum wird dennoch allerorten daran festgehalten?
Die Antwort auf die Frage nach der Beharrlichkeit des Multitasking hat mehrere Stoßrichtungen und, diesen geschuldet, unterschiedliche Narrative und Agenten, denen hier probeweise nachgegangen werden soll. Gestreift werden dabei Dinge, die auf den ersten Blick nichts oder nur wenig miteinander zu tun haben, die in ihrer Gänze aber ein Tableau ergeben, das für das Selbstverständnis und die Selbstbeschreibung der Gegenwart ein hohes Maß an Schlüssigkeit aufweist. Reizvoll daran ist nicht nur, dass unterschiedliche Wissens- und Disziplinformen aneinander geraten, etwa zur Veranschaulichung eines Arguments, zur Untermauerung einer Theorie sowie zur personalen Exemplifizierung durch einen bestimmten Typus, sondern dass in diesem Durchlauf historische Bezüge eine sonderbare und schwer zu beschreibende Rolle spielen. Was sich zeigen wird, sind Überkreuzstellungen von Positionen, die gerade angesichts von Veränderungen in den Naturwissenschaften Relektüren alter kultureller Phantasmatiken ermöglichen und somit rückwirkend zu deren Verständnis beitragen. Das ist zunächst und zugegebenermaßen trivial. In dem Moment, in dem das Fliegen oder die Raumfahrt technische Wirklichkeit geworden sind, haben Luftraum und fremde Planeten ihr Potenzial als phantasmatische Fluchtpunkte für die Zukunft eingebüßt. Weniger trivial ist aber der Befund, dass in diesem Prozess Natur und Kultur auf eine Weise in Stellung gebracht werden, die widersprüchlicher kaum sein könnte. Die Wechselhypothek verspannt Zukünfte und Vergangenheiten in einer Zeitlichkeit, die alles andere als linear ausgerichtet ist. Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, Wunschdenken und technische Realisierung, anthropologische und technische Datenverarbeitung, menschliche Kognition und Computertechnik, die grotesken Körper der Natur und die Möglichkeiten der transgenen Biologie – sie alle mitsamt den Beispielen und Typen, den Anwendungs- und Veranschaulichungsfeldern erzählen eine Geschichte, an deren Ende der Tritt in die Multitasking-Falle nicht ein beliebiges Ereignis unter anderen ist, sondern die conditio humana der Gegenwart und ihrer Zukunft. Allen Ratgebern und ihrer Rhetorik zum Trotz nimmt diese Verfasstheit ihr Maß kaum verhohlen und auf eine bestimmte Weise dennoch unterschwellig an den Möglichkeiten technischer Medien. Im Multitasking ist die Sorge um den Menschen mit der um die Maschine geeint.7
Hinter dieser Geschichte der modernen Individualisierung steckt jedoch noch eine andere. Es ist eine Geschichte, die scheinbar unbeschadet aller Vorgaben der Philosophie, aber auch der zuständigen Menschenwissenschaften und des sogenannten Alltagssachverstands den Status personaler Identitäten eigenwillig verhandelt. Auf die Frage Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?, die ihrem Verfasser, dem Philosophen Richard David Precht, immerhin eine Aufmerksamkeit weit über den Tellerrand seiner Fachdisziplin hinaus und Auftritte in zahllosen Fernsehshows beschert hat,gibt sie eine Antwort, die sich nicht in der wohlfeilen Beschreibung von Rollenvervielfältigungen in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften erschöpft oder sie auf die Flexibilitätsforderungen einer unter Druck geratenen Lebens- und Arbeitswelt herunterbricht.8 Vielmehr veranschlagt sie die Identität als eine zählbare Ressource mit steigerbarer Wertschöpfung und nimmt den Vorsatz beim Wort, mehr gelten zu wollen, als man es nach gängigen Konzepten personaler Identitäten kann. Derlei Geltungssucht hat nur wenig zu tun mit der Renommiererei als einer charakterologischen Fehlentwicklung und dem Renommisten als ihrem selbstüberheblichen Akteur. Wie an zahlreichen Fallgeschichten zu zeigen sein wird, verbleibt ihr Potenzial nicht im Metaphorischen, sondern soll der Sache nach Bestand haben und einem numerischen Wortsinn Rechnung tragen. Wie viele bin ich also wirklich, für wie viele kann ich mich halten – und wie hoch ist der Preis, den ich für derartige Optimierungen zu zahlen habe? Denn um eine solche Potenzierung zu erreichen, werden Strategien und Medien der Selbstvervielfältigung ersonnen, die das lineare Abarbeiten von Tasks durch Techniken vermeintlicher oder echter Parallelverarbeitung ersetzen wollen. Nach dem Grundsatz divide et impera wird sich geteilt, um, derart vervielfältigt, den Anforderungen der modernen Lebenswelt zu genügen. Der Befehl divide et impera, der den Maximen machiavellistischer Machtpolitik entstammt und Vorläufer in der nicht weniger machttrunkenen Kriegskunst des chinesischen Generals Sunzi hat, taugt als Versatzstück einer unablässigen Arbeit an und einer Sorge um sich – im Sinne jener Bestimmung, die ihr der späte Foucault zugedacht hat.
Dabei ist ein Aspekt besonders herauszustreichen. Dieser zielt auf die Möglichkeit, das Verhältnis von Spaltung und Vervielfältigung so zu konzeptualisieren, dass es nicht reflexartig dem Bereich des (Psycho-)Pathologischen und aller möglichen Symptomatiken von Depersonalisation, multipler Persönlichkeit und krankhafter Schizophrenie zugerechnet, sondern gerade umgekehrt zur Forderung und zur Herausforderung einer neuen Ökonomie erhoben wird.9 Der neue, der polypersonale Schizo ist ihr positives Leitbild, er ist es, der zur systemnotwendigen Einlösung gouvernementaler Selbstregierungs- oder Selbstumgangskünste taugt.10 Dieses Leitbild wird an unterschiedlichen Orten reflektiert und ausgehandelt, die trotz aller Gestreutheit einen gemeinsamen Fluchtpunkt zu haben scheinen und dort mitsamt den zugehörigen Teilgeschichten und ihren Protagonisten zusammenlaufen. Multitasking, wie es etwa der amerikanische Multimind-Performer Harry Kahne in den zwanziger Jahren durch Einsatz verschiedener Psycho- und Kulturtechniken einem staunenden Publikum vor Augen führte, ist nicht weit entfernt von gegenwärtigen Spekulationen, die im Umfeld eines biological engineering laut werden. Kahne jedenfalls verstand es, mit seinen vier Extremitäten und seinem Mund gleichzeitig auf eine Tafel zu schreiben, und auch sonst soll er in der Lage gewesen sein, bis zu sechs Tasks parallel und in allen denkbaren Körperhaltungen zu prozessieren – so war es naheliegend, dass er später als der Proto-Multitasker schlechthin gefeiert werden konnte. Das Alleinstellungsmerkmal, auf dem seine enorme Popularität und Marktfähigkeit gründeten, war seine sprichwörtliche Vielfalt: Kein Wunder, dass »The Man with the Multiple Mind« in seiner Unvergleichbarkeit als »The Incomparable Mentalist« bejubelt wurde, kein Wunder, dass der »Multiple Mentality Course«, den er anbot, sich großen Zulaufes erfreute und sogar zunehmend wieder erfreut: Vertrieb und Kommunikation erfolgen inzwischen via Internet, wo die Ratschlüsse des magischen Kahnes in die Rubrik diverser Selbstoptimierungskünste fallen – ein Besuch auf der Seite www.self-improvement-ebooks.com genügt, um sich solcher Imperien selbst zu bemächtigen. Auch die mit derlei Phänomenen verbundene Gruppenbildung hat nicht lange auf sich warten lassen: Wie eine Website der School of Phenomenal Memory Community belegt, lebt dort das Gedächtnis an ihn fort – etwa in Form von Links, mit denen die Mitglieder auf die Nähe der dort erlernten Techniken zu Kahne hinweisen.11 Wieder sind es Vervielfältigungsszenarien und ihre Verkörperungen, die Kahnes Anliegen mit einem naturwissenschaftlichen verbinden und die in einer aktuellen Diskussion verhandelt werden, die grundsätzlicher nicht sein könnte: Ausgelotet werden dabei die Chancen und Risiken einer Technik, die unter dem Label des Transhumanismus weit über die akademischen Spiegelfechtereien hinaus für Furore sorgt – nicht zuletzt, weil sie sehr handgreifliche Konsequenzen für die Definition des Menschen und die Ausgestaltung seiner künftigen Lebenspraxis hat.12
Abb. 4: Aus einem Wochenschau-Film von 1938:Der »ultimate multitasker« Harry Kahne schreibt kopfüber und rückwärts eine Textpassage aus einem Buch ab, während er sich mit dem Publikum unterhält.
So stellt Jean-Marie Lehn, der Begründer der submolekularen Chemie und Nobelpreisträger des Jahres 1987, entsprechende Überlegungen in den Kontext dessen, was unter die Zwischenüberschrift »Die Befreiung des Menschen von den Ketten der Evolution und der Dualismus von natürlich und unnatürlich« fällt.13 Anlass ist ein unlängst geführtes Gespräch über die Zukunft von Mensch und Technologie, genauer noch: über die Frage, ob wir auf der Grundlage neuer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse ewig werden leben können und ob wir das überhaupt wollen. Befragt nach den Möglichkeiten der von ihm mitbegründeten Synthetischen Biologie, gerät Lehn auf ein exemplarisches Feld der Perfektibilität, das er an der Befähigung zum Multitasking veranschaulicht. Was zunächst harmlos und nicht frei von Ironie wirkt (die Möglichkeit etwa, gleichzeitig zu schlucken und zu atmen), führt schnell zu grundsätzlichen Überlegungen, die an die Ikonografie parallel verarbeitender Hausfrauen und Performancekünstler, aber auch an die radioaktiv verseuchter Mutanten und technisch hochgerüsteter Kampfmaschinen anschließt: Warum, so sinniert der Chemiker und Nanotechnologe, sollte es nicht sinnvoll und zielführend sein, einen Menschen mit Flügeln oder mit vier Armen zu züchten – mit Blick auf die Resultate transgener Manipulationen in der Embryologie sei dies schließlich ein inzwischen vergleichsweise bescheidenes Unterfangen. Längst schon gäbe es, wie er mit Verweis auf die Arbeiten des Basler Embryologen Walter Gehring ausführt, Fliegen, die funktionstüchtige Augen an den Beinen haben, und überdies würde ihn, den um kulturellen Ausgleich bemühten Naturwissenschaftler, Mehrhändigkeit in die Lage versetzen, ohne einen musikalischen Partner vierhändig Klavier spielen zu können. Für die Vorhaltung seines Gesprächspartners, des Systembiologen Roman Brinzanik, damit werde die Grenze des Menschlichen gestreift oder gar überschritten, hat Lehn wenig Verständnis. Vielmehr kontert er mit dem sehr grundsätzlichen Hinweis, von Menschenhand geschaffene Dinge könnten überhaupt nicht unnatürlich sein, weshalb derlei Veränderungen selbst Teil des evolutionären Programms seien. Warum also sollte man auf die Möglichkeit verzichten, allein vierhändig zu musizieren oder sich auf derart natürliche Weise Flügel verleihen zu lassen?
Der Schriftsteller Jean Paul (1763-1825) schlägt fernab der Realität solcher Züchtungen in seinem Roman Dr. Katzenbergers Badereise einen achtbeinigen Doppelhasen vor, dessen sonderbar potenzierte Verfasstheit die Begehrlichkeiten des Anatomen Katzenberger auf sich zieht. Nicht nur der Umstand, dass in einem Zwischenkapitel mit der Überschrift »Mißgeburten=Adel« die Monstrosität als Wissensgenerator gefeiert wird, verbindet Jean Paul und seinen Doppelhasen mit einem ökonomischen Kalkül. Nicht das vierhändige Klavierspiel mit sich selbst, welches die Überlegungen des Submolekulargenetikers angestachelt hatte, sondern die Effizienz des historischen Botenwesens mit Relaisstationen, die dem Pferdewechsel dienten, werden jenem mit einem doppelten Satz Beine bestückten Wundertier, das »sogar sich an sich selber, wie an einem Bratenwender, hat umdrehen und auf die vier Relais-Läufe werfen können, um auf ihnen frisch weiter zu reisen, während die vier ausgespannten in der Luft aufruhten und selber ritten«, zum Vorbild.14