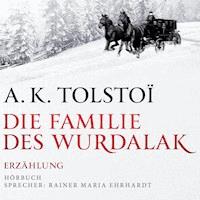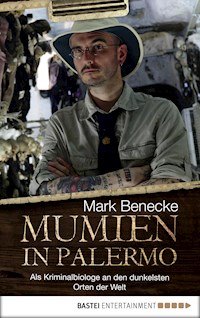
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ob Italien, Kolumbien oder Vietnam - Wie ein Indiana Jones der Kriminalbiologie wird Mark Benecke in die verschiedenen Länder dieser Welt gerufen, um dunkle Geheimnisse aufzuspüren, brutale Morde und unerklärliche Tötungen zu untersuchen. Dabei begegnet er korrupten Polizeibeamten und trifft auf skrupellose Mörder. Ein ganz besonderer Fall sind die Mumien, die in einem Kapuzinerkloster in Palermo aufgefunden werden. Hunderte, vielleicht tausende. Er lernt die Mönche kennen. Was haben sie zu verbergen? Dr. Made packt seinen Koffer und kommt der Wahrheit auf die Spur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Mark Benecke
Mumien in Palermo
Als Kriminalbiologe an den dunkelsten Orten der Welt
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Fotos Innenklappen: Archiv Mark Benecke
Karten Innenklappen: Sarah Franke, Köln
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
Einband-/Umschlagmotiv: © Archiv Mark Benecke
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-2955-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Neuigkeiten vom Autor unter: www.benecke.com
Vorwort
Das Publikum entscheidet – nicht nur die Themen meiner Vortragsabende, sondern auch, dass ich die folgenden Fälle aufschreibe.
Dieses Buch ist mein Geschenk an alle Zuschauer:innen und Zuhörer:innen, Studierenden und Fans, denn ohne Ihre Nachfragen wären mir viele Details, auch in meinen eigenen Fällen, nie aufgefallen. Danke schön.
Es freut mich, dass gerade die schrägen Themen dabei so oft nachgefragt werden. An Aliens und entflammten Menschen kann man seine Kombinations- und Experimentiergabe schärfen, weil gedankenlähmende Vorurteile dabei besonders harmlos wirken. Sind sie aber nicht.
Den Fall von Therese von Konnersreuth habe ich deshalb kurzfristig mit in das Buch genommen. Er zeigt uns, warum nur rechtzeitige, sachliche Aufklärung ein später nicht mehr beeinflussbares Glaubensgebilde verändern kann.
Ich möchte zudem zeigen, dass auch die kauzigste Forschungsrichtung kriminalistische Bedeutung haben kann. Nicht jeden Fall können wir mit dem klassischen kriminalistischen Besteck bearbeiten. Einige Forscher:innen, die sich nicht für Forensik interessieren – ich mich aber sehr für ihre Forschungen – stelle ich Ihnen daher ebenfalls hier vor. »Picking someone’s brain«, nennen die Amerikaner:innen, was ich mit diesen Kolleg:innen mache; zu deutsch: durch Fragen lernen.
Vorweg noch eine große Verbeugung an Martin Schöller, der mich 1998 in Manhattan für eine forensische Reportage auf analogem Film porträtierte. Er ist heute einer der bekanntesten Fotografen Nordamerikas, dabei aber so menschlich und cool wie früher geblieben. Für dieses Buch hat er zwei Fotos zur Verfügung gestellt.
Im Namen der Leser:innen danke ich auch dem Verlag, der Ihnen und mir nach zwanzigjähriger Zusammenarbeit ein Buch mit durchgehend farbigen Abbildungen ermöglicht hat.
Damit entlasse ich Sie in die Welt der besonders sonderlichen Fälle. Ich hoffe, Sie folgen mir auf verschlungenen und manchmal detailreichen Wegen. Dabei wird sich ein eigenwilliges Rätsel nach dem anderen lösen und lichten.
Wie immer gilt dabei: Glauben Sie nichts.
Prüfen Sie alles.
Mark Benecke
Amsterdam und London, Sommer 2016
Eine Alien-Autopsie
Niemand (auf der Erde) weiß, ob es Außerirdische gibt. Vielleicht können wir sie einfach nicht wahrnehmen – sie könnten riesig oder sandkornklein sein. Wabern sie wie Nebel durch die Gegend oder gleichen sie Radiowellen, die sogar durch uns hindurchreichen? Und wer sagt, dass Aliens auf der Erde leben? Vielleicht stürzt ja bloß manchmal eine Gestalt ab, landet in unserem Schwerefeld und kracht – wenn ihr Schiff nicht verglüht – auf die Erdoberfläche.
Wir prüfen in der naturwissenschaftlichen Kriminalistik nichts, was wir nicht messen oder beschreiben können. Zu den nicht genügend genau beschriebenen und daher unprüfbaren Wesen und Dingen gehören Gott, die Gerechtigkeit und Geister. Was wir nicht messen können, besprechen wir nicht.
Als ich gefragt wurde, ob ich eine Alien-Autopsie untersuchen wollte, war die Antwort trotzdem nicht so einfach. Denn es gab eine Tatort-Spur – einen verwackelten Schwarz-Weiß-Film aus Roswell, angeblich aus dem Jahr 1947. Das Team aus den USA wollte wissen, ob der Film und damit die Sektion des außerirdischen Lebewesens echt sein kann oder nicht. Der Tonmann der Produktion hatte berichtet, dass alles innerhalb weniger Tage als Fälschung im Hinterhof zusammengestrickt worden sei. Doch mehr als sein Wort hatten wir nicht.
Also schaute ich mir das rätselhafte Werk an. Auf den ersten Blick verblüffte mich weniger das Alien als die seltsame Uniform der Untersucher. So einen Schutzanzug hatte ich noch nie gesehen. Doch es gibt vieles, was ich noch nie gesehen habe.
In New York hatte ich schon neben dem Chef des Institutes für Rechtsmedizin im Sektionssaal gestanden, der in Straßenkleidung dieselbe Leiche aufschnitt, an welcher der ebenfalls neben ihm stehende Präparator wegen der damals zunehmend auftretenden Krankheiten Hepatitis C und AIDS in einem Vollschutzanzug, einer Art Astronauten-Outfit, arbeitete. Wer wollte da entscheiden, ob die KollegInnen im Jahr 1947 in einer Militärbasis in der Wüste nicht auch unübliche Schutzkleidung trugen, während sie das Alien zerlegten?
Ungewöhnliche, aber nicht unmögliche Sektionsausrüstung bei der Alien-Autopsie: Strahlenschutzausrüstung oder ein Anzug gegen biologische oder chemische Kampfstoffe?
Merkwürdig am Alienfilm war auch, dass die UntersucherInnen darin nur zaudernd an der Leiche arbeiteten. Die meisten Handgriffe bei einer Sektion sind Tag für Tag dieselben, und wie bei jedem anderen Beruf stellt sich daher nach einiger Zeit Routine ein. So prüfen RechtsmedizinerInnen beispielsweise immer die Leichenstarre, indem sie einen Arm oder ein Bein der toten Person anwinkeln (beziehungsweise es versuchen), und setzen immer gleiche Schnitte, um die inneren Organe untersuchen zu können. Die Ärzte auf der Militärbasis in Roswell arbeiten im Film aber nur ganz zaghaft, zeigen nach hier und nach dort und scheinen in einer Szene sogar den Pulsschlag an einer großen Ader am Hals zu prüfen. Und das bei einem auf die Erde abgestürzten Alien, dessen Raumschiff zertrümmert sein soll und aus dem trotz schwerer Beinverletzung keine Flüssigkeiten austreten.
Doch wer weiß schon, was den KollegInnen kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges angesichts eines kindlich oder krank aussehenden Besuchers aus dem All während dessen Sektion durch den Kopf gegangen sein könnte.
Also suchten wir nach härteren, messbaren und besser prüfbaren Tatsachen. Wir fanden sie – aber nicht durch Tüfteln, Zeugen oder Nachdenken, sondern mittels biologischer Vergleiche. Wir fragten uns, ob die Körperzusammensetzung und der Aufbau des fremden Wesens – egal, wo es herkam – unter den im Film erkennbaren Bedingungen Sinn ergaben.
Anatomische Besonderheiten
Nachdem wir die Filmaufnahmen kontrastverstärkt hatten, zeigte sich, dass das Alien am schwer verletzten, durch den Absturz geöffneten Bein eine schräge Wunde aufwies. Darunter lag ein Hohlraum. Die Wunde musste also in einer festen, dicken Schicht liegen, fast wie ein Lochbruch eines Rohres. Das ist eigentümlich, weil lebende Körper eigentlich anders stabilisiert sind. Und einen lebenden Körper hatte unser Alien ja.
Beispielsweise gibt es auf der Erde keine meterhohen Riesenspinnen, weil diese – wie offenbar auch die Beine unseres Außerirdischen – außen hart und innen weich sind. Eine harte Außenhülle muss mit zunehmender Größe der Riesenspinne aber immer dicker werden, damit sie das Gewicht tragen kann. Da solch eine feste Hülle steif sein muss, können die ebenfalls immer dicker und steifer werdenden Gelenke bald nicht mehr arbeiten. Riesenspinnen wären also unbewegliche Spinnen. Darum könnten sie uns nichts anhaben.
Warum hat das Alien im Film also einerseits eine dicke, steife Außenhaut, zugleich aber die Gelenke eines Menschen, bei dem die steifen Knochen innen liegen? Denn menschliche Gelenke funktionieren ja überhaupt nur durch ihre außen liegenden Muskeln und Sehnen, die mit den innen liegenden Knochen verbunden sind. Beim Alien stimmt also etwas nicht.
Zur Erklärung, warum dieser biologische Widerspruch so interessant ist: Unsere Außenhülle, die Haut, ist sehr stabil. Man kann Haifisch-Angelhaken hindurchstecken und Menschen damit in die Luft ziehen (body suspension). Sie ist aber trotzdem nicht hart und steif, sondern eine bieg- und dehnbare Hülle. Das Alien ist biomechanisch also verdächtig menschenähnlich aufgebaut, ohne offenbar unter irdischen Bedingungen entstanden zu sein.
Gleichzeitig ist das Wesen so vermurkst konstruiert, dass keine Umwelt auf anderen Planeten dazu passt. Denn käme es von einem Planeten mit großer Schwerkraft, würden wir ein gedrungenes Wesen erwarten, das nicht auf zwei schlanken Beinen geht. Bei geringerer Schwerkraft erwarten wir ein fluffig-elastisch gebautes Alien, ohne die harte Außenschicht unseres Film-Fremdlings, die beim Unfall wie erwähnt gleich einem außen harten Rohr aufgebrochen wirkt.
Die Schwerkraft wirkt aber im ganzen Universum, auch auf anderen Planeten, und lässt sich nicht abschirmen. Sie verhält sich nicht wie magnetische oder elektrische »Strahlen«, die wir durch eine Metallwand abblocken können. Die Anziehung von Massen lässt zwar mit zunehmender Entfernung nach, ihre Wirkung ist aber doch unbegrenzt und nicht abschirmbar. Sie endet nie.
Wenn daher Lebewesen, die wie unser Alien Arme und Beine haben, auf einem Planeten aufwachsen, dann sind sie immer der Schwerkraft dieses Planeten ausgesetzt. Massen ziehen sich an – auch Planeten und deren BewohnerInnen gegenseitig. Die Schwerkraft wirkt sich darum auf den Bauplan aller Lebewesen aus, auch auf unser Alien. Und dessen Konstruktion sieht bezogen auf den der Schwerkraft angepassten Aufbau verdammt erdenähnlich aus.
Alienblut
Man könnte nun – entgegen aller bisherigen archäologischen Funde – einwenden, dass das Alien vielleicht von Ahnen abstammt, die irgendwann einmal die Erde besucht hätten (oder wir sie). Die Erbsubstanz wäre ausgetauscht und vermischt worden, und danach hätten die Wesen mit großem technischen Aufwand Raumstationen mit anderen Schwerkraftverhältnissen gebaut und jeden Tag wie menschliche Astronauten ein Fitnessprogramm betrieben, um ihre Knochen und Muskeln funktionsfähig zu halten.
Doch selbst diese schon herausfordernde Annahme hilft uns nicht, den Körperbau des Wesens zu verstehen. Denn es geht nicht nur um Knochen und Muskeln. Das tote Alien hat auch keine Totenflecken, obwohl bei seiner Sektion Blut oder eine andere Flüssigkeit aus seinem Körper läuft.
Teile des Blutes sickern mit der Schwerkraft ins Gewebe und bleiben dort stecken: Totenflecken. Die Frau lag auf dem Rücken – dort, wo die Matratze und Falten gegen den Körper drückten, gelangte kein Blut ins Gewebe (weiße Aussparungen).
Wenn eine Flüssigkeit auf der Erde in einem lebenden Körper wie Blut funktioniert, dann sammelt sie sich durch die Schwerkraft in unteren Körperbereichen an. Langstrecken-Reisende kennen das, weil die Beine nach einigen Stunden ohne Bewegung wehtun. Ältere Menschen kennen es als »Wasser in den Beinen«, jüngere vielleicht von einer Ohnmacht, wenn ihr Herz nicht mehr stark genug schlägt, um das Blut gegen die Schwerkraft nach oben, in Richtung Gehirn, zu transportieren.
Bei toten Menschen entstehen deshalb Totenflecken. Das sind rötlich gefärbte Bereiche des Körpers, in welche die Schwerkraft Teile des Leichenblutes gezogen hat. Nach einigen Stunden sitzen diese toten, roten Blutverfärbungen dauerhaft im Gewebe fest und lassen sich nicht mehr verschieben, beispielsweise durch einen Daumendruck auf die betreffende Stelle. Die Totenflecken fließen bald auch nicht mehr an andere Gewebestellen, wenn man die Leiche dreht. Warum also hat das Alien keine Totenflecken?
Möglich wäre, dass die blutartige Flüssigkeit des Aliens farblos ist. Sein Blut würde dann zwar ins Gewebe sinken und dort Flecken erzeugen – wir könnten sie wegen der fehlenden Eigenfarbe aber nicht sehen.
Farbloses Blut? Das hört sich verrückt an, ist aber auch auf der Erde weitverbreitet. Die meisten irdischen Lebewesen transportieren ihre Nähr- und Botenstoffe mit einer hellen, nicht wie bei Menschen rot gefärbten Flüssigkeit durch ihre Körper. Insekten verwenden dazu beispielsweise farblose Hämolymphe. Das Blut von Tintenschnecken, Krebsen, Spinnen und Muscheln enthält statt Eisen die Kupferverbindung Hämocyanin. Auch sie ist farblos. Es gibt also farbloses Blut auf der Erde, und vielleicht auch anderswo.
Während der Sektion des Aliens aus Roswell rinnt aber dunkles Blut aus seinem Halsschnitt. Da seine erkennbar dicke Haut mit Nährstoffen versorgt werden muss, muss die Nahrung dafür durch Blut ins Gewebe gebracht werden. Einfaches Sickern oder Diffusion genügen dafür nicht, weil damit nur kurze Strecken überbrückt werden können, beispielsweise bei Bakterien. Entweder ist das Blut des Aliens also hell (ist es aber nicht) oder es gelangt ins Gewebe und muss dann Totenflecken erzeugen (passiert auch nicht).
Vermutlich hat hier jemand eine irdische, richtige Beobachtung auf eine fremdplanetarisch erfundene Wirklichkeit gepropft. Immerhin – das ist eine Stoßrichtung, die sich durch Spuren und Beweise, auch ohne Glauben und Meinen, verfolgen lässt.
Füße auf Abwegen
Ungewöhnlich sind auch die Füße des Aliens. Warum sollte auf einem anderen Planeten dieselbe Fußform entstehen, wie wir sie auf der Erde von Menschen – und nur von Menschen – kennen? Selbst wenn der fremde Planet erdähnlich oder der Erde sogar bis ins Kleinste gleich aufgebaut wäre: Dort entstehende Körper wären, auch unter vollkommen gleichen Umweltbedingungen, anders aufgebaut.
Lebewesen entwickeln sich – sogar auf ähnlichen Planeten – stets stark unterschiedlich, weil die Entwicklung des Lebens als Einbahnstraße verläuft. Bereits »entwickelte«, also bei lebenden Wesen vorhandene Organe, Knochen und dergleichen können zwar in weiter entwickelten Lebewesen wiederverwendet und umfunktioniert werden. Eine Neuordnung der vielen verschachtelt arbeitenden Gewebeteile ist aber unmöglich.
Wenn ein solcher Neubau möglich wäre, dann hätte sich mit der Entwicklung des aufrechten Ganges von Affen und Menschen beispielsweise der Bau des Beckens und der Gelenke völlig verändert. Neugeborenenköpfe würden dann bei einer vaginalen Geburt nicht mehr stark zusammengequetscht, SportlerInnen würden die Bänder nicht reißen, und Bandscheibenvorfälle gäbe es auch nicht mehr. All diese Unvollkommenheiten kommen daher, dass Becken, Bänder und Bandscheiben Kompromisskonstruktionen sind. In der Evolution müssen die zum Überleben nötigen und sinnvollen Aufgaben stets mit den körperlich schon gegebenen Möglichkeiten in Einklang stehen. Da man aber weder auf Geburten noch auf Bewegung verzichten kann, muss das bereits vorhandene, beispielsweise für den vierbeinigen Gang gebaute Material, so angepasst werden, dass es funktioniert. Perfekt wäre etwas ganz anderes, nämlich ein Neubau von Grund auf. Es ist also sehr ungewöhnlich, dass in dieser Einbahnstraße aus irdischen Zufällen mit Vulkanausbrüchen, Kriegen und Klimaveränderungen über Jahrmillionen genau der gleiche Fuß bei Aliens und Menschen vorkommen soll.
Selbst auf einem sehr ähnlichen Planeten wäre daher der Aufbau der Lebewesen über die Jahrhunderttausende immer wieder an kleinen Abzweigungen, in kleinen Schritten, ein wenig anders verlaufen. Fluten, Sandstürme und Kälte löschen beispielsweise immer wieder einen Teil der Lebewesen zufällig aus, und eine etwas anders gebaute Form von Lebewesen überlebt ebenso zufällig. Die wunderschöne Vielfalt der Lebensformen auf der Erde zeugt von solchen Zufällen und kleinen Konstruktionsschritten. Nicht nur wird jede Nische der Welt – von einer heißen Quelle unter Wasser bis zum Schnee in den Bergen – von Lebendigem besiedelt. Die Besiedlung verläuft eben auch durch Verdrängungen, Zufälle, Katastrophen im Rahmen des genau dann und dort gegebenen genetischen Spielraumes.
Es gibt auf der Erde deshalb nicht nur sehr viele Fußformen (Pferde und Vögel gehen auf ihren Zehen, Enten haben Schwimmhäute), sondern auch verschiedene Augenarten. Tintenschnecken haben beispielsweise keinen blinden Fleck in der Netzhaut, eine schlitzförmige Pupille und eine andere Linsenfüllung. Ihr Auge ist anders als Menschenaugen aufgebaut, obwohl es ähnlich aussieht.
Wenn es nun schon auf der Erde Millionen getrennter Entwicklungen, darunter sogar Neuerfindungen der Sehorgane gab – warum sollte dann auf einem anderen Planeten ausgerechnet ein bis ins Detail gleicher Menschenfuß oder ein irdisch anmutendes Menschenauge entstehen?
Box: Alien-Augen
Mein Kollege (und Vorbild) Prof. Dr. Benno Meyer-Rochow ist der produktivste Forscher, den ich kenne. Er gewann einen Ig-Nobelpreis für Strömungslehre in Harvard, nachdem er den Druck berechnete, mit dem Pinguine ihren Kot sternförmig ums Nest spritzen. Dabei durfte er die Tiere nicht anfassen, weil das in freier Natur streng verboten ist.
Meyer-Rochow, der mittlerweile in Japan lebt, hat Suizide unter Sehbeeinträchtigten erforscht, den Einfluss von Licht vor der Geburt auf das menschliche Leben danach geprüft und die Augen von Kerbtier- und Schnecken-Arten beschrieben, die noch nicht mal Google kennt. Jüngst hat er haarige Larven rasiert und festgestellt, dass sie danach im Wasser untergehen. Ich kenne keinen Forscher, der so viele jenseits des Tellerrands liegende biologische Arbeiten geschrieben hat wie er.
Da er sich seit Jahrzehnten mit dem Aufbau der Augen von Motten, Schnecken, Menschen, Krebsen und Krokodil-Eisfischen sowie der Wirkung von Licht auf Lebewesen beschäftigt, fragte ich ihn, wie viele Sorten von Augen er auf der Erde kennt.
Mark/Frage:
Welche irdischen Augentypen fallen Dir auf Anhieb ein?
Experte unter anderem für Augen von Lebewesen, selbst an sehr entlegenen Orten: Benno Meyer-Rochow.
Benno Meyer-Rochow/Antwort:
Eine durchaus »markige« Frage: Soll sie sich nur auf Menschen beschränken (auf Augenfarbe und Augenform) oder die Tierwelt mit einbeziehen?
Beim für die Aufnahme des Lichts notwendigen Sehpigments gibt es im Tierreich mindestens vier Typen, die man als »retinal A1, A2, A3 und A4« unterscheidet. A1 und A2 sind fast überall bei Wirbeltieren zu finden (A2 auch bei manchen Krebstieren), A3 bei Insekten und A4 (selten) bei Krebstieren. Da A1 auch bei sogenannten Purpurbakterien auftritt, kann man wohl davon ausgehen, dass es das ursprünglichste Sehpigment ist.
Die vier Typen schließen allerdings nicht aus, dass es auch eventuell noch weitere gibt. Im Auge des Tintenfischs Watasenia, einem leuchtenden Kalmar, sind sogar drei Sehpigmente (A1, A2 und A4) vorhanden.
Mark/Frage:
Eine große Vielfalt, schon bei den Bausteinen der Augen. Wie schaut es mit ganzen Augen aus?
Benno Meyer-Rochow/Antwort:
Damit kommen wir zur Optik. Da sind zwei Haupttypen zu unterscheiden: einerseits Augen mit nur einer Hornhaut und Linse sowie andererseits die bekannten Facettenaugen mit oft vielen Hundert sogenannten Ommatidien, die alle selbst eine winzige Cornea und ein Linsengebilde, das man Kristallkegel nennt, besitzen.
Die Sache wird aber dann viel komplizierter, weil es nämlich von beiden Augentypen zahlreiche Unterabteilungen gibt. Ja, es gibt sogar Fische mit beidseitig in »Überwasser-« und »Unterwasseraugen« getrennte Augen, also vieräugige Fische.
Ähnliches gibt es auch bei manchen Insekten. Taumelkäfer, die auf der Wasseroberfläche entlangflitzen, aber auch manche Eintagsfliegen- und Leuchtkäfermännchen, bei denen das eine Facettenauge nach oben in den Himmel schaut und das andere Facettenauge zur Seite und nach unten schielt. Darüber hinaus haben viele Insekten noch sogenannte einlinsige Stirnaugen (das sind keine Facettenaugen, sondern Einzelaugen, die dem Insekt wohl Informationen über die Lichtintensität vermitteln und nicht zum Formsehen beitragen).
Larvenaugen, sogenannte Stemmata, kommen als eigener Augentyp noch hinzu, verschwinden aber bei der Umwandlung von der Larve zum erwachsenen Insekt und werden dabei durch die Facettenaugen ersetzt.
Unser Kollege Siegmund Exner-Ewarten hat schon 1891 zwischen sogenannten Appositions- und Superpositionsaugen bei Insekten und Krebstieren unterschieden. Das sind zwei sehr wichtige Untertypen, aber von denen gibt es dann auch wieder wenigstens fünf weitere Untertypen. Und würde man versuchen, die Augen nach ultrastrukturellen, retinalen Gesichtspunkten zu klassifizieren, dann käme man wohl auf mindestens fünfzig retinal verschiedene Facettenaugen.
Mark/Frage:
Ich staune.
Benno Meyer-Rochow/Antwort:
Bei einlinsigen, also Wirbeltieraugen, ist es auch nicht viel anders: Alle – abgesehen von den oben erwähnten vieräugigen Fischen – haben nur eine Linse.
Aber sowohl die Pupille als auch die Iris können gewaltig unterschiedlich sein: die Pupille in Form und Größe, die Iris in Farbe und Ausbreitung. Bei der Retina fällt dann hauptsächlich die Unterscheidung in Zäpfchchen (»cones«) und Stäbchen (»rods«) auf. Bei Tiefseefischen gibt es aber noch viele so genannte »banked retinas«, das sind hintereinanderliegende, gestaffelte Sehzellen.
Spinnentiere und Tintenfische haben keine Facettenaugen, sondern einlinsige Augen. Deren Entwicklungen verlaufen allerdings anders als die der Wirbeltier-Einlinsen-Augen. Während bei Wirbeltieren die Retina ein Auswuchs des Gehirns ist, entstehen die Retinas der Einlinsenaugen von Spinnen und Tintenfischen, und auch einiger Quallen, durch Einsinken und Umgestaltung der Außenhaut nach innen hin.
Wirbeltieraugen hingegen sind »umgedrehte« Augen, das heißt, Licht hat eine Reihe von Zelllagen zu durchqueren, darunter verschiedene Arten von Nervenzellen, bis es die Sehzellen erreicht. Spinnen- und Tintenfischaugen sind »direkte« Augen, die Nervenzellen liegen also hinter den Sehzellen. Das Licht erreicht die Sehzellen, bevor die anderen Zellen erreicht werden.
Mark/Frage:
Schwer vorstellbar, dass diese Vielfalt auf einem anderen Planeten ebenso entstanden wäre und zu einem menschenähnlichen Auge geführt hätte.
Benno Meyer-Rochow/Antwort:
Es wird sogar noch komplizierter. Wenn man die sogenannten Nadelloch-Kameras und Augengruben bei manchen Weichtieren und Plattwürmern noch als Augen bezeichnet, dann würden wir noch mehr Augentypen hinzuzurechnen haben, und ein Kontinuum von lichtempfindlichen Hautarealen bis hin zum komplizierten Menschenauge würde uns eine zumindest optisch und anatomisch große Zahl von Augentypen bescheren.
Wollte man ganz grob eine Einteilung nach anatomischen Gesichtspunkten vornehmen, so käme man vielleicht mit einem Dutzend Augentypen aus – aber es dürfte klar sein, dass die Sache kompliziert ist und wenigstens nur hinsichtlich der Sehpigmente einigermaßen Klarheit herrscht.
Ganz interessant vielleicht noch: Würfelquallen besitzen einlinsige Augen mit Retinas und so weiter, aber sie haben kein Gehirn! Was also kam zuerst: Gehirn oder Auge?
Und ebenfalls kompliziert: Die Zirbeldrüse ist ja bei niederen Wirbeltieren (Amphibien, manchen Reptilien und Fischen) noch ein richtiges drittes Auge im Gehirn, das bei Säugetieren zur Epiphyse und nach Descartes zum Sitz der Seele wurde.
Dieselbe Vielfalt wie bei den Augen gibt es wie gesagt auch bei irdischen Füßen. Allerdings brauchen wir hier keinen Fußspezialisten mehr als Fachmann, sondern können uns die Vielfalt einfach in der Natur, im Zoo oder im Internet ansehen.
Auch auf anderen Planeten würden Tausende von Fußformen entstehen. Warum das Alien auf dem Sektionstisch ausgerechnet Menschenfüße – wenngleich mit sechs Zehen – hat, ist daher unerklärlich und zu viel des Zufalls. Kurz gesagt: Unser Alien kommt von der Erde.
Versöhnliches zum Schluss
Es gibt noch viele weitere biologische Details, die beweisen, dass das Film-Alien aus Roswell nicht echt sein kann. Wie Sie gesehen haben, hilft die biologische Betrachtung mehr als jede Verschwörungstheorie oder Grübelei dabei, das Unwahre auszuschließen und das Wahre darzustellen.
Zweierlei muss ich dem Alien-Sektionsfilm, nachdem ich ihn oft gesehen habe, ohnehin lassen. Erstens ist die Fälschung mit Liebe angefertigt – zumindest mehr, als es angesichts eines reflexhaften »Aliens gibt es eh’ nicht« auf der einen und »Außerirdische müssen die Erde besucht haben« nötig gewesen wäre.
Zweitens habe ich aus der Untersuchung gelernt, dass sich sehr leicht falsche Grundannahmen in unsere Köpfe einschleichen. So herrschte beispielsweise lange die Überzeugung, dass es das Spiralkabel am Telefon im Hintergrund des Alien-Sektionsraumes (Abb. S. 12) im Jahr 1947 noch nicht gegeben habe. Nur weiß ich erstens nicht, ob das Militär nicht die ein oder andere Technik – auch Telefonspiralkabel – früher eingesetzt hat als der Rest der zivilen Welt. Und zweitens ergab sich bei sehr genauem Nachforschen, dass solche Kabel eben doch schon, auch für »Zivilisten«, damals verfügbar waren.
Der Fehler des Alienfilms ist nicht eine lieblose Ausstattung, sondern die mangelnde biologische Schlüssigkeit – sein Blut, die Augen und Füße und vieles mehr müssten einfach fantasievoller und anders aussehen, weil auch bei einer ähnlichen Umwelt verschiedene Lösungen entstehen.
Die Zelluloid-Schnipsel des angeblichen Kameramannes aus Roswell, die laut Produzentenmärchen fünfzig Jahre lang versteckt waren und dann beim Londoner Filmproduzenten Ray Santilli auf einmal auftauchten, sind durch ihre biologischen Widersprüche enttarnbar. Es ist keine Glaubensfrage, sondern eine Tatsache, dass in diesem Film eine Puppe zerteilt wird. Genau deshalb haben wir den schönen Fall bearbeitet: ein kriminalistisches Gehirntraining nach meinem Geschmack.
Beim nächsten Alien-Fund bin ich daher gerne wieder dabei.
Die biologische Formenvielfalt ist wild, frei und von Millionen von zufälligen Auswahlprozessen der Umwelt, aber auch durch Katastrophen geprägt. Warum sollte auf einem anderen Planeten ein menschenähnliches Lebewesen entstehen, wenn schon auf der Erde der blanke Zufall regiert? Im Uhrzeigersinn: Siebzehn Meter lang, achttausend Kilogramm schwer: der Riesen-Dino Spinosaurus aegyptiacus; die verdammt intelligente Krake Octopus vulgaris; der Kurzschnabel-Ameisen-Igel Tachyglossus aculeatus, ein Eier legendes Säugetier aus Australien, sowie der bis zu fünfzig Jahre alt werdende Zwergflamingo Phoeniconaias minor – unterschiedlicher geht’s nicht.
Während selbst Ufo-Fans heutzutage oft mit Augenzwinkern auf ihre Beobachtungen schauen, ist das im Bereich althergebrachter Religionen (und in der Politik) anders. Politische und religiöse Einstellungen haben die unlogische Eigenart, dass sie von den jeweils Überzeugten stets für wahr gehalten werden. Das ist lustig, denn wie der Lauf der menschlichen Kulturen zeigt, hat noch niemand immer recht gehabt. Wenn es um nicht messbare Einheiten wie Gott oder die Seele – jenseits der messbaren Gehirnfunktionen – geht, dann ist die Chance für Irrtümer noch viel größer.
Über Religion und Politik streite ich mich daher nicht. Ihre Glaubensgrundlagen sind ja eh nicht messbar. Zudem bin ich mit der kölschen Einstellung, dass jeder glauben kann, was er oder sie will, solange er andere damit nicht einschränkt, aufgewachsen. Mit dieser entspannten Geisteshaltung habe ich gelernt, dass in den meisten Menschen ein sozialer und guter Kern steckt. Religion hat damit meist wenig zu tun. Wenden wir uns also lieber den beweisbaren Tatsachen zu. Denn das geht auch bei religiös auslegbaren Erscheinungen.
Therese Neumann arbeitete seit sechs Jahren auf einem Bauernhof, als sie im Alter von zwanzig Jahren zu kränkeln begann und zusammenbrach. Sie wurde blind und taub, litt an Lähmungen und wurde fortan gepflegt. Fünf Jahre lang hütete sie das Bett, bis sie am Tag der Seligsprechung der Karmeliter-Nonne Therese von Lisieux plötzlich wieder sehen konnte. Etwa zwei Jahre später, am 17. Mai 1925 – das war der Tag der Heiligsprechung ihrer Namenspatronin – bildeten sich auch Therese Neumanns Lähmungen zurück.
Psychologisch waren solche Ausfälle, besonders die der Sinnesorgane, schon seit 1895 beschrieben. Die Forschungen von Sigmund Freud und Josef Breuer zur damals noch so genannten »Hysterie« waren aber noch nicht in Therese Neumanns Dorf am oberpfälzischen Steinwald gelangt. Dort, zwischen Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, war man damals weit von aktuellen Wissenschaftsberichten entfernt.
Zwar waren schon seit Jahrhunderten, auch vor den Berichten von Freud und Breuer, »hysterische« Störungen ohne körperliche Ursache bekannt, die verschiedene Erkrankungen erzeugten. Besonders dabei waren Gehstörungen, Lähmungen, Störungen der Berührungsempfindlichkeit und eben auch Taub- und Blindheit. Doch niemand konnte diese Auffälligkeiten einordnen.
Heute wissen wir, dass solche Störungen sich nur dann entfalten, wenn Publikum vorhanden ist. Dazu reicht eine aufmerksame Person, aber mehrere Menschen sind besser.
Da sich der Begriff »Hysterie« heute abfällig anhört, nennt man die Auffälligkeiten lieber »Konversions- oder somatoforme Störung«. In milder Ausprägung kennt sie jeder – es sind die bekannten psychosomatischen Veränderungen oder körperliche Schwierigkeiten, die in Wahrheit auf Probleme mit der Umwelt und sich selbst zurückzuführen und in den Körper »umgeleitet« werden. Auf diese Weise hält sich der menschliche Geist unangenehme oder unerträgliche persönliche Schwierigkeiten eben nicht vom Leib, sondern von der Seele. Die Umleitung in den Körper geschieht also, weil der Geist die Probleme nicht abarbeiten kann. Solche Probleme können unterdrückte sexuelle Wünsche, Todesfälle, Katastrophen und Ähnliches sein. Wenn solche Probleme zu schwer oder zu weit ferngehalten werden, kann es statt der heute weitverbreiteten Rücken- oder Kopfschmerzen auch zu krassen Ausfällen wie Lähmungen, Krampfanfällen, Blindheit und – das wird gleich noch interessant – auch zu tagträumerischem Geschichtenerzählen kommen.
Ausbruch einer Hysterie
Therese Neumann hatte im März 1918 einen schweren Brand in ihrem Dorf miterlebt, der sie körperlich und geistig mitgenommen hatte. Ob dieses gewaltige Scheunenfeuer der Grund für ihr späteres Verhalten war, werden wir nie erfahren. Therese ist aber eine derart typische »Hysterische« alter Schule, dass es schon fast gruselig ist, die wissenschaftliche Erstbeschreibung der Entdecker dieser Auffälligkeit zu lesen.
Man findet, so berichten Sigmund Freud und Josef Breuer, »unter den Hysterischen die geistig klarsten, willensstärksten, charaktervollsten und kritischsten Menschen. In ihren hypnoiden Zuständen sind sie alieniert [von sich entfremdet], wie wir es alle im Traume sind.
Der typische Verlauf einer schweren Hysterie ist der, dass zunächst in hypnoiden Zuständen ein Vorstellungsinhalt gebildet wird, der dann, genügend ausgewachsen, sich während einer Zeit von akuter Hysterie der Körperinnervation und der Existenz des Kranken bemächtigt. Anfall und normales Leben gehen nebeneinanderher, ohne einander zu beeinflussen.«
In einem berühmten Fallbericht der Patientin Anna O. schildert Breuer, dass »der Gegensatz zwischen der unzurechnungsfähigen, von Halluzinationen gehetzten Kranken und dem geistig völlig klaren Mädchen höchst merkwürdig« ist. Es ist also das Wesen der Hysterie oder der Konversionsstörungen, dass die Betroffenen nicht laufend »verrückt« wirken.
Religiöse Menschen haben hierbei eine andere Sicht. Wenn andere Menschen glauben, Gott oder seine Propheten zu sehen oder ihn durch sich sprechen zu lassen, so halten Gläubige das für wahr und möglich. Auch in Konnersreuth galten Thereses Leiden für gottgewollte Besonderheiten. Therese will ab 1926, abgesehen von winzigsten Stückchen »heiligen Brotes«, nichts gegessen haben. Außerdem blutete sie aus verschiedenen Wunden ihres Körpers. Und wo es Blut gibt, da können wir auch Spuren untersuchen.
Zu diesen Blutspuren kommen wir gleich. Zunächst noch ein Wort zum weiteren Werdegang von Therese.
Schon nach wenigen Wochen kamen Dutzende, dann Hunderte und zuletzt, beispielsweise an Karfreitagen, Tausende von BesucherInnen, um Thereses Blutwunder zu sehen.
Kurz darauf, im Juli 1927, führte das Bischöfliche Ordinariat aus Regensburg eine zweiwöchige »amtliche«, also kirchlich-offizielle Untersuchung und Beobachtung von Therese Neumann durch.
Einer der beteiligten Ärzte, Gottfried Ewald, war Sohn eines Theologieprofessors. Seit 1920, im Alter von etwas über dreißig Jahren, war er Oberarzt für Psychiatrie an der Universitätsnervenklinik Erlangen geworden.
Auch ein Biologe war bei Thereses Untersuchung zwei Tage lang vor Ort. Er hieß Sebastian Killermann und war nicht nur Biologe, sondern seit 1895 auch katholischer Priester. Wie sein Kollege Gottfried Ewald war er mit der christlichen Gedankenwelt vollkommen vertraut. Das erwähne ich, weil wir bei heutigen »Psi-Tests« der ›Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften‹ beim Test von beispielsweise Wünschelruten-GängerInnen oder Kristall-PendlerInnen häufig hören, dass skeptische Menschen im Raum die übersinnlichen Psi-Kräfte stören. Das war im Fall von Therese von Konnersreuth nicht so. Sie »lud« ihr bekannte Kritiker oder Zweifler persönlich aus, wenn sich diese als Besucher anmeldeten.
Biologe Killermann meldete in seinem Bericht aus dem Jahr 1928 »große Zweifel« an dem, was er bei Therese erlebte. Unter anderem kam ihm seltsam vor, dass er aus dem Raum gebeten wurde, in dem Therese lag, damit »durchgelüftet werden könne«. Bei seiner Rückkehr in den Raum war das schon zuvor auf Thereses Wangen vorhandene, von ihr angeblich geweinte Blut aufgefrischt. Nach Killermanns Auffassung hatte Therese es »durch Aufweichung (vielleicht mit Speichel) flüssig gemacht«.
Therese Neumann mit »Wundmalen«. Das Blut stammt gemäß DNA-Test von ihr, allerdings ist die Verteilung der Spuren eigentümlich und passt weder theologisch noch blutspurenkundlich zu deren angeblicher Entstehung durch Einwirkung aus dem Jenseits (Spurenrekonstruktion nach Berichten, Fotos und Zeichnungen vom Fundort).
Killermanns jüngerer Kollege Ewald sah das anders. Er gab an, die Blutungen aus Thereses Augen selbst beobachtet zu haben. Auch andere Ärzte hätten den Blutungsbeginn sogar »zum Teil mit der Lupe beobachtet«, so Ewald.
Doch die katholische Kirche blieb skeptisch. Schon im Jahr 1927 hatte sie davon abgeraten, die Hungerkünste und Blutwunder von Therese Neumann als Anlass für Wallfahrten anzusehen. Als die Menge der wallfahrenden BesucherInnen trotzdem zunahm, schlugen die immer noch zweifelnden bayrischen Bischöfe fünf Jahre vor, Therese in einem katholischen Krankenhaus untersuchen zu lassen.
Das lehnte die immer noch hungernde und blutende Frau verblüffenderweise ab. Verblüffend war es vor allem deshalb, weil Therese durch einen medizinischen Beweis eines echten Wunders noch mehr Aufmerksamkeit für ihre christlichen Botschaften erhalten hätte. Warum sollte sie etwas gegen eine weitere Verbreitung der Worte von Jesus haben, die sie regelmäßig während ihrer Visionen vortrug?
Wusste Therese, dass sie nicht hungerte und wie jeder andere Mensch aß? Dass niemand, so wie Therese es tat, an Körperfülle zunehmen kann, der hungert? Wusste sie, dass ihre Blutwunder nicht nur durch übernatürliche Kräfte erklärbar waren? Oder war sie einfach zu schüchtern, um ihre Heimat zur ärztlichen Behandlung im Krankenhaus zu verlassen?
Therese hatte auch schon früher, noch vor ihren Visionen und Blutungen, öfter wundersam entstandene Verletzungen und Krankheiten erlitten. Sie hatte diese aber nur ein einziges Mal von einem Arzt versorgen lassen. Das war seltsam, denn 1918 und 1919 will Therese Neumann Magengeschwüre, Eiteransammlungen unterhalb des Zwerchfells, Halsgeschwüre, Mandelentzündungen, Furunkel in Achsel und Ohr, eine Blutvergiftung, Rheuma und Herzbeschwerden gehabt haben. Ebenfalls im Jahr 1919 will sie nach eigenen Angaben bei elf schweren Unfällen unter anderem einen Schädelbasisbruch erlitten haben. Es gab keinen einzigen Zeugen für die Unfälle – und, wie gesagt, sie ging nur ein einziges Mal zum Arzt.
Dieser einmalige Arztbesuch Thereses fand am 10. März 1918 statt. Das war bereits zu einer Zeit, in der sie nach eigenen Angaben kaum noch aß. Wegen einer angeblichen Blasen- und Darmlähmung hatte sie damals das Krankenhaus Waldsassen aufgesucht. Es ist nicht bekannt, was genau die Ärzte bei der Untersuchung feststellten. Bekannt ist aber, dass Therese im Krankenhaus viel aß und sich von der Familie sogar zusätzliche Speisen bringen ließ. Da sie trotz Zubrotes nicht satt wurde, und weil ihr das Essen im Krankenhaus absolut nicht schmeckte, entließ sie sich selbst mit den Worten, dass man sie offenbar verhungern lassen wolle.
Ohne Details zu kennen, wissen wir aber doch, dass die Untersuchung im Krankenhaus nichts Schwerwiegendes zutage brachte. Therese erhielt laut Pfarrer Hanauer weder eine Unfall- noch eine Invalidenrente, die sie mit ihren Beeinträchtigungen hätte einfordern können.
Unterschiedliche Ansichten zu Therese Neumann
Die normale Bevölkerung in Konnersreuth wusste wie gesagt nichts von den Forschungen zur Hysterie. Ärzte und Journalisten – in Bayern oft abfällig »Studierte« genannt – hörten jedoch bald davon. In Thereses geradezu klassischem Fall stritten sie erbittert darum. Beispielhaft lagen sich Josef Deutsch, Facharzt für Chirurgie und Frauenkrankheiten (man glaubte früher, dass Hysterie vorwiegend Frauen treffe) und Chefarzt des Dreifaltigkeitskrankenhauses in Lippstadt, sowie sein Widersacher Fritz Gerlich in den Haaren, zum Zeitpunkt der Blutwunder ehemaliger Chefredakteur der ›Münchener Neuesten Nachrichten‹. Gerlich hatte 1929 ein zweibändiges Buch über Therese Neumann verfasst und glaubte zutiefst an das Wunder der Visionen und Blutungen. Obwohl er die Merkmale von Konversionsstörungen genau kannte, wollte er sie bei Therese nicht anerkennen. Gerlich schreibt:
»Wir müssen bei Hysterischen mit einer seelischen Veranlagung rechnen, die aus krankhaftem Geltungsdrang erfahrungsgemäß auch zu Lüge und Betrug greift. Ob dieses bewusst oder unbewusst geschieht, ist für unsere Frage gleichgültig.«
Aber, da war sich Gerlich sicher: Therese war nie beim Lügen erwischt worden. Das stimmte zwar so nicht, doch eine kleine Gruppe, der sogenannte »Konnersreuther Kreis«, wollte es gerne so sehen und verbreitete es demgemäß. Dass Konversionsgestörte, wie oben angedeutet, in ihren schlechten Momenten auch ganze Geschichtsstränge erfinden, klammerte Gerlich ebenfalls aus. Er bezog sich lieber auf den Alltag Thereses, in dem sie sich aufrecht und ehrlich verhielt. Doch dass sich die junge Frau in gesunden Momenten gesund verhielt, hieß nicht, dass es in ungesunden Momenten anders war.