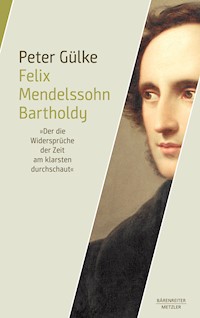Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bärenreiter
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Peter Gülke widmet sich in 54 Essays dem großen Thema Tod und Abschied in der Musik, aber auch in der Literatur. Mit unnachahmlicher Sprachkraft präsentiert er Erkenntnisse, die von allgemeinem Interesse und bedeutend für den kulturellen Diskurs über Tod und Vergänglichkeit sind. Musik ist als diejenige unter den Künsten charakterisiert worden, die in besonderer Weise von Vergänglichkeit und Tod spricht. Wie aber tut sie das? Peter Gülke gibt darauf vielfältige Antworten. Aus dem Inhalt: • Wieviel Totentanz ist in überlang dahinwirbelnden Finali bei Mozart und Schubert enthalten? • Warum bekommen Tristan und Isolde nicht den Liebestod, den sie so überwältigend besungen haben? • Warum fällt Musik bei Nennung des Todes in einen harmonischen Abgrund? • Wie gehen Komponisten mit den Grausamkeiten der "Dies-irae"-Sequenz um? • Wie gedenken Komponisten verstorbener Kollegen? • Welche Erfahrungen liegen der Todesmystik in Bachs frühen Kantaten zugrunde? • Warum muten etliche Schlusspassagen bedeutender Romane wie insgeheim von Musik unterlegt an? Peter Gülke ist Träger des Ernst von Siemens Musikpreises und des Sigmund Freud-Preises für wissenschaftliche Prosa. Er ist Dirigent, Musikwissenschaftler und Musikschriftsteller.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
|3|Peter Gülke
Musik und Abschied
|4| Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Hinweise zur Zitierfähigkeit und Register-Benutzung
Diese epub-Ausgabe ist zitierfähig. Um dies zu erreichen, ist jeweils der Beginn einer Seite mit |xx| gekennzeichnet. Bei Wörtern, die von einer zur nächsten Seite getrennt wurden, steht die Seitenzahl vor dem im epub zusammengeschriebenen Wort.
Sofern im Register Seitenzahlen genannt sind, beziehen sich diese auf die Printausgabe. In dieser epub-Ausgabe führt ein Link zum Beginn der entsprechenden Textstelle.
eBook-Version 2015
© 2015 Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG, Kassel
Gemeinschaftsausgabe der Verlage Bärenreiter, Kassel und J. B. Metzler, Stuttgart und Weimar
Umschlaggestaltung: +CHRISTOWZIK SCHEUCH DESIGN
unter Verwendung eines Fotos von Karoline Gülke
Lektorat: Jutta Schmoll-Barthel
Korrektur: Daniel Lettgen, Köln
ISBN 978-3-7618-7024-2
DBV 113-08
www.baerenreiter.com
www.metzlerverlag.de
eBook-Produktion: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
|5|Für D.
|6|Peter Gülke ist Träger des »Nobelpreises für Musik« (Ernst von Siemens Musikpreis) und des Sigmund-Freud-Preises für wissenschaftliche Prosa der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung. Er wurde 1934 in Weimar geboren, wo er seit dem Tod seiner Frau wieder lebt. Peter Gülke wirkt als Dirigent, Musikwissenschaftler und Musikschriftsteller. Er war Kapellmeister unter anderem an der Staatsoper Dresden und Generalmusikdirektor in Weimar und Wuppertal und lehrte von 1999 bis 2004 an den Universitäten Zürich und Basel. Bei Bärenreiter/Metzler sind viele Bücher von ihm erschienen, zuletzt »Von Bach bis Beethoven. Streifzüge durch große Musik«.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Der Autor
Am Abend zuvor
1Schuberts Quintett
2Sie war gern in Kirchen
3Rettung durch András
4Weimarische Todesmystik .Der junge Bach
5Davor und danach .Reiner Kunze und Nelly Sachs
6Nächtliches Totenamt .Pierre de la Rue, Ockeghem, Brumel
7Vox humana .Totenrede auf Dietrich Fischer-Dieskau
Selbstgespräche I
8Verbotener Enquist
9Trauermusik für große Damen und Herren
10Zwei Königreiche .Bach und Friedrich der Große
11Gryphius betet
12Zweimal Orpheus .Monteverdi und Gluck
13Tage des Zorns .Zelenka, Mozart, Verdi
14Sprachmächtige Sprachlosigkeit .Ombra-Szenen
15Ombra-Szene ohne Szene .Mozarts »Jenamy«-Konzert
16Eigener und ritueller Tod .Pamina und Freimaurer
17Transzendiertes C-Dur .Gluck, Haydn, Beethoven
Selbstgespräche II
18»Den Tod statuiere ich nicht« .Goethe
19Ewigkeit im Vergänglichsten .Alte Motetten
20Plädoyer und Gedenken .Palestrinas »Missa Papae Marcelli«
21Totengedenken unter Musikern .Von Du Fay bis Kurtág
22Zerbröselnde Themen .Beethoven
23»Todes-Erfahrung« .Rilke
24Im Teil das Ganze .Rückblicke bei Beethoven, Schubert und Bruckner
25Totentänze? .Mozart und Schubert
26Zerschnittenes Lied .Schuberts »Leiermann«
27»Dass du nicht enden kannst, das macht dich groß« .Schubert
28Musik oberhalb der komponierten – und Beethovens op. 131
29»In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahnsinn« .Mozart und Strauss
30Hörbar und unhörbar tönendes Schweigen .Nachklang und Coda bei Mozart, Beethoven, Schumann und Brahms
Selbstgespräche III
31Vorkammern der Ewigkeit .Verschwiegene Melodramen der Dichter
32Zyklisch im Blick aufs Ende .Schumanns »Kerner-Lieder«
33Keine Erlösung, nirgends .Brahms’ »Vier ernste Gesänge«
34Erinnerung, Heimweh .DvořáksCellokonzert
35»Dass sie nicht allein seien« .Brahms und Berg
36Musik für den eigenen Tod .Du Fay, Josquin, Gombert, Gesualdo, Froberger, Schostakowitsch
37Frauen sterben anders .Purcell,Janáček, Verdi
38»Mitleidig das Auge zu Marke erhebend« .Tristans Liebestod
39Liebestod verfehlt
40Vier Tode .Mussorgsky
41In Musik voraussterbend? .Tschaikowskys letzte Sinfonie
Selbstgespräche IV
42Tod mit und ohne Verklärung .Strauss und Mahler
43Mallarmés stille Musikantin
44»Land, das ferne leuchtet«: Fahrkarten nach Orplid .Duparc
45Mélisandes leiser Tod .Debussy
46Ausfahrt ohne Ankunft .Rimbaud und Britten
47Sterbeprotokolle .Janáčekund Hodler
Selbstgespräche V
48Mahlers »Kindertotenlieder«
49»Zu langsam« richtig .Furtwängler, Fischer-Dieskau, Walter, Barenboim
50Spätwerk – und Mahlers letztes Adagio
51Lob des Wiederhörens
52»Im Abendrot« .Richard Strauss
53Unkomponiertes Finale .Bartóks Sechstes Streichquartett
54»Stets die Wahrheit« .Schostakowitsch
Ad finem
Register
Dank
|11|Am Abend zuvor
Es hatte so gut ausgesehen, dass seine Hoffnungen noch einmal hoch hinausschossen. Die als letzte Rettung empfohlene Dialyse hatte sie wider Erwarten gut überstanden und danach, anders als in den Nächten zuvor, ruhig geschlafen. So berichtete die Nachtschwester, die alle halbe Stunde nach ihr gesehen hatte – und sie gegen Morgen tot fand, still weggegangen, ohne Spuren von Quälerei oder Kampf.
Obwohl ihm religiöse Rituale als Beschwichtigungen verdächtig sind, erschien ihm richtig, wie sie da lag: mit gefalteten Händen, offenem Mund, das wächserne Gesicht entspannt, auf dem Tischchen neben ihr der Blumenstrauß, den die Schwägerin gestern gebracht hatte, eine brennende Kerze, ein Kreuz.
Dann aber – Stille im Raum, eine Stille, wie er sie zuvor nur beim Tod der Eltern erlebt hatte, nun aber neu, Einbruch einer Welt ohne Widerhall. Keine Wahrnehmung dessen, was eingetreten war, auch nicht der gedämpfte Ton, in dem alle um ihn herum sprachen, minderten die Verzweiflung, das Anrennen dagegen, dass er das Geschehene begreifen müsse, sie sich entzogen hatte, er ihr kein Wort mehr würde sagen können, sie nicht mehr antworten werde. Es dauerte lange, bis man mit ihm reden konnte. Auf dem Gang warteten Leute, um das Bett ins Totenzimmer zu rollen.
Fortan sah er Unbegreiflichkeiten immer höher um sich aufwachsen – das Rätsel des Todes, mit dem Philosophen und Theologen sich ertragreich und aussichtslos herumschlagen, und das geliebte Geheimnis einer Frau, mit der er fast 60 Jahre lang »in Not und Freude« verbunden war.
|12|1
Schuberts Quintett Damals erschrocken, erinnere ich genau, wie sie die Musik zum ersten Mal hörte – fast erstarrt, mal vornüber gebeugt, das Gesicht in den Händen vergraben, mal mich mit großen Augen anstarrend.
Obgleich kurz vor Schuberts Tod entstanden, ist es keine einseitig todbezogene Musik, umso deutlicher indes vor dem Raster verschiedener Zeitarten aufgespannt. Musik braucht nicht explizit von Vergänglichkeit und Tod zu reden – das besorgen Anlässe und Texte –, um von ihnen zu handeln. »Meditatio mortis« hat sie Adam von Fulda in einem um 1490 geschriebenen Traktat genannt, möglicherweise des ambivalenten Genitivs bewusst: Im Genitivus obiectivus meditiert sie über den Tod, im Genitivus subiectivus meditiert als Musik der Tod selbst.
In Schuberts Adagio singen drei Mittelstimmen in einem breitgezogenen Klangband und überwiegend kleinen Intervallschritten, fast wie in alten Motetten als Choral in Langmensur, die die Töne so sehr dehnt, dass man das Melodieganze kaum realisiert. Zudem wandert es von der Grundtonart, dem vornehmlich mit Verklärung verbundenen E-Dur, rasch nach Fis-, bald auch nach D-Dur. Leicht erfassbare Achtelschleifen verbinden die »Haltetöne«, geben den melodischen Fluss wie nach Stauungen frei und beziehen ihre Eindringlichkeit wesentlich daher, dass auch unsere Erwartungen auf Fortgang angestaut waren, die Linie unser Ohr in die Spannung zwischen Verweilenwollen und Weitermüssen eingebunden hat. Kaum halten wir ihren Riesenatem aus – umso weniger, als die erste Violine und das zweite Cello ein kleingliedriges Frage-und-Antwort-Spiel treiben, mithin zwei Zeitarten sich gegeneinander definieren, indem sie scheinbar wenig vermittelt nebeneinanderher laufen. Man könnte es eine approximative Verdeutlichung der antiken Begriffe »aion« (»Ewigkeit«) und »chronos« (»tickende« Zeitlichkeit) nennen.
Dass das Klangband und die erste Violine am Ende des ersten Teils einander antworten, den Abstand also verringern, hindert den explosiven Ausbruch aus der Spannung des Gegenübers nicht – ins Pandämonium eines Mittelteils mit hetzenden Sechzehnteltriolen, die einen |13| oktavierten, verzweifelt heulenden Gesang von erster Violine und erstem Cello vor sich hertreiben. Der kleine Sekundschritt, hier von e nach f, von der Verklärungstonart E-Dur ins düstere f-Moll – Schubert kannte ihn ähnlich aus Beethovens Streichquartetten op. 127 und 131 – hat sein Gewicht auch als Signatur der Nachbarschaft von seraphischer Schönheit und »des Schrecklichen Anfang«. Demgegenüber erscheinen Hinweise auf die Identität der Terztöne gis bzw. as und hier wie dort prägende Terzdurchgänge nahezu buchhalterisch. Beide Tonarten liegen mit vier Kreuzen bzw. vier Been entgegengesetzt gleich weit vom C-Dur der anderen Sätze entfernt. Noch das Ende des entfesselten Tobens, das mehrmals in leisen Passagen Kraft für den nächsten Ansturm sammelt, lädt die Beschreibung zu drastischer Bildlichkeit ein: Wie außer Atem gebracht, ermüdet es, stockt, röchelt, verlischt nahezu.
Am Echo vom Echo des letzten Seufzers rettet sich die Musik und findet zum ersten Teil zurück, in eine konvergierende Reprise insofern, als der »Choral« fast unbeirrt die alte Bahn zieht, die Phrasen im Dialog der Außenstimmen jedoch größer werden, zuweilen ineinandergreifen und den breitgedehnten Gesang der Mittelstimmen stellenweise heterophon umspielen. Wenn er »ppp« subdominantisch abtaucht, scheint die dialogisierende Arbeit getan, die Außenstimmen ziehen sich, punktierte Auftakte der Violine ausgenommen, ins Pizzicato und in eine Regelmäßigkeit zurück, die dem Choral stärker zugeordnet erscheint; ehe die erste Violine, nachdrücklicher schließend als vor dem f-Moll-Einbruch, zum Dolmetsch des Chorals wird – eben dort, wo Schubert in den Part der zweiten Violine das Trauer- und Todessignet des chromatischen Lamento-Abstiegs einträgt.
»Eigentlich kann ihr niemand widerstehen«, hat Louis-Ferdinand Céline von der Musik gesagt. »Was soll man denn mit seinem Herzen anfangen? – man verschenkt es gern und muß danach trachten, aus jeder Musik die ungeschriebene Weise, unsere Weise herauszuhören: das Lied vom Tod«. Wer so redet, setzt ein dichotomisches Verständnis von Tod und Leben voraus, dem Schubert im Quintett konsequent opponiert, indem er das Gegeneinander von selig singender Bejahung und schroffen Bedrohungen in allen Sätzen – Lehrstücken zum »Media vita in morte sumus« – immer neu und anders verfolgt. Die singenden |14| Passagen stellen sich als je nach Situation und Satzcharakter eigenständige Emanationen ein und desselben Grundhabitus dar – stets engschrittig um zentrale Töne gewundene Melodien: Niederschlag der alle Stationen durchwirkenden »poetischen Idee«, des Singens über Abgründen. Ebenso brutal, wie das f-Moll-Appassionato ins Quasi religioso des E-Dur-»Chorals« einbricht, wird im ersten Satz auf die Kantilene wie mit Keulen eingeschlagen, besonders am Ende; innerhalb der explosiven Vitalität des Finales, die zur Charakteristik »Sieg des Lebens« einlädt, zieht die Kantilene als erinnerungshafter Durchblick, eine Fata Morgana, am Horizont vorüber.
Die fast epilogische Handhabung am Schluss mag auch als Reaktion auf die radikalste verstanden werden: im Scherzo, dessen aggressiv anspringender Lebenslust ein Abstieg in katakombenhaftes Dunkel gegenübersteht, wie er so selten komponiert worden ist – im Trio, wo eher ländlerisch Diesseitiges zu erwarten wäre. Schubert zeichnet Des-Dur vor, schreibt jedoch ein absteigendes, zwischen f-Moll und As-Dur hangelndes Unisono, das als As-Dur-Skala auf g ankommen müsste. Jedoch landet es auf ges; die Überraschung steigert der hier im Trio erstmals erscheinende, zudem satte Dreiklang.
Es ist, als ob die Musik in ein Loch fiele. Recht nahe liegt der Vergleich mit anderen Stellen, wo die Unbegreiflichkeit des Todes durch Fortschreitungen verdeutlicht wird, die außerhalb alles Erwartbaren liegen, der Tonsatz allen Halt zu verlieren scheint – im »Moro, lasso« aus Gesualdos Sechstem Madrigalbuch ebenso wie im fast wie ein Moll-Akkord klingenden Ces-Dur-Quartsextakkord am Ende des vierten der »Vier letzten Lieder« von Richard Strauss. Schubert bekräftigt Schock und Untertext durch die nachfolgende Moll-Eintrübung, die noch tiefer ins Dunkel hineintreibt – so weit, dass er enharmonisch umnotieren muss: Nach der Des-Dur-Kadenz im achten Takt des zweiten Teils ist das notierte cis-Moll eigentlich ein des-Moll, vier Takte später nach der notierten H-Dur-, eigentlich einer Ces-Dur-Kadenz das notierte h-Moll ein ces-Moll. Was für ein Glück, dass Schubert es am Ende des zweiten Teils in Des-Dur plagal abfängt, den Rückweg aus dem fast unbetretbaren Land gerade noch findet!
|15|2
Sie war gern in Kirchen Nicht wegen des Gebetsgemurmels oder der Gesänge, bei denen die Gemeinde der Orgel regelmäßig hinterherschleppt – »hoffentlich hält der oben sich die Ohren zu«; eher wegen des Blicks schräg nach oben in die Vierung zu dem ins steinerne Gewölbe hereingeholten Himmel. Und wegen der Grabplatten, die teils flachliegen, teils später aufgerichtet worden sind. Da liegen oder stehen sie nun, eine Phalanx zunehmender Abstraktionen, von aufdringlichen Details bis zu fast gelöschten Stricheleien reichend – Bischöfe, Äbte, Krieger, Amtsherren mit ihren Insignien, Bürgersleute an der Seite feiertäglich aufgezäumter Frauen, vollplastisch-weltlich für die Fahrt nach drüben gerüstet, mit Ornaten, schweren Ketten, Helmen, Hauben, Rüschen, Stehkragen bis hin zu den Imponierbeutelchen der Landsknechte, als könnten sie all das in die Ewigkeit mitnehmen; andere mit abgewetzten Konturen, abgeschmirgelten Nasen, Hirtenstäben, nur mehr Andeutungen von allem, was einstmals vorragte und nicht standhielt; manche als flach geritzte Strichfiguren knapp kenntlich, einige nur noch erahnbar, in steinerne Anonymität zurückpoliert.
Jahrhundertelang haben Schuhe der Kirchgänger die Toten zunehmend in die Unkenntlichkeit geschoben und die Mimikry widerlegt, mit der sie für die große Fahrt und das Gedächtnis der Nachwelt präpariert worden sind. Angesichts so freundlich verzögerter Erosion braucht man sie nicht als Fußabtreter missbraucht zu finden.
Einmal, als wir herumgingen, war’s besonders stimmig; da stellten wir uns vor, sie kröchen aus dem Verstummen heraus, tuschelten, redeten oder stritten miteinander. Doch wurden sie unterbrochen: Von oben ertönte die c-Moll-Passacaglia.
|16|3
Rettung durch András Gibt es etwas, das nicht vom Übrigbleiben redete, nicht mit Bezügen auf die Tote aufwarten könnte? Es rastet ein, bevor ich’s bemerke – mir fast zu selbstverständlich, wie Befindlichkeiten, dann Gedanken es heranziehen, einsaugen und nahezu allem eine Schwere verschaffen, die es vordem nicht hatte. Sodass ich den Abstand zu denen kaum wahrnehme, die nicht gerade jemanden verloren haben. Vorsicht! Es gibt einen Hochmut von Trauernden – ich als Ausnahmefall geehrt durch den Hieb, der mir verpasst worden ist.
Abends im Bus auf dem Weg ins Konzert überfällt mich, wie stimmig es ist, dass ich gefahren werde, ich niste mich in der Konstellation ein. Soweit Winterschmutz und aufgemalte Reklamesprüche es erlauben, sehe ich durch die Fensterscheiben Ladenketten und Menschengetümmel, Autolichter, blinkende Ampeln usw. Leben zieht da draußen vorbei, von dem ich abgetrennt bin. Da jede Situation nach Rechtfertigungen angelt, fällt mir der Spruch der 80-Jährigen ein, der ich einst im Herbst den Garten umgegraben habe: Man müsse sehr alt werden, um Natur richtig zu begreifen, weil man von ihr nichts mehr will. Von denen draußen will ich nichts.
Eine Stunde später im Konzert ergreift es mich. Das übertragene Verständnis nährt sich aus dem konkreten: Ich habe mich greifen lassen. András Schiff spielt die »Davidsbündlertänze« und die »Kreisleriana«, spielt Schumanns bekennerischen Lebensüberschwang nahe am Anschein des hier und jetzt Entstehenden auf eine Weise hinein, die die Musik zur realsten aller realen Gegenwart macht – das jetzt Gegenwärtige eilends von anderem Gegenwärtigen verdrängt. Kaum bleibt Zeit, eine Gedächtnisspur zu sichern, bei einem Detail zu verweilen, zu memorieren. Genau das intendiert die Apotheose des Vorbei und Sonie-wieder, ihre Ungeduld erlaubt nicht einmal den kleinen Abstand, dessen es bedürfte, um das Vorbei als solches zu reflektieren. Thematische Bezüge, stimmige Aufeinanderfolge, Korrespondenzen, Architektur – geschenkt! Wen das interessiert, wer sich, sei’s für Augenblicke, dem reißenden Strom verweigert und Eindrücke seitwärts abzulegen, |17| festzuhalten versucht, veruntreut den Sinn dieser Musik – und setzt sich zugleich einem Paradoxon aus: Sehr wohl lädt auch sie ein, aufgehalten zu werden. Damit wir die jubelnde, grausame Vergänglichkeit verspüren, an ihr authentisch leiden können, muss es uns um das Vergehende leidtun, muss an ihm ein Gran Unvergänglichkeit haften. Derlei »Verweile doch …« nistete diesmal in jeder winzigen Verzögerung, in jedem geringfügig hinausgeschobenen Schlussklang, jeder liebevoll ziselierten Melodie. Für den nach Bezügen Süchtigen war es, noch im Furor, mit dem die Musik fortstürzte, ein Privatissimum in »Stirb und werde«.
Zugleich umgekehrt: Zu den schönsten Diesseitsmetaphern, unter anderem des Lindenbaums als des Ortes der Liebenden oder der Mondnacht mit sanft rauschenden Ähren, gehören auch die über den Bildrand hinausblickenden Konjunktive: Die »Zweige rauschten,/als riefen sie mir zu«, die Seele, die »weit ihre Flügel« ausspannte, »als flöge sie nachhaus«.
4
Weimarische Todesmystik Hört man in frühe Bach-Kantaten tief genug hinein, wird man an Deutungen vollends irre, die nach zugrunde liegenden Erlebnissen fragen. Wie oft, wie suggestiv geht hier »der Mensch mit Heimweh durch die letzte Angst« (Bloch), woher kennt ein 25- bis 30-Jähriger Gefühlslagen, stammen Erfahrungen, ohne die man diese Musik sich nicht vorstellen mag? Wäre in seinem Interesse nicht zu wünschen, dass er die mystisch intonierte Innigkeit der Dichtungen von Salomo Franck nicht in der Tiefe hätte erschließen, verlängern, ihr zu tönender Unmittelbarkeit hätte verhelfen können, wie er es getan hat? Dem dichtenden »Gesammten Consistorial-Sekretär« waren immerhin drei Söhne gestorben, auch war er fast eine Generation älter als Bach. Bei dem, was im Zusammenwirken der beiden zustande kam, müssen innere, bekennerische Veranlassungen umso mehr vermutet werden, als der selbst in religiösen Fragen autoritäre Herzog Wilhelm Ernst pietistischen Strömungen ungern mehr Einfluss gewährte, als sich ohnehin nicht vermeiden ließ.
|18| Einerseits legt Bachs Musik die Frage nach jener vielleicht voreilig »pietistisch« genannten Todes-Kompetenz nahe, andererseits erscheint sie nur halbrichtig gestellt: Es gibt eine Weisheit des Mediums, die nur innerhalb seiner zur Verfügung steht; nur in und über Musik erreichen Musiker Bereiche, die ihnen außerhalb unerreichbar sind – oft möchte man es für sie geradezu hoffen.
Jene Weisheit freilich darf man nicht eo ipso verfügbar denken, sondern als je neu aufscheinend, wo traditionell gewachsene Bedeutungen der Musik mit dem Erlebnisfundus derer zusammenkommen, auf die sie treffen. Ort und Möglichkeit der Konjunktion, Sprungbretter fürs Ineinander von Erlebnis und musikalischer »Erkenntnis« müssen je neu gebaut werden. Mögen noch so viele Topoi mitspielen – die gedämpfte Innigkeit der Flöten und Gamben oder die flutende Metrik im »Actus tragicus« (noch vor Weimar), diskret hinterlegte Cantus firmi und die still-selige Hingebung an die »süße Todesstunde« bleiben neu gefunden.
Die Frage nach der besonderen Kompetenz des jungen Bach lässt sich weder mit Hinweisen auf den Zeitgeist oder Francks Dichtung erledigen noch mit dem Allgemeinplatz, genial Begabte brauchten nicht erlebt zu haben, was sie darstellen, suggestiv Imaginiertes sei ohnehin oft stärker und wirklicher als was uns im »Dunkel des gelebten Augenblicks« begegnet. Insofern wiegt nicht schwer, dass die »süße Todesstunde« auf die am sechzehnten Sonntag nach Trinitatis fällige Geschichte vom Sohn der Witwe von Nain bezogen ist und man von Rollenprosa sprechen könnte.
Neben aller Bezauberung durch die direkt mitteilende Musik kommen wir dem – in Leipzig fortwirkenden – Mirakel der Stücke im Blick auf Disposition und Dramaturgie näher. In der Kantate »Der Himmel lacht, die Erde jubilieret« zum Beispiel konkurriert der Jubel ob der Auferstehung zunächst mit dem als »Jauchzet, frohlocket« ins »Weihnachtsoratorium« übernommenen »Tönet, ihr Pauken, erschallet, Trompeten« aus der Glückwunschkantate für die sächsische Kurfürstin, jähe Wechsel von Tempi und Stimmungslagen sorgen für weltlich-realistische Anschaulichkeit. Je stärker indes die Selbstreflexion des Gläubigen die Oberhand gewinnt, desto mehr reduziert Bach den äußeren Aufwand – mit Höhe- und Zulaufpunkt in der allein dem Sopran, der Oboe und |19| den Streichern gehörigen Arie »Letzte Stunde, brich herein«. Wer bei »Ich hatte viel Bekümmernis« überhört, dass die Bekümmernis – »ich hatte«! – der Vergangenheit angehört, mag erstaunt sein angesichts Bachs unbekümmerter Komposition der Worte. Wie mit dem Erstaunen rechnend eröffnet er die Fuge, als müsse zum Jubel ausgeholt werden, mit einem mehrmals angeschlagenen »ich«; freilich auch, weil sie zwischen kontrastierenden Sätzen steht: einer Sinfonia mit Oboe und Violine als zwei klagend wetteifernden Soli – einem Beginn, an den Bruckner in seiner Fünften Sinfonie angeschlossen haben könnte – und dem hierüber chromatisierend hinausgehenden Lamento von Oboe und Sopran in der Arie »Seufzer, Tränen, Kummer, Not«, die schon in der Sinfonia anklingt. Dergestalt exponiert er eine gewagte, unterschiedliche Affektlagen beanspruchende Dialogizität des Ganzen – wohl auch, um zu legitimieren, dass Jesus als Partner in ein Duett eintritt. Als Wagnis weist es auch der anschließende wiegenliedhafte Chor »Sei nun wieder zufrieden, meine Seele« aus, wenn Bach bei den Worten »Was helfen uns die schweren Sorgen,/was hilft uns unser Weh und Ach?« auf ein Zitat der zweiten Strophe des Chorals »Wer nur den lieben Gott lässt walten« einschwenkt. Erst danach hat erlöster Jubel freie Bahn.
Der Umgang mit Cantus firmi ist etabliert genug, um jene Selbstverständlichkeit zu begünstigen, mit der man Benennung mit Erklärung verwechselt, der Anspruch profilierter Lösungen mithin qua Zuordnung verkleinert wird: Wir haben eine Kategorie, einen Namen, bei denen die Sache unterkommt, und übersehen, was nicht unterkommt. Schon im 15. Jahrhundert begegnen Cantus-firmus-Behandlungen, bei denen kritischer Abstand zu deren Praktikabilität und Selbstverständlichkeit mitkomponiert scheint. So auch bei Bach: »Sei nun wieder zufrieden, meine Seele« gibt eines von etlichen Beispielen, bei denen satztechnisch die Distanz der »nicht-firmen« Stimmen zur Choralmelodie so groß ist, dass von Kommentar, Ausschmückung oder Ähnlichem kaum gesprochen werden kann und wenig zum Eindruck fehlt, das Stück funktioniere auch ohne Cantus.
Hierauf freilich kann Bach es nicht angelegt haben – der Transzendenzbezug ist zu wichtig –, vielmehr auf eine Unmittelbarkeit des Singens und Sagens, die sich vom Symbolanspruch des Cantus abhebt und nicht |20| eigens als zugeordnet verstanden zu werden braucht. Das gilt für die Arie »Letzte Stunde, brich herein« mit dem Choral »Wenn mein Stündlein vorhanden ist« in der Kantate BWV 31 ebenso wie für das in »Komm, du süße Todesstunde« mitgeführte »Herzlich tut mich verlangen/nach einem sel’gen End«, das am Ende – »Der Leib zwar in der Erden/von Würmern wird verzehrt« – im Choralsatz den Schlusspunkt setzt. So nahe in der Aussage die Texte, so groß der Abstand zwischen emblematischem Choral und direkt sprechendem »Kommentar«.
Zum gläubig akzeptierten, gar ersehnten Tod gehören niedrige Schwellen, wiegenliedhaft besänftigte Übergänge nach drüben, tänzerisch gelöstes Entgegenjauchzen, bisweilen eine Mitte zwischen beidem, »Stirb in mir, Welt« in der – freilich nicht gesicherten – Kantate »Meine Seele rühmt und preist« (BWV 189), und ebenso, dass Bach die Musik gewissermaßen als Kundschafterin vorausschickt: In etlichen Sätzen spricht sie, oft als Solo-Instrument – meist Oboe – personifiziert, ausführlicher als der Singende, schiebt diesen gar in die Rolle des Stichwortgebers, so bei der Bitte, die letzte Stunde möge hereinbrechen, in der Kantate »Der Himmel lacht, die Erde jubilieret« (BWV 31), ganz und gar in zwei Arien der Kantate BWV 82 »Ich habe genung«.
Diese, in Leipzig zum 2. Februar 1727 komponiert, belegt die hier etwas pauschal so genannte »Todesmystik« als nicht nur weimarbezogen – weder örtlich noch zeitlich, nicht einmal für Bach selbst: der »Actus tragicus« entstand schon in Mühlhausen. Immerhin hat die »Meisterzeit in Weimar« (Heinrich Besseler) mit den durch Franck angeregten Inspirationen Befestigungen und Ergebnisse gezeitigt, für die etliche Wiederverwendungen von hier Komponiertem sprechen, unter anderem das für verschiedene Positionen erwogene, schließlich ans Ende des ersten Teils der »Matthäuspassion« gestellte »O Mensch, bewein dein Sünde groß«.
Während die zweite Arie der Kantate BWV 82 (»Schlummert ein, ihr matten Augen«) keiner weiteren Erklärung bedarf, hat die dritte mit dem zunächst töricht anmutenden »Ich freue mich auf meinen Tod« oft Verlegenheiten bereitet. Dass Bach jedoch mehr als ein Notopfer an den Text entrichtet hat, belegen neben dem jubelnd aufschießenden Vivace etliche rhetorische Verdeutlichungen: Koloraturen auf »freue«, jähe Fermaten-Aufenthalte bei »fallet sanft und selig zu«, blockierende Hemiolen |21| bei »Not, die mich noch auf der Welt gebunden«, gedehnte Melismen auf »gebunden«. Auch hätte er die Kantate nach dem Februar 1727 kaum viermal oder noch öfter wiederholt, wären jene Verlegenheiten die seinen gewesen.
Freilich bedarf der Text der dritten Arie eines Dolmetschs, als vom Evangelisten Lukas (2, 22ff.) dem frommen Simeon in den Mund gelegt. Dem »war ein Wort zuteil geworden vom heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn in die Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine Augen haben den Heiland gesehen.« Die Arie gehört, wie die »matten Augen« der zweiten, als »Rollenprosa« dem sterbebereiten Simeon; uns gehört sie, anders als jene, nur auf dem Umweg über ihn. Bach setzt die Kenntnis des Umwegs voraus, also auch, dass man sich nicht gleich identifiziere mit dem weltflüchtigen »ach! hätt’ er (der Tod) sich schon eingefunden …, / da entkomm’ ich aller Not, / die mich noch auf der Welt gebunden«.
Die vorausgegangene Arie bedarf keines Umwegs. Nicht einmal bedarf die Musik, um als Schlummerlied wahrgenommen zu werden, der Worte des Singenden; der erscheint eher als Zaungast und bloßer Stichwortgeber. Was für ein Schlaf muss es sein, in den man auf solche Weise gewiegt wird, wie sehr muss der fürs Drüben Zuständige sich gedrungen fühlen, es entsprechend auszurichten! Auch die Satzweise sorgt für Zurückhaltung des Singenden; keine exponierte Anforderung zwingt ihn, nach vorn zu drängen, mehrmals verweilt er auf Haltetönen und lässt den Vortritt den Streichern und der Oboe, die Führung hat er, vom Continuo begleitet, nur in kadenzierenden Takten und den Rahmenteilen des Mittelstücks. Dieses nämlich fällt zwischendurch in den Beginn zurück, womit sich, bei Arien selten, eine rondoartige, überdies zentralsymmetrische Gliederung ergibt:
Ritornell – A – Ritornell / B – A’ – C / Ritornell – A – Ritornell
|22| Weil Ritornell und A-Teil streckenweise identisch sind, die Arie wie im Kreis geht, immer wieder in den Beginn zurückfällt, in ihn sich einspinnen will, wird sie, soweit das Nacheinander im Zeitlauf es zulässt, zum Kokon, zur tönenden, immer neu sich selbst hingegebenen Meditation.
Am Ende der »Matthäuspassion« rückt die Todesmystik das Geschehen vor einen größtmöglichen Horizont. »Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen«, singen alle – auch die, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, in effigie auch die Gemeinde: Choräle gibt es nun nicht mehr. Der »Abend, da es kühle war«, breitet mildes Licht über die Szene. Unterscheidungen der Genera – Rezitative, Turba-Chöre, Arien, Choräle – fallen fast dahin, die episch breite Arie »Mache dich, mein Herze, rein« gehört eher dem Tableau als dem, der »Jesum selbst begraben« will. Da das Gegenüber von Darstellung und Deutung verblasst, erübrigt sich die Frage, weshalb Henkersknechte, Pharisäer und Hohepriester, immerhin wie Judas Zuarbeiter des göttlichen Heilsplans, mitklagen dürfen und das jämmerliche, über Gebühr gehöhte »Herr, wir haben gedacht« als Entschuldigung ausreicht. »Mein Jesu, gute Nacht« als Refrain in dem von Solisten angeführten Rundgesang verdeutlicht nochmals, dass alle, wirklich alle Beteiligten sich »mit Tränen« niedersetzen und dem Toten »Ruhe sanft« nachrufen.
Dies überwältigend und gefährlich schöne Ende wäre als Ästhetisierung von Glaubensinhalten verdächtig, vergäße man, dass Versöhnung im Sinne der Kreuzestheologie alle und alles einbegreift und dass – anders als bei Johannes, der Jesus mit »Es ist vollbracht« zum Theologen seiner selbst macht – bei Matthäus einer stirbt, der in der letzten, höchsten Not keinen Halt bei Gottvater und dessen Auftrag findet: »Mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Die ungeheure Coda der »Matthäuspassion« war auch vonnöten, um den Schrei des Gekreuzigten aufzuwiegen, jene Versöhnung heimzubringen, die ihm entglitten war – womit er das Menschgewordensein bis in die letzte Konsequenz durchlebt, den Tod, mit dem wir allein sind.
|23|5
Davor und danach
Fern kann er nicht mehr sein,
der tod
Ich liege wach,
damit ich zwischen abendrot und morgenrot
mich an die finsternis gewöhne
Noch dämmert er,
der neue tag
Doch sag ich, ehe ich’s
nicht mehr vermag:
Lebt wohl!
Verneigt vor alten bäumen euch,
und grüßt mir alles schöne.
In Reiner Kunzes dem eigenen 80. Geburtstag zugesprochenen Gedicht ist außer zwei epilogisch auslaufenden Versen der fünfte (»mich an die finsternis gewöhne«) der einzige, der das vierhebige Metrum (-/-/-/-/-) als Zeilenganzes ungestört wahrt. Es fällt nicht schwer, das zwischen Spruch und Strophenordnung schwebende Kleinod zu verschandeln, es versuchsweise ins Streckbett jenes Metrums zu zwingen – nicht, um es zu »enttarnen«, vielmehr, um einen latenten Hintergrund in den Blick zu bekommen, von dem aus Licht auf rhythmische Freiheiten, unregelmäßige »Takte« fällt, dank derer es zwingender, gebundener erscheint, als es in streng gebundener Sprache der Fall wäre:
Fern kann er nicht mehr sein, der Tod.
Ich liege wach, damit ich zwischen
Abendrot und Morgenrot
mich an die Finsternis gewöhne.
Noch dämmert er, der neue Tag,
|24| doch sag ich, eh ich’s nicht vermag:
Lebt wohl!
Verneigt vor alten Bäumen euch,
und grüßt mir alles Schöne.
Das ist grässlich. Beim zweiten und dritten Vers dieser Version knirscht es erheblich, im sechsten dürfte »mehr« nicht wegfallen, zudem lassen alle Verse vor »Lebt wohl!« außer »Abendrot und Morgenrot« am Anfang auch daktylische Skansion zu: /- -/-/-/(-). Diese Ambivalenz gibt dem Anfangswort besonderes Gewicht – im Jambus ist »Fern« leicht, im Daktylus schwer; ohnehin empfindet man das Gedicht als mit zwei Schweren beginnend: »Fern kann er …« Nur in den beiden letzten Versen läuft der vierhebige Jambus unbehelligt geradeaus; insofern könnte man sie als Fluchtpunkt und Offenlegung jenes Hintergrundes deuten, wären sie nicht »Coda«, Vermächtnis, da mit »Lebt wohl« und dem einzigen Satzzeichen am Ende einer Strophe bereits das Schlusswort gesprochen scheint.
Andererseits nehmen sie den Tonfall des Anfangs auf. Die entspannte Diktion von »Fern kann er nicht mehr sein,/der tod« lässt für sich genommen nicht darauf schließen, dass es sich um ein Gedicht handelt; allmählich spricht sich der Dichter in dieses hinein. Am ehesten deutet das nachgestellte »der tod« auf gebundene Sprache hin, jedoch wäre es bei »Fern kann der Tod nicht mehr sein« aufgrund des dann möglichen, durchlaufenden Daktylus (/- -/- -/) noch stärker der Fall. Das Schlüsselwort bedarf eines Anlaufs; wenn nicht nachgesetzt, käme der Tod zu selbstverständlich daher.
Die Coda der zwei Schlussverse steigert die Redeweise des Beginns, wobei die metrische Bindung die sanft ironische Tönung unterstreicht: Es müssen nicht unbedingt »alte Bäume« sein, vor denen wir uns verneigen sollen, sie stehen für vieles andere; und wenn wir »alles schöne« grüßen sollten, hätten wir viel zu tun. Das mit dunklen, letzten Dingen befasste Gedicht soll leicht enden, nahe bei Heines salopper Volte: »Wenn du eine Rose schaust,/sag, ich lass sie grüßen«, auch nicht weit weg von Hyperion-Hölderlins bekennerischer Schwere: »Wenn du an mein Grab kommst …, auch die Bäume grüße und die fröhlichen Bäche, und lass, du Liebe! dir mein Bild dabei begegnen.«
|25| Als reiche für den Tod der syntaktische Anlauf nicht aus, bekommt er eine eigene Zeile; dem Schlaflosen (»Ich liege wach«) wird die Nacht auch in der weitaus längsten, syntaktisch kompliziertesten Zeile lang; und das oben hypothetisch ins Versmaß gezwungene »Doch sag ich, eh ich’s nicht vermag« muss gestört, zur stauenden Barriere aufgehöht werden, um dem »Lebt wohl!« Nachdruck und Gewicht einer Mündung, des eigentlich letzten Wortes zu verschaffen. An solchen Unebenheiten – Klopstock nannte es »körnigten Styl« – hat die Möglichkeit der glatteren, metrisch »einverstandenen« Formulierung untergründig teil.
Angesichts des Gegenstandes verwundert nicht, dass der Text sich in allegorisch dicht besetztem Terrain bewegt. Dem scheint unter anderem Rechnung getragen, wenn »abendrot und morgenrot« sich in die vierte Zeile drängen und sie zur sperrigsten, längsten machen, »abendrot« symbolisch prallvoll, »morgenrot« bis hin zu »leuchtest mir zum frühen Tod« kaum weniger, beides zusammen präjudiziert unter anderem durch Wilhelm Müllers »Vom Abendrot zum Morgenlicht/ward mancher Kopf zum Greise«. Und in der »finsternis«, an die das Ich des Gedichts sich gewöhnen will, treffen Schlaf und Tod sich in lang eingeübter Brüderlichkeit. Dies bestätigt der zögernd heraufkommende Morgen (»Noch dämmert er, / der neue tag«), als traue der Sprechende sich eine emphatische Begrüßung der Sonne, von Licht und Leben nicht mehr zu.
Wenn fühlbar aus normativen Strukturen herausgesprengt, sprechen Details eindringlicher; demgemäß liegen Trümmer des supponierten metrischen Gehäuses noch anderswo herum. Auch als Widerpart zu »Lebt wohl!« als dem einzigen anderen zweisilbigen Vers musste »der tod« von dem ersten abgetrennt werden, zudem findet er so deutlicher ein Klangecho bei »abendrot« und »morgenrot«; »noch« und »doch« signalisieren, dass sie innerhalb ein und derselben Strophe als zwei Versanfänge nebeneinander gestanden haben könnten; und die dichte Folge der Reimworte »tag«, »sag« und »vermag« trägt zum Imbroglio vor der Auflösung ins »Lebt wohl« wesentlich bei. Dass dieses als Quintessenz ungereimt für sich bleibt, ist kein Zufall – umso weniger, als andererseits die Leichtigkeit des Schlusses mit »schöne« befördert wird, weil »gewöhne« als Reimwort von fern aus der fünften Zeile herüberwinkt.
· · · · ·
|26|Musik in den Ohren der Sterbenden –
Musik in den Ohren der Sterbenden –
Wenn die Wirbeltrommel der Erde
leise nachgewitternd auszieht –
wenn die singende Sehnsucht der fliegenden Sonnen,
die Geheimnisse deutungsloser Planeten
und die Wanderstimme des Mondes nach dem Tod
in die Ohren der Sterbenden fließen,
Melodienkrüge füllend im abgezehrten Staub.
Staub, der offen steht zur seligen Begegnung,
Staub, der sein Wesen auffahren läßt,
Wesen, das sich einmischt in die Rede
der Engel und Liebenden –
und vielleicht schon eine dunkle Sonne
neu entzünden hilft –
denn alles stirbt sich gleich:
Stern und Apfelbaum
und nach Mitternacht
reden nur Geschwister –
In der Nähe von Sterbenden oder eben Gestorbenen leise zu reden mahnt jede Krankenschwester, nicht nur aus Pietät. Woher kommen Ahnung oder Wissen, dass jene uns noch hören, der Hörsinn zuletzt stirbt? Bei Nelly Sachs zieht »die Wirbeltrommel der Erde leise nachgewitternd aus«, nicht »ab«, war also nicht nur um die Sterbenden, sondern in ihnen; und sie geht wie selbstverständlich in die Musik der Sterne über, »harmonia caelestis« im Sinne der Alten. Die fließt »nach dem Tod in die Ohren der Sterbenden« – gegen den Einwand, Sterbende seien noch nicht tot.
»Nach dem Tod« hätte Nelly Sachs weglassen können; strikte Trennung von Hier und Drüben indes, das »Messer zwischen Leben und Tod« duldet sie nicht. Die Rede von »dunklen Sonnen« macht deutlich, dass »Israels Leib … aufgelöst in Rauch« auch ins Jenseits hineinweht; andererseits zweifelt sie selbst beim ermordeten Bräutigam nicht daran, dass »diese Erde keinen ungeliebt von hinnen gehen läßt«, dass der Tod uns in »die göttlich entzündete Geometrie des Weltalls« hinübergeleitet. |27| Wie sehr begreift sie Musik als Teil des anderen Lebens, gar als dieses selbst? Drüben, »nach Mitternacht«, sind alle Gestorbenen, ist alles Gestorbene füreinander »Geschwister«. Muss man den Gedankenstrich am Ende der letzten Zeile als hinter diese Gewissheit schüchtern gesetztes Fragezeichen lesen?
Jener Glaube wäre zynisch verkleinert, sähe man in ihm vornehmlich die Trostzuflucht einer Frau, die nie verwunden hat, den Schrecken des Judenmords entgangen zu sein, nie weitab war von den Konsequenzen derer, die es nicht ertrugen: Tadeusz Borowski, Jean Améry, Primo Levi, Paul Celan, Peter Szondi. Fast alle Angehörigen hat sie in den Vernichtungslagern verloren und 1961 um Gnade für Eichmann gebeten. »Melodienkrüge« füllen sich ihr sogar im »abgezehrten Staub«.
Damit prallt sie im Blick auf »selige Begegnung« auf ein Schlüsselwort. »Staub, Rauch, Asche sind … immer gegenwärtig« (Enzensberger); Staub kann sich seligen Begegnungen öffnen und »sein Wesen auffahren« lassen. »Unser Gestirn ist vergraben in Staub«, heißt es in einem anderen Gedicht; dennoch weiß sie den Stern der Erlösung leuchten. »Es gibt und gab und ist mit jedem Atemzug in mir der Glaube an die Durchschmerzung, an die Durchseelung des Staubes als eine Tätigkeit wozu wir angetreten«, schreibt sie am 9. Januar 1958 an Celan; »ich glaube an ein unsichtbares Universum, darin wir unser dunkel Vollbrachtes einzeichnen. Ich spüre die Energie des Lichts, die den Stein in Musik aufbrechen läßt.« In ihrem bekanntesten Gedicht wird »Israels Leib … aufgelöst in Rauch« von einem Stern empfangen, »der schwarz wurde«. »Oder war es ein Sonnenstrahl?«, fragt sie dennoch.
Fliegender, sehnsüchtig singender Sonnen, geheimnisvoller Planeten, der Wanderstimme des Mondes ist sie so sicher, dass ihre Rede sich von deren Schwingungen anstecken lässt, wie in einem Exordium vorbereitet schon im ersten Vers: »Musík in den Óhren der Stérbenden«. Danach klingt »die síngende Séhnsucht der flíegenden Sónnen« wie eine jubelnde Steigerung, als bedürften die Worte beflügelnder Vorstellungen, um daktylisch abzuheben – »Musik«, die gegen das Gewicht und die Kontur der Worte bzw. Bilder immer neu hergestellt werden muss. Bei »in die Óhren der Stérbenden flíeßen« hat der Daktylus nochmals freie Bahn.
|28| »Staub« verändert Ton, Sprechweise und Syntax. Vor der letzten Zeile der ersten Strophe stand in sieben Zeilen ein unvollständiger Satz, ein wie ungeduldig von einer Jenseitsvorstellung zur nächsten forteilendes Sprechen. Nun, da das beladene Wort gefallen ist, wird es wiederholt, als müsse das Gedicht sich seiner und seines Bedeutungsumkreises versichern. So kommt es, dreimal an »Staub …, Staub …, Wesen« anschließend, zu kleinteilig zerpflückter, wie überstürzt gesprochener Syntax. Nachdem schon die erste Strophe dringlich deklamiert erschien, mutet die zweite atemlos an, aufgefangen endlich im weit ausschwingenden »eínmischt in die Réde der Éngel und Líebenden«, sodann abgebremst im trochäischen »únd vielleícht schon eíne dúnkle Sónne néu entzünden hílft«.
Dies liegt im Vorfeld der großen Kadenz, einer Doxologie, des feierlich zelebrierten Schlusschorals, nun weitab von metrischen Beunruhigungen. Dem in diesem Gedicht einzig vollständigen Satz und dem Gleichschritt der vier Zeilen fügt sich, zusammengezogen aus »es stirbt sich« und »alle sterben gleich«, auch die erste:
(Denn) álles stírbt sich gleích:
Stérn und Ápfelbáum
únd nach Mítternácht
réden núr Geschwíster –
Der Eindruck getragener Feierlichkeit erklärt sich aus jenem inneren Tempo, das von der Dichte, dem Eigenprofil der Bilder und Begriffe ebenso bestimmt wird wie vom Metrum und von klanglichen Valeurs – etwa der »singenden Sehnsucht der Sonnen«. Am Ende hat das Gedicht sein Flussbett gefunden. Hier ganz und gar, wie überall in Dichtungen der Nelly Sachs, wird gebetet.
|29|6
Nächtliches Totenamt Er sitzt im Dunklen und hört die »Missa pro defunctis« von Pierre de la Rue, einem der in Europa weit herumgekommenen Niederländer, zeitweise im Dienst Kaiser Maximilians, später Favoritmusiker von dessen Tochter Margarete. Die nachtschwarze Dunkelheit der tiefen Lagen – vom Bass wird mehrmals das große C und das Contra-B verlangt – verträgt sich gut mit der Dunkelheit im Zimmer, im Streulicht entfernter Straßenlampen treten die Gegenstände nur schattenhaft hervor. Obwohl das »Dies irae«, die geballte Ladung augustinischer »Logik des Schreckens«, ausgespart ist, bleibt die Musik auf weiten Strecken schroff und ungefällig, seraphisch aufgehellte Wohlklänge sind selten. Hierzu würde gut passen, was der häufig angestrengte Ausdruck Singender auf Bildern von damals nahelegt: dass sie anders, »kehliger« sangen als heute, möglicherweise weitab von den Klangbädern, mit denen manche Ensembles sich und uns den Zugang zu jener Musik erleichtern.
Nichts beleidigt ihn derzeit mehr als Weichspül-Theologie unter anderem im Kielwasser von falsch verstandenem Schleiermacher, die alles Kierkegaard’sche »Furcht und Zittern« wegkratzt, an die entsetzlichste Hinrichtungsart mit Lobpreisungen eines barmherzigen Gottes herandrängelt und im Nazarener-Kitsch, der Butzenscheiben-Frömmigkeit cäcilianischer Musik manch schlimme Blüte trieb. Sein Großvater, berichtete die Mutter, habe in der Kirche, sonst als Vorsänger die Gemeinde anführend, bei »Mein Mund, er träuft zu jeder Zeit/von süßem Sanftmutsöle« aus Protest pausiert.
In Pierre de la Rues Requiem fließt kein Sanftmutsöl. Insgesamt hält sich der musikalische Satz eng an die liturgischen Vorlagen und beansprucht, wie meisterhaft immer gefügt, wenig für sich – große Kunst, die nicht primär Kunst sein soll. Vermutlich sind gregorianische Melodien damals nicht nur von Eingeweihten als Hintergrund mitgehört, Polyphonie vornehmlich als direkte Verlängerung und schmückende Ausfaltung, als Predigt wahrgenommen worden; enge Imitationen in Duo-Passagen erwecken den Eindruck, dass um die Wette gepredigt |30| wird, man einander ungeduldig ins Wort fällt. Weil der Text nicht ungestört fortläuft, erzwingen sie besondere Aufmerksamkeit. Bei Trauermusik mag die Empfindlichkeit gegenüber luxurierender Polyphonie besonders groß gewesen sein.
Welch eine Dramaturgie beim Wechsel zwischen einem Sänger, zweien oder allen! Zu Beginn hält der Komponist die Schwelle zwischen dem Anruf des Rezitanten – nur das Wort »Requiem« – und dem Einstieg des Chores so niedrig wie möglich, indem er die Stimmen direkt an die liturgische Melodie anschließen und nacheinander einsetzen lässt – leise daherkommende Verzweigung ein und desselben. Zeit zu kontrapunktischer Entfaltung hat die Musik nicht, weil »et lux perpetua« griffig formuliert und paarig imitiert gesungen werden soll – Trittbrett zu weit ausholenden, die Lichtverheißung auf unterschiedliche Weise wiederholenden Verflechtungen. Fast ließe sich von einer Exposition der Konstellation von Vorsänger und – mehrfach gestaffeltem – Tutti sprechen. Jener holt den Chor mit »Te decet hymnus, Deus, in Sion« (Dir, Gott, gebührt ein Loblied in Sion) aus der Feier des »ewigen Lichts« zurück; dem aber antwortet das Tutti und verstärkt die Aussage mit »Et tibi reddetur votum in Jerusalem« (Dir erfülle man das Gelübde in Jerusalem). Wenig später akzentuiert es die Eindringlichkeit des »Exaudi« (erhöre) durch akkordischen Gleichschritt, erstmals und im ersten Satz nur hier.
Im Offertorium baut La Rue die beiden auf »Quam olim Abrahae« zulaufenden Komplexe ähnlich auf, beide Male als große Steigerungen, mit imitierenden Duo-Passagen beginnend, die – wiederum niedrige Schwelle – direkt an den Rezitanten anschließen; nach dessen »Domine Jesu Christe« will das obere Stimmpaar beim ersten Mal das preisende »Rex gloriae« für sich, beim zweiten Mal redet das tiefe Stimmpaar für alle mit der Bitte, der Herr möge Opfer und Gebete annehmen »für jene Seelen, deren Gedenken wir heute feiern (»pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus«). Die erste Steigerung läuft auf das – wieder akkordisch-eindringlich deklamierte – »repraesentet« zu: Der heilige Michael möge sie ins heilige Licht »geleiten«; in der zweiten verdichtet sich die Polyphonie nach den Duo-Passagen, kulminiert in den taktweise gestuften Einsätzen bei »in requiem sempiternam« und mündet in ekstatische Wiederholungen von »gaudere«, der Vorausschau auf ewige Freuden.
|31| Ähnlich den Texten zugewandt, zugleich anders verfährt der Komponist in den übrigen Sätzen und trägt dem Umstand Rechnung, dass in der abschließenden Communio von der »lux aeterna« bzw. »perpetua« bis hin zur wörtlichen Übereinstimmung mit dem Introitus-Beginn abermals die Rede ist und dieser finalegemäß übertroffen werden sollte. Wenn es so war, geben die kostbaren, durch den Rahmen der »Cumsanctis-tuis«-Abschnitte umschlossenen Takte ingeniöse Antwort: nochmals »Et lux perpetua luceat eis« deklamierend, in rascherem akkordischem Gleichschritt beginnend und bei »luceat« ohne Wortwiederholung sich verzweigend. Wie am Beginn der Communio »leuchtet« das Licht auch im Satz – er liegt höher als fast alles Vorangegangene.
Wie er da sitzt und hört, in die Musik hineinkriechen, sie tief in sich einlassen will, verblassen Fragen wie: Ob da einer sei, der ewige Ruhe schenken kann, wie diese Ruhe beschaffen sei, ob es die »lux aeterna« gebe, die den Toten leuchtet, offenbar aber nicht sicher leuchtet.
Selbst in sakrosankten Texten spielen zuweilen Momente mit, die mit Gottergebenheit wenig zu tun haben: Im Offertorium wird der »rex gloriae« nicht nur gebeten, die Seelen der Verstorbenen vor den Qualen der Hölle, den Tiefen der Unterwelt, dem Rachen des Löwen zu bewahren und sie friedlich »de morte … ad vitam«, ins ewige Leben hinüber zu geleiten, zweimal wird er eindringlich gleichlautend darauf hingewiesen, er habe es dem Abraham »et semini euius« einstmals versprochen. Mozart hat es »molto energico« komponiert.
Dezidiert Tröstendes begegnet in dieser Musik nicht, eher eine von oben verbürgte Kameradschaft, insoweit Musik nicht nur die vergänglichste aller Künste, sondern tönende Vergänglichkeit selbst ist – und Kameradschaft mit denen, die sich vor 500 Jahren ähnlich fassungslos ins Ritual retten wollten.
· · · · ·
Das mehrstimmige Requiem hatte noch keine lange Geschichte, als Pierre de la Rue um 1500 die »Missa pro defunctis« komponierte. Die Benennung weist darauf hin, woher es kam; als Gattung eigenen Rechts kann es, Teile des Ordinarium missae mit solchen des Proprium de tempore mischend, nicht einmal in der Konfiguration der Sätze gelten: |32| Graduale, Tractus und Offertorium bleiben oft fakultativ, das »Dies irae« war erst seit dem Trienter Konzil obligatorisch. Ob Jan Ockeghems Requiem, das erste erhaltene, unvollständig ist, weil Sanctus, Agnus Dei und Communio fehlen, lässt sich deshalb nicht entscheiden.
Nur von einem vorangegangenen wissen wir; Guillaume Du Fay hat es vermutlich in den 1440er-Jahren für die alljährlich abgehaltenen Versammlungen des Ordens vom Goldenen Vlies komponiert – jeweils am dritten Tag feierte der Orden die Totenmesse. Später hat er es in die Chorbücher der Kathedrale zu Cambrai eintragen lassen und als nach seinem Begräbnis aufzuführen verfügt. Ob es dazu gekommen ist, wissen wir nicht; der Tod des 77-Jährigen trat wohl überraschend ein, auf dem Sterbebett hat er nicht, wie ebenfalls verfügt, seine »Ave-regina«-Motette hören können. Anders als diese ist das Requiem, noch in den 1520er-Jahren in Cambrai gesungen, verloren gegangen.
Dass Du Fay den Zeitgenossen als »lumen totius musicae atque cantorum lumen« galt und eigene Werke als Vermächtnis zusammenstellen ließ, begünstigt den Eindruck, mit solchen Verfügungen – es betrifft auch seine alljährlich zu singende Antonius-Messe – sei über Sicherung des Gedenkens hinaus einige Glorifizierung beabsichtigt gewesen. Dabei bliebe unbedacht, wie wenig wir die Konsequenzen täglich geübter, die Ars moriendi einschließender Gläubigkeit nachvollziehen können, dass Musik mehr war als Wegweiser, Akzidens der Jenseitsfahrt: der Orpheus-Sage vergleichbar ein Türöffner; dass Gott die in Cambrai gesungene Musik, mit der Du Fay vor ihn tritt, tatsächlich hören und als Vorposten der unhörbaren, von ihm veranstalteten »harmonia caelestis« erkennen würde; dass sie entliehen sei und dem eigentlichen Autor vom Protokollanten nunmehr zurückgegeben werde.
Die Vorstellung, bestimmte Kunstfertigkeiten könnten an einer Werkstruktur auch teilhaben, wenn sie, als Möglichkeit im Hintergrund, nicht zum Einsatz kämen, mutet spekulativ an; einige Passagen im Requiem von Jan Ockeghem, der Du Fay als unbestritten erster Musiker seiner Zeit nachfolgte, legen sie dennoch nahe. Direkte Niederschläge der legendären Kanonkünste, die allererst und einseitig mit ihm und Wunderzeugnissen vorausdenkender Imagination wie der »Missa cuiusvis toni« oder der »Missa prolationum« verbunden waren, findet man |33| hier nicht, indirekte umso mehr. Das betrifft unter anderem Duo-Passagen, in denen beide Linien subtil und innig verschlungen sind und zugleich sich als eine einzige, der deklamativen Eindringlichkeit zuliebe aufgespaltene, als potenziertes gregorianisches Psalmodieren darstellen; ebenso betrifft es furios redende, von einer musikalischen Prägung zur nächsten fortstürzende Partien im Graduale, deren kadenz- und zäsurloses Dahinfluten rhetorischen Verdeutlichungen zunächst nicht günstig erscheint und dennoch den Worten aus dem 22. Psalm ein Podest bietet; die sich zudem weniger polyphon geben als sie sind. Es betrifft allgemein eine Diskretion, die die Musik abhält, sich selbstbezüglich vorzudrängen. Das wäre innerhalb des tönenden »Seins zum Tode« peinlich, obwohl sie hier – »Todesraum grenzt vermittelt an Musik« (Bloch) – zuständiger ist als andere Künste.
Dort jedoch, wo Wort und Ton einander semantisch oder strukturell nahekommen, gar in Einklang gebracht werden können, setzt Ockeghem auf vielerlei Weise an. Antiphonische, in liturgischer Einstimmigkeit vorgeformte Traditionen erscheinen am Beginn von Introitus und Graduale ins Szenenhafte projiziert, wenn der Chor dem Anruf des Rezitanten antwortet – zunächst als homophones Echo und sich als Medium der Vertiefung ausweisend, da dies den Worten viel Raum schafft. Dem folgt beim gelängten »aeternam« eine so behutsame wie direkte Wortausdeutung, ähnlich im Offertorium bei dem mit »de morte transire ad vitam« angesprochenen ewigen Leben. Durchweg verfährt Ockeghem bei rhetorischen Momenten diskret, weitab vom Auftrumpfen mit eigenen Möglichkeiten: am Ende des Tractus beim Nachdruck der Tag und Nacht peinigenden Frage »Ubi est Deus?« ebenso wie im Offertorium bei der Bitte um Rettung vor Hölle und Abgrund, auch bei der – wiederholten – Mahnung, dies habe Gott schon dem Abraham versprochen.
Antiphonisch inspiriert erscheint auch das Gegeneinander zwei- bzw. drei- oder vierstimmiger Partien, auffällig nicht nur bei vollstimmigen Bekräftigungen – »consolata sunt« im Graduale, »Ubi es Deus tuus?« im Tractus, »rex gloriae« im Offertorium –, sondern auch im Wechsel unterschiedlicher, wie aus gegensätzlichen Richtungen, aus der Tiefe bzw. Höhe einander zusingender Gruppen; dass Tonlagen seinerzeit nicht nur symbolhaft räumlich begriffen wurden, steht außer Frage – |34| wie sehr Klangerlebnisse in Kathedralen zugleich Raumerlebnisse waren, belegen zeitgenössische Berichte.
Für die Exposition jener Antiphonie gab das Kyrie mit drei je dreigliedrigen Teilen erwünschte Gelegenheit: die erste »Kyrie«-Anrufung drei-, die zweite zwei-, die dritte wieder dreistimmig, die drei »Christe«-Rufe umgekehrt, der zweite, wiederum dreigliedrige »Kyrie«-Teil wie der erste, von diesem abweichend nur in der letzten, als abschließende Bekräftigung vierstimmig gesetzten Anrufung. So ergibt sich ein regelmäßiger Wechsel der Besetzungen und, diese betreffend und durch die weitgehende Identität der flankierenden »Kyrie«-Teile bestätigt, die fast zentralsymmetrische Disposition:
a – b – a/b – a – b/a – b – c
Dergestalt potenziert die Musik das In-sich-Kreisen der Worte und deren Inständigkeit.
In einer Hinsicht scheint schon in den ersten Totenmessen ein eigener Weg eingeschlagen: Sie halten zur liturgischen Einstimmigkeit mehr Nähe; zumeist liegen die Cantus, anders als bei den Versteckspielen längst üblicher Messzyklen, in den Oberstimmen. Offenbar wird Distanz zum Ritual angesichts des ernsten Gegenstandes schnell als abgehoben verdächtig. Pierre de la Rues Generationsgenosse Antoine Brumel, wie jener zumindest im weiteren Sinne Schüler von Ockeghem, hat ein Requiem hinterlassen, das sich in der fast durchgängigen Beschränkung auf harmonische Stützung des Cantus wie ein ängstlich verengtes Gegenstück zu La Rues freizügiger Gestaltung ausnimmt. Dessen Requiem maßgebend zu nennen, fällt dank dieser Konstellation nicht schwer, wiewohl dahinter das verschollene von Du Fay steht; wie viele verlorene außerdem?
Beim exzentrischen Antoine Brumel, dem ersten bedeutenden Franzosen in einer von Niederländern dominierten Epoche, der trotz unsteten Lebensgangs – Chartres, Paris, Genf, Chambéry, Laon, Ferrara, Rom; mehrmals unfriedlich entlassen – ein ansehnliches Werk hinterließ, schlagen die Anforderungen der Totenmesse in differierenden Niveaus offen durch. Im Sanctus und Agnus, als wiederholte Anrufe mit wenig Worten der Musik leicht zugänglich, beschränkt er sich auf eine akkordische Fundierung des liturgischen, zudem sparsam ausgezierten Cantus |35| und bleibt der Vertiefung des Gesagten einiges schuldig; im wortreichen »Dies irae«, dem einzigen vor dem Trienter Konzil in einem Requiem erscheinenden, wechselt er im Ablauf der Strophe regelmäßig zwischen Ein- und Mehrstimmigkeit und gerät mehrmals an solche, die sich für die jeweils andere Behandlung besser eignen würden, muss damit naheliegende Frage-Antwort-Konstellationen ignorieren. Derlei Beschränkung liegt sternenweit weg von Werken wie seiner zwölfstimmigen »Missa Et ecce terrae motus«, einem grandiosen, raffinierte Kanonbildungen einschließenden Klangbad, das humanistisch oder tridentinisch beflügelte Puristen das Fürchten gelehrt haben müsste.
In seinem Requiem heben sich Introitus und Communio wie befreiende Ausbrüche von den kargen Lösungen ab, besonders an den Schlüssen, wo die Musik, als sei sie selbst ein Stück Ewigkeit, von der »lux aeterna«, die den Toten leuchten möge, und dem »requiem sempiternam« nicht lassen will. Nun fährt sie frei aus, schon als klingendes Medium dem Jenseits nahe, kompetenter von ihm redend als Worte.
7
Vox humana – Totenrede auf Dietrich Fischer-Dieskau Worte passen in diese Stunde nicht. Nur »Musik und des Verewigten Wort« hatte Thomas Mann bei der Trauerfeier für Gerhart Hauptmann gewünscht. Wie nun gar, wenn des Verewigten Wort größtenteils Musik war, bis in die letzte Körperfaser hinein gelebte Musik? Da müsste doch er reden – in der Glaubensfestigkeit des »Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden«, oder mit dem unsagbar innigen Schlummerlied für Magelone: »Schlafe, schlaf ein, … ich will dein Wächter sein.« Das holt kein Wort ein, wie immer Worte die Gemeinsamkeit des Gedenkens artikulieren mögen. Denn jeder hat ein Recht auf die eigene Art des Gedenkens, auch das Recht, auf eigene Weise untröstlich zu sein. Nachrufe werden auch durch die Hilflosigkeit beglaubigt, mit der sie nach-rufen, hinterherrufen.
|36| Vor drei Wochen konnten Worte am Sarg wenigstens den Abstand verringern zwischen jener persönlichsten, gegen alle Umwege allergischen Trauer und den normativen Ritualen von Tod und Begräbnis. Dennoch entkam ich dem Hader mit jenem Abstand nicht, als der Sarg grässlich präzise in die Erde hinabfuhr und die Vorstellung sich aufdrängte, irgendwo oben, vermutlich im Paradies, Abteilung Musik, würde, angeführt von Schubert, Schumann, Brahms und Mahler, ein Empfangskomitee an der Pforte stehen und ihn willkommen heißen: »Hier gibt’s genug Engelsgezirp und amtlichen Palestrina; nun, Dieter, singe Du!«
In dieser Stunde interessiert mich nicht, dass manchem die Rede vom Recht, untröstlich zu sein, überzogen erscheint. Man könnte meinen, der Einschlag des Todes sei durch 87 Lebensjahre und die Legende abgefangen, die Dietrich Fischer-Dieskau der Anwesenheit eines Mitlebenden längst enthoben hat. Sie hat es nicht. Nicht nur Nahestehende, die von den Nöten der letzten Jahre und Monate wussten, traf die Nachricht unvermittelt hart. Es gibt Tode, auf die man entgegen aller Wahrscheinlichkeit nicht vorbereitet ist, hier zudem, weil jene Legende von einer Art ist, die keine geminderte Gegenwart verträgt. Wer Fischer-Dieskau singen hört, kann sich dem Auf-Du-und-Du, dem Eindruck nahezu physischer Anwesenheit kaum entziehen.
Gewiss spielt hier das Privileg der emotional direkt redenden Musik mit – »das Ohr ist der Seele am nächsten« (Herder). Große Interpreten wischen ohnehin jene Historizität beiseite, deren Maßgaben zu sagen erlauben würden, Bach könne man heute nicht mehr singen wie Fischer-Dieskau um 1950 bei Karl Ristenpart. Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass wir von dort so weit entfernt sind wie damals er von den Sängern, mit denen Mahler in Wien zu tun hatte.
Dies könnte wie Abwehr der langen Schatten anmuten, die Fischer-Dieskau über ein Terrain wirft, in dem schon die zweite Generation nach ihm zu Hause ist. Sie hat es nicht leicht – und profitiert zugleich, im Blick auf eine schwindelnd hoch liegende Messlatte, unter anderem davon, dass Liederabende mit anspruchsvollen Programmen erst durch ihn selbstverständlich geworden sind. Wer hätte zuvor gewagt, Schumanns Kerner- oder Brahms’ »Magelone-Lieder« als Zyklen zu begreifen und öffentlich zu präsentieren?
|37| Auch andere Kontexte waren im Spiel – die Stunde Null der deutschen Katastrophe, wonach vieles, was deutsch hieß, neu legitimiert werden musste. Ihr und den folgenden Jahren wurde in dem jungen Sänger ein Herold geschenkt, dem von der jüngsten Vergangenheit nichts anhing. Wie fragwürdig die Unterscheidung eines »bösen« vom »guten« Deutschland immer bleiben mag, bei ihm fand sie Anhalt. Manche Nachkriegserfolge Daheimgebliebener waren den Emigranten zu Recht ärgerlich – bei ihm war es anders, er durfte die Herzkammern deutsch-romantischer Innerlichkeit den Landsleuten und den Kriegsgegnern von gestern unbefangen aufschließen. Die politische Relevanz dieser deutschen »vox humana«, des erklärtermaßen apolitischen Missionars war enorm, einem englischen Biografen galt er als »Inbegriff deutscher Kultur«.
So präzise der kometenhafte Aufstieg in die Szenerie der Nachkriegszeit gebettet war, so bald – mit zunehmenden Jahren immer mehr – sah Fischer-Dieskau sich als verspäteten Propheten einer heiligen, auf letzten Ernst vereidigten Kunst, trotz dröhnender Erfolge unsicher, ob man die Botschaft so verstehen werde, wie er sie meinte. Was seit etwa 20 Jahren auf den Bühnen grassiert, war für ihn der pure Horror, seit Langem schon hat man ihn, der in mehr als 60 Rollen geglänzt hatte, im Publikum nicht mehr gesehen.
Dies unter altersbedingter Konservativität abzubuchen, wäre billig. Vielmehr sprach ein Abstand mit, der aus angestrengter Selbstbewahrung herrührte und am ehesten bei gemeinsamer Arbeit oder im kleinen Kreis vertrauter Menschen dahinschwand. Kein dermaßen existenziell verfasstes Kunstverständnis kommt ohne Abgrenzung aus, je höher einer steigt, desto einsamer ist er. Noch in privateste Lebensbereiche hat Fischer-Dieskau seine mönchische, vom Alltag abgeschottete Arbeitsklausur hineingeschnitten, die in manchen Formen von Lebensfremdheit an Thales, den bei der Betrachtung des Himmels versehentlich in den Brunnen stürzenden Philosophen, erinnert, in der rücksichtslosen Fixierung auf ein einzig und allein Wichtiges an E. T. A. Hoffmanns Cardillac.
Sonderbare Unschuld desjenigen, der an sich höchste Ansprüche stellt und erstaunt ist, wenn andere das nicht begreifen, nicht tun, nicht können! Mancher, der sich beim Musizieren in innige Kommunikation |38| eingebunden fand, hat erleben müssen, dass es sie darüber hinaus kaum gab; Jubelfeiern nach Konzerten oder Premieren sind seine Sache nie gewesen. Immerhin haben ihn viele, wie Brigitte Fassbaender, auch als »sehr normalen Menschen, … herzlichen und lustigen Kollegen« erlebt; »er hat herrlich lachen können.« Ihre Kollegin Marjana Lipovšek, danach gefragt, wie man im Münchner Ensemble zurechtgekommen sei, benannte die Sache schlagend: »Ganz einfach: Wir haben ihn angehimmelt, und er fand es selbstverständlich.«
Wie auch nicht, da er, wo immer er auftrat, im Mittelpunkt stand und Sturzbächen rühmender Superlative ausgesetzt war: ein »Gott, dem alles geschenkt wurde« (Elisabeth Schwarzkopf), »der größte Sänger des Jahrhunderts« (Leonard Bernstein), »der größte Musiker, der mir begegnet ist« (Swjatoslaw Richter). Man sollte meinen, sein Rang hätte ihn von Lob und Tadel unabhängig gemacht – weit gefehlt! In übergroßen Empfindlichkeiten verriet sich die Anspannung, unter der er stand.
Abgesehen davon, dass Urteile Außenstehender diejenigen kalt erwischen, die aus der Hitze des Vollzugs kommen und wissen, dass sie gegeben haben, was hier und heute irgend möglich war, ärgerte Fischer-Dieskau die Profilierungssucht derer, die sich an ihm schadlos hielten. Wenn der Anspruch, der schärfste Kritiker seiner selbst zu sein, von mittleren Geistern angefochten wird, reagiert man allergisch, besonders, wenn sie eigene Unsicherheiten bestätigen. Wer außer ihnen selbst ermisst schon, wie sehr Musizierende mit jeder Aufführung von vorn beginnen, mit dem Werk sich selbst riskieren? Das sollte angesichts der minutiös durchgeformten Hochämter seiner Konzerte nicht vergessen werden.
Kein anderer Sänger hat weit über 40 Jahre höchste Ansprüche vertreten und ihnen genügt, kein anderer ein so vielfältiges Repertoire vertreten, kein anderer hat derart umfangreichen Einsatz für neuere und neueste Musik neben dem klassisch-romantischen Repertoire gewagt und diesem so viel zurückgewonnen, keiner hat so viele Einspielungen hinterlassen. Ein vor zwölf Jahren erschienener Katalog zählt 190 Komponisten, 25 »Figaros«, 9 »Matthäuspassionen«, 14-mal Brahms’ »Deutsches Requiem«, 18-mal »Die schöne Magelone«, 23-mal die »Lieder eines fahrenden Gesellen«, 33-mal »Die Winterreise« – Belege nicht nur ungeheuren Widerhalls und der Geschäftstüchtigkeit von Dritten, sondern |39| auch einer kreativen, unverwandt auf Herausforderungen ausgehenden Neugier. Differenzen der Aufnahmen bezeugen das nicht weniger als Grenzgänge, seien es Partien wie Busonis Faust, Henzes Mittenhofer, Reimanns Lear, oder fachlich am Rande liegende, der »Rheingold«-Wotan und Sachs.
Er hätte es leichter haben können. Der lyrische Schmelz seines hohen Baritons, sehr bald in allen Registern sichergestellt und vertieft durch etwas, was man, um Charakterisierungen verlegen, »tönende Humanität« nennen könnte, hätte anderen allemal ausgereicht, mindestens zu dem, was er als »Belkantisieren« bespöttelte. Ihm reichte es nicht. Da Elisabeth Schwarzkopf ihn den nannte, »dem alles geschenkt wurde«, hat sie hinzuzufügen vergessen, dass er selbst sich nichts geschenkt hat. Zu so sicherer Beherrschung von tausenden Liedstrophen, zu solcher Reichweite, solch subtiler Kontrolle des Atems gelangt man nicht ohne konsequentes, hartes Training. Wenn irgendeiner seine Begabung als Auftrag und Verpflichtung begriff, dann er; wenn irgendwo bei einem Sänger Genie auch Fleiß war, dann bei ihm, noch in der Arbeit am Anschein, dass dies, als »frei von den Göttern« herabkommend, nicht so sei.
Deshalb gefiel es ihm nicht, wenn Kollegen von Pingeligkeiten auf szenischen Proben berichteten; Regisseuren und Dirigenten, die es nicht genau nahmen, rechnete er die Spielräume keineswegs positiv an, die hierbei offenblieben, Schluderei war ihm ein Gräuel. Er wollte es genau wissen und konnte, in der Recherche de l’absolu auf Kameradschaft angewiesen, verletzbar und wehrlos erscheinen. Bei Schostakowitschs Vierzehnter Sinfonie habe ich es vom Pult aus erlebt: Noch bei der kleinsten Unregelmäßigkeit zuckte er zusammen.
Der Ärger über jene Berichte hatte allerdings, besonders den Liedgesang betreffend, ernstere Gründe: In der Arbeit noch an kleinsten Nuancen stellte Fischer-Dieskau mit seinen Mitstreitern eine Einmütigkeit her, die am Ende, oberhalb aller Vorfestlegung, durchaus ungeplante Freiheiten ermöglichte. Im Konzert, das wissen die Klavierbegleiter am besten, konnte es plötzlich anders ausfallen als zuvor erarbeitet – und hätte dennoch ohne die Vorarbeit nicht anders sein können! So blieben die Konzertabende sternenweit entfernt von Blaupausen vorangegangener Aufführungen oder Einspielungen – hundertmal Gesungenes jeweils |40| hier und jetzt neu wahrgenommen, neu erlebt, fundamental unwiederholt, immer auf dem Wege zu Valérys »possible à chaque instant«, einem »So und nicht anders«, worin aufgehoben bleibt, dass es auch anders hätte sein können.
»Sie sind ja gar kein Sänger, Sie sind ja ’n Barde«: Hindemiths Kompliment liegt nahe beim oft bemühten Orpheus-Vergleich, ist mehr als blumige Metapher, weil der Singende stärker als jeder andere der Musik schutzlos gegenübertritt: Kein vermittelndes, objektivierendes Instrument schiebt sich zwischen ihn und sie, er selbst, sein Körper, ist das Instrument; auch bei rein technischem Training bleibt er an intimste Befindlichkeiten gekettet. Überdeutlich dank totaler Instrumentalisierung seiner selbst sang nie nur Fischer-Dieskaus Stimme, sondern – Kopf, Herz und Physis zum Ton hin fokussierend – stets der ganze Mann.
Dunkle Stunden des Altgewordenen erklärten sich großenteils daher, dass er von jenem »zweiten Stoffwechsel« zunehmend abgeschnitten war, als welcher Musik die Körperlichkeit des Singenden bis in die letzte Faser durchströmt. Eben dies hatte den epiphanienhaften Beglaubigungen zugrunde gelegen, dank derer Wort und Ton wie endgültig wiedervereinigt anmuten und der Traum von der Ursprache sich momentweise zu erfüllen scheint. Wer könnte das je vergessen: das lösende, todtraurige Dur bei »Will dich im Traum nicht stören«; die bebend verhaltene Andacht, die in Eichendorff-Schumanns »Mondnacht« den schwebenden Konjunktiv von Worten und Tönen aufnimmt (»Es war, als hätt’ der Himmel …«); die Quintessenz aller Innigkeit im »Schlafe, schlaf ein« der »Magelone«, das verschämte Schwelgen in Vorstellungen eines schönen Todes bei »Sterb ich, so hüllt in Blumen meine Glieder« oder »O sieh, wie eine Silberbarke schwebt der Mond« im »Lied von der Erde« – schon der Sextaufschlag und der Wechsel von »o« zu »i« (»O sieh«) blicken zum Nachthimmel auf. Konsonanten werden intentional aufgeladen – im zögernden »sch« von »Schönheit« steckt die scheue Annäherung (»er schuf die Schönheit und dein Angesicht«), schon das gehauchte »h« – »Heil sei dem Freudenlicht der Welt« im ersten der »Kindertotenlieder« – enthält, wie schwer es dem verwaisten Vater wird, das Freudenlicht der Welt freudig zu begrüßen. Der tief reflektierte Ernst und die Noblesse seiner Kunst bleiben sängerischen Verführungen nichts schuldig, ohne ihnen |41| zu verfallen; nicht ein Schatten von Salon oder Schmachtfetzen bleibt bei Strauss’ »Traum durch die Dämmerung«, und die dreiste Schmissigkeit von »Auf, hebe die funkelnde Schale« erscheint zugleich schwunghaft wahrgenommen wie durch die aufgehellte Stimme distanzierend überhöht – der Liedsänger in einer Rolle.