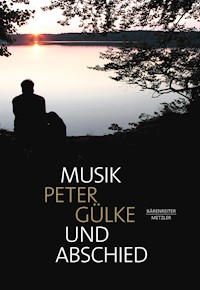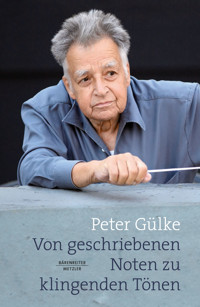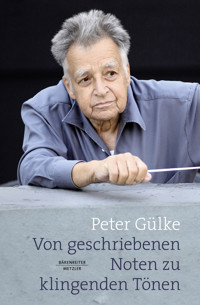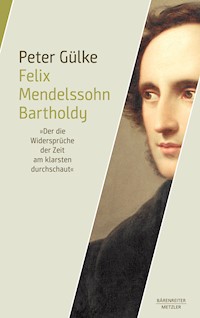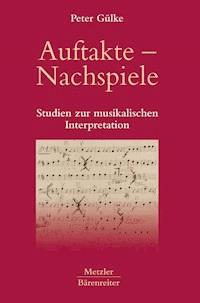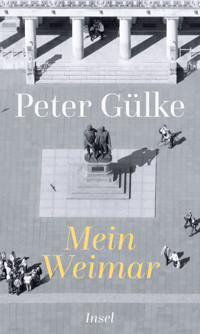
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Weimar – »Ilm-Athen« und »Goethestadt« mit dem Nachbarort Buchenwald. Der berühmte Dirigent, Musikwissenschaftler und Schriftsteller Peter Gülke, Nachfahre der Familie Vulpius, vergegenwärtigt sich in diesem Buch die prägenden Erfahrungen seines Lebens: die Kindheit in einer Stadt, die »der Führer« so gern besuchte; die Jugend in der stalinistischen DDR; der Musikerberuf im gelenkten Staat; 1983 dann der Entschluss, das Land zu verlassen, weil der Druck seitens der Stasi unerträglich geworden war; 1990 Rückkehr in sein »fernes, nahes, geschändetes, geliebtes Weimar«, das eine andere Stadt geworden ist. Immer wieder öffnen sich Aussichten auf vergangene Epochen, treten Goethe, seine Frau Christiane Vulpius, Herder, Schiller, Schopenhauer auf den Plan, aber auch Schubert, Bach, Mendelssohn – wie überhaupt Porträts von Musikern und brillante Musikbeschreibungen einen weiteren Schwerpunkt des Buches bilden. Ein wiederkehrendes Motiv sind die Besuche auf dem Ettersberg und dabei der Versuch, sich »das Unfassliche« des Menschheitsverbrechens zu erklären.
»Vielleicht muss einem die Stadt, in der so viel eigene Vergangenheit hängt, ganz verloren erscheinen, um neu erblickt, neu angenommen zu werden.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Peter Gülke
Mein Weimar
Insel Verlag
Mein Weimar
Zweierlei »Mein«. Vor fast achtzig Jahren lernte ich bei Fräulein Rauch in der Pestalozzi-Schule, »mein« sei ein besitzanzeigendes Fürwort. Weimar indes, überhaupt eine Stadt als Besitz anzuzeigen – welch eine Anmaßung! Im Sinne von Verwurzelung und Prägung besitzt sie mich hundertmal mehr als ich sie. Um es bei dieser Auskunft nicht zu belassen, sondern um Vergessen zu verlangsamen, Sonden vorzuschieben, mich weimarisch, als Sohn der Stadt, zu definieren, schreibe ich hier – und um Dank zu sagen.
»Mein« bezeichnet aber nicht nur Besitzanspruch, es schränkt auch ein. Jeder erinnert eine andere Stadt. Manche Viertel habe ich kaum kennengelernt, in manche Straßen bin ich nie gekommen, andere tausendmal gegangen. Je nach dort Erlebtem, nach den Menschen, die dort wohnten, Schulkameraden, die man mochte oder mied, Häusern, die man als einladend oder abweisend empfand, haben sie eigene Temperaturen – Überreste aus Zeiten, da der Gesichtskreis des Kindes sich allmählich weitete, man in entfernteren Gegenden herumzustrolchen begann. Insgesamt ist das eine kompliziert verflochtene Erinnerungs-Geographie mit Haupt- und Nebenadern, unterschiedlichen Wärme- und Helligkeitsgraden, leicht oder schwer greifbaren Anhalten. Nicht fern liegt der Vergleich mit mentalen Strukturen, oft oder selten, gern oder ungern benutzten Gedankenwegen, »Denk-Furchen«.
Wenn wir Erinnerungen in bestimmte Richtungen auf die Reise schicken, erreichen sie zuweilen unvorhersehbare Stationen. Dem unmittelbar Erlebten, halbwegs sicher Gewußten entnehmen sie Anhalte für nicht unmittelbar Erlebtes, indirekt Erfahrenes, die in Bereiche vorzudringen erlauben, bei denen ich von »meinem Weimar« kaum sprechen dürfte – fast unwillkürliche Erinnerungen knapp vor Prousts »mémoire involontaire«. Freilich gibt’s auch Löcher im Heraufgerufenen, den Launen eines hier nostalgisch gefräßigen, dort irrlichternden Gedenkens geschuldet, das die Scheinwerfer der Aufmerksamkeit sehr willkürlich lenkt.
Fern von Beschwerungen eines in der Endrunde manövrierenden Lebens ist es das Recht der Jüngeren, vorwärts zu leben, eine Stadt samt allem, was sie bietet, mehr als Nutzobjekt denn als Hallraum wahrzunehmen. Alte sollten mit Erinnerungen nicht protzen, nicht zu viel Aufmerksamkeit einfordern – auch, da Geschichte für sie aus jeder Dachrinne tropft und qua Masse suggeriert, alles sei wichtig und mitteilenswert. Derlei Erinnerung erscheint im Blick auf die offenen Lebenshorizonte der Jüngeren leicht als verspätete Machtprobe von Leuten, die sich zurückhalten sollten.
Die sind im übrigen, was tatsächlich Geschehenes anbelangt, nicht unbedingt verläßlich, selbst wenn sie sich bemühen, es zu sein. Vergangenheit bzw. Geschichte sind keine Tresore, worin Daten, Geschehnisse in ihrer puren Faktizität überdauern, und selbst wenn, wären diese nicht abrufbar. Gerade wenn man sich der Positivität des Geschehenen verantwortlich weiß, es möglichst direkt zu fassen versucht, erfährt man, daß eine beschriebene Tatsache nicht die Tatsache selbst ist. Je klarer sie in der Erinnerung zu stehen scheint, desto mehr sollte man dieser mißtrauen. Überdies gehört zur Kenntnis dessen, was sich ereignet hat, die Ahnung, was sich hätte ereignen können. Abgesehen davon, daß der Rückblickende auch unter sicher fixierten Daten auswählt, schon damit also Partei nimmt: Idealiter müßte er von einer Position ausgehen, für die die jeweiligen Ereignisse in der Zukunft liegen, müßte Vergangenes als Zukünftiges, als »vergangene Zukunft« (Reinhart Koselleck) darstellen, in der, was tatsächlich eintrat, eine von mehreren offenen Möglichkeiten war. »Die Personen in der Vergangenheit entschwinden uns immer mehr – und wollen wir davon sagen, muß es Dichtung sein«, hat eine der interessanten Frauen des klassischen Weimar, Charlotte von Kalb, am Ende ihres Lebens gemeint.
Eines mag Alte entschuldigen: daß der Gedanke, demnächst abtreten zu müssen, zuweilen geringer wiegt als der, die letzten zu sein, die manches noch wissen, wichtige Menschen, Geschehnisse noch im Gedächtnis haben, und daß dieses Wissen mit ihnen endgültig in die Grube fahren wird. Auch das steht hinter der Zähigkeit, mit der sie an einem nur noch eingeschränkt lebbaren Leben hängen. Eine fast Hundertjährige kann tagelang jubeln, weil sie auf einer zerknickten Postkarte von anno dunnemals, winzig klein gedruckt, nahezu unleserlich, den Namen des ihr längst unerreichbaren Dorfes gefunden hat, in dem sie aufgewachsen ist. So sind die Alten! Der Radius des Erlebens verkleinert, der Resonanzboden indes vertieft sich, Erleben und Erinnern werden zunehmend eins. »Der Gegenwart zeitgenössisch, ihr wahrhaft zugehörig ist derjenige, der weder vollkommen in ihr aufgeht noch sich ihren Erfordernissen anzupassen versucht. Insofern ist er unzeitgemäß; aber eben diese Abweichung, dieser Anachronismus erlauben es ihm, seine Zeit wahrzunehmen und zu erfassen.« (Giorgio Agamben) – damit können die allemal rückbezogenen Alten sich trösten.
»Zukunft braucht Herkunft« – auf der Linie von Odo Marquards griffiger Formel ließen sich Überlegungen anschließen, weshalb Rückbindungen wichtiger werden in Zeiten, da beschleunigte Lebenstempi und das Dauerfeuer läppischer Informationen nicht zu ertragen sind ohne die Möglichkeit, schnell wegzuschieben, schnell zu vergessen. Das Quantum dessen, was man »gnädigem« Vergessen anheimgeben sollte, wächst in beängstigendem Maße. »Man bedenke, daß mit jedem Atemzug ein ätherischer Lethestrom unser ganzes Wesen durchdringt«, schrieb der alte Goethe an Carl Friedrich Zelter, »so daß wir uns der Freuden nur mäßig, der Leiden kaum erinnern. Diese hohe Gottesgabe habe ich von jeher zu schätzen, zu nützen und zu steigern gewußt«.
Wie auch immer Weimar sich mir als aufgeschlagenes Buch, als Palimpsest darbietet, wo hinter jüngeren Einträgen allenthalben ältere durchschimmern – ob ich zwischen, unter den Zeilen genauer lese als Jüngere, bezweifle ich; jedenfalls anders.
Parkgänge. In den letzten Kriegsjahren bin ich oft durch den Park zur Am Horn wohnenden Großmutter, der »Horn-Oma« Auguste Gülke, geb. Vulpius, gelaufen, habe sie auf Spaziergängen begleitet. Später erlebten wir Totenrituale der Roten Armee: Soldaten schritten zur Melodie Unsterbliche Opfer hinter einem langsam fahrenden Wagen, auf dem, im offenen Sarg blumenumkränzt, der Tote lag. Bei Dunkelheit war’s gefährlich, weil geflohene Soldaten im Park versteckt und an Zivilkleidung interessiert waren. Auch der Schulweg führte durch den Park: am Christiane-Becker-Denkmal vorbei, auf dessen Rückseite Ernst von Wildenbruch aussichtslos mit Goethe – auf der Vorderseite – konkurriert, den ›Euphrosynen-Abstieg‹ hinunter über die Naturbrücke an der Ilm entlang, beim Puschkin-Denkmal vorbei über die Schillerstraße.
Abb.1 Blick auf Goethes Gartenhaus
Vor dem Gartenhaus haben wir in den fünfziger Jahren bei der Heuernte geholfen und an Sommerabenden Nachtigallen schlagen hören, die Abende begünstigten zweisame Spaziergänge und Studentenverlöbnisse; »und dem Liebenden gönnet, daß ihm begegne sein Glück«, bittet Goethe die Nymphen auf der unterhalb des Römischen Hauses angebrachten Tafel. An etlichen Stellen haften unvermeidliche Erinnerungen: Bänke, auf denen die Horn-Oma gesessen hat; das Borkenhäuschen, um das herum ich, neben meinem gala-uniformierten Vater stolz herlaufend, die in der Schule aufgeschnappte Auskunft loswerden mußte, Kriege seien nötig, weil es zu viele Menschen auf der Welt gäbe, und er mir böse in die Parade fuhr: Wie ich’s finden würde, wenn wir – Mutter, Geschwister, Vater, ich selbst – zuviel wären; der Ilmbogen unterhalb vom Borkenhäuschen, wo der alte Professor Münnich mich beschwor, musikalische Ambitionen aufzugeben: Es reiche nicht, er meine es gut; nach einem heftigen Stasi-Verhör bin ich nachts durch den Park geschlichen und mußte an das von Liebeskummer in den Selbstmord getriebene Fräulein von Laßberg denken.
James Joyce, danach gefragt, weshalb er nie nach Dublin zurückgekommen sei, hat geantwortet, er sei doch nie weggegangen. So könnte auch ich antworten. Allerdings habe ich die Erfahrung, daß man über Heimat besser Bescheid weiß, wenn sie fern, fast verloren ist, gründlicher machen müssen; er hätte jederzeit zurückgekonnt, ich hingegen, republikflüchtiger Verbrecher, nicht. Daß die DDR bald zerbröseln würde, konnte keiner ahnen, die Verhältnisse schienen lebenslänglich verordnet. Bei Hamburg an der Elbe sitzend habe ich zu berechnen versucht, vor wieviel Tagen das vorbeifließende Wasser übers Wehr bei der Schaukelbrücke gerauscht war.
Nun, nach Jahrzehnten »Exil« und etlichen Ortswechseln zurückgekehrt, überfällt’s mich auf Parkgängen manchmal symbolsüchtig: Bis zum letzten Augenblick versuche ich offenzuhalten, welche Wegabzweigung ich nehmen werde, versuche an der Freiheit eines Flaneurs zu nippen, der im Sinne von Paul Valérys »possible à chaque instant« ganz und gar auf die Unmittelbarkeit der Situation bezogen sein will, im Blick aufs fällige Entweder-Oder bis zum letzten Moment die kleine Freiheit offenhält. So lehrt der Park – ost- und westwärts durch Straßen begrenzt, nördlich und südlich in die Landschaft hinauslaufend bzw. ins ländliche Oberweimar mündend – jene eingeschränkte Beliebigkeit, in der wir uns allenthalben bewegen, auch musizierend: Einerseits werden wir von der Partitur auf vorgebahnte Wege gewiesen, andererseits wollen wir unsere Spontaneitäten gegen- und miteinander ausspielen.
Oder ich erinnere die Situation, in der all dies versperrt war, lasse die Gedanken laufen, die bei einem seit Studienzeiten vertrauten Sonett vom jung verstorbenen Du Bellay haltmachen, das von unerreichbarer Heimat redet und oft mir durch den Kopf gegangen ist. Warum bewegt es mich jetzt so, da ich’s doch nicht mehr »brauche«? – als hätte sich in fast fünfhundert Jahre alten Worten der Bodensatz aufgestauter Sehnsüchte gesammelt, als wüßten die Worte die Stimmungen noch, in denen ich sie damals mir vorgesagt habe: »…Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village / Fumer la cheminée, et en quelle saison / Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, / Qui m’est une province, et beaucoup davantage?« – »Wann, ach, werde ich in meinem kleinen Dorf den Rauch aus den Kaminen steigen sehen, zu welcher Jahreszeit den Garten meines kleinen Hauses wiedersehen, ein ärmlicher Besitz und noch viel mehr?«
Mittlerweile gehöre ich zu den treuen Parkgängern, vielleicht bin ich der treueste. Bei jedem Wetter, zu jeder Tages- oder Nachtzeit unterwegs, finde ich stets einen anderen Park und sage dem Gartenhaus-Besitzer, wenn ich vorbeikomme, eines seiner Gedichte vor. Hörte er manches von ihnen von Bäumen, Fluß und Mond, der »Busch und Tal mit Nebelglanz« füllt, sich zugesprochen, mußte er nur ganz Ohr sein und schnell aufschreiben, wie kein anderer es konnte? So zu fragen legt derjenige nahe, der den Fluß bittet, seinem »Sang Melodien« zuzuflüstern.
Das sollte man nicht als metaphorisierenden Übersprung, als poetisch aufgeplusterte Rätselrede abtun. »Wollen wir uns finden«, so Hugo von Hofmannsthal, »dürfen wir nicht in unser Inneres hinabsteigen: draußen sind wir zu finden, draußen«.
»Bitte nicht berühren«. Ohne die Schildchen geht es nicht, anderenfalls würde jeder zweite der durch die Gedenkorte flutenden Besucher Tische, Stühle, Kommoden etc. befummeln. Wer hätte nicht Lust, im Gartenhaus einmal auf dem Sitzbock Platz zu nehmen – ohne Aussicht, auch nur zu einem einzigen Satz inspiriert zu werden, wie Goethe Tausende geschrieben hat; welcher Musiker hätte nicht Lust, am Frauenplan die Tasten des Hammerflügels zu schlagen, auf dem der junge Mendelssohn »Lärm gemacht« hat, wie der Hausherr launig verlangte?
Musikinstrumente, im Gartenhaus, am Frauenplan, im Stadtschloß, in Tiefurt, verdeutlichen es drastisch: Sie wollen, müssen gespielt werden. So unterschiedlich die Beweggründe sein mögen – respektvolle Bewahrung hier, stupide Wertanhäufungswut dort –, der Vergleich mit altitalienischen Geigen liegt nahe, die, von Überreichen erworben, in Banksafes verbannt und zum Tod durch Nicht-schwingen-Können verurteilt werden.
Ähnlich Häuser und Wohnungen: Wie Instrumente gespielt werden wollen, so wollen sie benutzt, bewohnt werden, allemal als Hohlformen von Leben gebaut, das in ihnen stattfinden soll. Dieses aber – die andächtige Hilflosigkeit vieler Besucher spiegelt es wider – ist in den Gedenkorten erloschen, wenn auch in verschiedenen Graden: Im immer noch »geselligen«, eine Lebensform widerspiegelnden Tiefurt, in einzelnen Räumen in Dornburg und Großkochberg haben sich Reste erhalten, auch in den Arbeitsklausen der Dichter – dorthinein kann man den diktierend auf und ab gehenden Goethe, den am Schreibtisch den Duft fauliger Äpfel atmenden Schiller halbwegs noch projizieren. Anderswo, in den Repräsentationsräumen der Schlösser, sind derlei Reste einstigen Lebens kaum noch zu erspüren, auch nicht im vorderen Trakt am Frauenplan.
Das Wissen darum sollte im staunenden Betrachten mitenthalten bleiben, anderenfalls es uns schockartig erwischt: Gewiß hat Schloß Belvedere auch seinerzeit monatelang leer gestanden – um die herzogliche Familie dann, im Sommer mit frischer Luft auf der Höhe, abwechslungsreich kalkulierter Räumlichkeit und wunderbaren Ausblicken zu verwöhnen. Heute indes fordert eine von riesigen Prunkvasen bis zu kleinen Porzellanfiguren reichende Inflation hochfürstlicher Nutzlosigkeiten dazu auf, bewundert oder in ihrer Skurrilität witzig gefunden zu werden. Dabei dürfen dem Besucher Geduld und Atem ausgehen, auch angesichts des Mißverhältnisses von Kunstfertigkeit und minimem Nutzwert der nach Staatsbesuchen rasch beiseite gelegten Mitbringsel. Von einigen unterschiedlich gelungenen Porträts abgesehen, fragt man leicht verstimmt nach der Arroganz derer, die das sich leisten konnten, vielleicht im prahlerischen Ausstellen konkurrieren mußten – der Weimarer Hof galt doch als vergleichsweise schlicht! Oder man versucht, sich den Respekt vor der handwerklichen Kunst von solchen Fragen nicht verderben zu lassen.
Stünde der Zeugniswert nicht außer Zweifel, müßten wir von einander multiplizierenden Überflüssigkeiten sprechen: Bedarf der Nippes eines solchen Rahmens? Auf welch andere Weise indes bekäme das Gebäude Inhalt? Was André Malraux zum »imaginären Museum« gesagt hat, das die Exponate aus ihrem Lebenszusammenhang reißt, wird hier im Extremfall vorgeführt, zumindest auf eine Belehrung darüber hinauslaufend, wie sternenweit gesellschaftliche Üblichkeiten von Zeiten gerückt sind, die uns in anderen Zeugnissen vertraut erscheinen. Deshalb brauchte die Bitte, nichts zu berühren, im Schloß Belvedere nicht so häufig wie anderswo plaziert zu werden; am ehesten laden Exponate zur Berührung ein, die vom einstmaligen Leben direkter reden als in Glasvitrinen aufgereihte Figürchen, denen man Pablo Nerudas Lobpreis vernutzter Gebrauchsgegenstände entgegenhalten möchte.
Allerdings klingt die Rede vom »Befummeln« geringschätziger, als die palpatorischen Gelüste verdienen. Man sollte Auskünfte zu magischen Wirkungen körperlicher Kontakte, vom Herüberfließen heilender Kräfte beim Berühren heiliger Personen oder Gegenstände, von Reliquien etc. nicht vorschnell als abergläubisch abtun. Damit geriete auch Goethe unters Verdikt, der eine an Ulrike von Levetzows Urgroßvater gerichtete Handschrift Friedrichs des Großen in die Hand bekam, sie restaurieren ließ, gar bedichtete: »Das Blatt, wo seine Hand geruht, / Die einst der Welt geboten, / Ist herzustellen fromm und gut. / Preis ihm, dem großen Toten«. Der vermeintliche, Goethes »fromm und gut« widersprechende Fetischismus beginnt schon bei der erwärmenden, persönlich verbürgten Authentizität handgeschriebener Briefe.
»Bitte nicht berühren« reagiert auf unwiderruflich eingetretenen Abstand, bezeugt und vergrößert ihn.
Kindergeographie. Je jünger wir sind, desto kräftiger schreibt bei ihr Phantasie mit, auch im Bedürfnis, sich bei Spielgenossen auf der Straße – damals kam selten ein Auto vorbei – interessant zu machen; wohl auch, weil eine Grenze zwischen der »ersten«, wichtigsten Realität, dem Vertrauensraum der eigenen Familie und Wohnung, und dem Außen von Straße und Nachbarschaft gezogen sein will. Zwar waren wir schon ein Stück weit hinaus über den Stolz, nicht mehr an Nikoläuse, Weihnachtsmänner und Osterhasen zu glauben, nicht jedoch über die Lust, Gehörtes, Gesehenes fabulierend zu vergrößern. Was zu bösen Übertreibungen führen konnte: Ein grummeliger alter Mann in einem Häuschen vor der Linksbiegung der damaligen Luisen-, jetzt Humboldtstraße geriet in die Rolle der Hexe bei Hänsel und Gretel dank des Verdachts, er sei ein Menschenfresser. Näher an der Wahrheit war das Gemunkel, vor kurzem sei eine alte Hexe gestorben, die auf dem »Silberblick« gewohnt, über laute Kinder gezetert, manchmal nach ihnen mit dem Spazierstock geschlagen habe; das war Elisabeth Förster-Nietzsche, der nicht nur Onkel Walther Vulpius seine Aufwartung machte, sondern auch der, den Golo Mann, weil er den Namen nicht in den Mund nehmen mochte, nur »H.« nannte. Schlimmere Wahrheit enthält die geflüsterte Mitteilung, an der Ecke des Ettersberges sei es still, kein Vogel sänge dort, wegen des Gestanks seien alle Vögel weggeflogen.
Später macht die Phantasie konkreten Erfahrungen Platz, Nachbarschaft, Häuser, Straßen definieren sich durch Bewohner: im Nebenhaus Klaus W., ein lieber, harmloser Junge, der keinen Vater mehr und eine stille Mutter hatte. Gegenüber Dörte S., ein sprödes Mädchen, das selten mit uns spielte, trotzdem imponierte – nicht nur, weil der Vater General war. Als ich blöd prahlte, ich habe auf einen Ausflug mit dem Jungvolk fünf Zuckerstückchen mitbekommen und alle mit einem Mal aufgefressen, beschämte sie mich mit der Bemerkung, sie hätte sie ihrer Mutter zurückgebracht. Rechts neben Dörtes Haus der dumm-arrogante Klaus F., der sich mit uns nicht einließ. Im Haus links von ihr ein liebes, etwas älteres Mädchen, das, im Sommer 45 von einem GI »geschändet«, von ihrer Mutter gezwungen wurde, mit ihr gemeinsam so viele Apfelkerne und noch anderes zu sich zu nehmen, bis es zur tödlichen Vergiftung reichte. Dort im Untergeschoß Gerd H., der sich auf kleine Diebstähle und »Duckeleien« (= Tauschgeschäfte) spezialisiert hatte und eine Rotte kaum zehnjähriger Kleinstkrimineller bei Raubzügen in Kaufhäusern kommandierte. Auch der rothaarige Günter L. im Nebenhaus gehörte dazu. Schräg gegenüber, Ecke Liszt- und Cranachstraße, im Parterre Ursel H., die so groß war, daß man beim Ballspiel keine Chance gegen sie hatte. In der Etage drüber der lieb-doofe Horst R., der sich aufdrängte und nicht zur Kenntnis nahm, daß wir mit ihm nichts zu tun haben wollten.
Und dann die, vor denen wir, vorauseilend feige, auf die andere Straßenseite auswichen: Wiklaf S., über dessen ältere, frühreife Schwester böse getuschelt wurde, er selbst ein drahtiger, abenteuersüchtiger Raufbold, der wenig später vom Baum fiel und sich das Genick brach. In der Cranachstraße auf halbem Wege zur Pestalozzi-Schule der Obernazi Karl Astel, Autor jener Ahnentafel, die jeder ausfüllen, sich entweder als rein »arisch« oder jüdisch versippt ausweisen mußte. Seine Söhne standen im Ruf, Rabauken zu sein, mit ihnen ließ man sich ungern ein; einer war später als Verfasser feinsinnig-esoterischer Lyrik der personifizierte Gegenentwurf zum Vater.
In den letzten Kriegsmonaten trieben wir riskante Spielchen: Nachdem die Sirenen geheult und die Mütter nach uns gerufen hatten, blieben wir auf der Straße, um aus der Richtung der Bombergeschwader zu erschließen, wohin sie flögen. Im Februar 45 war ich einmal stolz, richtig getippt zu haben: Dresden.
Anneliese Mellinger. Sie spielte mit uns im Kindergarten in der Garten-, dann Adolf-Bartels-, heute Abraham-Lincoln-Straße. Die oppositionell eingestellten Frauen, die die angeschlossene Jugendleiterinnen-Schule führten, mögen aus naheliegenden Gründen begrüßt haben, daß Gauleiter Sauckel, auch »Sauleiter Gauckel« genannt, seine Kinder zu ihnen schickte.
Irgendwann im Jahr 1939 oder Anfang 1940 kamen sachkundige Herren ins Haus, um die Kinder zu inspizieren, wir mußten uns halb ausgezogen beschauen lassen. Anneliese mußte sich splitternackt ausziehen, sich drehen und wenden und auf dem Fußboden kriechen.
Warum erinnere ich genau, daß wir – Fünf- oder Sechsjährige! – das peinlich fanden und Mitleid hatten? Vielleicht hat das entsetzte Gesicht der Kindergärtnerinnen geholfen. Wenig später waren wir »Erstenskläßler«; wohl deshalb weiß ich von Anneliese sonst nichts. Vielleicht auch, weil die Herren sie »lebensunwert« fanden und Konsequenzen auf dem Ettersberg empfohlen haben. Daß wir uns auf schuldunfähige Kindlichkeit herausreden können, verhindert Schatten von Mitschuld über der Erinnerung ebenso wenig wie der hilflose Versuch, über die schmale Gedächtnisspur irgend etwas wiedergutzumachen.
Warum erinnere ich ebenso genau, daß mir auf der Liszt-Straße – ich wollte für fünf Pfennig Brausepulver kaufen – ein Mädchen mit Judenstern am Kleid entgegenkam und mich mit großen, ernsten, dunklen Augen ansah? Weshalb, da ich von den Hintergründen nichts wissen konnte, steht das flüchtige Aneinandervorbei so sicher im Gedächtnis? Warum, während die Namen fast aller Kindergartenkinder vergessen sind, habe ich den von Anneliese Mellinger nicht vergessen, weiß sogar, daß sie in der Adolf-Bartels-Straße gegenüber wohnte?
A. H. und anderes. Der »Führer« kam gern nach Weimar, einmal, als auch Erst- oder Zweitkläßler auf den Marktplatz kommandiert wurden. Auf dem Balkon vom Hotel »Elephant« eine hellbraune Wolke: Das waren die »Goldfasanen« – so wurden uniformierte Bonzen genannt. Irgendwo dazwischen er. An den Oberlippenbart, schräg in die Stirn gekämmtes Haar und den vorgestreckten Arm erinnere ich mich nicht – jedoch daran, daß unser Vater plötzlich in Paradeuniform auftauchte und, als wär’s amtlich verordnet, meine Schwester und mich aus der schnurgerade angetretenen Reihe herausholte und mit uns davonging.
Die zwei Jahre ältere Schwester hatte spitze Ohren. Ich nicht; mir erschien A. H. so erhaben, daß ich meinte, er müsse nicht mal aufs Klo; woraufhin sie, mit scharfer Stimme und strafendem Blick: »Der scheißt wie du!«
Eines Abends, wohl im Herbst 1944, unser Vater war gerade von der Ostfront gekommen, mußte sie vor dem Einschlafen noch einmal hinaus und horchte an der Schlafzimmertür der Eltern. Diesmal, anders als sonst, gab sie es zu: »Vati hat ganz traurig zu Mutti gesagt: Sie bombardieren die Gleise nicht!« Wir haben im Dunkeln noch lange gerätselt, was das wohl bedeuten könnte, wußten nichts vom Zugverkehr in Richtung Auschwitz.
Einen Waffenstillstand zwischen geschwisterlichen Schimpfkanonaden haben wir benutzt, um einschlägige Vokabeln nach Grad und Verworfenheit zu ordnen. Nachdem über die schlimmsten Einvernehmen erzielt war, zog sie mich in die Nische unseres Hauseingangs und flüsterte mir ins Ohr: »Ich weiß noch ein schlimmeres Wort: Nazi!«
Auch das gehörte zu Nazi-Methoden, uns in Härte zu trainieren: Mit Angabe von Tag und Stunde, diese irgendwann vormittags, wurde bekanntgemacht, wann ein Verbrecher – wenn ich’s recht erinnere, Inhaber eines Kaufhauses am Wielandplatz – durchs Fallbeil hingerichtet würde. Um diese Zeit wurde es in der Schule mucksmäuschenstill, uns war übel, so als hörten wir das Fallbeil sausen und den Kopf in den Korb rollen.
Kurz vor Kriegsende – wir waren ins Sophienstift gezogen, weil die Pestalozzi-Schule als Lazarett diente – verkündete ein Anschlag, Churchill wolle, wenn er gewönne, deutsche Mädchen in Käfige sperren und deutsche Jungen schlachten.
Es war nicht nur knabenübliche Bewunderung, sondern auch die rigorose Einübung in Hierarchien, Formationen, Dienstgrade, Befehlshaber, die den Primaner bei der Einschulung im Wilhelm-Ernst-Gymnasium alles bestaunen ließ – Sekundaner und Tertianer sowieso; die Aula und die Zeremonie, die Rede des Direktors Herfurth, eines Altnazis, der sich schon bei der Hetze gegen das Bauhaus hervorgetan hatte; das kitschige Thüringen-Lied, mit dem der Schulchor uns begrüßte; den dirigierenden Musiklehrer Heusinger, den ich später als jämmerlich kratzenden Aushilfsgeiger erlebte; meinen Freund Hans-Georg S., der wußte, wann der Dreisechzehntel-Auftakt in Glucks Orpheus-Ouvertüre fällig ist, so daß ich, im Schulorchester am selben Cello-Pult sitzend, zu ihm hinübergeschielt habe.
Der Kastanienbaum. Als ich jüngst mich in den Garten stahl, der seit siebzig Jahren nicht mehr unserer ist, habe ich reagiert fast wie Goethes Werther (Brief vom 15. September) angesichts der im Pfarrhof gefällten Nußbäume: Wie kann so ein Baum spurlos verschwinden! Ein für Sechs- bis Siebenjährige riesig hoher, der das vierstöckige Haus Cranachstraße 29 überragte.
Um so stärker die Erinnerung: Damals standen wir oft vor ihm, sehnsüchtig nach oben blickend, weil er in unerreichbarer Höhe sich in zwei Stämme aufgabelte, auf denen man leicht hätte weiterklettern können. Bis zum achten Geburtstag das große Geschenk kam: Unsere Mutter ließ Sprossen annageln, auf denen wir die Gabelung erreichen konnten. In der Nachbarschaft wurde gemunkelt, Frau Doktor habe es wohl darauf abgesehen, daß ihr Sohn und seine Freunde sich das Genick brächen.
Wir haben es uns nicht gebrochen, sind auf einem Stamm hinaufgeklettert, oben auf den anderen hinübergesprungen, haben dort stundenlang gesessen, uns selig gewiegt, durchwehen lassen, tiefsinnige Gespräche geführt, haben uns, über Dächer hinwegblickend, oberhalb der Welt und der Geschehnisse gefühlt, haben Kastanienblätter zigarrenartig zusammengedreht, zum Trocknen in die Zweige gehängt und später »gepafft«, haben das Theater brennen und Rauch über dem Ettersberg nach dem Luftangriff im August 1944 aufsteigen sehen, der zum Vorwand für den Mord an Ernst Thälmann wurde.
Wenn die Sirenen heulten, sind wir schnell hinuntergeklettert. Im Keller amtierte als Luftschutzwart der Kunstmaler Engelbert Schoner, der ängstlichste von allen, die dort saßen, mit vier Kindern auch unsere Mutter. Wenn es krachte, verkündete er mit angstbebender Stimme: »Meine Herrschaften, die Bomben, die wir hören, treffen uns nicht!«
Die Nachrede ob Frau Doktors Leichtsinn wurde leiser, als wir das Höhentraining gebrauchen, nach Luftangriffen Dächer reparieren, Sparren und Ziegel neu setzen konnten. Bei der Vorstellung, wie wir Zehnjährigen oben herumgeturnt, auf Giebeln geritten sind, fährt mir heute der Schwindel in die Beine. Auf kein Honorar bin ich so stolz gewesen wie auf die fünf Reichsmark, die mir die Eigentümerin des Hauses Windmühlenstraße 2 überreichte, nachdem das Dach wieder regendicht war.
»Pimpf«. Die Bezeichnung gehörte wie »Gau« oder »Thingplatz« zum altdeutsch stilisierten Nazi-Jargon. »Pimpfe« waren wir offiziell vom zehnten bis zum vierzehnten Jahr, danach »Hitlerjungen«. Selbst wenn wir hinter dem Voigt-Stift in der Berkaer Straße bis zur Erschöpfung exerzieren mußten, mit Kniebeugen in fünf Zeiten »gestriezt« wurden, waren wir es gern. Den Eltern war es recht, mußten sie doch fürchten, daß wir uns wichtigmacherisch verplappern würden, wenn wir wüßten, wie sie dachten. Im Jugendleiterinnen-Seminar, wo unsere Mutter unterrichtete, hat man geflüchteten Häftlingen weitergeholfen. Obwohl die mutigen dort tätigen Frauen sich später dessen hätten rühmen können, haben sie kaum davon erzählt. Ein Bruder unserer Mutter war mit den Verschwörern vom 20. Juli eng befreundet; ihnen hat er, nachdem es im benachbarten Neuhardenberg zu heiß geworden war, sein Gut Altfriedland zu Geheimtreffen angeboten.
Wir indessen lasen in Büchern, die auf Schulhof-Gesprächen aktuell waren wie heutzutage Fernsehkrimis: Mölders und seine Männer – über den Jagdflieger, der über hundert Gegner zur Strecke brachte; Mein Weg nach Scapa Flow des U-Boot-Kommandanten Günter Prien, der in dem schottischen Hafen ein kleines Pearl Harbor veranstaltet hatte; Die Bremen kehrt heim, worin ich Kapitän Ahrens, der den nachjagenden Engländern bei Kriegsausbruch ein Schnippchen schlug, ebenso toll fand wie Bordkapellmeister Pommerenke mit dem Dirigierstock. In einem kleinen Handbuch über Kriegsflugzeuge waren Lockheeds und Spitfires selbstverständlich jämmerlich und Stukas, Me 109 und Ju 52 turmhoch überlegen. Ebenso selbstverständlich kannte jeder jeden Militär-Dienstgrad, fast jeden General und jeden Eichenlaubträger mit Namen.