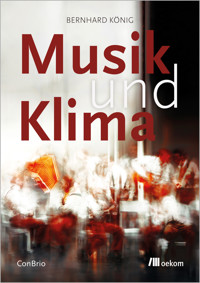
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Klimawandel bedeutet auch: Unser musikalisches Erbe ist bedroht. Mit jedem Zehntelgrad Temperaturanstieg schwinden die Spielräume für Schönes. Aber was heißt das für diejenigen, die Musik produzieren, aufführen, lehren oder einfach nur gerne hören? Ist Musik Teil des Problems? Kann sie zur Lösung beitragen? Wird es in Zukunft noch Konzerthäuser und Festivals geben? Bernhard König verknüpft die Perspektive des Musizierens und der musikalischen Ästhetik mit der des Klimaschutzes. Er zeigt, auf welche Weise ein klima- und umweltverträgliches Musikleben reicher, vielfältiger und lebendiger sein könnte, als es manche Teile unseres gegenwärtigen Musiklebens sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 829
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard König
Musik und Klima
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2024 oekom verlag, München oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH, Goethestraße 28, 80336 München +49 89 544184 – 200
www.oekom.de
Layout und Satz: le tex, xerif
Lektorat: Susanna Hanke
Umschlaggestaltung: Laura Denke, oekom verlag
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9783987263668
DOI: //doi.org/10.14512/9783987263545
Menü
Cover
fulltitle
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Inhaltsverzeichnis
Prolog:
Wie die Schönheit in die Welt kam
Teil I:
Kann Musik die Welt schöner machen?
Kapitel 1:
Die brennende Stadt
Kapitel 2:
Teil des Problems?
Kapitel 3:
Schützenswerte Freiheit
Kapitel 4:
Bedrohtes Erbe
Kapitel 5:
Die Verhässlichung der Welt
Teil II:
Können Töne etwas ausrichten?
Wie das singende Raubtier seine wahre Bestimmung fand
Kapitel 6:
Das Kind in der Mondrakete
Kapitel 7:
Musikalischer Aktivismus
Kapitel 8:
Soll Musik nützlich sein?
Kapitel 9:
Wandel begleiten
Kapitel 10:
Die Landkarte der Lösungswege
Teil III:
Braucht Musik Wachstum?
Wie alles immer besser wurde
Kapitel 11:
Das große Accelerando
Kapitel 12:
Die Gentrifizierung der Welt
Kapitel 13:
Musik zum Sitzen
Kapitel 14:
Triebkraft und Getriebene
Kapitel 15:
Die andere Schönheit
Teil IV:
Können wir uns ändern?
Kapitel 16:
Die vielstimmige Welt
Kapitel 17:
Einander zuwenden
Kapitel 18:
Warum weniger Wachstum mehr Musik braucht
Epilog:
Das Große Innehalten
Nachwort
Literaturverzeichnis
Abkürzungen
Index
Anmerkungen
PrologWie die Schönheit in die Welt kam
Einst war die Welt nicht schön. Sie war auch nicht hässlich. Sie war weder gerecht noch grausam, weder groß noch klein, sondern einfach nur da. Die Farbe einer Frucht konnte schön sein und zum Verzehr locken. Ein Balztanz oder ein Federkleid konnten schön sein und zur Paarung einladen. Aber die Welt? Niemand hatte ein Auge für sie. Bis eines Tages ein seltsames kleines Raubtier des Weges kam.
Das kleine Raubtier stakste auf zwei Beinen umher wie ein Vogel, doch es konnte nicht fliegen. Es war nackt wie ein Fisch, doch es konnte unter Wasser nicht atmen. Und, was am seltsamsten war: Es wollte einfach nicht erwachsen werden. Monat um Monat verging, doch das kleine Raubtier blieb so ungeschickt und verletzlich, wie es auf die Welt gekommen war. Unbeholfen tapste es durch die Gegend, ständig mussten seine älteren Artgenossen es vor dem Verderben retten oder ihm den Weg weisen. Und auch wenn es nach siebzehn, achtzehn Jahren endlich ausgewachsen war, erreichte es nur selten wahre Meisterschaft.
Die anderen Erdenwesen waren Könnerinnen und Könner ihres Fachs. Manche von ihnen konnten vorzüglich jagen, andere betörend locken. Manche verstanden sich auf das Handwerk des Tötens, andere schenkten verschwenderisch Leben. Manche hielten Hof und zeigten sich, andere blieben ein Leben lang im Verborgenen. Das kleine Raubtier war anders. Es konnte leidlich klettern und springen, ausdauernd marschieren oder sich verstecken und geduldig abwarten – von allem ein bisschen und gerade einmal so viel, wie es brauchte, um sich behelfen zu können. Nur eines konnte dieses kleine, frierende, unbeholfene Raubtier im Übermaß und besser als jedes andere Wesen auf Erden: Die Schönheit der Welt erkennen.
Herangereift war diese eigenartige Fähigkeit in all den Jahren, in denen es sich ums eigene Überleben wenig hatte kümmern müssen, weil es von anderen umsorgt und beschützt worden war. Vom ersten Tag an hatte das kleine Raubtier Trost und Schutz in elterlichem Gesang gefunden. Und während die Großen jagten und ackerten und rackerten, schaute das kleine Raubtier in den Himmel und gab den Wolken Gesichter. Es sammelte Steine, Baumrinden und Orte und gab ihnen eine Seele oder ein Geheimnis. Es betrachtete die Welt, unterschied ihre Geschöpfe voneinander und gab ihnen Namen und Geschichten.
Wann immer aber das kleine Raubtier ein neues Stückchen Schönheit entdeckt hatte, zögerte es nicht lange, seine Artgenossen daran teilhaben zu lassen. Sie wussten es ihm zu danken. Mal gab es satt zu essen, Jagd und Ernte hatten reiche Beute gebracht und es gab allen Grund, ausgelassen zu feiern. »Zeig uns, wie schön die Welt ist!«, riefen dann die restlichen Raubtiere fröhlich. Und das kleine Raubtier erzählte es ihnen und sang ihnen ein Lied davon. Ein andermal, wenn die Vorräte mager waren und der Regen ausgeblieben war, saßen die Raubtiere hungrig und frierend am Feuer. »Sag, kleines Raubtier, ist die Welt wirklich schön?«, fragten sie dann verzagt. Und das kleine Raubtier erinnerte sie an bessere Zeiten und sang ihnen ein Lied davon.
So wurde die Schönheit zu einem Lebensmittel, das nie versiegte. Sie half durch Dürrezeiten und frostige Winter. Sie wurde während langer Wanderschaft zur Heimat. Selbst in tiefster Not, wenn Düsternis und Hoffnungslosigkeit sich breit machten, blieben immer noch die Lieder und Geschichten. Sie erinnerten an eine Zeit der Geborgenheit, in der alles so war, wie es sein soll. Sie erinnerten daran, dass der Himmel voller gütiger Gesichter ist, dass die Steine eine Seele haben und die Geschöpfe einen Namen.
Teil IKann Musik die Welt schöner machen?
Kapitel 1Die brennende Stadt
Plötzlich erspähe ich mich selbst. Etwa hundert Meter entfernt, zwischen all den anderen Teenagern mit ihren Spruchbändern und handbemalten Papptafeln, steht der Jugendliche, der ich einmal war. Die anderen rufen »Hopp, hopp, hopp – Kohlestopp!« und »Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!«. Auf ihren Papptafeln steht »Schulstreik für das Klima« und »Es gibt keinen Planet B«. Der Jugendliche, der ich einmal war, hält keine Tafel in der Hand und ruft keine Parolen. Er steht bloß da und schaut zu mir herüber, mit einem Gesichtsausdruck, den ich schwer deuten kann. Anklagend? Enttäuscht? Auffordernd? Er dürfte etwa 17, 18, allerhöchstens 19 Jahre alt sein. Ich erkenne ihn kaum wieder. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr an ihn gedacht.
*
Kann Musik die Welt schöner machen? Obwohl mein Beruf es eigentlich nahelegt, sich diese Frage zu stellen, kam sie mir in dieser knappen und zugespitzten Formulierung erstmals im Frühjahr 2019 in den Sinn – kurz nachdem ich ungeplant, als zufälliger Zaungast, in eine Fridays‐for‐Future‐Demonstration hineingeraten war. In den Tagen danach ließ sie mir keine Ruhe mehr. Wann immer ich sie mir stellte, brachte sie eine Fülle an neuen Ideen, Zweifeln und weiterführenden Fragen hervor. So viele, dass ich beschloss, ihnen ein ganzes Buch zu widmen.
Die Frage, ob Musik die Welt schöner machen kann, scheint leicht beantwortbar, fast schon trivial zu sein, solange sie sich auf unsere alltägliche Lebenswelt oder auf unser subjektives Weltempfinden bezieht. Selbstverständlich können wir uns mit Musik die Welt schöner machen. Wir tun es, wann immer wir im Stau das Autoradio einschalten oder morgens unter der Dusche ein Lied anstimmen, um schwungvoller in den Tag zu kommen.
Sehr viel komplizierter wird die Antwort, wenn man sie mit den ästhetischen Denkmodellen des 20. und 21. Jahrhunderts zu beantworten versucht – wenn man also beispielsweise Musik als »Kunst« versteht und bei den Vordenkerinnen und Machern von Neuer Musik, Soundart, Jazz, Computermusik oder den vielen Spielarten musikalischer und multimedialer Konzeptkunst nach Antworten sucht. Schnell wird man sich dabei mit einer so großen Fülle an Musikbegriffen und ästhetischen Konzepten konfrontiert sehen, dass die Frage selbst nur noch als grob vereinfachend und unzulänglich erscheinen kann. Soll Musik denn überhaupt »schön sein« (geschweige denn irgendetwas »schön machen«)? Gibt es »die« Musik überhaupt noch? Und was, um alles in der Welt, ist mit »Welt« gemeint?1
Wer angesichts solcher verwirrenden Rückfragen den Wissenschaften mehr vertraut als der Ästhetik, könnte stattdessen auch versuchen, die Frage nach dem Verhältnis von »Musik«, »Schönheit« und »Welt« in Versuchsreihen und Messdaten zu übersetzen. Nachdem sich die Wirkung von Musik auf den Menschen über Jahrhunderte hinweg einer wissenschaftlichen Erforschbarkeit störrisch widersetzte, versuchen Neuroästhetik und empirische Ästhetik ihr seit Anfang des neuen Jahrtausends die letzten Geheimnisse zu entreißen und die neuronalen Grundlagen des Schönheitsempfindens zu entschlüsseln.
Dies alles werde ich im vorliegenden Buch nur oberflächlich streifen. Stattdessen werde ich, ausgehend von zahlreichen konkreten Beispielen, nach dem Weltbezug von Musik fragen – und danach, welche Daseinsberechtigung und Relevanz unser professionalisierter und institutionalisierter Musikbetrieb vor dem Hintergrund der gegenwärtigen globalen Krisensymptome noch für sich beanspruchen kann. Im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts Musiker oder Komponistin zu sein – das bedeutet: singen, spielen, Töne erfinden und Konzerte veranstalten in einer Welt, die ökologisch, politisch und sozioökonomisch aus den Fugen geraten ist. Wir musizieren für eine Menschheit, die gleich mehrere hochriskante Wetten gegen die Naturgesetze eingegangen ist. Der Einsatz: Die Lebensgrundlagen unserer eigenen Nachkommen. Wie viel Grad Erderwärmung, wie viel Artensterben, wie viele kollabierende Ökosysteme vermag unsere Spezies noch zu verkraften? Unsere Kinder und Enkel werden es in wenigen Jahrzehnten wissen.
Dies bedeutet aber zugleich auch: Wir musizieren für eine Zukunft, die infrage steht. Das klingt zunächst einmal ziemlich abgehoben und theoretisch – doch die »Nachwelt« ist in der Musik keine abstrakte Größe, sondern eine wichtige Adressatin. Wer eine Bach‐Fuge spielt, einen alten Schlager singt, eine Aufnahme von Janis Joplin oder Louis Armstrong hört, erweckt ein Stück Vergangenheit zum Leben. Wer Musik komponiert, aufnimmt oder unterrichtet, gestaltet ein Stück Zukunft. Zu fragen, ob Musik die Welt schöner machen kann, bedeutet deshalb zugleich auch danach zu fragen, wie sich das, was wir heute tun, morgen auswirken wird. In welchem Zusammenhang steht unser heutiges Tun als Musikschaffende mit dem zukünftigen Zustand der Welt? »Dürfen« wir weitermachen wie bisher? »Müssen« wir unseren musikalischen Schönheitsbegriff einer kritischen Überprüfung unterziehen? Ist Musik Teil des Problems oder wird sie »gebraucht« – und wenn ja, wofür? Können wir irgendetwas dazu beitragen, dass sich das, was aus den Fugen geraten ist, wieder fügt?
Ich weiß, dass ich mich mit solchen Fragen auf dünnes Eis begebe. Manche werden in ihnen (zu Recht) einen Angriff auf die Kunstfreiheit wittern. Andere werden sie aus guten Gründen als abwegig, marginal, verharmlosend oder irrelevant empfinden. All diese kritischen Anfragen sind nachvollziehbar und berechtigt. Der für mich selbst am schwersten zu entkräftende Einwand, der mir während des Schreibens ein ständiger Begleiter war, ist der Selbstvorwurf der Anmaßung. Noch wenige Monate, bevor ich mit dem Schreiben begann, hätte ich hochgradig allergisch auf die Fragestellung dieses ersten Kapitels reagiert. Ich hätte nichts anderes in ihr zu hören vermocht als eine unsympathische Mischung aus Naivität, Künstlerhybris und eurozentrischer Überheblichkeit. Klavierspielen für eine bessere Welt? Komponieren gegen das Artensterben? Wer auch immer derlei Weltverschönerung für sich beansprucht hätte und ernsthaft von sich behauptet hätte, das eigene Kulturschaffen besitze irgendeine globale Relevanz, dem oder der wäre ich angesichts dieser Selbstüberschätzung mit lautstarkem Spott oder stiller Verachtung begegnet.
Bis zu jenem Tag im Frühsommer 2019, an dem ich, ohne es geplant zu haben, in eine Fridays‐for‐Future‐Demonstration geriet. Von diesem Tag an hatte die Frage, ob Musik die Welt schöner machen könne, plötzlich einen neuen Klang für mich.
*
Der 17-, 18-, 19‐Jährige, der ich einst war, war in einer kulturellen Nische groß geworden, die von Vorbildern wie Maurice Ravel und Chick Corea, Edvard Grieg und Dave Brubeck bevölkert wurde. Musikalische Schönheit war der Dreh‐ und Angelpunkt dieser Parallelwelt. Bemessen ließ sie sich an pianistischer Brillanz und Geläufigkeit, am Groove eines Jazztrios oder am gemeinsamen Atem eines Kammermusikensembles. Schönheit war eine Frage von Technik, Fleiß, Begabung und einem Quäntchen Inspiration.
Ein engagierter Religionslehrer brachte dieses Schönheitskonzept von Grund auf ins Wanken. Er riss den jungen Mann aus seiner heilen Konservatoriumswelt und konfrontierte ihn mit den globalen Gegenwarts‐ und Zukunftsfragen der Achtzigerjahre. Mit der Gefahr eines Atomkrieges. Der Ausbeutung des Südens durch den Norden. Der Zerstörung der Umwelt. Den Grenzen des Wachstums. Auf einmal gab es Dinge, die relevanter waren als Fingersätze und Jazz‐Changes. Zwar blieb der 17-, 18-, 19‐Jährige auch weiterhin zu sehr Nerd und Einzelgänger, als dass er auf Demos gegangen wäre oder an Sitzblockaden teilgenommen hätte. Doch stattdessen wurde er Vegetarier, verzichtete auf den Führerschein, kämpfte vor Gericht für das Recht auf Verweigerung des unbefristeten Zivildienstes im Kriegsfall. Die eigene vormalige Begeisterung für schöne Musik hingegen begann er zunehmend zu verachten. Terztonleitern zu üben, für Miles Davis oder die Kunst der Fuge zu schwärmen, erschien ihm angesichts der drohenden Gefahren als dekadent. Die Welt stand am Abgrund und er wollte zu denen gehören, die versuchten, sie positiv zu verändern. Fortan, so schwor er sich, würde er ein konsequent ökologisches Leben führen und all sein musikalisches Können und seine Kreativität dem Kampf gegen atomare Rüstung, globale Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung widmen.
Dies alles ist lange her. Ein paar Jahre lang versuchte ich mich an die Vorsätze des Jugendlichen von damals zu halten, doch dann zerbröselten sie mir unter den Fingern und machten einem bequemen Pragmatismus Platz, den ich in völliger Verkennung und Verdrängung der Tatsachen als »Vernunft« und »Erwachsenwerden« empfand. Die monatliche Miete, die Aufs und Abs des Familienlebens, die sich bietenden und wieder zerschlagenden beruflichen Chancen – irgendwie fühlten sich all diese Dinge dann doch wichtiger an, als die Zukunft der Menschheit oder die Bewohnbarkeit des Planeten. Klimawandel? Als Musiker und Komponist interessierte mich zwei Jahrzehnte lang allenfalls das gesellschaftliche Klima. Von dem anderen, dem physikalisch‐meteorologischen Klima und seiner unguten Beeinflussung durch den Menschen las ich hin und wieder in der Zeitung, sorgte mich privat darum, verzichtete um seinetwegen auf Auto und Flüge. Als berufliches Thema aber hielt ich mir die Erderwärmung vom Leib.
Meine Umgebung machte es mir leicht. Zeitgleich zu den eigenen guten Vorsätzen erodierten auch die großen Utopien. Der Eiserne Vorhang fiel, die Welt wurde unübersichtlich und für uns Mitteleuropäer*innen zugleich in einem nie dagewesenen Maße verfügbar. Niemand glaubte mehr an irgendeine weltumspannende Heilslehre jenseits der kapitalistischen Normalität. Sich allzu offensiv »umweltbewusst« oder »friedensbewegt« zu geben, zeugte von schlechtem Geschmack und Moralaposteltum. »Gutmensch« wurde zum Schimpfwort. Und weil mein Studium und meine beruflichen Anfänge als Komponist mitten in diese Zeit der Abkehr vom utopischen Denken fiel, wurde das, was sich zunächst als Bequemlichkeit in mein Privatleben eingeschlichen hatte, auf beruflicher Ebene zur Haltung. Ich vermied es, als Komponist über »die Welt« oder »die Zukunft« zu sprechen. Entscheidend war das Hier und Jetzt, das unmittelbare Gegenüber. Alles andere wäre mir unseriös und albern erschienen.
Im Frühsommer 2019, am Rande einer Fridays‐for‐Future‐Demonstration, fällt mir der 17-, 18-, 19‐Jährige, der ich einmal war, schlagartig wieder ein. Unverhofft taucht er zwischen den demonstrierenden Jugendlichen auf, anfangs als blasse Erinnerung, dann als zunehmend hartnäckige Stimme aus der Vergangenheit. Eine Stimme, die mitreden, sich in mein Leben einmischen will. »Wo bist du gewesen all die Jahre? Was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Zugfahren und taz‐Lesen – ist das alles, was von unserer Kampfansage gegen die Übel der Welt geblieben ist?«
Weil es aber nicht nur mir so geht, sondern Hunderttausenden, die von diesen streikenden Jugendlichen jäh aufgeschreckt oder zur Stellungnahme gezwungen oder an jemanden erinnert werden, der oder die sie einmal waren, spricht plötzlich alle Welt über die Welt. Mit einem Mal sickert in die Köpfe und Herzen ein, was unsere Generation seit Jahrzehnten wusste und wovor viel zu viele von uns beharrlich die Augen verschlossen hatten: dass nichts vernünftiger, nichts der Gegenwart angemessener ist, als bei allem, was man tut, global zu denken und das eigene Handeln in größere Zusammenhänge zu stellen. Nicht, weil wir uns als Einzelne anmaßen, die Welt retten zu können. Sondern weil wir gar nicht anders können, als permanent auf sie einzuwirken. Indem wir Auto fahren oder nicht Auto fahren. Fernreisen unternehmen oder keine Fernreisen unternehmen. Tiere essen oder keine Tiere essen.
»Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.« Das ist unüberhörbar und unmissverständlich. Ein neuer Cantus firmus, der dem medialen Hintergrundrauschen meiner letzten drei Lebensjahrzehnte einen unausweichlich fordernden Klang gibt. Ein simpler, eingängiger Ohrwurm, unter dessen prägender Tonalität sich die Vielstimmigkeit der altbekannten und allgegenwärtigen Krisensymptome neu sortiert. All das, was ich bereits mit 17, 18, 19 gewusst hatte. All die Warnungen und Appelle der NGOs und Wissenschaftlerinnen, der Waldbesetzerinnen und Veganer, der G8‐Aktivisten und Wachstumskritikerinnen, die ich seither immer und immer wieder gehört und wahrgenommen hatte, ohne mich angesprochen zu fühlen. All das, was ich über drei Jahrzehnte hinweg mal hier gelesen, mal dort aufgeschnappt hatte: Dieses unverbundene und verdrängte Halbwissen über schmelzende Eisberge, schwindende Regenwälder, sterbende Korallenriffe, übersäuerte Meere, unfruchtbare Böden, wachsenden Flugverkehr, wachsende Flächenversiegelung, wachsenden Fleischkonsum, wachsende Treibhausgas‐Emissionen, wachsende Ungerechtigkeit. All dies sortiert und verknüpft sich plötzlich zu einem einzigen, großen, kategorischen Imperativ: dass es so nicht weitergehen kann.
*
Wir Menschen sind, das vergessen wir hin und wieder, biologische Wesen. Genauer gesagt: Wirbeltiere aus der Klasse der Säugetiere. Wie jedes andere Lebewesen sind auch wir auf das angewiesen, was die Ökologie als Habitat bezeichnet: Auf ein biologisches Zuhause, in dem wir existieren können. Dazu gehört auch ein Klima, das es uns überhaupt erst möglich macht, neben der körpereigenen Thermoregulation noch genügend Energie für andere Aktivitäten aufzubringen. Langfristige Klimamodelle zeigen, dass die Erde diese günstigen Lebensbedingungen unter normalen Umständen noch für mehrere zehntausend Jahre geboten hätte.2 Aber die Umstände sind nicht normal. Wenige Jahrzehnte haben genügt, um das fein austarierte Zusammenspiel von physikalischen, chemischen und biologischen Kreisläufen, dem wir unsere Zivilisation verdanken, instabil werden zu lassen.
Von sogenannten »Klimaskeptikern« hört man mitunter, derartige Schwankungen seien ein Stück erdgeschichtlicher Normalität. Das ist völlig richtig. Unser Planet hat schon mehrere Klimawandel überstanden und sich wieder davon erholt. Es ist nicht der »Weltuntergang«, vor dem uns die Wissenschaft warnt. Es ist aber auch nicht bloß irgendein abstraktes, allgemeines Wärmerwerden. Wovor die Forscher*innen warnen, ist das Ende jener planetaren Grundstabilität, auf deren Boden in den zurückliegenden zwölf Jahrtausenden Kultur gedeihen konnte. Antonio Stradivari und die Erbauer der ersten asiatischen Zithern, Clara Schumann und Billie Holiday, John Cage und Johann Sebastian Bach – sie alle hatten eines gemeinsam: Sie lebten in einer Epoche der Erdgeschichte, die als Holozän bezeichnet wird.
Das Holozän bot ideale Bedingungen zum Musizieren und Komponieren: eine reiche Biodiversität, geringe und langfristig planbare Temperaturschwankungen, gewaltige Trinkwasservorräte, ausreichend bewohnbare Landflächen. Erst auf Grundlage dieses stabilen Gefüges verschiedenster natürlicher Parameter konnte dauerhaft Land besiedelt werden, konnten neue Formen der Vorratshaltung und Arbeitsteilung entstehen, Städte gebaut, Landwirtschaft und Handel betrieben werden. Musik und Musikinstrumente hatte es auch zuvor schon gegeben. Aber die klimatisch ungewöhnlich stabile Epoche des Holozäns ermöglichte neue Spezialisierungen, Werkstoffe, Gestaltungsformen und Klangvorstellungen. Und so entstand binnen zehn bis zwölf Jahrtausenden eine atemberaubende Fülle an musikalischen Erfindungen: Kirchentonarten und arabische Maqams. Chöre und Orchester. Rohrflöten und Emax‐Sampler. Der Kammerton und die Notenschrift.
Dieser kulturelle Reichtum scheint ein echtes Alleinstellungsmerkmal zu sein: Bislang ist der Wissenschaft kein zweiter Planet bekannt, auf dem ein Musikleben wie das unsere möglich wäre.3 Doch mit jedem Zehntel Grad Temperaturanstieg wird die Erde für uns Menschen unwirtlicher und entfernt sich ein Stück weiter von dem Zustand, der unsere Kultur in den vergangenen 12.000 Jahren geformt hat. Auch die Musik wird davon betroffen sein. Auch zum Musikmachen und Musikhören bedarf es einiger grundlegender Voraussetzungen. Dazu zählen nicht nur funktionierende Musikinstrumente, leserliche Noten oder ein aufgeladener Akku. Wer sich über längere Zeit hinweg auf Musik einlassen, sie genießen oder vielleicht sogar von Berufs wegen proben, unterrichten und aufführen möchte, braucht dafür ein Grundgefühl von existenzieller Sicherheit. Festen Boden unter den Füßen. Eine Umgebungstemperatur unter 50°C.
Unsere Nachkommen werden mit rasant wachsender Wahrscheinlichkeit unter Bedingungen leben, unter denen Menschen noch nie zuvor leben mussten. Wir sind dabei, das artgerechteste Habitat zu zerstören, das wir musizierenden Wirbeltiere überhaupt nur haben können. Und zwar unwiederbringlich.4
*
2019 hat Greta Thunberg eine prägnante Formulierung gefunden, die seither häufig zitiert worden ist: »Unser Haus brennt«.5 Doch ein zutiefst tragischer Aspekt dieser näher rückenden Katastrophe besteht darin, dass die Zusammenhänge zwischen ihren Ursachen und Auswirkungen unserem menschlichen Wahrnehmungsapparat nicht zugänglich sind. Ein brennendes Haus, das tatsächlich als solches wahrgenommen würde, würde alle archaischen Reflexe mobilisieren. Wir würden die Gefahr riechen, hören, sehen und ohne jeden Verzug konsequent handeln.
Lange nahmen wir hier in Mitteleuropa allenfalls einen leichten Brandgeruch wahr. Die Sommer wurden wärmer, die Unwetter heftiger, die Wälder stiller, die Windschutzscheiben sauberer. Doch mittlerweile spüren auch wir Europäer*innen, dass unser Habitat sich gravierend verändert. 2018 gab es in Deutschland rund 20.000 hitzebedingte Todesfälle. Während ich in den frühen 2020er‐Jahren an diesem Buch schreibe, werden Dürresommer, Ernteausfälle, Starkregen, Überschwemmungen, Waldbrände und Hitzetote zu einer neuen Normalität.6 Dennoch werden weiterhin Erdöl und Kohle verfeuert, Moore trockengelegt, Grünflächen als Bauland versiegelt und Privatautos auch dort zugelassen, wo ein funktionierendes Nahverkehrsnetz existiert.
Vielleicht wird es diesem langsamen Schwelen und der dadurch ausgelösten vorherrschenden Gemütslage eher gerecht, von einer brennenden Stadt zu sprechen. Die Brandherde rücken näher und mehren sich. Die Beunruhigung steigt, doch sie bezieht sich noch immer auf etwas, das größtenteils in einem anderen Stadtteil zu geschehen scheint. Hier und da haben erste Löschmaßnahmen begonnen, längst ahnen viele Menschen, dass der globale Funkenflug jederzeit auch die eigene privilegierte Wohnlage erreichen kann, doch noch immer wird brennbares Material auf den Straßen gestapelt, noch immer werden die Flammen angefacht.
Unsere Stadt brennt – an vielen Stellen gleichzeitig. Genau dieses Bild war es, das sich für mich am Rande einer Fridays for Future‐Demo mit der eingangs gestellten Frage verknüpfte, ob Musik die Welt schöner machen könne. Und mit einem Mal erhielt diese Frage einen neuen Klang, der mir ganz und gar nicht mehr trivial, naiv oder überheblich erschien:
Kann Musik eine brennende Stadt schöner machen?
Nero und Notre‐Dame
Peter Ustinov und Tacitus haben ihn zur Ikone gemacht: Nero, den singenden Kaiser, der zunächst Rom anzündet, um anschließend einen Gesang auf den Untergang Trojas anzustimmen. Die brennende Stadt wird zur Kulisse und künstlerischen Inspirationsquelle. Auch wenn die Altertumswissenschaft heute davon ausgeht, dass die Überlieferung vom singenden Brandstifter nicht den historischen Tatsachen entspricht,7 so hat diese Episode sich doch, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt, ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Zahlreiche Opern, Theaterstücke und Romane haben die Szene im Lauf der Jahrhunderte aufgegriffen. Im 20. Jahrhundert kehrt das Motiv des menschenverachtenden Schöngeistes dann in veränderter Form in Filmen und Groschenheftchen wieder. Vampire und Superschurken, größenwahnsinnige mad scientists und brutale Nazis tun es Nero nach und schwelgen, während ringsum die Welt in Flammen steht, in Opernarien und Sinfonien oder sitzen selbst Toccata‐spielend an der Orgel.8 Es versteht sich von selbst, dass die dramaturgische Intention eines solchen Soundtracks nicht darin besteht, die betreffende Filmszene in einem ungetrübten und wahrhaftigen Sinn zu verschönern. Musikalische Schönheit lässt sich in diesem Zusammenhang nur als Dissonanz wahrnehmen: Je schöner die Musik, umso monströser wird die Szenerie.
Dass dies auch völlig anders sein kann und der Kontext der »brennenden Stadt« musikalische Schönheit nicht automatisch in abstoßenden Zynismus und Barbarei verwandeln muss, verdeutlicht eine andere Szene. Im April 2019 steht in Paris die Kathedrale Notre‐Dame in Flammen. Einige Anwohner*innen finden sich zu einem spontanen Chor zusammen. Diesmal findet es niemand anstößig, dass angesichts der Flammen gesungen wird. Mehrere Medien berichten wohlwollend davon; in einer Tageszeitung heißt es: »Eine Frau stimmt »Ave Maria« an, liest den Text vom Handy ab. Wer kann, stimmt mit ein. Kamerateams halten fast dankbar drauf. Ein Mann bläst auf seinem Horn ein paar schiefe Töne, lässt es bald wieder sein, untröstlich. Improvisierte Trauer«.9
Ich habe das Bild der brennenden Stadt wörtlich genommen und diese beiden weit auseinanderliegenden Beispiele gewählt, weil sie eines verdeutlichen: Offenbar sind die herkömmlichen Schönheitskriterien außer Kraft gesetzt, sobald Musik in einer Situation der Not erklingt. Ob Nero ein Genie war oder nicht, ob die Anwohner von Notre‐Dame sauber oder unsauber gesungen haben, dürfte für das Werturteil der meisten Menschen gänzlich irrelevant sein. Stattdessen wird die situative Angemessenheit oder Unangemessenheit zum entscheidenden Schönheitsmaßstab. In deren Beurteilungen können ganz unterschiedliche Beobachtungen und Einzelbewertungen einfließen: Wie groß ist die Not, um die es geht? Stehen die Musizierenden den Helfenden im Weg? Wird hier gerade aus Anteilnahme oder um der eigenen Profilierung willen gesungen? Viele dieser Kriterien sind zwar eher moralischer oder pragmatischer Natur, doch sie scheinen auch für das intuitive Schönheitsempfinden ausschlaggebend zu sein. Schönheit wird durch die Empathiefähigkeit des Betrachters oder der Zuhörerin neu gewichtet. Das »Ave Maria« im Angesicht der brennenden Kathedrale mag in seiner »objektiven« musikalischen Qualität noch so bescheiden gewesen sein – die sich darin ausdrückende hilflose Trauer lässt es auf eine Weise wahrhaftig erscheinen, die durchaus auch in einem ästhetischen Sinn als »schön« erscheinen kann.
Eines aber scheint für die ästhetische Bewertung von Musik in Notlagen ganz besonders wichtig zu sein: Die Frage nämlich, wer es ist, der oder die dort musiziert. 2014 gingen Bilder um die Welt, die den palästinensisch‐syrischen Pianisten Aeham Ahmad, am Klavier sitzend, in den Trümmern des Flüchtlingsviertels Yarmūk am Rande von Damaskus zeigten. Niemand empfand diese Konzerte in einer Umgebung des Leides als unangemessen. Im Gegenteil: Später, nachdem er nach Deutschland geflüchtet war, machte Aeham Ahmad eine bemerkenswerte Karriere als »Pianist aus den Trümmern« und erhielt einen internationalen Menschenrechtspreis. Das entscheidende Detail: Ahmad ist selbst in Yarmūk aufgewachsen. Er gehörte zu denen, die dort lebten und nun existenziell von Krieg und Belagerung bedroht waren. Und genau deshalb war er in der Lage, diese geschundene und ausgebombte Stadt mit seiner Musik schöner zu machen. Sein Auftritt mitten in der »tiefsten Hölle«10 konnte als ein Stück Selbstermächtigung und Widerstand verstanden werden. Oder, wie Ahmad selber es später formulierte: Er gab den Menschen »ein wenig Menschlichkeit, Hoffnung und Würde« zurück.11
Es gibt viele solcher Beispiele, in denen Musik zu einer Quelle des Trostes und Lebensmutes wird, während ringsum die Welt in Flammen steht. 2022 konzertierte die ukrainische Geigerin Vera Lytovchenko während der Bombardierung von Charkiw mehrfach in einem Keller, in dem sie selber und ihre Nachbarn Zuflucht gesucht hatten. 1992 gab der bosnische Cellist Vedran Smailović mitten im belagerten Sarajevo eine Serie von Solokonzerten unter freiem Himmel, um der Opfer eines Mörsereinschlags zu gedenken.12 Bereits während der Zeit des Nationalsozialismus hatte es in den jüdischen Ghettos von Warschau und Lodz ein reges Untergrund‐Musikleben gegeben, das bis zu Liederabenden und Sinfoniekonzerten reichte. Selbst in Konzentrationslagern und Gestapo‐Gefängnissen wurde aus freien Stücken gesungen und musiziert. Doch gerade hier gab es eben auch das barbarische Gegenstück: Musik, die missbraucht und funktionalisiert wurde, um Menschen zu quälen und ihre »Seele zu zersingen«.13
All diese Beispiele haben eines gemeinsam: Sie lassen sehr deutlich erkennen, in welcher Beziehung die Musizierenden zu der jeweiligen Notlage stehen. Von Nero wird erzählt, er habe den Brand selbst gelegt. Die Anwohner von Notre‐Dame sind emotional stark involviert, ohne unmittelbar geschädigt oder gefährdet zu sein. Vedran Smailović, Aeham Ahmad und Vera Lytovchenko hingegen sind zu musikalischen Stimmen der Kriegsopfer geworden. An der Angemessenheit ihres Musizierens kann es deshalb keinen Zweifel geben.
Im Falle der Umwelt‐ und Klimakrise fehlt diese Eindeutigkeit. Die kausalen Zusammenhänge sind kompliziert und die herkömmlichen Kategorien von »gut und böse« oder »schuldig und unschuldig« greifen nicht. Einerseits kann in den reichen Ländern des Nordens fast niemand von sich behaupten, ganz und gar unbeteiligt zu sein. Andererseits kann der oder die Einzelne wenig ausrichten. Sicherlich gibt es unterschiedliche Grade der Verantwortlichkeit: Regierungen oder Energiekonzerne können mehr bewegen als Privatleute. Aber es gibt, anders als bei einem kriegerischen Angriff oder einer mutwilligen Brandstiftung, nicht die eine, klar identifizierbare Gruppe von Schuldigen. Stattdessen verschwimmen die Grenzen zwischen Leidtragenden und Verursachern.
In einigen Teilen der Welt ist die Situation eindeutig. Auf den Marshallinseln zum Beispiel. Der ozeanische Inselstaat ist massiv von Landverlust und Trinkwasserknappheit durch das Ansteigen des Meeresspiegels betroffen. Gleichzeitig sind seine Bewohner*innen gänzlich unschuldig an dieser Misere. Ihre eigenen Pro‐Kopf‐CO2‐Emissionen liegen deutlich unter dem globalen Durchschnitt und entsprechen ziemlich genau jenem Wert, den auch die restliche Weltgemeinschaft erreichen müsste, um eine weitere Erderhitzung zu vermeiden. Wenn ein marshallesischer Frauenchor mit Protestgesängen gegen diese Ungerechtigkeit aufbegehrt und den drohenden Verlust der eigenen Heimat betrauert, dann steht die Berechtigung dieses Protests außer Frage.14
Aber kann man die Marshallesinnen zum Maßstab machen? Und was würde das für uns in Europa bedeuten? Haben wir als Bewohner*innen eines reichen Industrielandes dann überhaupt noch das Recht, als Betroffene und Bedrohte zu singen? Oder müssen wir uns dieses Recht erst erarbeiten, uns in Askese üben, auf Fleisch und Flüge verzichten, bevor wir ein Protestlied anstimmen dürfen? Und als wer oder was singen und musizieren wir eigentlich, wenn wir einfach nur unseren Job als Berufsmusiker oder Komponistin machen? Kann man das überhaupt noch, wenn die Stadt bereits brennt? Spielt es irgendeine Rolle, ob und wie man sich zu dieser Notlage positioniert? Und wie werden künftige Generationen auf eine Musik zurückblicken, die dann womöglich in ihren Augen aus einer Zeit stammen wird, in der man das Schlimmste noch hätte verhindern können? Wie wird unsere Musik in den Ohren unserer Nachfahren klingen? Wird sie überhaupt noch jemand hören wollen? Oder wird sie geächtet sein? Wird unser heutiges Musizieren, Dirigieren und Inszenieren am Rande des Abgrunds eines Tages ähnlich unangemessen und bizarr erscheinen wie der Gesang des Nero?
Fragen wie diese betreffen natürlich nicht nur die Musik. Sie betreffen jegliches Handeln in Zeiten der Umwelt‐ und Klimakrise. Wer in Mitteleuropa lebt und über eigenen Wohnraum verfügt, regelmäßig einkauft, sich mit anderen Verkehrsmitteln als dem Fahrrad fortbewegt und am gesellschaftlichen Leben partizipiert, belastet unweigerlich die Umwelt und das Klima. Und zwar in einem Maße, das – hochgerechnet auf die Weltbevölkerung – auf Dauer nicht verantwortbar ist. Dieses »Zuviel« ist in unserem Gesellschaftssystem und in unserer Kultur verankert. Der oder die Einzelne kann dieser Systemlogik nicht entkommen. Manche haben es versucht und sich selbst die Aufgabe gestellt, ihr persönliches Emissionsbudget auf ein zukunftsverträgliches Maß zu verringern. Sie alle sind letztlich daran gescheitert.15
»By design or by disaster«
Ob Musik die Welt in Zeiten der Klimakrise schöner machen kann, ist deshalb keine individuelle und auch keine rein ästhetische, sondern eine systemische Frage. Damit sie es weiterhin kann – dies ist eine der Hauptthesen meines Buches – muss sich vieles verändern. Auch dieser Veränderungsdruck betrifft nicht allein die Musik, sondern ist ein Merkmal unserer Zeit. Denn in einem Punkt ist sich das Gros der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig: Wir Menschen haben diesen Planeten so tiefgreifend verändert, dass sich unweigerlich auch unser eigenes Leben verändern wird.16 Die Frage ist längst nicht mehr, ob diese Veränderungen kommen werden. Sie sind unaufhaltsam. Die Frage ist, ob die Menschheit noch in der Lage sein wird, diese unausweichlichen Veränderungen aktiv mitzugestalten. Ändert sich unser Leben »by design« – also beispielsweise durch neue Lebensweisen, neue Formen der Energiegewinnung und einen neuen Umgang mit der Natur? Oder ändert es sich »by disaster«?17 Brechen die Veränderungen ungebändigt über uns herein, weil uns irgendwann keine Handlungsspielräume mehr bleiben? Wenn dies aber für alle Lebensbereiche gilt, dann gilt es auch für die Musik. Auch sie wird sich verändern. Und auch hier gibt es zwei Möglichkeiten: die Veränderungen vorausschauend zu gestalten oder abzuwarten, bis sie von selbst geschehen.
Es ist beängstigend, wenn alles sich verändert, und es ist deshalb sehr menschlich, die Veränderungen abzuwehren und so lange wie möglich am Vertrauten festzuhalten. Man kann die Zwangsläufigkeit dieser Veränderungen aber auch als eine faszinierende und herausfordernde Gestaltungsaufgabe verstehen. Welche Rolle können Musikinstitutionen und musikalische Akteur*innen bei diesem gesamtgesellschaftlichen Wandel spielen? Gibt es sinnvolle und seriöse Ansätze für musikalische Lösungsbeiträge? Wie kann es gelingen, unser Musikleben auf eine vorausschauende Art und Weise so umzugestalten, dass Musik auch in Zukunft noch eine Quelle von Schönheit bleiben kann? Solche Fragen überhaupt zu stellen und in diese Richtung weiterzudenken erfordert ein gewisses Maß an »Gläubigkeit«. Man muss an die Musik selbst glauben und davon überzeugt sein, dass sie keine Nebensache ist. Dass es um etwas geht beim Musikmachen. Dass es nicht gleichgültig ist, wovon und wie und für wen wir singen und musizieren. Und man muss an ihre Gestaltbarkeit glauben. Daran, dass es lohnend sein kann, über ihre Rolle in unserer Gesellschaft nachzudenken. Dass es nicht völlig abwegig ist, mit Tönen ein kleines Stückchen Welt mitgestalten zu wollen.
Der naive Kinderglaube eines unverbesserlichen Musikträumers? Vielleicht. Womöglich war es ja genau dieser kleine Rest an unverwüstlicher Gläubigkeit, der mich dazu gebracht hat, auf die hartnäckige Stimme des 17-, 18-, 19‐Jährigen von damals zu hören. Ihn nicht gleich wieder wegzuschicken, sondern mich auf seine Fragen und Mahnungen einzulassen. Wir hatten es in den folgenden Wochen nicht immer leicht miteinander. Wir haben viel gestritten. Aber irgendwann haben wir, trotz aller wechselseitigen Vorbehalte, gemeinsam beschlossen dieses Buch zu schreiben.
»Kann Musik die Welt schöner machen?« In dieser Frage schwingen Zweifel, Sorgen und Hoffnungen mit. Die Träume des 17‐Jährigen und die Skepsis des alternden, desillusionierten Berufskomponisten. Nimmt man beides zusammen, dann entsteht eine Möglichkeit. Es ist möglich, dass Musik diesen Anspruch auch in Zukunft noch einlösen kann. Es ist denkbar, dass der Musik durch die Klimakrise neue, wichtige Aufgaben und eine neue Relevanz zuwachsen. Aber es ist nicht selbstverständlich. Damit das Mögliche zu einer neuen Wirklichkeit werden kann, müsste sich vieles verändern.
Dieser Möglichkeit werde ich mich in den folgenden Kapiteln aus unterschiedlichen Blickwinkeln annähern. Mal werde ich von außen auf die Wechselbeziehungen zwischen Musik und Klima schauen, mal aus einer musikalischen Innenperspektive. Mal werde ich zu diesem Zweck eine eher wissenschaftliche Haltung einnehmen, mal die eines Geschichtenerzählers oder eines Journalisten. Diese häufigen Perspektivenwechsel scheinen mir wichtig zu sein, um dem Thema gerecht zu werden. Mögliche Schönheit lässt sich nicht beweisen oder widerlegen. Aber man kann sich hoffnungsvoll und in kleinen Schritten an sie herantasten.
Kapitel 2Teil des Problems?
Parents for Future.Scientists for Future. Omas for Future. Als »die Fridays« ab 2018 die öffentliche Bühne betreten, sammeln sich viele hinter den protestierenden Jugendlichen. Der Orchestergraben und die Begleitband jedoch bleiben anfangs weitgehend unbesetzt. Zur lautesten musikalischen Stimme der Bewegung wird mit Billie Eilish eine jugendliche Sängerin, die selbst im Alter der Demonstrierenden ist. Die älteren Semester aus der Musikszene scheint es hingegen anfangs deutlich weniger aufs Podium zu drängen. Die großen Popstars halten sich weitgehend zurück. Kein Konzerthaus erklärt den Klimanotstand. Keines der großen Orchester legt anlässlich eines Klimastreiks seine Arbeit nieder. Ausgerechnet diese extrovertierte und engagierte Branche, die sonst immer gerne dabei ist, wenn es gilt, wichtigen Anliegen öffentlichkeitswirksam eine Stimme zu geben, bleibt in diesem ersten Fridays‐for‐Future‐Jahr zu großen Teilen stumm.18 Schüchternheit oder Weltfremdheit sind es sicher nicht, die die Musikwelt verstummen lassen. Worin die Zurückhaltung stattdessen begründet sein könnte, lassen jene erahnen, die sich nach und nach vereinzelt zu Wort melden. Anders als die Parents, Scientists und Omas sammeln sie sich nämlich nicht hinter den politischen Forderungen der streikenden Jugendlichen, sondern hinter einem zerknirschten Eingeständnis: »Ja, auch ich fliege zu viel!«
Im Glashaus
»Wir haben schon eine Menge großer Touren gemacht«, räumt die Band Coldplay selbstkritisch ein und fragt sich nun: »Wie können wir es so verändern, dass wir nicht so viel nehmen, sondern mehr geben?«
»Brauchen wir wirklich 27 Szenenwechsel?«, fragt die Musikagentin Emma Banks und schlägt vor: »Wenn jeder, der auf einer großen Tour ist, fünf Lastwagen einsparen würde, hätte das schon eine Wirkung.«
»Die Natur ist keine ewig währende Gabe«, warnt der Dirigent Vladimir Jurowski und fährt fort: »So wie wir mit der Natur verfahren, werden wir sie bald nur in Oratorien von Haydn oder anderen Musikwerken wiederfinden«.19
Solche nachdenklichen Töne hörte man im ersten Fridays‐for‐Future‐Jahr häufig – und zwar über alle Stil‐ und Genregrenzen hinweg. Mit großer Aufrichtigkeit nehmen Musikerinnen und Konzertveranstalter ihre eigene Schadensbilanz in den Blick, stellen (selbst‑)kritische Fragen an die eigene Branche und thematisieren offensiv ihre eigene Dauermobilität. Vor allem die vielen berufsbedingten Flugreisen werden zur Gretchenfrage, an der kaum ein Artikel, kaum eine Podiumsdiskussion oder Radiosendung zum Thema »Musik und Klima« vorbeikommt.20 Und als Billie Eilish aus dieser kollektiven Haltung der Selbstbezichtigung ausschert und ihre Popularität stattdessen nutzt, um über den Klimawandel zu informieren, wirft eine Journalistin ihr prompt mangelnde Konsequenz vor: »Wenn Eilish das Klima wirklich retten wollte (...), dann würde sie die Welttour mit dem Jet absagen.«21
Der Grund dafür, dass sich die Musikprofis mit lautstarkem Klimaprotest zurückhalten und sich stattdessen mit der eigenen Schadensbilanz auseinandersetzen, liegt auf der Hand. Nimmt man die globale Gesamtentwicklung des internationalen Festival-, Konzert‐ und Tourneebetriebs in den Blick, dann gab es bis zum Ausbruch der Corona‐Pandemie eine klare Richtung: mehr von allem. Mehr Konzerthäuser, mehr große Festivals, mehr internationale Tourneen. Mobilität gehörte schon immer zum Musikerberuf. Dauerhafte globale Mobilität jedoch – einst ein Markenzeichen internationaler Stars wie Elton John oder Yehudi Menuhin – ist erst seit wenigen Jahrzehnten Normalität. Allein im November 2018 befanden sich sechs große deutsche Orchester auf Fernost‐Tournee. Wenig später warb die Hamburger Elbphilharmonie damit, dass sich in nur einer Spielzeit »40 internationale Top‐Klangkörper die Klinke in die Hand« geben würden.22 Hinterfragt hatte man dies alles vor 2019 selten. Man hielt die Maschinerie am Laufen. Erfolg maß sich an der Zahl und Ferne der Auslandsauftritte. Wer im Inland blieb, musste die fehlende Internationalität auf andere Weise kompensieren. Noch im Juni 2019 prahlte der Popstar Mark Forster damit, dass für das Equipment seiner Open‐Air‐Tournee mehr LKWs im Einsatz seien als bei Lady Gaga.23
Auch ich selbst bin, als ich das erste Mal auf Fridays for Future stoße, ein Dauerreisender – wenn auch, mangels Prominenz, nur in sehr bescheidenem Umfang. Dass auch exzessives ICE‐Fahren Energie verbraucht und mein ständiges berufliches Unterwegssein einen messbaren Einfluss auf Umwelt und Klima hat, ist mir bis zu diesem Zeitpunkt nie in den Sinn gekommen. Mit durchschnittlich 700 bis 1.000 Kilogramm CO2 pro Jahr schlugen meine beruflichen Bahnfahrten zu Buche. Dies war zwar einerseits weniger, als wenn ich mit dem Auto gefahren oder geflogen wäre. Doch andererseits sind diese mobilitätsbedingten Emissionen, die ich mir völlig gedanken‐ und bedenkenlos gegönnt habe, zehnmal höher als die jährlichen Gesamtemissionen einer durchschnittlichen Einwohnerin von Somalia, die sehr viel mehr als ich unter den Folgen der Erderwärmung zu leiden hat. Und sie sind wohl auch höher als das jährliche CO2‐Budget, über das die Generation meiner Enkel und Urenkel noch verfügen wird.
Ähnliche Gedanken dürften damals viele Musikerinnen und Musiker gehabt haben. Wenn Greta Thunberg ihr empörtes »How dare you« ausrief; wenn die schulstreikenden Jugendlichen ihr »... weil ihr uns die Zukunft klaut« skandierten, dann fühlten wir Vielreisenden uns auf beklemmende Weise angesprochen. Als Adressat aber kann man kein Verbündeter sein. Bevor man sich öffentlich zu Wort meldet, gilt es erst einmal, eine eigene, glaubwürdige Position zu finden. Es war also durchaus angemessen, sich in diesem klimapolitischen Wendejahr erst einmal zurückzuhalten. Wer im Glashaus sitzt, ist für alle sichtbar. Und wer Internationalität zum Erfolgskriterium macht und jeden Abend auf einer anderen Bühne dieser Welt steht, ist gut beraten, sich mit lautstarkem Klimaprotest zurückzuhalten.
Und so trat ein Teil der musikalischen Prominenz, statt mit Klimasongs oder lauten Appellen, als geläuterte Vielflieger*innen auf die Bühne und gelobte, den eigenen CO2‐Fußabdruck fortan zu reduzieren.24 Auch hinter den Kulissen begann ein Umdenken. Immer mehr Konzertagenturen setzten sich selbstkritisch mit der eigenen Schadstoffbilanz auseinander. Immer häufiger ließen Festivals und Konzerthäuser ihre Schadstoff‐Emissionen und mögliche Einsparpotenziale berechnen. Auf immer mehr Ebenen der Musikwirtschaft – im Instrumentenbau, im Verlagswesen, bei der Bühnenbeleuchtung – wurde über Alternativen zu den bisherigen, umweltschädlichen Praktiken nachgedacht.25 Es scheint, als habe die Musikwelt ihre Lektion gelernt.
Die Frage ist bloß: Welche Lektion?
Das größte Konzert aller Zeiten
Ein historischer Wendepunkt sollte es sein. Eine so starke Signalwirkung sollte von ihm ausgehen, dass niemand sich würde entziehen können. Und deshalb durfte es nicht irgendein Konzert unter vielen bleiben. Es sollte das »größte Konzert aller Zeiten«26 werden.
Die Initiator*innen hatten in jeder Hinsicht auf Superlative gesetzt: Veranstaltungen auf allen sieben Kontinenten, die sich an diesem 7.7.2007 dank Internetstreaming und weltweiter Fernsehübertragungen zu einem einzigen globalen Event verbanden. 150 Live‐Acts an elf zentralen Standorten. Zusätzlich rund 10.000 kleinere Veranstaltungen in 130 Ländern. Unter den Musiker*innen Berühmtheiten wie Alicia Keys und Kanye West, Genesis und The Police, aber auch eine Amateurband von Polarwissenschaftlern in einer antarktischen Forschungsstation. Und, allen voran, die Queen of Pop Madonna. All dies sollte helfen, ein globales Milliardenpublikum zu erreichen, für das gemeinsame Anliegen zu sensibilisieren und zugleich ein deutliches Signal an die politischen Entscheidungsträger*innen zu senden.27
Doch das Signal fiel bei weitem nicht so eindeutig aus wie erhofft. Anstatt das beeindruckende Staraufgebot oder die gewaltige logistische Leistung zu würdigen, schoss sich ein Großteil der Presseberichte auf einen Aspekt ein, der noch niemals zuvor Gegenstand von Kulturkritik gewesen war: Auf die Energie‐ und Umweltbilanz der Veranstaltung selbst. Das britische Boulevardblatt Daily Mail berechnete, dass allein die beteiligten Stars für ihre Auftritte über 350.000 Flugkilometer zurücklegen würden. Verschiedene Zeitschriften errechneten für das Event eine »schwindelerregende« CO2‐Bilanz, die je nach Berechnungsgrundlage zwischen 31.500 und 110.000 Tonnen lag. Die BBC‐News berichteten von »tausenden Plastikbechern auf dem Boden des Wembley Stadions«. Und die Neue Zürcher Zeitung hielt es sogar für angebracht, den Betrag der monatlichen privaten Stromrechnung eines Mitveranstalters zu veröffentlichen.28 Was war geschehen? Warum dieses plötzliche investigative Interesse an Plastikbechern, Stromrechnungen und Flugmeilen?
Der wichtigste Grund für diese journalistische Schwerpunktsetzung war natürlich das selbst gewählte Thema des Events. Live Earth – so der Titel des globalen Konzertmarathons – war explizit dem Klimaschutz gewidmet. Der Zeitpunkt für eine solche Veranstaltung war klug gewählt. Die drohende Klimakatastrophe war 2007 ins öffentliche Bewusstsein gerückt wie nie zuvor; der Weltklimarat warnte eindringlicher denn je vor den Folgen der Erderwärmung und forderte ein tiefgreifendes Umsteuern. In Deutschland machte erstmals das Wort »Klimagerechtigkeit« die Runde; die promovierte Physikerin Angela Merkel setzte sich kurzzeitig als »Klimakanzlerin« an die Spitze der Bewegung und profilierte sich mit der radikalen Forderung, kein Mensch dürfe mehr als zwei Tonnen CO2‐Ausstoß verursachen. Viele Klima‐ und Umweltschützer*innen hofften, dass der lange ersehnte internationale Durchbruch unmittelbar bevorstehe.29
Man könnte es also durchaus als Beweis für ein erfolgreiches Agendasetting verbuchen, wenn gleich mehrere Redaktionen akribisch die Energiebilanzen des Großevents und seiner Stars berechnen ließen. Doch es gab noch einen zweiten Grund für das Medieninteresse. Mit dem US‑amerikanischen Unternehmer und Politiker Al Gore hatte sich eine ebenso prominente wie umstrittene Galionsfigur an die Spitze von Live Earth gesetzt. Der Dokumentarfilm An Inconvenient Truth hatte ihn zum berühmtesten Klimaaktivisten der Welt gemacht, gleichzeitig profitierte er als milliardenschwerer Unternehmer von grünen Technologien. Gore wurde deshalb immer wieder als Umweltheuchler verspottet, der um des eigenen Profits willen Panik schüre. Dieser Vorwurf färbte nun auf das von ihm unterstützte »größte globale Entertainment‐Event der Geschichte«30 ab.
Genüsslich wurde der Finger in die Wunde des Widerspruchs zwischen der klimapolitischen Botschaft und ihrer energieintensiven Verbreitung gelegt. »Würden Sie«, fragte die britische Sonntagszeitung The Observer, »ein Spanferkelbraten veranstalten, um für den Vegetarismus zu werben?«31
Manche Berichte und Kommentare beließen es nicht bei der Kritik des Festivals, sondern nahmen den gesamten Lebensstil der beteiligten Superstars mit ihren »benzinsaufenden Strassenflitzern [sic]« und all den anderen »Protz‐Insignien der Popkultur«32 ins Visier. Vor allem Frontfrau Madonna musste sich bissige Kommentare zu ihrem Reiseverhalten und ihren aufwendigen Konzertinszenierungen gefallen lassen, nachdem sie eigens für Live Earth einen neuen Song produziert hatte, in dem sie zu Verhaltensänderungen aufrief: »Diesmal musst du dich ändern! Du zuerst!« – eine Steilvorlage für ihre Kritiker*innen.33
Selbstverständlich ist es Aufgabe einer kritischen Presseberichterstattung, derartige Widersprüche aufzudecken und anzuprangern. Aber es hätte in diesem Fall durchaus Gründe gegeben, auch die Kritik selbst kritisch zu hinterfragen. Warum hatte keine der investigativen Redaktionen als Vergleichswert den CO2‐Fußabdruck ihrer eigenen journalistischen und publizistischen Tätigkeit berechnen lassen? Warum reagierten die Medien ausgerechnet hier in einer solchen Schärfe, ignorierten aber die Umwelt‐ und Klimabilanzen anderer, vergleichbar großer Events?34 Wie sinnvoll ist es, die Treibhausgas‐Emissionen eines globalen Events von derartiger Reichweite mit dem »jährlichen Fußabdruck eines durchschnittlichen Briten« zu vergleichen?35 Warum wurde nicht die Möglichkeit eines positiven, bewusstseinsbildenden Effektes in die Rechnungen einbezogen?36 Und warum blieb in all den kritischen Berichten unerwähnt, dass die Macher*innen von Live Earth erstmals in der Musikgeschichte ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept für große Festivals entwickelt hatten, von dem Fachleute später sagten, es habe damals in der gesamten Branche nichts gegeben, das so »akribisch und maßgebend« gewesen sei wie die »bahnbrechenden« Umweltrichtlinien von Live Earth?37
Die Erfahrung, dass die Botschaft des Festivals wie ein Bumerang zurückkam und sich gegen die mitwirkenden Stars richtete, hat hinter den Kulissen des Musikbusiness tiefe Spuren hinterlassen. Der musikalischen Fachwelt war unmissverständlich vor Augen geführt worden, dass eine lautstarke Positionierung für den Klimaschutz der eigenen Reputation schaden kann. Politische Appelle aus der Popkultur brauchen Authentizität. Doch anders als bei den großen Freiheitsdiskursen des 20. Jahrhunderts steht die Popmusik bei diesem Thema nicht automatisch auf der richtigen Seite. Wer mit seiner klimapolitischen Botschaft möglichst viele Menschen erreichen will, muss auf eine maximale Popularität der mitwirkenden Stars setzen. Doch diese Berühmtheit ist in der Regel an internationale Präsenz gekoppelt – und damit auch an eine überdurchschnittlich schlechte Klimabilanz. Das Veranstaltungsmanagement mag noch so »grün« und durchdacht sein – es wird in der öffentlichen Wahrnehmung stets im Hintergrund bleiben und von der Prominenz der Stars überstrahlt werden. Was in diesem Fall eben auch bedeutet: Von deren individueller Klimabilanz. Die Medien verstärken diese Personalisierung, indem sie den Blick auf einzelne, bizarr verschwendungssüchtige Lebensstile lenken. Letztlich spielen sie mit ihrem Bemühen um kritische Kommentare einer unkritischen und unpolitischen Selbstentlastung in die Hände.
Was eigentlich als ein aufrüttelnder Paukenschlag nach außen intendiert war, hat also nach innen etwas völlig anderes bewirkt: Ernüchterung. Und so endete mit Live Earth nicht nur eine Serie von globalen, politisch motivierten Musik‐Mega‐Events.38 Es gab im folgenden Jahrzehnt auch keine vergleichbaren Versuche mehr, den Klimaschutz überhaupt noch zu einem zentralen popkulturellen oder künstlerischen Thema zu machen und ihn in einer konzertierten Aktion auf die ganz große Bühne zu bringen.
Auch außerhalb der Musikbranche ging die klimapolitische Aufbruchstimmung schnell wieder vorbei. Beim Kopenhagener Klimagipfel von 2009 scheiterte der Versuch, sich auf verbindliche Klimaschutzziele zu verständigen. In den darauffolgenden Jahren wurde der Klimaschutz wieder zu einem Gegenstand langwieriger und zäher Verhandlungen, die von außen betrachtet wie Stillstand wirkten.39 Ernüchterung also auch auf der Bühne der Weltpolitik – und die allseitige Erkenntnis: Wer sich auf die Klimakrise einlässt, hat es nicht nur mit physikalisch messbaren Emissionsproblemen zu tun. Sondern auch mit vielerlei Kommunikationsproblemen, die letztlich alle den gleichen Ursprung haben: einen schwer berechenbaren Einflussfaktor namens »Mensch«.
Unüberwindbar? Psychologische Hürden
»Wie kann das sein?«, rufen die schulstreikenden Jugendlichen uns Älteren mit ihren Demos und Schulstreiks zu. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie kann es sein, dass noch immer so viele den menschengemachten Klimawandel leugnen oder verharmlosen, obwohl die Fakten »seit langer Zeit auf dem Tisch liegen«? Und wie kann es sein, dass die Politik sich nur für diejenigen Lösungen interessiert, die sie »in die Lage versetzen, weiterzumachen wie bisher«?40
»Wie kann das sein?«, fragen Klimawissenschaftlerinnen und ‑wissenschaftler schon lange und mit wachsender Verzweiflung. Wie kann es sein, dass jahrzehntelang alle Warnungen kollektiv verdrängt wurden? Und wie kann es sein, dass die Weltgemeinschaft sich sehenden Auges an den Rand einer Situation »unermesslichen Leides« manövriert hat?41
Aus der Frage, wie dies alles sein kann, ist ein eigenes interdisziplinäres Forschungsfeld entstanden. Nachdem die Erderwärmung anfangs als ein rein naturwissenschaftlich‐technisches Problem betrachtet worden war, wurde im Lauf der Zeit immer deutlicher, wie vielschichtig und komplex die Mechanismen sind, die einer wirksamen Klimapolitik im Weg stehen. Es entstand eine »zweite Wissenschaft des Klimawandels«, die dessen »menschliche Dimensionen«42 untersucht – darunter auch jenes deprimierende Phänomen, das in der Fachliteratur als »Knowledge‐Action‐Gap« bekannt ist und das die Autorin Annett Entzian in Anlehnung an einen Filmklassiker auf eine prägnante Formel gebracht hat: »Denn sie tun nicht, was sie wissen«.43
Die psychologischen und emotionalen Gründe des Nicht‐Handelns ernst zu nehmen, bedeutet nicht, andere Faktoren in Abrede zu stellen. Zweifellos wird Klimaschutz auch durch Macht‐ und Wirtschaftsinteressen blockiert. Doch die psychologischen Faktoren können eine wichtige, verstärkende Rolle spielen. Die Abwehrreaktionen mancher Menschen bei Reizthemen wie »Veggie‐Day« oder »flächendeckende Tempolimits« folgen einem ähnlichen Muster wie die negative Berichterstattung zum Live Earth‐Festival.44 Die Psychologie bezeichnet diesen Bumerangeffekt als Reaktanz und meint damit ein Aufbegehren gegen Übergriffe auf die eigenen Freiheitsrechte und Handlungsspielräume. Reaktanz kann in vielen Fällen durchaus sinnvoll und gesund sein. Die eigene Autonomie zu verteidigen und Freiheitseinschränkungen abzuwehren kann ein wichtiger Beitrag zu einer offenen und pluralistischen Gesellschaft sein. Problematisch und dysfunktional wird dieser Abwehrmechanismus in dem Moment, in dem er dazu dient, unbequeme Wahrheiten von sich fern zu halten und Privilegien zu verteidigen, die aus subjektiver Sicht zwar angenehm und vielleicht sogar berechtigt erscheinen mögen, die global gesehen aber großen Schaden anrichten. Die Folge: Berechtigte Appelle laufen ins Leere, die Warnenden und Mahnenden werden der Heuchelei bezichtigt oder als unsympathische Besserwisser karikiert.
Besonders heftig fällt die Reaktanz aus, wenn sich klimapolitische Appelle mit großer Prominenz und einer entsprechenden medialen Verstärkung verbinden. Je öffentlichkeitswirksamer der Finger in die Wunde gelegt wird, umso unbarmherziger werden die Mahner*innen mit inkonsequenten Umsetzungen ihrer eigenen Forderungen konfrontiert. Nicht nur Al Gore und Madonna, auch Greta Thunberg bekam diesen Abwehrmechanismus immer wieder zu spüren. So erntete sie beispielsweise im Januar 2019 einen Shitstorm, weil sie während einer rund dreißigstündigen Zugfahrt zum Weltwirtschaftsforum in Davos ein in Plastik eingepacktes Toastbrot aus dem Bordbistro verzehrt hatte.45
*
Einzelfälle wie dieser erklären noch nicht, wie aus einer subjektiven Abwehrhaltung eine langfristig und kollektiv wirksame Kraft werden kann. Psychologische Abwehrmechanismen können viele Gründe haben und die Klima‐ und Umweltkrise zeichnet sich durch mehrere Eigenschaften aus, die eine solche Abwehr besonders zu begünstigen scheinen. Eine davon ist die schiere Größe der Gefahr. Der Klimawandel und das Artensterben sprengen alle Dimensionen des Vorstellbaren. Der Klimakommunikationsexperte George Marshall hält die Abwehr einer derart unfassbaren Bedrohung für einen psychologischen Schutzmechanismus, der dem menschlichen Gehirn fest »einprogrammiert« ist.46 Paradoxerweise scheint aber gerade in dieser überfordernden Größe auch ein Stück individueller Entlastung zu liegen. Gerade weil die Bedrohung so riesig ist, erscheint sie im Alltag als nebensächlich. Private Sorgen wie das Abzahlen der Hypothek oder die Probleme der eigenen Kinder scheinen relevanter zu sein als der drohende Verlust einer bewohnbaren Erde.47 Dies gilt erst recht, wenn globale Probleme die eigenen Alltagsgewohnheiten infrage stellen. Angesichts der Größe des Gesamtproblems erscheint der eigene Beitrag dann wie der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Dies wäre nicht weiter schlimm, wenn es lediglich Wasser wäre, das hier tropft. Doch in vielen Fällen geht es um Herzblut. Auch wenn Flugreisen nicht der ideelle Kern eines Musikerlebens sind, kann ein Flugverzicht in vielen Fällen bedeuten, den eigenen Wirkungsradius erheblich zu verkleinern, wertvolle Kontakte abzubrechen und eine internationale Tourneetätigkeit zu beenden oder zumindest stark zu reduzieren. Gemessen an seiner verschwindend geringen Klimawirkung erscheint ein derartiges Opfer unverhältnismäßig groß. Und natürlich wird man leicht viele andere Verursacher*innen finden, die um ein Vielfaches mehr »Teil des Problems« sind als die eigene Branche: Die Stahlindustrie. Die Landwirtschaft. Die Kohlekraftwerke in China.
Eng verwandt mit dem Problem der überfordernden Größe ist das der räumlichen und zeitlichen Ferne. Zwischen Ursache und Wirkung können mehrere Jahrzehnte oder tausende Kilometer liegen. Auch hier gerät die menschliche Empathiefähigkeit an ihre Grenzen. Etwas vereinfacht könnte man sagen: Wir Menschen und unser moralisches Rüstzeug sind »nicht dafür gemacht«, uns für derart weit entfernte Auswirkungen unseres eigenen Handelns verantwortlich zu fühlen. Viele Menschen verfügen über einen sehr feinen moralischen Kompass, wenn es um das unmittelbare zwischenmenschliche Verhalten geht. Sie haben ein Gespür dafür, ob und wann eine Lüge, eine Beleidigung oder ein Klaps auf den Po situativ angemessen, gerade noch vertretbar, leicht übergriffig oder ganz und gar inakzeptabel ist. Doch diese intuitive Kompassnadel versagt, wenn es um den Zusammenhang zwischen kleinen, alltäglichen Handlungen und sehr großen, fernen Wirkungen geht. Phänomene wie die Erderhitzung oder das Massenaussterben überschreiten nicht nur das Maß des Vorstellbaren und sinnlich Wahrnehmbaren. Sie sprengen auch das traditionelle Koordinatensystem menschlicher Verantwortung. Dass das Autofahren oder der Fleischkonsum in Deutschland irgendetwas mit sibirischen Permafrostböden oder künftigen Generationen zu tun haben soll, kann man sich zwar anlesen und kognitiv wissen. Aber es fällt extrem schwer, dieses Wissen auf eine Weise zu verinnerlichen, die ähnlich zuverlässig als Richtschnur für falsches und richtiges Handeln funktioniert, wie es die moralischen Imperative des Zwischenmenschlichen tun.
Neben der Größe und der Ferne der Klima‐ und Umweltkrise ist ein drittes Wahrnehmungsproblem ihre Langsamkeit. Planvolles menschliches Handeln orientiert sich an überschaubaren Zeiträumen. Der Klimawandel aber ist eine »schleichende Bedrohung«48, die nicht in den zeitlichen Horizont von Legislaturperioden, Haushaltsjahren oder Theaterspielzeiten passt. Spürbar wird sie erst dort, wo sie sich in Dürre oder Stürmen, Waldbränden oder Überschwemmungen äußert. Doch gerade in solchen Momenten wird der unmittelbare Handlungsdruck durch akute Not und Gefährdung so übermächtig, dass deren übergeordnete und schleichende Ursachen erst recht zweitrangig, ihre aktive Eindämmung und Bekämpfung erst recht aufschiebbar zu sein scheinen. Vielleicht kann man sich das überfordernde Ausmaß dieser Langsamkeit am besten anhand des viel zitierten Begriffs »Anthropozän« vor Augen führen. In vielen Debatten und Projekten wird dieser Begriff so behandelt, als bezeichne er eine neue, gerade erst beginnende oder zukünftige Geschichtsepoche. Doch dabei wird übersehen, dass es ein Chemiker und Meteorologe war, der diesen Begriff geprägt und in die geologische Zeitrechnung eingereiht hat, in der üblicherweise in Jahrmillionen gerechnet wird.49 Ein Menschenleben ist, geologisch betrachtet, fast nichts. Seit der Erfindung des Ackerbaus und dem Errichten fester Siedlungen hat die Menschheit bislang noch keine geologische Zeitenwende erlebt. Man könnte also sagen: Das Anthropozän spielt in einer völlig anderen Liga als gewöhnliche historische Epochen wie die Antike, das Mittelalter oder die Neuzeit. Es gibt deshalb für das, was die Menschheit gegenwärtig erlebt, keine Erfahrungswerte, keine Bilder, an die sich anknüpfen ließe, keine Erzählungen, die sich fortführen ließen. Entsprechend schwer fällt es, zu verstehen, dass wir gegenwärtig keine kultur‑, sondern eine erdgeschichtliche Epochenzäsur erleben und dass Veränderungsprozesse, die sich »nur« über wenige Jahrzehnte oder Jahrhunderte erstrecken, in diesem Kontext nicht langsam, sondern rasend schnell sind.
Jahrzehntelang haben die Ferne, Größe und Langsamkeit der Bedrohung dazu beigetragen, sie unsichtbar zu machen. Fatalerweise schien der Klimawandel gerade dort weit weg zu sein, wo ein massives Gegensteuern besonders wichtig und effektiv gewesen wären: in den energiehungrigen Ländern des globalen Nordens. Dies beginnt sich seit den 2010er‐Jahren spürbar zu ändern. Mehrere Dürresommer und eine starke Zunahme von verheerenden Waldbränden, Stürmen und Überschwemmungen haben aus der abstrakten Bedrohung eine akute Gefahr gemacht. Doch selbst diese »objektive« Nähe führt nicht überall dazu, dass der Klimawandel ernst genommen wird.50 Offenbar gibt es weitere Faktoren, die das Hinschauen schwer machen.
*
Einschneidende Verhaltensänderungen setzen nicht nur ein tiefes Verständnis voraus. Sie brauchen auch starke Gefühle. Ohne eine solche emotionale Grundierung droht der geforderte Verzicht zur lästigen Pflichtübung oder zu einer unerträglichen Zumutung zu werden. Doch die Klima‐ und Umweltkrise als Ganzes ist nicht nur »unsichtbar« – sie macht es uns Menschen auch auf emotionaler Ebene nicht leicht.
Ein besonders wirkmächtiges Gefühl ist Angst. Angst kann aktivieren, sie kann aber auch lähmen. Angesichts von Erderhitzung und Artensterben verbinden sich diese beiden Gesichter der Angst offenbar zu einer besonders ungünstigen Konstellation. Einerseits kann, wo »wütendes Wetter«, die »Vernichtung der Arten« und eine »unbewohnbare Erde« drohen und ständig von »Desaster, Zerstörung und drohendem Untergang« die Rede ist, die Angst so unerträglich werden, dass ihr nur noch mit Verdrängung und Verleugnung beizukommen ist.51 Dem Psychotherapeuten Christoph Nikendei zufolge müssen die belastenden Affekte in einem solchen Fall »abgewehrt und aus dem Bewusstsein verbannt werden«, weil die »umfassende Realisierung des sich abzeichnenden globalen Desasters mit den leidvollen Konsequenzen für all diejenigen, die uns lieb und wichtig sind« subjektiv als »vernichtender und bedrohlicher« empfunden wird, als »die Anerkennung der Bedrohung selbst«.52 Auf der anderen Seite lösen aber auch die Verzichtsappelle und empfohlenen Gegenmaßnahmen Ängste aus, die dann möglicherweise sehr viel konkreter, greifbarer und fühlbarer sind als die unterdrückte Klimaangst. Die Palette dieser Verlustängste ist groß und kann sich beispielsweise auf Arbeitsplatz, Ansehen, Bewegungsfreiheit und verschiedenste Wohlstandsprivilegien beziehen. Aus einer globalen Gerechtigkeitsperspektive mag es sich dabei vielfach um die »Luxussorgen« von Überprivilegierten handeln. Gleichwohl sind diese Ängste als Gefühle ebenso real wie menschlich. Sie beeinflussen alltägliches und politisches Handeln und blockieren mit großer Macht jenen tiefgreifenden Wandel, der zur Eindämmung der Krise geboten wäre.
Auch Trauer kann eine starke und wertvolle Triebkraft für Veränderungen sein. Für den Kulturphilosophen Charles Eisenstein ist die einseitige Konzentration der Umweltschützer auf ein fernes und abstraktes Problem wie den Klimawandel deshalb ein fataler Fehler: »Wir bewegten uns vom Herz zum Hirn, als wir verlangten, dass uns ferne Konsequenzen wie z.B. der Meeresspiegelanstieg bis 2050 motivieren sollten, und nicht der Schaden, der uns ins Gesicht starrt: Die Fische sind fort, die Aale sind fort, die Bäume sind fort, die Wale sind fort«. Anstatt diese verheerende Naturzerstörung konkret zu benennen und immer wieder an sichtbaren Beispielen festzumachen, werde durch die Übermacht des Klimanarrativs ein Umweg über Datensätze und Computermodelle genommen. So entstehe eine »Kluft zwischen Ursache und Wirkung, die nur überbrückt werden kann, wenn man den Erklärungen des Wissenschaftsestablishments glaubt«. Doch »zum umweltbewussten Menschen«, so Eisenstein, werde man nicht durch Zahlen, sondern »durch die Erfahrung von Schönheit und Verlust«. Wenn wir hingegen »Umweltprobleme in CO2‐Begriffen formulieren, erzeugen wir eine Distanz zu unmittelbarer Trauer und Entsetzen der Menschen«.53
Nicht nur das Trauern fällt in der Klimakrise schwer, sondern auch die Auseinandersetzung mit Schuldgefühlen und Wut. Die großen Protestbewegungen des 20. Jahrhunderts bezogen sich stets auf ein mehr oder minder klar definiertes Gegenüber – seien es autokratische Herrscher, korrupte Eliten, »das Kapital« oder »die da oben«. Dem Sozialpsychologen Harald Welzer zufolge hatten »alle erfolgreichen sozialen Bewegungen (...) im Kern das Thema Gerechtigkeit«.54 Wenn aber die Ursache des Übels zu großen Teilen darin besteht, dass sehr viele Menschen auf sehr ähnliche Weise konsumieren, sich fortbewegen und die eigene Wohnung heizen, dann lassen sich nur schwer Schuldige adressieren. Der Klimakrise fehlt, zumindest nach herkömmlichen Maßstäben, der bad guy.55 Natürlich erzählt sie global gesehen von großer Ungerechtigkeit – doch auch die Wut, die Empörung und Verzweiflung jener Inselbewohnerinnen, Kleinbauern und indigener Völker, die schon seit Jahren unter den Auswirkungen zu leiden haben, hat es schwer, ein konkret ansprechbares Gegenüber zu finden. Sie kann sich nur pauschal an »die« Konsum‐ und Wohlstandsgesellschaften oder an »die« Menschen des globalen Nordens richten, ihnen »Umweltrassismus« vorwerfen und eine »wachsende Schuld« attestieren.56
Doch wie soll man eine Schuld begreifen – geschweige denn spüren und eingestehen – wenn die Vorwürfe aus weiter Ferne kommen und im Alltag kaum hörbar werden, weil die eigene Umgebung das kritisierte Verhalten für völlig normal hält? Und selbst wenn es hin und wieder mal einem dieser Vorwürfe gelingen sollte, die lärmende Normalität zu durchbrechen und ein kurzzeitiges Schuldgefühl aufflackern zu lassen – was tut man dann mit einer solchen Irritation? Beschuldigt zu werden führt ja beileibe nicht immer automatisch zu Reue, Einsicht und sofortiger Verhaltensänderung. Sondern möglicherweise – und damit schließt sich der Kreis – zu Reaktanz.
*
Gewiss sind damit noch lange nicht alle Faktoren benannt, die in den zurückliegenden Jahrzehnten den Schritt vom Klimawissen zum Klimahandeln erschwerten. Mindestens ebenso schwer wie die psychologischen Hürden fallen systemimmanente Zwänge und wirtschaftliche Interessen ins Gewicht. Vorbehaltloser Klimaschutz würde nicht nur unsere sämtlichen »gefestigten Annahmen, unsere Routinen und Alltagsgewohnheiten«57 infrage stellen. Er würde auch Karrierepläne, Geschäftsmodelle und Strategien des Machterhalts durchkreuzen. In der globalen Ökonomie, wo »weit über 90% der vorhandenen Öl‑, Gas‐ und Kohlereserven« nicht mehr genutzt werden dürften, wenn die Klimaziele eingehalten werden sollen – was einer »billionschweren Enteignung« von Staaten und Unternehmen gleichkäme.58 Aber auch im parteipolitischen Wettbewerb, wo über viele Jahre hinweg jeder Versuch, um des Klimas willen regulierend in die Wirtschaft oder das Alltagshandeln einzugreifen, mit einem massiven Verlust an Wählerstimmen bestraft wurde.
Zusammengenommen ergibt dies alles das entmutigende Bild einer Situation, die im wahrsten Sinn des Wortes ausweglos erscheint. Die Stadt brennt. Doch so bedrohlich dieser Brand auch sein mag – der Weg hinaus führt in unerforschtes Gelände und wirkt noch viel bedrohlicher. Probleme, wo man hinschaut. Und hinter jedem Problem lauert ein neues. Ein gefährlicher Sumpf aus Widerständen, Ängsten und Ungewissheiten, in dem jeder Schritt zu einem unkalkulierbaren Risiko wird. Zaghaftigkeit und Mutlosigkeit werfen die demonstrierenden Jugendlichen von Fridays for Future der Politik vor. Zaghaftigkeit und Mutlosigkeit war bereits den Regierungschefinnen und ‑chefs vorgeworfen worden, nachdem der Klimagipfel von 2009 gescheitert war. Aber ist diese Vorsicht nicht mehr als verständlich? Es ist die Zaghaftigkeit derer, die am Rand des Sumpfes stehen und fürchten müssen, dass jedes schnelle Vorpreschen – und wäre es auch ein Vorpreschen in die einzig richtige Richtung – ihren persönlichen politischen Untergang nach sich ziehen wird.
Auch wir Musikerinnen und Musiker zogen es damals, nach den ernüchternden Erfahrungen von Live Earth





























