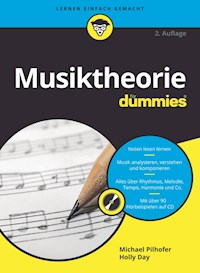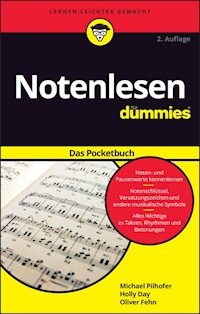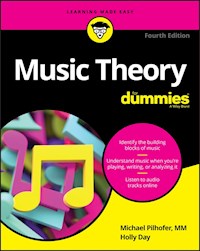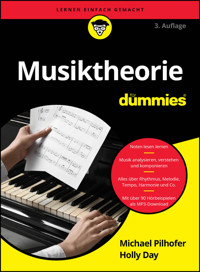
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Da ist Musik drin!
Michael Pilhofer und Holly Day erklären Ihnen in diesem Buch leicht verständlich alles Wichtige über Musiktheorie – vom Notenlesen bis zum Komponieren eigener Songs. Sie erfahren alles über Rhythmus, Tempo, Dynamik und Co., lernen, wie Tonleitern und Akkordfolgen aufgebaut sind, wie Sie einer Melodie auch Harmonie verleihen und vieles mehr. Denn schon ein wenig Grundwissen über Musiktheorie hilft Ihnen, Ihre Bandbreite als Musiker enorm zu vergrößern. Wenn Sie dachten, Musiktheorie sei trocken, wird dieses Buch eine angenehme Überraschung für Sie sein.
Sie erfahren
- Das Wichtigste über Vorzeichen und den Quintenzirkel
- Das Geheimnis von Klangfarben und Akustik
- Was Rhythmus und Dynamik bewirken
- Welche Formen es in Klassik, Blues und Jazz gibt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Musiktheorie für Dummies
Schummelseite
DIE C-DUR-TONLEITER (STAMMTÖNE)
C-D-E-F-G-A-H-C
VIOLINSCHLÜSSEL UND BASSSCHLÜSSEL
NOTENZEICHEN UND NOTENWERTE
Von links nach rechts: ganze Note, halbe Note, Viertelnote, Achtelnote, Sechzehntelnote
Aufeinanderfolgende Achtelnoten und Noten von noch geringerem Wert verbindet man durch einen Balken:
und
NOTEN- UND PAUSENBAUM
Die Zeichen für Noten- und Pausenwerte auf einen Blick:
Der Notenbaum. Oben ganze Noten, darunter halbe Noten, Viertelnoten und so weiter
Der Pausenbaum. Oben ganze Pausen, darunter halbe Pausen, Viertelpausen und so weiter
AKKORDE
Durakkorde bestehen (mindestens) aus dem Grundton, der großen Terz und der reinen Quinte der betreffenden Tonleiter:
Mollakkorde bestehen (mindestens) aus dem Grundton, der kleinen Terz und der reinen Quinte der betreffenden Tonleiter:
ESELSBRÜCKEN FÜR VIOLIN- UND BASSSCHLÜSSEL
Violinschlüssel (jeweils von unten nach oben):
Bassschlüssel (jeweils von unten nach oben):
Liniennoten: Ein guter Hund darf fressen.
Liniennoten: Geh, hol dir frische Austern!
(E-G-H-D-F)
(G-H-D-F-A)
Zwischenraumnoten: F-A-C-E (englisch für »Gesicht«)
Zwischenraumnoten: Alle Chinesen essen Gemüse. (A-C-E-G)
NOTENABSTÄNDE AUF KLAVIER UND GITARRE
Zwei Klaviertasten beziehungsweise Gitarrenbünde sind jeweils einen Halbton voneinander entfernt.
Der Quintenzirkel
Die gängigsten Intervalle
Prime (1)
Sekunde (2)
Terz (3)
Quarte (4)
Quinte (5)
Sexte (6)
Septime (7)
Oktave (8)
Musiktheorie für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
3. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Original English language edition Music Theory For Dummies, 2nd ed. © 2012 by Wiley Publishing, Inc.
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Copyright der englischsprachigen Originalausgabe Music Theory For Dummies, 2nd ed. © 2012 by Wiley Publishing, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Diese Übersetzung wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Alle Rechte bezüglich Text und Data Mining sowie Training von künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Technologien bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne die schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Bevollmächtigte des Herstellers gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung ist die Wiley-VCH GmbH, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Deutschland, E-Mail: [email protected].
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverillustration: © Pixel-Shot – stock.adobe.comKorrektur: Cora Elsässer, Flörsheim
Print ISBN: 978-3-527-72292-1ePub ISBN: 978-3-527-85134-8
Über die Autoren
Michael Pilhofer unterrichtet Musiktheorie und Percussion am McNally Smith College of Music in St. Paul, Minnesota. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er als professioneller Musiker, und er machte Tourneen und Plattenaufnahmen mit Joe Lovano, Marian McPartland, Kenny Wheeler, Dave Holland, Bill Holman, Wycliffe Gordon, Peter Erskine und Gene Bertoncini.
Holly Day unterrichtet Schreiben am Open Book Writing Collective in Minneapolis. Sie schrieb Texte zum Thema Musik für zahlreiche Publikationen, wie etwa Guitar One, Music Alive!, Computer Music Journal, The Oxford American und Mixdown Magazine. Zu ihren bisherigen Veröffentlichungen gehören Music Composition for Dummies, Shakira, The Insider's Guide to the Twin Cities und Walking Twin Cities.
Über den Übersetzer
Oliver Fehn war Musiker und Musiklehrer. Er spielte Gitarre, Klavier und Harmonika und trat schon im Teenageralter als Singer/Songwriter vor Publikum auf. Die Musik war seine große Leidenschaft, auch wenn er sich sein Geld hauptsächlich in der »schreibenden Zunft« verdiente. Er war als Autor belletristischer Bücher und als Übersetzer tätig. Für die »Dummies« hat er zahlreiche Bücher übersetzt und bearbeitet, darunter Musiktheorie für Dummies, Ukulele für Dummies, Komponieren für Dummies, Songwriting für Dummies und viele mehr. Er ist außerdem Autor von Übungsbuch Musiktheorie für Dummies und Co-Autor von Notenlesen für Dummies.
Über die Fachkorrektoren
Wendelin Bitzan ist Musiktheoretiker, Pianist und Komponist. Er unterrichtet Musiktheorie und Gehörbildung an deutschen Hochschulen, spielt gelegentlich an öffentlichen Orten Klavier, redet und schreibt leidenschaftlich gern über Musik und lebt mit seiner Familie in Berlin.
Stefan Hofmeister begann seine musikalische Karriere im Alter von fünf Jahren und setzte diese am Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen fort, wo er sein Abitur im Leistungskurs Musik (Gesang) ablegte. Danach arbeitete er zeitweise als Lehrkraft bei den Privaten Musiklehrer Instituten Ostbayern. Als Sänger im Renner Ensemble Regensburg nahm er in über zehn Jahren an vielen Konzertreisen im In- und Ausland teil und wirkte bei diversen CD-Produktionen mit. Inzwischen lebt er In München und arbeitet als freiberuflicher Übersetzer für die Sprachkombinationen Englisch-Deutsch und Japanisch-Deutsch. Seit dem Jahr 2008 singt er im Bass bei der Gruppe »Die Bergkameraden«.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autoren
Über den Übersetzer
Über die Fachkorrektoren
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Was Sie nicht lesen müssen
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: Der richtige Einstieg in die Musiktheorie
Kapitel 1: Musiktheorie – was ist das eigentlich?
Seit wann gibt es Musikinstrumente? Und seit wann die Musiktheorie?
Licht aus, Spot an für die Grundlagen der Musiktheorie!
Was bringt Ihnen nun Ihr Musiktheorie-Wissen?
Kapitel 2: Was Noten wirklich wert sind …
Meet the Beat!
Wie erkennt man den Wert einer Note?
Ganze Noten
Halbe Noten
Viertelnoten
Achtelnoten und noch kleineres Gemüse
Punkte, Bögen und anderer wichtiger Kleinkram
Und jetzt geht's ans Üben …
Kapitel 3: Mach mal Pause …
Wie kann ich Pausen im Notensystem erkennen?
Und wenn die Pause länger sein soll?
Übung: Noten und Pausen bunt gemischt
Kapitel 4: Musiker sollten niemals taktlos sein
Takt? Metrum? Was ist das eigentlich?
Einfache Taktarten – einfaches Spiel
Eine Idee schwieriger (aber auch nicht schwer): Die zusammengesetzten ungeraden Taktarten
Und jetzt noch die asymmetrischen Taktarten …
Kapitel 5: Der richtige Beat – ein Spiel ohne Grenzen
Was Sie über Betonungen und Synkopen wissen müssen
Auftakte – die große Ausnahme von der Regel!
Unregelmäßige Teilungen: Triolen und Duolen
Teil II: Noten finden und verbinden
Kapitel 6: Noten: Wann spielen? Wie erkennen? Wo finden?
Noten, Notenschrift und Notenschlüssel
Ganztonschritte, Halbtonschritte, Versetzungszeichen und Vorzeichen
Wie man Noten auf dem Klavier und auf der Gitarre spielt
Und wie merkt man sich das Ganze jetzt?
Kapitel 7: Alles über Dur- und Molltonleitern
Alles über Durtonleitern
Und jetzt wird's mollig …
Noch mehr Tonleitern? Hilfe!
Kapitel 8: Vorzeichen und der Quintenzirkel
Werden Sie mit dem Quintenzirkel vertraut!
Wie man Durtonarten an ihren Vorzeichen erkennt
Und wie funktioniert das jetzt bei den Molltonarten?
Die ganze Vorzeichen-Wissenschaft auf einen Blick
Kapitel 9: Das Intervall – der Abstand zwischen zwei Tönen
Primen, Oktaven, Quarten und Quinten
Wie man Sekunden, Terzen, Sexten und Septimen erkennt
Wie man Intervalle aufbaut
Große und reine Intervalle in der C-Dur-Tonleiter
Und nun zum Dessert: Komplementärintervalle
Kapitel 10: Wie Akkorde aufgebaut sind
Wie aus drei verschiedenen Tönen ein Dreiklang wird
Der nächste Schritt: Die Septakkorde
Alle Dreiklänge und Septakkorde auf einen Blick
Enge Lagen, weite Lagen, Umkehrung: Was man mit Akkorden alles machen kann
Kapitel 11: Akkordfolgen und Kadenzen
Zur Wiederholung und Vertiefung: Tonleitern und Akkorde in Dur und Moll
Wie man Akkordfolgen aufspürt und dem Kind einen Namen gibt
Wie aus einem Dreiklang ein Septakkord wird
Akkordfolgen – praktisch angewandt!
Der lockere Umgang mit Akkorden: Fakebooks und Tabulaturen
Der Weg in eine andere Tonart (Modulation)
Von der Akkordfolge zur musikalischen Kadenz
Teil III: Form, Tempo, Dynamik und noch viel mehr als Weg zum musikalischen Ausdruck
Kapitel 12: Die Grundbausteine der Musik: Rhythmus, Melodie, Harmonie und Form
Es ist der Rhythmus, bei dem ich mit muss!
Wie Melodie entsteht
Eine gute Melodie runde ab mit Harmonie
Die Arbeit mit musikalischen Phrasen und Perioden
Vom Formteil zur großen Form
Kapitel 13: Was Sie über die klassischen Formen wissen sollten
Der Kontrapunkt war der Wendepunkt
Was ist eine Sonate?
Eine runde Sache: Das Rondo
Mit Fug und Recht beliebt: Die Fuge
Kombinieren beim Komponieren – so entsteht eine Sinfonie
Zugabe, Zugabe …? Okay, noch ein paar klassische Formen und Gattungen
Kapitel 14: Zurück in die Gegenwart: Hier sind Blues, Jazz und Co.
Den Blues »im Blut haben«
Jede Menge Spaß mit Rock und Pop!
Für alle, die gern improvisieren: Der Jazz!
Kapitel 15: Den Klang variieren durch Tempo und Dynamik
Das richtige Tempo finden
LAUT??!! Leise …? Dynamik bedeutet Lautstärke
Kapitel 16: Die Klangfarbe und Akustik von Instrumenten
Welche Farben hat die (Musik-)Welt?
Sitzordnungen und die Frage, welcher Musiker wo sitzt
Teil IV: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 17: Zehn häufig gestellte Fragen zum Thema Musiktheorie
Warum ist Musiktheorie so wichtig?
Ich mache bereits Musik – ohne theoretisches Wissen! Wozu sollte ich mich jetzt noch damit herumärgern?
Warum taucht in Musiktheorie-Büchern immer wieder die Klaviatur auf? Ich spiele doch gar kein Klavier!
Gibt es eine Blitzmethode, um Noten lesen zu lernen?
Wie erkenne ich eine Tonart an den Vorzeichen?
Lässt sich ein Musikstück in einer anderen Tonart spielen?
Wenn ich zu viel über Musiktheorie weiß, kann ich dann überhaupt noch anständig improvisieren?
Kann ich mit der Theorie auch als Schlagzeuger etwas anfangen?
Wieso ausgerechnet zwölf Töne?
Wie hilft mir die Musiktheorie dabei, mir ein Musikstück besser einzuprägen?
Kapitel 18: Zehn Musiktheoretiker, die Sie kennen sollten
Pythagoras (582–507 v. Chr.)
Boethius (480–524)
Gerbert von Aurillac/Papst Sylvester II (950–1003)
Guido von Arezzo (990–1040)
Nicola Vicentino (1511–1576)
Christiaan Huygens (1629–1695)
Arnold Schönberg (1874–1951)
Harry Partch (1901–1974)
Karlheinz Stockhausen (1928–2007)
Robert Moog (1934–2005)
Teil V: Anhang
Anhang A: Musikbeispiele zum Buch
Anhang B: Grifftabellen für Akkorde
Anhang C: Glossary
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 6
Tabelle 6.1: Die im deutschen Sprachraum übliche Bezeichnung der Stammtöne und T...
Kapitel 7
Tabelle 7.1: Die 15 Tonleitern, wie sie von Gitarristen und Pianisten verwendet ...
Tabelle 7.2: Die verschiedenen Molltonleitern für sämtliche Tonarten, wie Gitarr...
Tabelle 7.3: Die Kirchentonarten
Kapitel 9
Tabelle 9.1: Sämtliche Intervalle von der Prime bis zur Oktave
Tabelle 9.2: Die Intervalle in der C-Dur-Tonleiter, bezogen auf den Grundton
Kapitel 10
Tabelle 10.1: Wie man Dreiklänge durch das Aufeinanderschichten von Terzen aufba...
Tabelle 10.2: Die Dreiklänge und ihre Stufen in der jeweils passenden Tonleiter
Tabelle 10.3: Wie man Septakkorde durch das Aufeinanderschichten von Terzen aufb...
Tabelle 10.4: Die Septakkorde und ihre Stufen in der jeweils passenden Tonleiter
Kapitel 11
Tabelle 11.1: Die gängigsten Akkordtypen und ihre Bezeichnung mit römischen Ziffe...
Tabelle 11.2: Die gängigsten Akkordfolgen in Dur
Tabelle 11.3: Die gängigsten Akkordfolgen in Moll
Tabelle 11.4: Bezeichnungen und Symbole der Septakkorde
Tabelle 11.5: Dur- und Molldreiklänge und Septakkorde samt ihren Stufen
Kapitel 15
Tabelle 15.1: Gängige Tempobezeichnungen
Tabelle 15.2: Die gängigsten Dynamikbezeichnungen
Tabelle 15.3: Graduelle Veränderungen der Lautstärke
Tabelle 15.4: Artikulationsbezeichnungen für verschiedene Instrumente
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Links eine ganze Note (ohne Hals, ohne Fähnchen), da...
Abbildung 2.2: Aufeinanderfolgende Achtelnoten kann man der Einfachheit halber du...
Abbildung 2.3: Sechzehntelnoten haben zwei Fähnchen, und man verbindet sie mit Do...
Abbildung 2.4: Auch Zweiunddreißigstelnoten lassen sich in Gruppen zusammenfassen...
Abbildung 2.5: Der »Notenbaum«. Beim Spielen hat jede der fünf Ebenen die gleiche...
Abbildung 2.6: Eine ganze Note besteht aus einem hohlen Kopf ohne H...
Abbildung 2.7: Drei ganze Noten hintereinander – aber jede umfasst vier Viertel.
Abbildung 2.8: Die Brevis (Doppelganze) umfasst acht Viertel.
Abbildung 2.9: Eine halbe Note erklingt halb so lang wie eine ganze Note.
Abbildung 2.10: Eine ganze Note, gefolgt von zwei halben Noten
Abbildung 2.11: Diese vier Viertelnoten bilden je einen Taktschlag (eine Zählzeit...
Abbildung 2.12: Die Abfolge von ganzen, halben und Viertelnoten kann natürlich va...
Abbildung 2.13: Achtelnoten sind ausgefüllt, haben einen Hals und ein Fähnchen. A...
Abbildung 2.14: Eine Sechzehntelnote dauert halb so lang wie eine ...
Abbildung 2.15: Eine Zweiunddreißigstelnote hat drei Fähnchen am Hals und den hal...
Abbildung 2.16: Ein Punkt verlängert eine Note immer umdie Hälfte ihres ursprüngl...
Abbildung 2.17: Zwei durch einen Haltebogen verbundene Viertelnoten entsprechen d...
Abbildung 2.18: Übung 1
Abbildung 2.19: Übung 2
Abbildung 2.20: Übung 3
Abbildung 2.21: Übung 4
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Der »Pausenbaum« verrät uns genau, welchem Notenwert jede Pause en...
Abbildung 3.2: Eine ganze Pause »hängt« an der Notenlinie undsieht aus wie ein Hu...
Abbildung 3.3: Dem Symbol für eine doppelte Pause werden Sie nurselten oder viell...
Abbildung 3.4: Eine halbe Pause dauert halb so lang wie eine ganze Pause und gena...
Abbildung 3.5: Übungsbeispiel
Abbildung 3.6: Die Viertelpause bedeutet, ein Viertel lang stillzuh...
Abbildung 3.7: Übungsbeispiel
Abbildung 3.8: Symbol für eine Achtelpause: ein Stiel mit einem Fähnchen
Abbildung 3.9: Eine Sechzehntelpause hat zwei Fähnchen –genau wie die Sechzehntel...
Abbildung 3.10: Eine Zweiunddreißigstelpause hat drei Fähnchen.
Abbildung 3.11: Eine halbe Pause mit einem Punkt dahinter entspricht einer Dreivi...
Abbildung 3.12: Übung 1
Abbildung 3.13: Übung 2
Abbildung 3.14: Übung 3
Abbildung 3.15: Übung 4
Abbildung 3.16: Übung 5
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Drei typische Taktarten – der Dreivierteltakt, der Viervierteltakt
Abbildung 4.2: Beispiel für einen Dreivierteltakt. Jede Takteinheit besteht aus g...
Abbildung 4.3: Das Diagramm besteht aus drei Ebenen, deren Gesamtnotenwerte einan...
Abbildung 4.4: Der 4/4-Takt gehört zu den einfachen Taktarten.
Abbildung 4.5: Auch der 3/4-Takt gehört zu den einfachen Taktarten.
Abbildung 4.6: Auch der 3/8-Takt gehört zu den einfachen Taktarten.
Abbildung 4.7: Beim 2/2-Takt besteht jede Takteinheit aus zwei Schl...
Abbildung 4.8: Übung 1
Abbildung 4.9: Übung 2
Abbildung 4.11: Übung 4
Abbildung 4.10: Übung 3
Abbildung 4.12: Übung 5
Abbildung 4.13: Der 6/8-Takt als Beispiel für eine zusammengesetzte ungerade Takt...
Abbildung 4.14: Bei zusammengesetzten ungeraden Taktarten bestehen die Noten aus ...
Abbildung 4.15: Ein Musikbeispiel im 6/8-Takt. Hier müssen Sie jeweils die erste ...
Abbildung 4.16: Der 9/4-Takt als Beispiel für eine zusammengesetzt...
Abbildung 4.17: Übung 1
Abbildung 4.18: Übung 2
Abbildung 4.19: Übung 3
Abbildung 4.20: Ein Beispiel im 5/4-Takt. Die Betonung liegt auf den Taktschlägen...
Abbildung 4.21: Auch in diesem Beispiel für einen 5/8-Takt liegt die Betonung auf...
Abbildung 4.22: Ein Beispiel im 7/4-Takt. Die Betonung liegt auf den Zählzeiten e...
Abbildung 4.23: Ein Beispiel im 7/8-Takt. Die Betonung liegt auf den Zählzeiten e...
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Ein Takt mit Synkope
Abbildung 5.2: Diese beiden Takte sehen zwar kompliziert aus – aber Synkopen enth...
Abbildung 5.3: Zweimal ein Beispiel dafür, wie die Platzierung einer Note zu eine...
Abbildung 5.4: Vor dem ersten vollständigen Takt dieses Beispiels sehen Sie hier ...
Abbildung 5.5: Der letzte Takt unseres Songs hat nur zwei Schläge – diese ergänze...
Abbildung 5.6: Wenn man eine Viertelnote in drei gleich lange Noten aufteilt, erh...
Abbildung 5.7: Ein Stück, das sowohl normale Viertelnoten als auch Triolen enthäl...
Abbildung 5.8: Eine Duole hat den gleichen Notenwert wie die punktierte Note, für...
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Links der Violinschlüssel, rechts der Bassschlüssel
Abbildung 6.2: Der Violinschlüssel hat seinen »Bauch« auf der zweit...
Abbildung 6.3: Die Noten des Violin- oder G-Schlüssels
Abbildung 6.4: Auf der Linie zwischen den beiden Punkten beim Basss...
Abbildung 6.5: Die Noten des Bass- oder F-Schlüssels
Abbildung 6.6: Die Akkolade besteht sowohl aus Violin- als auch Bassschlüssel – d...
Abbildung 6.7: Altschlüssel (oben) und Tenorschlüssel (unten). Durch die untersch...
Abbildung 6.8: Sie sehen hier den Ton E auf der Klaviatur. Um einen Halbton tiefe...
Abbildung 6.9: Wenn Sie die dicke E-Saite im dritten Bund drücken und anschlagen,...
Abbildung 6.10: Hier wechseln Sie – genau umgekehrt wie im letzten Beispiel – auf...
Abbildung 6.11: Wenn wir vom Ausgangston E die Hand um einen Ganzton (oder zwei H...
Abbildung 6.12: Ein Ganztonschritt (beziehungsweise zwei Halbtonschritte) auf dem...
Abbildung 6.13: Das Erhöhungszeichen ist ein Kreuzsymbol und sieht aus wie das Nu...
Abbildung 6.14: Ein erhöhtes A wird zum Ais und findet sich im Notensystem auf de...
Abbildung 6.15: Ein erhöhtes E wird zum Eis und findet sich auf de...
Abbildung 6.16: Das Erniedrigungszeichen
Abbildung 6.17: Ein erniedrigtes A wird zum As.
Abbildung 6.18: Ein erniedrigtes E wird zum Es.
Abbildung 6.19: Ein Doppelkreuz (doppeltes Erhöhungszeichen) sieht...
Abbildung 6.20: Die Note auf der dritten Linie im Violinschlüssel ...
Abbildung 6.21: Die Töne der Klaviatur dargestellt an den Noten der Akkolade
Abbildung 6.22: Die ersten vier Gitarrenbünde. Ganz links sehen Sie die Bezeichnu...
Abbildung 6.23: Die Töne auf Bund 5 bis 9 auf dem Gitarrengriffbrett
Abbildung 6.24: Die Töne auf Bund 10 bis 14 auf dem Gitarrengriffbrett
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Die C-Dur-Tonleiter folgt, wie alle anderen Durtonleitern, dem Mus...
Abbildung 7.2: Dieses Durtonleiter-Muster funktioniert auf dem Gitarrenhals sowoh...
Abbildung 7.3: Die Töne der natürlichen Molltonleiter auf dem Klavier
Abbildung 7.4: So spielt man die natürliche Molltonleiter auf der Gitarre.
Abbildung 7.5: Die natürliche Molltonleiter in A auf der Gitarre.
Abbildung 7.6: Die harmonische Molltonleiter in A auf dem Klavier. ...
Abbildung 7.7: Die harmonische Molltonleiter auf dem Gitarrengriffbrett – Sie seh...
Abbildung 7.8: Die harmonische Molltonleiter in A auf dem Griffbret...
Abbildung 7.9: In der melodischen Molltonleiter sind die sechste un...
Abbildung 7.10: Bei der melodischen Molltonleiter werden die sechste und siebte S...
Abbildung 7.11: Die melodische Molltonleiter in A auf dem Griffbrett der Gitarre.
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Der Quintenzirkel in seiner heutigen Form. Er veranschaulicht die ...
Abbildung 8.2: Der Quintenzirkel verrät Ihnen genau, wie viele Erhöhungs- oder Er...
Abbildung 8.3: Die Erhöhungszeichen samt ihren Nummern und ihren Positionen im Vi...
Abbildung 8.4: Die Erniedrigungszeichen samt ihren Nummern und Positionen im Viol...
Abbildung 8.5: Die Tonartvorzeichnung und Tonleiter für C-Dur
Abbildung 8.6: Die Tonartvorzeichnung und Tonleiter für a-Moll
Abbildung 8.7: Die Tonartvorzeichnung und Tonleiter für G-Dur
Abbildung 8.8: Die Tonartvorzeichnung und Tonleiter für e-Moll
Abbildung 8.9: Die Tonartvorzeichnung und Tonleiter für D-Dur
Abbildung 8.10: Die Tonartvorzeichnung und Tonleiter für h-Moll
Abbildung 8.11: Die Tonartvorzeichnung und Tonleiter für A-Dur
Abbildung 8.12: Die Tonartvorzeichnung und Tonleiter für fis-Moll
Abbildung 8.13: Die Tonartvorzeichnung und Tonleiter für E-Dur
Abbildung 8.14: Die Tonartvorzeichnung und Tonleiter für cis-Moll
Abbildung 8.15: Die Tonartvorzeichnungen und Tonleitern für H-Dur und Ces-Dur
Abbildung 8.16: Die Tonartvorzeichnungen und Tonleitern für gis-Moll und as-Moll
Abbildung 8.17: Die Tonartvorzeichnungen und Tonleitern für Fis-Dur und Ges-Dur
Abbildung 8.18: Die Tonartvorzeichnungen und Tonleitern für dis-Moll und es-Moll
Abbildung 8.19: Die Tonartvorzeichnungen und Tonleitern für Cis-Dur und Des-Dur
Abbildung 8.20: Die Tonartvorzeichnungen und Tonleitern für ais-Moll und b-Moll
Abbildung 8.21: Die Tonartvorzeichnungen und Tonleitern für As-Dur und f-Moll
Abbildung 8.22: Die Tonartvorzeichnungen und Tonleitern für Es-Dur und c-Moll
Abbildung 8.23: Die Tonartvorzeichnungen und Tonleitern für B-Dur und g-Moll
Abbildung 8.24: Die Tonartvorzeichnungen und Tonleitern für F-Dur und d-Moll
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Beim harmonischen Intervall werden zwei Töne gleichzeitig gespielt...
Abbildung 9.2: Beim melodischen Intervall werden zwei Töne hintereinander gespiel...
Abbildung 9.3: Das Intervall zwischen F und C nimmt im Notensystem fünf Linien un...
Abbildung 9.4: Das Erhöhungszeichen vor dem F ändert nichts an der Quantität des ...
Abbildung 9.5: Alle Intervalle auf einen Blick: Von links nach rechts (jeweils zw...
Abbildung 9.6: Wenn sich ein Intervall, in diesem Fall zwischen den Tönen C und E...
Abbildung 9.7: Bei allen fünf Intervallen handelt es sich um Quinten. Da sie sich...
Abbildung 9.8: Zweimal der Ton E auf der Klaviatur, genau zwölf Tasten (Halbtonsc...
Abbildung 9.9: Die beiden Töne unter den Pfeilen bilden eine übermäßige Oktave.
Abbildung 9.10: Bei den beiden Tönen unter den Pfeilen handelt es sich um eine ve...
Abbildung 9.11: So sehen reine Quarten im Notensystem aus – die einzige Ausnahme ...
Abbildung 9.12: Auf dem Klavier oder Keyboard umfasst eine reine Quarte stets vie...
Abbildung 9.13: Hier haben wir dreimal eine reine Quarte, da im zweiten und dritt...
Abbildung 9.14: Hier die drei Beispiele aus Abbildung 9.13 auf der Klaviatur dargestellt.
Abbildung 9.15: Eine reine Quinte umfasst fünf Linien und Zwischenräume.
Abbildung 9.16: Drei Beispiele für Sekunden
Abbildung 9.17: Das Intervall zwischen E und F umfasst nur einen H...
Abbildung 9.18: Das Intervall zwischen F und G ist eine große Sekunde, da es aus ...
Abbildung 9.19: Ganz links eine große Sekunde, die durch die Versetzungszeichen i...
Abbildung 9.20: Große Sekunden
Abbildung 9.21: Kleine Sekunden
Abbildung 9.22: So wird aus einer großen Sekunde (ganz links) eine...
Abbildung 9.23: Und so funktioniert das Ganze auf dem Klavier: Ans...
Abbildung 9.24: Terzen liegen immer auf benachbarten Linien oder in benachbarten ...
Abbildung 9.25: Große und kleine Terzen im Notensystem
Abbildung 9.26: So wird aus einer großen Terz (ganz links) eine kleine Terz.
Abbildung 9.27: So wird aus einer kleinen Terz (ganz links) eine große Terz.
Abbildung 9.28: So wird aus einer großen Terz (ganz links) eine übermäßige Terz.
Abbildung 9.29: So wird aus einer kleinen Terz (ganz links) eine verminderte Terz...
Abbildung 9.30: Eine kleine und eine große Sexte
Abbildung 9.31: Eine kleine und eine große Septime
Abbildung 9.32: Die obere und untere Oktave der Note G im Violin- und Bassschlüss...
Abbildung 9.33: Um eine reine Quinte über dem Ton As zu bilden, müssen Sie zunäch...
Abbildung 9.34: Um eine reine Quinte zu erhalten, müssen beide Töne um den gleich...
Abbildung 9.35: Eine Quinte unter dem Ausgangston A
Abbildung 9.36: Durch das Erniedrigungszeichen vor dem D wird dieses Intervall zu...
Abbildung 9.37: Durch das Erniedrigungszeichen wird das Intervall A-E von einer r...
Abbildung 9.38: Die Intervalle innerhalb der C-Dur-Tonleiter
Abbildung 9.39: Komplementärintervalle
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Zwei Terzenschichtungen – einmal mit Linien- und einmal mit Zwisc...
Abbildung 10.2: Zweimal der Ton C im Liniensystem – beide können zum Grundton ein...
Abbildung 10.3: Der Grundton und die große Terz eines C-Dur-Akkords in verschiede...
Abbildung 10.4: Grundton und Quinte eines C-Dur-Akkords in zwei verschiedenen Lag...
Abbildung 10.5: C-Dur-Dreiklänge, in zwei verschiedenen Lagen
Abbildung 10.6: Ein C-Dur-Dreiklang auf dem Klavier oder Keyboard
Abbildung 10.7: F-Dur hat nur ein einziges Vorzeichen.
Abbildung 10.8: Die drei Töne, aus denen der F-Dur-Dreiklang besteht
Abbildung 10.9: Der As-Dur-Dreiklang
Abbildung 10.10: c-Moll auf dem Klavier oder Keyboard
Abbildung 10.11: Der c-Moll-Dreiklang im Notensystem
Abbildung 10.12: Der f-Moll-Dreiklang unterscheidet sich vom F-Dur-Dreiklang durc...
Abbildung 10.13: Der as-Moll-Dreiklang im Notensystem
Abbildung 10.14: Der übermäßige Dreiklang über C auf der Klaviatur …
Abbildung 10.15: … und im Notensystem
Abbildung 10.16: Der übermäßige Dreiklang über F
Abbildung 10.17: Der übermäßige Dreiklang über As
Abbildung 10.18: Der verminderte C-Dreiklang auf den Klaviertaste...
Abbildung 10.19: … und im Notensystem
Abbildung 10.20: Der verminderte Dreiklang über F
Abbildung 10.21: Der verminderte Dreiklang über As
Abbildung 10.22: C-Dur-Dreiklang
Abbildung 10.23: Der große C-Dur-Septakkord (C
maj7
)
Abbildung 10.24: c-Moll-Dreiklang
Abbildung 10.25: Der c-Moll-Septakkord (Cm
7
)
Abbildung 10.26: Der Dominantseptakkord über C (C
7
)
Abbildung 10.27: Der Grundton C und die kleine Septime darüber
Abbildung 10.28: Der verminderte Dreiklang über C
Abbildung 10.29: Der halbverminderte Septakkord über C (Cm
7b5
)
Abbildung 10.30: Verminderter C-Septakkord (C
dim7
)
Abbildung 10.31: c-Moll-Dreiklang
Abbildung 10.32: c-Moll-Septakkord mit großer Septime (Cm
maj7
)
Abbildung 10.33: Die Dreiklänge und Septakkorde für A
Abbildung 10.34: Die Dreiklänge und Septakkorde für As
Abbildung 10.35: Die Dreiklänge und Septakkorde für H
Abbildung 10.36: Die Dreiklänge und Septakkorde für B
Abbildung 10.37: Die Dreiklänge und Septakkorde für C
Abbildung 10.38: Die Dreiklänge und Septakkorde für Ces
Abbildung 10.39: Die Dreiklänge und Septakkorde für Cis
Abbildung 10.40: Die Dreiklänge und Septakkorde für D
Abbildung 10.41: Die Dreiklänge und Septakkorde für Des
Abbildung 10.42: Die Dreiklänge und Septakkorde für E
Abbildung 10.43: Die Dreiklänge und Septakkorde für Es
Abbildung 10.44: Die Dreiklänge und Septakkorde für F
Abbildung 10.45: Die Dreiklänge und Septakkorde für Fis
Abbildung 10.46: Die Dreiklänge und Septakkorde für G
Abbildung 10.47: Die Dreiklänge und Septakkorde für Ges
Abbildung 10.48: Der C-Dur-Dreiklang in der engen Lage
Abbildung 10.49: Der C-Dur-Dreiklang in einer weiten Lage
Abbildung 10.50: C-Dur-Dreiklang in der ersten Umkehrung, sowohl in enger als auc...
Abbildung 10.51: C-Dur-Dreiklang in der zweiten Umkehrung, sowohl in enger als au...
Abbildung 10.52: Ein C
maj7
-Akkord in der dritten Umkehrung, sowohl in enger als a...
Abbildung 10.53: Drei Akkordumkehrungen
Abbildung 10.54: Wie aus einer Akkordumkehrung wieder eine Reihe von aufeinanderf...
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Die a-Moll-Tonleiter inklusive der alterierten Stufen aus der har...
Abbildung 11.2: Die Dreiklänge auf den Stufen der C-Dur-Tonleiter
Abbildung 11.3: Die in der Tonart C-Dur enthaltenen Dreiklänge mit ihren Akkordsy...
Abbildung 11.4: Die in der Tonart Es-Dur enthaltenen Dreiklänge mit ihren Akkords...
Abbildung 11.5: Sämtliche Dreiklänge, die innerhalb der Tonart c-Moll möglich sin...
Abbildung 11.6: Die am häufigsten vorkommenden Dreiklänge in c-Moll
Abbildung 11.7: Dieses Symbol verrät Ihnen, dass Sie es mit einem halbverminderte...
Abbildung 11.8: Die Septakkorde auf den Stufen der Tonart C-Dur
Abbildung 11.9: Die Septakkorde auf den Stufen der Tonart c-Moll
Abbildung 11.10: Die ersten sieben Takte von »London Bridge«
Abbildung 11.11: Wie Sie sehen können, kehrt der Song zu Akkord I zurück.
Abbildung 11.12: Leadsheet für den Song »Scarborough Fair«
Abbildung 11.13: Beispiel für ein Leadsheet
Abbildung 11.14: Tabulatur (Tab) für den E-Dur-Akkord auf der Gitarre
Abbildung 11.15: Ein vollkommener Ganzschluss in C-Dur mit vorgeschalteter zweite...
Abbildung 11.16: Der Unterschied zwischen vollkommenem (VG) und u...
Abbildung 11.17: Plagale Kadenz in »Amazing Grace«
Abbildung 11.18: Zwei weitere Beispiele für plagale Kadenzen
Abbildung 11.19: Beispiel für einen Trugschluss in C-Dur (statt der Tonika erklin...
Abbildung 11.20: Halbschlüsse klingen irgendwie unvollendet.
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Die bogenförmige Kontur: Die Tonhöhen steigen zuerst an, dann wie...
Abbildung 12.2: Bei der wellenförmigen Kontur steigen die Tonhöhen abwechselnd au...
Abbildung 12.3: Die umgekehrte Bogenkontur: Diesmal sinken die Tonhöhen erst, dan...
Abbildung 12.4: Bei der kreisförmigen Kontur steht ein bestimmter Ton im Zentrum ...
Abbildung 12.5: Eine einfache Melodielinie in der Tonart C-Dur
Abbildung 12.6: Eine Bassstimme zu einer Melodielinie in der Tonart C-Dur
Abbildung 12.7: Ein Phrasierungsbogen in der Unterstimme eines Klavierstücks
Abbildung 12.8: Eine musikalische Periode besteht aus miteinander verbundenen Phr...
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Ein Beispiel aus Johann Sebastian Bachs Choralsatz »Aus meines He...
Abbildung 13.2: Ausschnitt aus dem Hauptthema in der Exposition de...
Abbildung 13.3: Ausschnitt aus dem Seitenthema des ersten Satzes d...
Abbildung 13.4: Ausschnitt aus der Durchführung des ersten Satzes von Beethovens ...
Abbildung 13.5: Ausschnitt aus der Reprise des ersten Satzes von Beethovens Sonat...
Abbildung 13.6: Ausschnitt vom Beginn (A-Teil) des dritten Satzes »Rondo Alla Tur...
Abbildung 13.7: Ausschnitt aus Bachs Fuge in C-Dur BWV 952, Takt 3 bis 11
Abbildung 13.8: Der Beginn des ersten Satzes von Beethovens fünfter Sinfonie in c...
Kapitel 15
Abbildung 15.1: Die Angabe »Allegro« über der Taktvorzeichnung legt ein schnelles...
Abbildung 15.2: Die Dynamikbezeichnungen verraten dem Musiker hier, dass er den e...
Abbildung 15.3: Beispiel für ein Crescendo – man steigert die Lautstärke immer me...
Abbildung 15.4: Beispiel für ein Diminuendo – man reduziert die Lautstärke immer ...
Abbildung 15.5: Binde- und Haltebögen in einer Passage aus dem Lied »O sole mio«
Abbildung 15.6: So sehen wir auf dem Notenblatt, wann wir das rechte Pedal benutz...
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autoren
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Anhang A: Musikbeispiele zum Buch
Anhang B: Grifftabellen für Akkorde
Anhang C: Glossary
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
5
6
7
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
195
196
197
198
199
200
201
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
237
238
239
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
283
284
285
286
Einführung
Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Musiktheorie hören? Fällt Ihnen da Ihre Musiklehrerin ein, die hinter ihrem Klavier saß und Sie kritisch beäugte? Oder erinnern Sie sich vielleicht an Mitschüler, die Theoriekurse belegten, in denen sie angestrengt versuchten, eine erklingende Tonfolge in Notenschrift umzuwandeln? Falls irgendeines dieser (oder ähnlicher) Bilder vor Ihrem geistigen Auge entsteht, wenn Sie das Wort Musiktheorie hören, dann dürfte dieses Buch für Sie eine angenehme Überraschung sein.
Viele »Musikanfänger« empfinden Musiktheorie als abschreckend und sagen sich: »Wozu der ganze Ballast? Ich kann doch Tabulaturen lesen und damit ebenfalls ganz gut Gitarre spielen! Weshalb soll ich mich jetzt auch noch mit Theorie herumschlagen?«
Dafür gibt es gute Gründe: Selbst wenn Sie sich nur ein wenig Grundwissen über Musiktheorie aneignen, hilft Ihnen das bereits dabei, Ihre Bandbreite als Musiker zu vergrößern und vor allem auch zu wissen, was Sie tun, wenn Sie spielen. Sie lernen zum Beispiel, Noten zu lesen – und schon stehen Ihnen völlig neue Musikrichtungen zur Verfügung, auf die Sie bisher verzichten mussten. Oder Sie lernen, wie Akkorde aufgebaut sind – und schon verfügen Sie über einige Grundvoraussetzungen, um Ihre eigene Musik zu komponieren.
Über dieses Buch
In Musiktheorie für Dummies werden Sie Schritt für Schritt alles lernen, um beim Spielen den Rhythmus gut einzuhalten oder Notenblätter nicht mehr als böhmische Dörfer zu empfinden. Sie werden ein Gespür dafür entwickeln, in welche Richtung ein Song sich entwickelt – egal ob Sie nun das Stück eines anderen nachspielen oder selbst etwas komponieren.
Sie müssen das Buch nicht unbedingt von vorne bis hinten durchackern. Es ist so aufgebaut, dass Sie nicht Kapitel 1 bis 4 studiert haben müssen, um Kapitel 5 zu verstehen. Sie können also getrost »hin und herspringen« – je nachdem, worüber Sie sich gerade schlaumachen wollen. Es von vorne bis hinten zu lesen hat allerdings auch seine Vorzüge – weil Sie dann vom einfachsten Anfängerwissen zu schwierigeren Dingen fortschreiten und Musik noch besser verstehen werden.
Wir werden so ziemlich jedes Thema besprechen, das für jemanden wichtig ist, der Musik machen will. Wir werden uns mit Notenwerten und Taktarten beschäftigen; wir werden lernen, wie Akkorde aufgebaut sind und wie man sie mit Melodien kombiniert; wir werden die Standardformen sowohl der modernen als auch der klassischen Musik genau unter die Lupe nehmen. Wenn Sie also gerade anfangen, sich mit Musiktheorie zu beschäftigen, sollten Sie schrittweise vorgehen. Am besten, Sie setzen sich beim Lesen ans Klavier oder nehmen die Gitarre (oder welches Instrument auch immer) zur Hand und versuchen alles, was Sie gelernt haben, sofort in die Praxis umzusetzen. Und denken Sie immer daran: Alles braucht seine Zeit. Im Musikunterricht an der Schule würde dieses Buch Stoff für mehrere Jahre hergeben. Setzen Sie sich also nicht unter Druck. Gut Ding will Weile haben.
Konventionen in diesem Buch
Wir halten uns in diesem Buch an ein paar feste Regeln, die Ihnen dabei helfen sollen, den Lernstoff für sich zu organisieren:
Wenn wir einen neuen Begriff einführen, setzen wir ihn
kursiv
.
Schlüsselbegriffe oder Überbegriffe in Listen setzen wir in
fetter
Schrift.
Was Sie nicht lesen müssen
In den grau hinterlegten Textkästen oder unter dem Icon für »Technische Hinweise« werden Sie manchmal geschichtliche Informationen oder Zitate von großen Musikern finden, die Sie vielleicht interessieren – vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall: Sie müssen nicht wissen, warum das Klavier das Lieblingsinstrument der meisten Komponisten ist oder aus welcher Sprache sich Begriffe wie »Dur« oder »Moll« ableiten, um auch den Rest des Buches zu verstehen. Wir haben diese Informationen einfach beigefügt, weil sie den Lehrstoff vielleicht etwas auflockern. Aber merken müssen Sie sich das nur, wenn Sie selbst wollen oder es für eine Prüfung brauchen. Wir jedenfalls werden nicht vor Ihrer Haustür auftauchen, um Sie abzufragen.
Törichte Annahmen über den Leser
Wir gehen mal davon aus, dass Sie als Leser dieses Buches Musik lieben, dass Sie unbedingt wissen wollen, wie Musik funktioniert, und dass Sie ganz wild darauf sind, zu erfahren, wie man einem Stück das richtige Timing und das perfekte Arrangement verleiht. Zumindest hoffen wir, dass bei Ihnen ein paar Notenblätter herumliegen, mit denen Sie bisher so gar nicht klargekommen sind, oder dass in einer Ecke Ihres Wohnzimmers ein altes Klavier steht, mit dem Sie es nach vielen Fehlversuchen mal wieder aufnehmen wollen.
Mal ehrlich – als Leser dieses Buches sollten Sie zumindest zu einer der folgenden Kategorien gehören:
Blutige Anfänger:
Wir haben dieses Buch für Musik-Einsteiger geschrieben, die erst mal lernen wollen, wie man Noten liest und Rhythmen klopft, bis sie irgendwann versuchen, selbst etwas zu komponieren – und dabei ihr Musiktheorie-Wissen zum Einsatz bringen. Anfänger sollten deshalb mit
Teil I
anfangen und Kapitel für Kapitel durcharbeiten, bis sie irgendwann merken: Oh, das war ja schon die letzte Seite. Die Reihenfolge der Themen in diesem Buch orientiert sich an der Didaktik des Musikunterrichts an der Schule.
»Abgebrochene« Musikschüler:
Das Buch eignet sich auch bestens für Leute, die in ihrer Jugend mal ein Instrument gelernt haben und noch immer wissen, wie man Noten liest – sich aber trotzdem nie mit dem Aufbau von Tonleitern und dem Improvisieren beschäftigen mussten und auch noch nie eine Jamsession mit anderen Musikern abgehalten haben. In diese Kategorie fallen mit Sicherheit viele Leser, und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie mithilfe dieses Buches die Freude am Spielen und an der Musik zurückgewinnen. Denn hier geht es nicht nur darum, sich sklavisch an ein Notenblatt zu halten, hier erhalten Sie auch Hinweise dazu, wie man selbst improvisiert und komponiert.
Erfahrene Performer:
Es gibt eine Menge Leute, die selbst Musik machen und auch schon vor Publikum aufgetreten sind, aber trotzdem die Details der Notenschrift noch nicht ergründet haben – auch für sie eignet sich dieses Buch ganz hervorragend. Falls diese Beschreibung auf Sie zutrifft, fangen Sie am besten mit
Teil I
an, denn dort geht es um die Grundlagen der Notenschrift, Notenwerte, Pausenwerte und so weiter. Sollten Sie aber bereits wissen, was Viertelnoten, Achtelnoten etc. sind, können Sie auch sofort bei
Teil II
einsteigen. Dort lernen Sie nämlich, wie man das gesamte Wissen um Noten, Tonleitern und so weiter praktisch anwenden kann – sowohl auf dem Klavier als auch auf der Gitarre.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Musiktheorie für Dummies gliedert sich in fünf Teile. In den ersten drei Teilen geht es jeweils um einen bestimmten Aspekt zum Thema Musik. Im vierten Teil – dem Top-Ten-Teil – lernen Sie dann einige interessante und kuriose Dinge über Musiktheorie kennen, die mit dem eigenen Spielen oder Komponieren nur am Rande zu tun haben. Im fünften Teil des Buches – er besteht aus drei Anhängen – erfahren Sie schließlich, welche Tonbeispiele Sie als Download unter www.downloads.fuer-dummies.de finden; außerdem finden Sie einen Überblick über Akkordgriffe auf dem Klavier und auf der Gitarre, gefolgt von einem Glossar. Auf diese Weise werden Sie immer sehr schnell finden, was Sie gerade suchen. Schließlich ist das Buch auch als Nachschlagewerk gedacht, und es gibt nichts Nervigeres, als ewig herumblättern zu müssen, um einen bestimmten Suchbegriff zu finden. Hier eine kurze Übersicht, was Sie in den einzelnen Buchteilen erwartet:
Teil I: Der richtige Einstieg in die Musiktheorie
Wir beginnen in Teil I