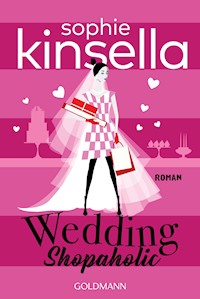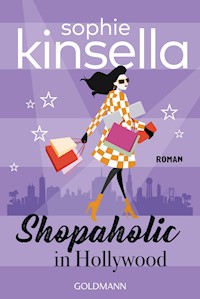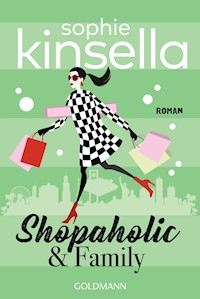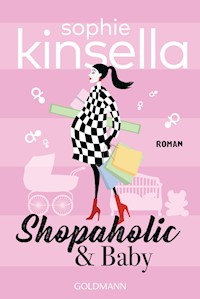2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sylvie und Dan sind seit zehn Jahren zusammen. Sie führen eine glückliche Ehe, haben zwei Kinder, ein hübsches Zuhause und wissen stets, was der andere denkt. Beim jährlichen Check-up-Termin prognostiziert ihr Hausarzt außerdem hocherfreut: Beide sind so kerngesund, dass sie sich bestimmt noch auf 68 gemeinsame Jahre freuen können. Erfreulich? Sylvie und Dan packt die blanke Panik. Wie zum Kuckuck sollen sie diese Ewigkeit überstehen, ohne einander zu langweilen? Sie beschließen, sich gegenseitig im Alltag zu überraschen. Doch das ist leichter gesagt als getan ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Sylvie und Dan sind seit zehn Jahren zusammen. Sie führen eine glückliche Ehe, sind Eltern eines bezaubernden Zwillingspaars, wohnen in ihrem Traumhaus und wissen stets, was der andere denkt. Beim jährlichen Check-up-Termin prognostiziert ihr Hausarzt außerdem hocherfreut: Beide sind so kerngesund, dass sie sich noch auf weitere 68 gemeinsame Jahre freuen können. Erfreulich? Wer konnte denn ahnen, dass mit »bis dass der Tod uns scheidet« noch weitere sieben Jahrzehnte gemeint sind? Wie zum Kuckuck sollen sie diese Ewigkeit zusammen überstehen? Ein Plan muss her, damit ihre Beziehung spannend bleibt und überdauert: Sylvie und Dan wollen einander immer wieder überraschen. Doch nicht nur gehen diese Überraschungen gehörig schief, es kommen auch Geheimnisse ans Licht, die ihre Ehe in ihren Grundfesten erschüttert. Und plötzlich müssen sie sich fragen, ob sie sich wirklich so gut kennen, wie sie immer dachten …
Weitere Informationen zu Sophie Kinsellasowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Sophie Kinsella
_________________
Muss es denn gleich für immer sein?
Roman
Aus dem Englischenvon Jörn Ingwersen
Die englische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Surprise me« bei Bantam Press, London, an imprint of Transworld Publishers.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung August 2018
Copyright © der Originalausgabe by Sophie Kinsella
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: © FAVORITBÜRO, München
Umschlagmotiv: © Julenochek/Rasstock/gowithstock/wacpan/Shutterstock.com
Redaktion: Kerstin Ingwersen
MR· Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-22607-7V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
für Henry
»Die Wahrscheinlichkeit, dass Zwanzigjährige 100 werden, ist heute dreimal so hoch wie bei ihren Großeltern und doppelt so hoch wie bei den Eltern.«
National Statistics Report 2011
»Die dramatische Geschwindigkeit, mit der sich die Lebenserwartung verändert, bedeutet, dass wir unsere Vorstellung von unserem späteren Leben radikal überdenken müssen …«
Sir Steven Webb, Britischer Minister für Renten 2010–2015
PROLOG
Ich habe so ein kleines Geheimvokabular für meinen Mann. Ausgedachte Worte, die ihn gut beschreiben. Er selbst weiß nichts davon. Hin und wieder fallen mir einfach Worte ein. Zum Beispiel …
Fragsam: wie er so süß das Gesicht verzieht, wenn er verwirrt ist, mit hochgezogenen Augenbrauen und forschendem Blick, als wollte er sagen: »Das erklär mir mal!« Dan ist nicht gern verwirrt. Er mag es eindeutig. Geradeaus. Klar und deutlich.
Neinisch: wenn er sich so verspannt, als müsste er sich verteidigen, sobald das Thema auf meinen Vater kommt. (Er denkt, ich merke es nicht.)
Geufft: wenn das Leben so hart zugeschlagen hat, dass ihm buchstäblich die Luft wegbleibt.
Im Grunde ist es ein Allzweckwort. Es könnte auf jeden zutreffen, auch auf mich. In diesem Moment trifft es auf mich zu. Denn genau das bin ich. Ich bin geufft. Meine Lungen sind wie erfroren. Meine Wangen kribbeln. Ich fühle mich wie in einer Vorabendserie, denn erstens schleiche ich in Dans Büro herum, zweitens ist er nicht da und weiß auch nichts von dem, was ich hier treibe, drittens habe ich eine geheime Schublade in seinem Schreibtisch geöffnet und kann viertens nicht glauben, was ich gefunden habe, was ich hier in der Hand halte.
Schwer atmend starre ich es an. Mein Hirn ruft mir panische Botschaften zu, etwa: Wie bitte? Und: Soll das heißen …? Und: Bitte nicht! Das kann nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein!
Und am schlimmsten: Hatte Tilda etwa von Anfang an recht? Habe ich mir das alles selbst zuzuschreiben?
Ich merke, dass mir die Tränen kommen und Fassungslosigkeit von mir Besitz ergreift. Und Angst. Ich bin nicht sicher, was überwiegt. Oder eigentlich doch. Die Fassungslosigkeit wiegt schwerer und verbündet sich mit Zorn. »Ist das dein Ernst?« Mir ist zum Schreien zumute. »Ist das wirklich dein Ernst, Dan?«
Aber ich tue es nicht. Ich mache nur ein paar Fotos mit meinem Handy, weil … na ja, zur Sicherheit. Kann man vielleicht brauchen. Dann lege ich das, was ich gefunden habe, wieder zurück, schließe die Schublade, verriegle sie sorgfältig, ziehe zur Sicherheit noch mal daran (ich bin ein klein wenig zwanghaft, was abgeschlossene Türen, ausgestellte Waschmaschinen und so was angeht. Ist keine große Sache, ich bin nicht verrückt, nur ein bisschen … na, ihr wisst schon) und schleiche mich davon.
Ich dachte, ich wüsste alles über meinen Mann und er wüsste alles über mich. Ich habe ihn bei Oben weinen sehen. Ich habe ihn im Schlaf »Ich werde dich vernichten!« rufen hören. Er hat mich gesehen, wie ich im Urlaub meine Höschen gewaschen habe (weil es im Hotel so unfassbar teuer war, sie in die Wäscherei zu geben), und er hat sie sogar für mich zum Trocknen aufgehängt.
Wir waren immer das Paar. Verflochten. Verschmolzen. Wir konnten die Gedanken des anderen lesen. Wir beendeten gegenseitig unsere Sätze. Ich hätte nicht gedacht, dass wir einander noch überraschen könnten.
Tja, da sieht man mal, wie wenig ich wusste.
KAPITEL EINS
FÜNFWOCHENZUVOR
Es beginnt an unserem zehnten Jahrestag. Wer hätte das gedacht?
Eigentlich stellen sich zwei Fragen: 1.) Wer hätte gedacht, dass es an einem derart vielversprechenden Tag losgeht? Und 2.) Wer hätte gedacht, dass wir überhaupt zehn Jahre durchhalten?
Wenn ich zehn Jahre sage, meine ich nicht seit unserer Hochzeit. Ich meine zehn Jahre seit unserer ersten Begegnung. Es war auf der Geburtstagsparty meiner Freundin Alison. Das war der Tag, der unser Leben für immer verändert hat. Dan stand hinterm Grill, ich bat ihn um einen Burger und … bamm.
Also, nicht bamm wie »Liebe auf den ersten Blick«. Eher bamm wie in »Wow. Diese Augen! Diese Arme! Der Typ gefällt mir.« Er trug eine Schürze und ein blaues T-Shirt, das seine Augen hervorhob, und er wendete die Burger mit großem Geschick. Er wusste, was er tat. Wie der Burger King persönlich.
Das Komische ist, dass ich nie gedacht hätte, Geschicklichkeit beim Burger-Wenden könnte eines Tages etwas sein, das ich mir von einem Mann erhoffte. Und doch war es so.
Während ich ihm so dabei zusah, wie er freundlich lächelnd den Grill bediente … nun, ich war beeindruckt.
Also ging ich zu Alison, um zu fragen, wer das war (»alter Freund von der Uni, macht in Immobilien, netter Typ«), und dann flirtete ich noch ein bisschen mit ihm. Als das nichts brachte, überredete ich Alison, uns beide gemeinsam zum Abendessen einzuladen. Und als auch das zu keinem Ergebnis führen wollte, bin ich ihm »zufällig« in der City über den Weg gelaufen, zweimal, das eine Mal im tief ausgeschnittenen Top (fast etwas nuttig, aber ich wusste mir anders nicht mehr zu helfen). Und dann endlich, endlich, nahm er mich wahr und fragte, ob wir uns nicht mal treffen wollten, und es war Liebe auf den – sagen wir – fünften Blick.
Zu seiner Ehrenrettung muss man sagen, dass er (behauptet er zumindest) eine Trennung zu verarbeiten hatte und nicht wirklich »auf der Suche« war.
Außerdem modifizieren wir diese Geschichte leicht, wenn wir sie anderen Leuten erzählen. Zum Beispiel das mit dem nuttigen Ausschnitt. Das muss ja nicht jeder wissen.
Wie dem auch sei. Spulen wir zurück zu dem Moment, als sich unsere Blicke trafen, als alles begann. Einer dieser schicksalhaften Momente, die dein ganzes Leben beeinflussen. Ein denkwürdiger Augenblick. Ein Augenblick, den man ein Jahrzehnt später mit einem Abendessen im Lieblingsrestaurant begeht.
Wir mögen den Laden. Das Essen ist gut, und uns gefällt die Atmosphäre. Dan und ich haben viele gemeinsame Vorlieben – Filme, Stand-up-Comedians, Spaziergänge –, wobei wir allerdings auch oft genug uneins sind. Zum Beispiel wird man mich nie im Leben auf einem Rennrad antreffen. Und Dan wird man ganz sicher nie beim Weihnachtsshopping begegnen. Er hat einfach keinen Sinn fürs Schenken, und sein Geburtstag wird langsam, aber sicher zum Problem. (Ich: »Du musst dir doch irgendwas wünschen. Denk nach.« Dan (gehetzt): »Kauf mir … äh … Ich glaube, wir haben kein Pesto mehr. So was kannst du mir schenken.« Ich: »Ein Glas Pesto? Zum Geburtstag?«
Eine Frau im schwarzen Kleid führt uns zu unserem Tisch und präsentiert zwei große graue Mappen.
»Die Speisekarte ist neu«, erklärt sie. »Ihre Kellnerin wird gleich bei Ihnen sein.«
Eine neue Speisekarte! Als sie geht, blicke ich zu Dan auf und sehe das unverkennbare Blitzen in seinen Augen.
»Neue Karte«, sage ich. »Was meinst du?«
Er nickt. »Kinderspiel.«
»Aufschneider«, erwidere ich.
»Herausforderung angenommen. Hast du Papier?«
»Na klar.«
Ich habe immer Papier und Stifte dabei, denn wir spielen dieses Spiel sehr oft. Ich gebe ihm einen Kugelschreiber und reiße eine Seite aus meinem Notizbuch, dann nehme ich mir selbst Kuli und Zettel.
»Okay«, sage ich. »Auf die Plätze, fertig, los!«
Schweigend studieren wir die Speisekarte. Es gibt sowohl Brasse als auch Steinbutt, was es etwas knifflig macht … aber trotzdem – ich weiß, was Dan bestellt. Er wird versuchen, mich auszutricksen, aber ich werde ihm zuvorkommen. Ich weiß genau, wie er funktioniert, wie sein Verstand sich dreht und wendet.
»Fertig.« Dan kritzelt ein paar Worte auf seinen Zettel und faltet ihn zusammen.
»Fertig!« Ich schreibe meine Antwort auf und bin gerade dabei, meinen Zettel zu falten, als die Kellnerin wieder an unseren Tisch kommt.
»Möchten Sie etwas trinken?«
»Unbedingt, und auch essen.« Ich lächle sie an. »Ich hätte gern einen Negroni, die Muscheln und das Huhn.«
»Für mich einen Gin Tonic«, sagt Dan, als sie fertig geschrieben hat. »Außerdem nehme ich auch die Muscheln und dazu die Brasse.«
Die Kellnerin geht, und wir warten ab, bis sie außer Hörweite ist. Dann:
»Wusste ich doch!« Ich schiebe Dan meinen Zettel zu. »Auch wenn ich Gin Tonic nicht erwartet hätte. Ich dachte, du nimmst Champagner.«
»Ich hab alles richtig. Volltreffer.« Dan reicht mir seinen Zettel, und ich sehe Negroni, Muscheln, Huhn in seiner ordentlichen Handschrift.
»Verdammt!«, sage ich. »Ich dachte, du denkst, ich nehme den Hummer.«
»Mit Polenta? Ich bitte dich.« Er grinst und schenkt mir Wasser nach.
»Ich weiß aber, dass du fast Steinbutt geschrieben hättest.« Ich kann es mir nicht verkneifen, etwas anzugeben, um zu zeigen, wie gut ich ihn kenne. »Entweder das oder die Brasse, aber du bist scharf auf den Safranfenchel, den es als Beilage zur Brasse gibt.«
Dans Grinsen wird breiter. Sag ich doch!
»Übrigens«, füge ich hinzu, während ich meine Serviette ausschüttle, »habe ich gesprochen mit …«
»Oh, schön! Was hat sie …«
»Alles gut.«
»Super.« Dan nippt an seinem Wasser, und ich hake das Thema im Stillen ab.
Viele unserer Gespräche laufen so. Überlappende Sätze und halbfertige Gedanken in Kurzschrift. Ich musste nicht ausformulieren: »Ich habe mit Karen, unserer Nanny, übers Babysitten gesprochen.« Er wusste es. Nicht dass wir ernstlich Gedanken lesen können, aber oft genug ahnen wir, was der andere als Nächstes sagen wird.
»Ach, und wir müssen noch reden über meine Mum und ihre …«, sagt er und nimmt einen Schluck Wasser.
»Ich weiß. Ich dachte, wir könnten gleich durchfahren von …«
»Ja, gute Idee.«
Und wieder brauchen wir nicht auszuformulieren, dass wir noch über die Geburtstagsfeier seiner Mum reden müssen und von der Ballettstunde der Mädchen direkt dorthin fahren könnten. Wir wissen es beide. Ich reiche ihm den Korb und weiß, dass er sich eine Scheibe von dem Sauerteigbrot nimmt, nicht weil er es besonders mögen würde, sondern weil er weiß, wie gern ich Focaccia esse. So ein Mann ist Dan. Einer, der dir dein Lieblingsbrot überlässt.
Unsere Getränke kommen, und wir stoßen an. Wir sind beide ganz entspannt, denn wir haben uns den Nachmittag freigenommen. Da wir gerade die Krankenversicherung wechseln, müssen wir beide später noch zur medizinischen Untersuchung.
»Tja. Zehn Jahre.« Ich ziehe die Augenbrauen hoch. »Zehn Jahre.«
»Unglaublich.«
»Wir haben es geschafft!«
Zehn Jahre. Das ist eine echte Leistung. Fast kommt es mir vor, als hätten wir einen Berg erklommen. Immerhin ist es ein volles Jahrzehnt! Drei Umzüge, eine Hochzeit, Zwillinge, gut zwanzig Ikea-Regale … das ist praktisch ein ganzes Leben.
Und wir haben großes Glück, dass wir noch da sind, dass wir noch zusammen sind. Das weiß ich. Einige andere Paare, die sich etwa zur selben Zeit kennenlernten, hatten weniger Glück. Meine Freundin Nadia war nach drei Jahren wieder geschieden. Es funktionierte einfach nicht.
Liebevoll betrachte ich Dans Gesicht, dieses Gesicht, das ich so gut kenne: die hohen Wangenknochen, die Sommersprossen und die gesunde Gesichtsfarbe vom vielen Radfahren. Seine semmelblonden Haare. Die blauen Augen. Seine energische Ausstrahlung, selbst hier beim Essen.
Gerade wirft er einen Blick auf sein Telefon und ich einen auf meins. Bei uns gibt es keine Regel gegen Handys, wenn wir mal ausgehen, denn wer hält schon eine ganze Mahlzeit durch, ohne wenigstens einmal nach seinem Handy zu sehen?
»Oh, ich hab was für dich«, sagt er plötzlich. »Ich weiß ja, es ist kein richtiges Jubiläum, aber trotzdem …«
Er zückt ein Rechteck in Geschenkpapier, und ich weiß schon, dass es dieses Buch über effektiven Hausputz ist, das ich so gern lesen möchte.
»Wow!«, sage ich, als ich es auspacke. »Danke! Aber ich habe auch eine Kleinigkeit für dich …«
Wissend lächelt er, als er merkt, wie schwer das Päckchen ist. Dan sammelt Briefbeschwerer, also kriegt er zu jedem Geburtstag und zu besonderen Anlässen einen geschenkt. (Und dazu natürlich ein Glas Pesto.) Damit bin ich auf der sicheren Seite. Nein, nicht auf der sicheren Seite. Das klingt langweilig, und langweilig sind wir bestimmt nicht. Es ist nur … na ja. Ich weiß, er freut sich darüber. Wieso sollte ich also Geld vergeuden und ein Risiko eingehen?
»Gefällt er dir?«
»Gefällt mir sehr.« Er beugt sich vor, um mir einen Kuss zu geben, und flüstert: »Ich liebe dich.«
»Und ich dich«, flüstere ich zurück.
Um Viertel vor vier sitzen wir in der Arztpraxis, sind allerbester Dinge, so wie es einem nur geht, wenn man den Nachmittag freihat, die Kinder zum Spielen verabredet sind und man gerade gut gegessen hat.
Wir waren noch nie bei Dr. Bamford – die Versicherungsgesellschaft hat ihn ausgesucht –, und er ist eine echte Type. Zuerst einmal ruft er uns beide gleichzeitig herein, was mir ungewöhnlich vorkommt. Er misst unseren Blutdruck, stellt uns einen Haufen Fragen und sieht sich die Ergebnisse des Fitness-Tests an, dem wir uns unterziehen mussten. Dann liest er, während er unsere Formulare ausfüllt, mit theatralischer Stimme vor:
»Mrs Winter, eine charmante Dame von zweiunddreißig Jahren, ist eine Nichtraucherin mit gesundem Appetit …«
Dan wirft mir bei »gesundem Appetit« einen belustigten Blick zu, aber ich tue so, als würde ich es nicht merken. Heute ist unser Jahrestag – da ist das was anderes. Und ich musste diese mächtige Mousse au Chocolat einfach essen. Ich sehe mein Spiegelbild in einer gläsernen Vitrinentür und setze mich augenblicklich gerade hin, ziehe den Bauch ein.
Ich bin blond, mit langen, wallenden Haaren. So richtig lang. Bis zur Taille. Rapunzelmäßig. Schon als Kind hatte ich lange Haare. Ich bringe es einfach nicht übers Herz, sie abzuschneiden. Meine langen blonden Haare zeichnen mich irgendwie aus. Das bin ich. Und mein Vater liebte sie. Also.
Unsere Zwillinge sind auch blond, weshalb ich sie am liebsten in diese typisch nordischen Streifenshirts stecke und ihnen Schürzchen umbinde. Zumindest war das so, bis sie in diesem Jahr beschlossen haben, dass sie Fußball lieber mögen als alles andere, und jetzt nur noch in ihren grellen blauen Chelsea-Trikots herumlaufen wollen. Ich mache Dan keinen Vorwurf. Jedenfalls keinen großen.
»Mr Winter, ein kräftiger Mann von zweiunddreißig Jahren …« Dr. Bamford fängt an, Dans Formular vorzulesen, und ich ersticke ein Prusten. »Kräftig«. Das wird Dan gefallen.
Schließlich geht er ins Fitness-Studio. Wir beide. Aber als Muskelprotz würde man ihn nicht bezeichnen. Er ist eben … Er ist genau richtig. Für einen Mann wie Dan. Genau richtig.
»… und das wär’s auch schon. Bravo!« Mit zahnreichem Lächeln blickt Dr. Bamford auf. Er trägt ein Toupet, was mir gleich aufgefallen ist, als wir hereinkamen, aber ich gebe mir alle Mühe, nicht hinzusehen. Zu meinem Job gehört es, Sponsoren für Willoughby House, ein kleines Museum mitten in London, zu finden. Von daher habe ich oft genug mit reichen, älteren Gönnern zu tun und bekomme viele Toupets zu sehen: manche gut, manche schlecht.
Nein, das nehme ich zurück. Sie sind alle schlecht.
»Was für ein nettes, kerngesundes Paar.« Dr. Bamford klingt anerkennend, als würde er uns ein gutes Zeugnis ausstellen. »Wie lange sind Sie schon verheiratet?«
»Sieben Jahre«, erkläre ich ihm. »Und davor waren wir drei Jahre zusammen. Wir kennen uns schon seit zehn Jahren.« Verliebt drücke ich Dans Hand. »Heute sind es genau zehn Jahre!«
»Zehn Jahre ein Paar«, bestätigt Dan.
»Glückwunsch! Und sie beide haben ja einen bemerkenswerten Stammbaum.« Dr. Bamford wirft einen Blick in unsere Akte. »Alle Großeltern leben noch oder sind sehr alt geworden.«
»Das stimmt.« Dan nickt. »Meine Großeltern erfreuen sich allesamt bester Gesundheit, und Sylvie hat noch Oma und Opa, die es sich in Südfrankreich gut gehen lassen.«
»In Pernod eingelegt«, sage ich und lächle Dan an.
»Aber von vier Elternteilen leben nur noch drei?«
»Mein Vater ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen«, erkläre ich.
»Oh«, sagt Dr. Bamford voller Mitgefühl. »Ansonsten war er aber gesund?«
»Oh ja. Sehr. Und wie. Supergesund. Er war unglaublich. Er war …«
Ich kann nichts dagegen tun. Schon greife ich nach meinem Handy. Mein Vater war ein attraktiver Mann. Dr. Bamford muss ihn sehen, um ihn einschätzen zu können. Wenn ich Menschen kennenlerne, die meinem Vater nie begegnet sind, ergreift mich fast so etwas wie Zorn, dass sie ihn nie gesehen, nie diesen festen, inspirierenden Händedruck gespürt haben, dass sie nicht begreifen können, was der Welt verloren gegangen ist.
Oft genug sagten Leute, er sähe aus wie Robert Redford. Er hatte Ausstrahlung. Charisma. Er war ein Sonnyboy, auch noch als er älter wurde, aber jetzt ist er nicht mehr da. Und obwohl es schon zwei Jahre her ist, wache ich immer noch hin und wieder auf und habe es für ein paar Sekunden vergessen, bis mir die Realität wieder einen Schlag versetzt.
Dr. Bamford betrachtet das Foto von meinem Vater und mir. Es stammt aus meiner Kindheit – ich habe das Bild nach seinem Tod gefunden und mit meinem Handy abfotografiert. Wahrscheinlich hat meine Mutter es aufgenommen. Daddy und ich sitzen auf der Terrasse unseres alten Hauses, unter der Magnolie. Wir lachen über irgendeinen Witz, an den ich mich nicht erinnere, und die Sommersonne lässt unsere blonden Köpfe leuchten.
Gespannt warte ich auf Dr. Bamfords Reaktion, wünsche mir, dass er sagt: »Welch schrecklicher Verlust für die Welt! Wie halten Sie das nur aus?«
Doch das tut er natürlich nicht. Mir ist aufgefallen, dass die Reaktion üblicherweise immer verhaltener wird, je länger die Trauer andauert. Dr. Bamford nickt nur. Dann gibt er mir mein Handy zurück und sagt: »Sehr schön. Nun, offensichtlich kommen Sie nach Ihren gesunden Verwandten. Vorausgesetzt, Sie bleiben unfallfrei, sage ich Ihnen beiden ein langes Leben voraus.«
»Wunderbar!«, sagt Dan. »Genau das wollten wir hören!«
»Und heute leben wir alle erheblich länger.« Freundlich lächelt Dr. Bamford uns an. »Unserer Langlebigkeit gilt mein vordringliches Interesse. Die Lebenserwartung steigt mit jedem Jahr. Leider hat die Welt das immer noch nicht so recht begriffen. Regierungen … Industrie … Rentenversicherungen … keiner ist richtig darauf vorbereitet.« Er lacht leise. »Was glauben Sie zum Beispiel, wie alt Sie werden, Sie beide?«
»Oh.« Dan zögert. »Na ja … ich weiß nicht. Achtzig? Fünfundachtzig?«
»Ich sage neunzig«, werfe ich ein. Meine Oma starb mit neunzig, da werde ich doch wohl auch so lange leben, oder?
»Oh, Sie werden über hundert«, sagt Dr. Bamford mit Nachdruck. »Vielleicht hundertzwei. Sie …«, er nimmt Dan ins Visier, »werden vielleicht nicht ganz so alt. Vielleicht hundert.«
»So stark kann die Lebenserwartung doch nicht gestiegen sein«, sagt Dan skeptisch.
»Die durchschnittliche Lebenserwartung nicht«, stimmt Dr. Bamford zu, »aber Sie beide sind überdurchschnittlich gesund. Sie achten auf sich, haben gute Gene … Ich bin mir sicher, dass Sie beide hundert Jahre alt werden. Mindestens.«
Er lächelt wohlwollend wie der Weihnachtsmann, der uns ein Geschenk bringt.
»Wow!«
Ich versuche, mir vorzustellen, wie ich mit hundertzwei sein mag. Ich dachte nicht, dass ich so lange leben werde. Eigentlich habe ich noch nie über meine Lebenserwartung nachgedacht. Ich habe einfach gelebt.
»Ist ja ’n Ding!« Dan strahlt übers ganze Gesicht. »Hundert Jahre!«
»Ich werde hundertzwei«, entgegne ich lachend. »Gegen mein superlanges Leben kommst du nicht an.«
»Was sagten Sie, wie lange Sie verheiratet sind?«, fragt Dr. Bamford. »Sieben Jahre?«
»Genau.« Ich strahle ihn an. »Zusammen seit zehn.«
»Dann habe ich eine gute Nachricht für Sie.« Dr. Bamfords Augen blitzen vor Vergnügen. »Sie dürften wohl noch weitere achtundsechzig wundervolle Ehejahre vor sich haben!«
Was?
Wie bitte?
Mein Lächeln erstarrt ein wenig. Vor meinen Augen verschwimmt alles. Ich kriege keine Luft mehr.
Achtundsechzig?
Hat er eben gesagt …
Noch achtundsechzig Ehejahre? Mit Dan?
Ich meine, ich liebe Dan von ganzem Herzen, aber …
Noch achtundsechzig Jahre?
»Ich hoffe, Sie haben genügend Kreuzworträtsel, um der Langeweile zu entgehen!« Der Arzt gluckst gutgelaunt. »Vielleicht sollten Sie sich ein paar Gespräche aufsparen. Obwohl, im Fernsehen läuft ja immer irgendwas!« Offenbar findet er sich zum Schreien komisch. »Und es gibt so viele gute Serien auf DVD.«
Ich versuche, mein Lächeln aufrechtzuerhalten, und werfe Dan einen Blick zu, um zu sehen, ob er darüber lachen kann. Doch er ist wie in Trance. Sein leerer Plastikbecher ist ihm aus der Hand gefallen, ohne dass er es bemerkt hätte. Er ist totenbleich.
»Dan.« Ich stoße seinen Fuß an. »Dan!«
»Ja doch.« Er kommt zu sich und lächelt starr.
»Ist das nicht eine tolle Nachricht?«, presse ich hervor. »Noch achtundsechzig gemeinsame Jahre! Das ist … Ich meine … Wir sind Glückspilze!«
»Absolut«, sagt Dan mit erstickter Stimme. »Achtundsechzig Jahre. Wir sind … Glückspilze.«
KAPITEL ZWEI
Natürlich ist das eine gute Nachricht. Eine wunderbare Nachricht. Wir sind kerngesund, wir werden lange leben … Das sollten wir feiern!
Aber noch achtundsechzig Jahre verheiratet? Im Ernst? Ich meine …
Im Ernst?
Auf dem Heimweg im Auto schweigen wir beide. Immer wieder werfe ich einen kurzen Blick zu Dan hinüber, wenn er gerade nicht guckt, und spüre, dass er dasselbe tut.
»Na, das war doch schön zu hören, oder?«, sage ich schließlich. »Dass wir hundert werden und unsere Ehe noch …«, ich bringe diese Zahl einfach nicht über die Lippen, »… eine Weile anhält«, ende ich lahm.
»Oh«, antwortet Dan, ohne den Kopf zu bewegen. »Ja. Fabelhaft.«
»Hast du … Hast du dir das so vorgestellt?«, frage ich. »Das mit der Ehe, meine ich. Die … also … die Länge?«
Schweigend runzelt Dan die Stirn, so wie er es immer tut, wenn er es mit einem kniffligen Problem zu tun hat.
»Das ist schon ganz schön lange«, sagt er schließlich. »Findest du nicht?«
»Es ist lang.« Ich nicke. »Ziemlich lang.«
Wir schweigen noch ein wenig, während Dan sich an einer Kreuzung konzentrieren muss und ich ihm ein Kaugummi anbiete, weil ich im Auto immer die Kaugummianbieterin bin.
»Aber im guten Sinne, nicht?«, höre ich mich sagen.
»Absolut«, antwortet Dan etwas zu schnell. »Na klar!«
»Wunderbar!«
»Wunderbar. Super.«
»Super.«
Wieder versinken wir in Schweigen. Normalerweise wüsste ich genau, was Dan denkt, doch heute bin ich mir nicht sicher. Mindestens fünfundzwanzig Mal sehe ich ihn an, sende ihm telepathische Botschaften: Sag was. Und: Sprich mit mir. Und: Würde es dich umbringen, mich mal anzusehen, nur ein Mal?
Nichts dringt zu ihm durch. Er scheint vollkommen in Gedanken versunken. Und so sehe ich mich gezwungen, etwas zu tun, was ich sonst nie tue, indem ich frage: »Was denkst du gerade?«
Noch im selben Augenblick bereue ich es. Ich war noch nie eine von diesen Frauen, die »Was denkst du?« fragen. Jetzt komme ich mir vor wie eine Bittstellerin und bin genervt von mir. Warum sollte Dan nicht eine Weile schweigend überlegen? Warum dränge ich ihn? Warum kann ich ihm nicht seine Ruhe lassen?
Andererseits: Was zum Teufel denkt er gerade?
»Ach.« Dan klingt zerstreut. »Nichts weiter. Ich dachte an Kreditvereinbarungen. Hypotheken.«
Hypotheken!
Fast möchte ich laut lachen. Okay, da sieht man mal wieder den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Was ich nur ungern sage, weil ich schließlich keine Sexistin bin – aber jetzt mal ehrlich! Ich sitze hier und denke an unsere Ehe, und da sitzt er und denkt an Hypotheken.
»Gibt es denn ein Problem mit unserer Hypothek?«
»Nein«, sagt er geistesabwesend und wirft einen Blick auf das Navi. »Mist, diese Route führt nirgendwohin.«
»Und wieso dachtest du dann an Hypotheken?«
»Ach, äh …« Dan legt die Stirn in Falten, ist mit seinem Navi-Display beschäftigt. »Ich dachte nur gerade, wenn man eine Hypothek aufnimmt …«, er reißt das Lenkrad herum und wendet mitten auf der Straße, ignoriert das wütende Hupen um sich herum, »… weiß man genau, wie lange man abbezahlen muss. Ja, es sind fünfundzwanzig Jahre, aber dann ist es vorbei. Man ist raus. Man ist frei.«
Mir krampft sich der Magen zusammen, und bevor ich klar denken kann, platze ich heraus: »Bin ich für dich denn eine Hypothek?«
Ich bin nicht länger die Liebe seines Lebens. Ich bin eine finanzielle Belastung.
»Bitte?« Erstaunt wendet sich Dan mir zu. »Sylvie, wir reden nicht von dir! Hier geht es doch nicht um dich!«
Du meine Güte! Noch mal: Ich möchte nur ungern sexistisch klingen, aber … Männer!
»Aber das denkst du? Hörst du dich reden?« Ich spreche mit meiner Dan-Stimme, um es ihm vor Augen zu führen: »Wir werden eine ungeheuer lange Zeit verheiratet sein. Verdammt. Hey, eine Hypothek hat echte Vorteile, denn nach fünfundzwanzig Jahren ist man damit durch. Man ist frei.« Dann sage ich mit meiner Sylvie-Stimme: »Willst du mir erzählen, das sei eine ganz normale Gedankenfolge? Willst du mir erzählen, das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun?«
»Das habe ich doch gar nicht …« Dan stockt, als ihn die Einsicht trifft. »Das habe ich nicht gemeint«, sagt er mit Nachdruck. »Das Gespräch mit dem Arzt hatte ich schon ganz vergessen«, fügt er noch hinzu.
Ich werfe ihm einen skeptischen Blick zu. »Du hattest es vergessen?«
»Ja, ich hatte es vergessen.«
Das klingt wenig überzeugend. Fast tut er mir leid.
»Du hattest die siebenundsechzig Jahre vergessen, die wir noch miteinander haben werden?« Ich kann es mir nicht verkneifen, ihm diese kleine Falle zu stellen.
»Achtundsechzig«, verbessert er sofort, dann steigt ihm eine verräterische Röte ins Gesicht. »Oder wie viele es auch sein mögen. Wie gesagt, ich kann mich wirklich nicht erinnern.«
Er ist so ein Lügner. Es hat sich in sein Gedächtnis eingebrannt. Genau wie bei mir.
Wir kommen nach Wandsworth und finden doch tatsächlich einen Parkplatz in der Nähe. Wir wohnen in einem kleinen Reihenhaus mit vier Zimmern, einem gepflasterten Weg zur Eingangstür und einem Garten hinterm Haus, in dem früher Kräuter und Blumen wuchsen, heute jedoch vor allem zwei monströse Wendy-Häuser stehen, die meine Mutter den Mädchen zum vierten Geburtstag geschenkt hat.
Nur meine Mutter kommt auf die Idee, zwei identische Wendy-Häuser zu kaufen. Und sie als Überraschung während der Geburtstagsparty liefern zu lassen. Sprachlos standen die Gäste da und sahen sich an, wie drei Handwerker gestreifte Wände, bonbonfarbene Dächer und hübsche, kleine Fenster anschleppten und zusammenbauten.
»Wow, Mummy!«, rief ich, nachdem wir uns der Reihe nach bei ihr bedankt hatten. »Die sind super … ganz toll … aber … gleich zwei? Wirklich?« Sie zwinkerte mir nur mit ihren klaren blauen Augen zu und erwiderte: »Damit sie nicht teilen müssen, Liebes«, als läge das doch auf der Hand.
Na gut. So ist meine Mutter. Sie ist liebenswert. Liebenswert nervig. Nein, vielleicht eher nervig liebenswert. Und außerdem ist das zweite Wendy-Haus ganz praktisch, weil ich meine Turnmatte und die Gewichte darin verstauen kann. Auch gut.
Als wir ins Haus eintreten, haben wir beide nicht viel zu sagen. Während ich die Post durchblättere, ertappe ich Dan dabei, wie er sich in der Küche umblickt, als sähe er das Haus zum ersten Mal. Als müsste er sich mit seiner Gefängniszelle vertraut machen.
Dann ermahne ich mich: Komm schon, das stimmt doch gar nicht.
Dann entschuldige ich mich bei mir selbst, denn offen gesagt stimmt es sehr wohl. Er schleicht umher wie ein Tiger, mustert mürrisch die blau bemalten Schränke. Als Nächstes ritzt er noch einen Strich in die Wand. Beginnt die Liste unseres endlosen, ermüdenden Marsches durch die kommenden achtundsechzig Jahre.
»Was?«, fragt Dan, als er merkt, dass ich ihn betrachte.
»Was?«, entgegne ich.
»Nichts.«
»Ich hab nichts gesagt.«
»Ich auch nicht.«
O Gott. Was ist mit uns passiert? Beide sind wir gereizt und misstrauisch. Und alles nur, weil dieser Arzt eine gute Nachricht für uns hatte.
»Also gut, wir leben also mehr oder weniger ewig«, bricht es aus mir hervor. »Damit müssen wir nun mal klarkommen, okay? Reden wir darüber!«
»Was denn reden?« Dan spielt den Ahnungslosen.
»Erzähl mir nichts!«, fahre ich ihn an. »Ich weiß doch, dass du denkst: Verdammte Scheiße, wie sollen wir das bloß so lange durchhalten? Es ist ja wirklich wunderschön, aber es ist auch …« Ich knete meine Hände. »Du weißt schon. Es ist … Es ist auch eine Herausforderung.«
Langsam rutsche ich mit dem Rücken am Küchenschrank abwärts, bis ich in der Hocke bin. Dan tut es mir nach.
»Es macht mir Angst«, stimmt er zu, und seine Miene entspannt sich ein wenig. »Ich fühle mich … überwältigt.«
Und da ist sie endlich heraus. Die ganze, schreckliche Wahrheit. Wir machen uns beide vor Angst fast in die Hosen angesichts dieser schier endlosen Ehe von epischem Ausmaß, in der wir uns plötzlich wiederfinden.
»Was dachtest du denn, wie lange wir verheiratet sein werden?«, frage ich nach einer Weile.
»Ich weiß nicht!« Verzweifelt wirft Dan seine Hände in die Luft. »Wer denkt denn schon an so was?«
»Aber als du vor dem Altar standest und gesagt hast, ›bis dass der Tod uns scheidet‹, hattest du da so was wie eine grobe Zahl vor Augen?«
Dan verzieht das Gesicht, als versuchte er, sich zu erinnern. »Hatte ich ehrlich nicht«, sagt er. »Ich hatte nur eine vage Vorstellung von der Zukunft.«
»Ich auch.« Ich zucke mit den Schultern. »Ich hatte keine feste Vorstellung. Ich dachte wohl, wir würden vielleicht eines Tages unsere Silberhochzeit feiern. Wenn Leute fünfundzwanzig Jahre verheiratet sind, denkt man: Wow. Die haben es geschafft! Die sind über den Berg!«
»Aber wenn wir Silberhochzeit feiern«, sagt Dan etwas grimmig, »haben wir noch nicht mal die Hälfte des Weges hinter uns. Nicht mal die Hälfte!«
Wieder schweigen wir. Immer mehr Auswirkungen dieser Erkenntnis werden uns bewusst.
»Immer und ewig kommt mir länger vor, als ich dachte«, sagt Dan trübsinnig.
»Geht mir auch so.« Ich sinke gegen den Küchenschrank. »So viel länger.«
»Ein Marathon.«
»Ein Supermarathon«, korrigiere ich. »Ein Ultramarathon.«
»Ja!« Gehetzt blickt Dan auf. »Genau! Wir dachten, wir laufen zehn Kilometer, und plötzlich stellen wir fest, dass wir an einem von diesen wahnwitzigen Hundert-Meilen-Ultra-Marathons in der Sahara teilnehmen, und es gibt keine Möglichkeit auszusteigen. Nicht dass ich aussteigen möchte«, fügt er hastig hinzu, als er meinen Blick sieht. »Aber ebenso wenig möchte ich davon … Du weißt schon … einen Herzinfarkt kriegen.«
Dan hat wirklich ein Händchen für Metaphern. Erst ist unsere Ehe eine Hypothek. Jetzt kriegt er davon einen Herzinfarkt. Und wer soll in dieser Geschichte eigentlich die Sahara sein? Ich?
»Wir haben unsere Kräfte nicht richtig eingeteilt.« Er kann einfach nicht aufhören. »Hätte ich gewusst, dass ich so lange leben würde, hätte ich wahrscheinlich nicht so jung geheiratet. Wenn alle Menschen hundert werden, müssen wir die Regeln ändern. Vor allem sollte man sich erst binden, wenn man mindestens fünfzig ist …«
»Um dann mit fünfzig Kinder zu kriegen?«, werfe ich schnippisch ein. »Schon mal was von der biologischen Uhr gehört?«
Dan stutzt kurz.
»Okay, das wird nichts«, räumt er ein.
»Außerdem können wir die Uhr nicht zurückdrehen. Wir stehen da, wo wir stehen. Was gut ist«, füge ich hinzu, weil ich positiv bleiben möchte. »Denk nur mal an die Ehe deiner Eltern! Die sind seit achtunddreißig Jahren verheiratet und immer noch zusammen. Wenn die das schaffen, schaffen wir es auch!«
»Meine Eltern sind nicht gerade das beste Beispiel«, sagt Dan.
Stimmt schon. Die beiden haben eine schwierige Beziehung.
»Na, dann eben die Queen«, sage ich, da klingelt es an der Haustür. »Die ist schon seit tausend Jahren verheiratet.«
Ungläubig starrt Dan mich an. »Die Queen? Was Besseres fällt dir nicht ein?«
»Okay, vergiss die Queen«, sage ich trotzig. »Lass uns später weiterreden.« Und damit gehe ich zur Tür.
Als die Mädchen freudestrahlend ins Haus platzen, verlieren die kommenden achtundsechzig Jahre mit einem Mal ihre Bedeutung. Das hier hat Bedeutung. Diese Mädchen, dieser Moment, diese rosigen Wangen, diese hohen, flötengleichen Stimmen, die schreien: »Wir haben Sticker! Wir hatten Pizza!« Die beiden zerren an meinen Armen, erzählen mir alles Mögliche und wollen mich mit Gewalt ins Haus ziehen, während ich noch versuche, mich von meiner Freundin Annelise zu verabschieden, die sie abgesetzt hat und fröhlich winkt, schon wieder auf dem Weg zurück zu ihrem Wagen.
Ich drücke die Mädchen an mich, spüre das vertraute Wuseln ihrer Arme und Beine, verziehe das Gesicht, als sie mit ihren Straßenschuhen auf meinen Füßen herumtrampeln. Sie waren kaum zwei Stunden zum Spielen weg. Ganz kurz nur. Doch als ich sie so an mich drücke, kommt es mir vor, als wären sie ewig weg gewesen. Ist Anna schon wieder gewachsen? Riechen Tessas Haare irgendwie anders? Und wo kommt dieser kleine Kratzer an Annas Kinn her?
Jetzt sprechen sie in ihrer geheimen Zwillingssprache, reden gleichzeitig, Strähnen ihrer blonden Haare verzotteln sich, während sie bewundernd den glitzernden Seepferdchen-Sticker auf Tessas Hand betrachten. Soweit ich die beiden verstehen kann, wollen sie »ihn für immer teilen, bis wir erwachsen sind«. Da er sich mit großer Wahrscheinlichkeit auflösen wird, sobald ich ihn abziehe, werden wir eine kleine Ablenkung brauchen, sonst ist das Geschrei groß. Wenn man mit fünfjährigen Zwillingen lebt, kommt man sich manchmal vor wie in einem kommunistischen Staat. Nicht dass ich die Shreddies abzähle, die ich ihnen morgens in ihre Schälchen fülle, aber …
Einmal habe ich die Shreddies tatsächlich abgezählt. Ging einfach schneller.
»Okay!«, sagt Dan. »Badezeit? Badezeit!«, verbessert er sich hastig. Badezeit ist keine Frage. Es ist eine feste Größe. Es ist der Dreh- und Angelpunkt. Im Grunde haben wir das gesamte Gefüge unserer Familienroutine um die Badezeit herumgebaut.
(Das ist im Übrigen nicht nur bei uns so, sondern bei allen mir bekannten Familien mit kleinen Kindern. Es gilt als allgemeine Überzeugung, dass ohne feste Badezeit auch alles andere seinen Halt verliert. Chaos breitet sich aus. Die Zivilisation löst sich auf. Zerlumpte Kinder streunen durch die Straßen, nagen an Tierknochen, während ihre Eltern wimmernd in irgendwelchen Seitenstraßen hocken. So ungefähr.)
Jedenfalls ist Badezeit. Und während unsere allabendliche Routine ihren Lauf nimmt, ist es, als hätte es diese seltsame Stimmung zwischen uns vorhin nie gegeben. Dan und ich sind wieder ein Team. Ahnen, was der andere will. Kommunizieren kurz und knapp, fast wie Gedankenleser.
»Wollen wir Annas …?«, beginnt Dan, als er mir die Entwirrbürste reicht.
»Hab ich heute Morgen gemacht.«
»Was ist mit …«
»Jep.«
»Und diese Nachricht von Miss Blake?« Er zieht die Augenbrauen hoch.
»Ich weiß.« Inzwischen entwirre ich Annas Haare mit den Fingern und flüstere über ihren Kopf hinweg: »Zum Schreien.«
Miss Blake ist unsere Schulleiterin, und ihre Nachricht lag in Annas Vokabelheft. Sie ging an alle Eltern mit der Bitte, einen bestimmten Vorfall bitte NICHT zu erwähnen und auch »nicht am Schultor darüber zu plaudern«, da der Verdacht »ABSOLUTUNBEGRÜNDET« sei.
Ich hatte keine Ahnung, worum es ging, also habe ich andere Eltern angemailt, und offenbar hat Miss Christy, die Lehrerin der Abschlussklasse, einen der Väter auf dem Klassencomputer gegoogelt, ohne zu merken, dass dieser mit dem Whiteboard verlinkt war.
»Kann ich mal den …«
Dan reicht mir den Duschkopf, und ich lasse warmes Wasser auf Annas Kopf rieseln, während sie kichernd kreischt: »Es regnet!«
Waren wir schon immer so? So im Einklang miteinander? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben uns verändert, seit die Mädchen da sind. Wenn man Zwillinge bekommt, muss man zusammenhalten. Man füttert, windelt, tröstet und reicht Babys hin und her, rund um die Uhr. Man perfektioniert seine Abläufe. Man vergeudet keine Worte. Als ich Anna und Tessa damals gestillt habe, war ich oft so müde, dass ich kein Wort mehr herausbrachte, und dann konnte Dan an meinem Gesichtsausdruck ablesen, was von Folgendem ich sagen wollte:
1. Könnte ich bitte noch mehr Wasser haben? Drei Liter müssten reichen.
2. Und Schokolade? Schieb sie mir einfach in den Mund. Ich saug sie in mich rein.
3. Könntest du bitte umschalten? Ich hab die Hände voller Babys und gucke jetzt schon dreizehn Stunden ununterbrochen irgendwelche Talkshows.
4. Mein Gott, bin ich alle. Habe ich das heute schon mehr als fünfhundert Mal gesagt?
5. Hast du eigentlich eine Vorstellung davon, wie alle ich bin? Mein ganzes Gerippe ist in sich zusammengeklappt, so alle bin ich. Meine Nieren stützen sich schlapp an meine Leber und weinen leise vor sich hin.
6. Aua, meine Nippel. Autsch. Aua.
7. Auuuuuuuuuuaaaa!
8. Ich weiß. Es ist natürlich. Es ist wunderschön. Wie auch immer.
9. Lass uns danach keine mehr kriegen, okay?
10. Hast du das kapiert? Hörst du mir zu, Dan? KEINEBABYSMEHR, NIEWIEDER.
»Aaaahh!« Abrupt komme ich zu mir, als Tessa das Wasser in der Wanne schwappen lässt und ich klatschnass werde.
»Okay!«, schimpft Dan. »Das war’s. Raus aus der Wanne, alle beide!«
Augenblicklich fangen die Mädchen gleichzeitig an zu heulen. Geheult wird viel in unserem Haus. Tessa heult, weil es ihr leidtut, dass sie mich so nass gespritzt hat. Anna heult, weil sie immer heult, wenn Tessa heult. Beide heulen, weil Dan laut geworden ist. Und natürlich heulen beide, weil sie müde sind, auch wenn sie es nie zugeben würden.
»Mein Sticker«, presst Tessa hervor, weil sie in solchen Situationen immer alles Negative aufzählt, das ihr so einfällt. »Mein Sticker ist kaputt! Und ich hab Aua am Daumen!«
»Wir bringen ihn gleich ins Sticker-Krankenhaus«, sage ich tröstend, während ich sie in ein Handtuch wickle. »Und deinen Daumen küsse ich wieder gesund.«
»Kann ich einen Eislolli haben?« Sie blickt zu mir auf, sieht ihre Chance.
Ihre Chuzpe muss man einfach mögen. Ich wende mich ab, um mein Lachen zu verbergen, und sage über meine Schulter hinweg: »Jetzt nicht. Morgen vielleicht.«
Während Dan den Vorlesedienst übernimmt, steige ich aus meinen nassen Klamotten. Ich trockne mich ab, dann stehe ich vor dem Spiegel und betrachte meinen nackten Körper.
Achtundsechzig Jahre. Wie ich wohl in achtundsechzig Jahren aussehe?
Vorsichtig kneife ich die Haut an meinem Oberschenkel zusammen, bis sie ganz faltig ist. O mein Gott. Diese Falten sind meine Zukunft. Nur dass ich sie überall haben werde. Ich werde faltige Oberschenkel haben und faltige Brüste und … ich weiß nicht … faltige Kopfhaut. Ich lasse meine Falten los und mustere mich. Sollte ich mal anfangen, mich gezielter zu pflegen? Ein Peeling zum Beispiel? Aber wie soll meine Haut denn halten, bis ich hundertzwei bin? Sollte ich nicht lieber Schichten aufbauen, statt sie wegzuschrubben?
Wie bleibt man überhaupt hundert Jahre lang ansehnlich? Wieso erfährt man darüber nichts aus den Zeitschriften?
»Okay, die Kleinen sind versorgt. Ich geh ’ne Runde joggen.« Als Dan hereinkommt, zieht er schon sein Hemd aus, dann hält er inne, als er mich nackt vor dem Spiegel stehen sieht.
»Mmm«, macht er mit leuchtenden Augen. Er wirft sein Hemd aufs Bett, kommt zu mir und legt seine Hände an meine Hüften.
Da ist er im Spiegel. Mein hübscher, jugendlicher Ehemann. Wie wird er wohl in achtundsechzig Jahren aussehen? Plötzlich habe ich ein bestürzendes Bild von Dan vor Augen, ganz alt und grau, wie er mit einem Stock auf mich einschlägt und keift: »Humbug, Weib, alles Humbug!«
Was lächerlich ist. Er wird alt sein. Nicht Ebenezer Scrooge.
Ich schüttle kurz den Kopf, um die Vorstellung loszuwerden. Mein Gott, warum musste dieser Arzt überhaupt von der Zukunft anfangen?
»Ich dachte gerade …«
»Wie oft wir noch Sex haben werden?« Dan nickt. »Ich habe es schon ausgerechnet.«
»Bitte?« Ich fahre herum. »Das habe ich nicht gedacht! Ich dachte …« Ich stutze interessiert. »Wie oft denn?«
»Elftausend Mal. Mehr oder weniger.«
»Elftausend?«
Vor Schreck kriege ich ganz weiche Knie. Ist das denn überhaupt physisch möglich? Ich meine, wenn ich dachte, Peeling würde meine Haut abwetzen, dann müsste doch …
»Ich weiß.« Er steigt aus seiner Anzughose und hängt sie auf. »Ich dachte, es wäre öfter.«
»Öfter?«
Wie konnte er glauben, es wäre öfter? Bei der bloßen Vorstellung wird mir ganz schwindlig. Elftausend Mal Sex, immer mit Dan. Nicht dass … Selbstverständlich möchte ich nur mit Dan, aber … elftausend Mal?
Woher sollen wir die ganze Zeit nehmen? Ich meine, wir müssen doch auch mal was essen. Wir müssen arbeiten. Und wird es uns nicht langweilig werden? Sollte ich neue Stellungen googeln? Sollte ich einen Bildschirm an der Decke installieren?
Diese Zahl kann nicht stimmen. Da ist irgendwo eine Null zu viel.
»Wie hast du das ausgerechnet?«, erkundige ich mich argwöhnisch, doch Dan hört gar nicht mehr zu. Mit den Händen fährt er an meinem Rücken hinab und umfasst meinen Hintern mit diesem zielstrebigen Gesichtsausdruck, den er dann immer bekommt. Wenn man mit Dan über Sex redet, will er es dreißig Sekunden später auch tun und nicht weiter darüber reden. Im Grunde ist jedes Gespräch zu diesem Thema für ihn totale Zeitverschwendung. (Ich dagegen rede sehr gern darüber, habe aber gelernt, es hinterher zu tun. Dann liege ich in seinen Armen und erzähle ihm alles, was ich so denke … also alles eigentlich, und er macht »Mmm-hmmm«, bis ich merke, dass er eingeschlafen ist.)
»Vielleicht lasse ich mein Joggen heute mal ausfallen«, sagt er und küsst mich fest am Hals. »Schließlich ist unser Jahrestag …«
Recht hat er. Und der Sex ist wundervoll – da sind wir inzwischen auch schon fast telepathisch –, und hinterher liegen wir im Bett und sagen Sachen wie: »Das war toll« und »Ich liebe dich« und alles, was glückliche Pärchen so sagen.
Und es war wirklich toll.
Und ich liebe ihn wirklich.
Aber wenn ich absolut total ehrlich sein soll, höre ich in meinem Kopf eine leise Stimme, die sagt: Okay. Nur noch 10 999 Mal.
KAPITEL DREI
Am Morgen bin ich früh wach, doch Dan ist mir voraus. Er sitzt bereits auf dem kleinen Korbstuhl in unserem Erker und starrt trübsinnig aus dem Fenster.
»Morgen.« Er wendet sich mir ein Stück weit zu.
»Morgen!« Ich setze mich auf, bin sofort hellwach. So viele Gedanken fliegen in meinem Kopf herum. Diese Sache mit dem ewigen Leben lässt mir keine Ruhe. Ich habe beim Einschlafen lange nachgedacht und die Lösung gefunden!
Gerade will ich Dan davon erzählen, da kommt er mir zuvor.
»Im Grunde muss ich also arbeiten, bis ich fünfundneunzig bin«, sagt er mutlos. »Ich habe mal ein bisschen nachgerechnet.«
»Bitte?«, sage ich verständnislos.
»Wenn wir ewig leben, müssen wir auch ewig arbeiten.« Er wirft mir einen unheilvollen Blick zu. »Um unser biblisches Alter zu finanzieren. Vergiss den Ruhestand mit fünfundsechzig. Vergiss überhaupt den Traum, es irgendwann mal ruhiger angehen zu lassen.«
»Sei nicht so miesepetrig!«, rufe ich. »Es war doch eigentlich eine gute Nachricht!«
»Möchtest du denn mit fünfundneunzig immer noch arbeiten?«, knurrt er.
»Vielleicht schon.« Ich zucke mit den Schultern. »Ich liebe meinen Job. Du liebst deinen Job.«
Dan zieht ein finsteres Gesicht. »So sehr nun auch wieder nicht. Mein Dad hat sich mit siebenundfünfzig zur Ruhe gesetzt.«
Langsam, aber sicher nervt mich seine Mäkelei.
»Sei nicht so negativ!«, erkläre ich. »Denk mal an all die Möglichkeiten! Wir haben noch Jahrzehnte über Jahrzehnte vor uns! Wir können alles machen! Das ist doch wunderbar! Wir brauchen nur einen Plan!«
»Was meinst du damit?« Dan wirft mir einen misstrauischen Blick zu.
»Okay, ich habe da ein paar Ideen.« Ich rutsche etwas weiter nach vorn auf dem Bett und blicke ihm tief in die Augen, versuche, ihn mit meiner Begeisterung anzustecken. »Wir teilen unser Leben in Jahrzehnte ein. In jedem Jahrzehnt machen wir was Neues, was Cooles. Wir sind kreativ. Wir fordern uns gegenseitig. Vielleicht sprechen wir zehn Jahre lang nur Italienisch miteinander.«
»Bitte?«
»Wir sprechen nur Italienisch miteinander«, wiederhole ich etwas trotzig. »Warum denn nicht?«
»Weil wir kein Italienisch sprechen«, sagt Dan, als hätte ich endgültig den Verstand verloren.
»Wir würden es lernen! Es wäre eine Bereicherung für unser Leben. Es wäre …« Ich mache eine vage Geste.
Dan starrt mich nur an. »Was hast du sonst noch für Ideen?«
»Wir probieren neue Jobs.«
»Was denn für neue Jobs?«
»Ich weiß nicht! Wir suchen uns großartige, erfüllende Jobs, die uns entsprechen. Oder wir leben auf verschiedenen Kontinenten. Vielleicht zehn Jahre Europa, zehn Jahre Südamerika, zehn Jahre USA …« Ich zähle die Kontinente an meinen Fingern ab. »Wir könnten überall leben!«
»Wir könnten reisen«, räumt Dan ein. »Wir sollten reisen. Ich wollte immer schon mal nach Ecuador. Die Galapagos-Inseln sehen.«
»Da hast du’s! Wir fahren nach Ecuador.«
Einen Moment lang schweigen wir. Ich merke, dass Dan sich mit dem Gedanken anfreundet.
Seine Augen fangen an zu leuchten, und ruckartig blickt er auf. »Okay, tun wir’s! Scheiß drauf, Sylvie, du hast recht. Es ist ein Weckruf. Wir müssen unser Leben leben. Wir buchen Flüge nach Ecuador, nehmen die Mädchen von der Schule und könnten Freitag schon da sein … Tun wir’s!«
Er sieht so begeistert aus, dass ich seinen Enthusiasmus nur ungern dämpfen möchte. Aber hat er denn nicht zugehört? Ich habe vom kommenden Jahrzehnt gesprochen. Oder vielleicht von dem danach. Irgendein weit entfernter, nicht näher spezifizierter Zeitpunkt. Nicht diese Woche.
»Ich möchte ja auch nach Ecuador«, sage ich. »Unbedingt. Aber es würde ein Vermögen kosten …«
»Es wäre ein einmaliges Erlebnis.« Dan wischt meinen Einwand beiseite. »Wir würden schon zurechtkommen. Ich meine – Ecuador, Sylvie!«
»Absolut!« Ich versuche, genauso begeistert zu klingen wie er. »Ecuador!« Ich lasse eine kurze Pause, bevor ich hinzufüge: »Das Problem ist nur, dass Mrs Kendrick es nicht gern sieht, wenn ich außerplanmäßig Urlaub nehme.«
»Sie wird es überleben.«
»Und die Mädchen haben ihre Schulaufführung. Sie dürfen die Proben nicht verpassen …«
Dan gibt einen ärgerlichen Laut von sich. »Okay, dann nächsten Monat.«
»Da hat deine Mutter Geburtstag«, sage ich. »Und die Richardsons kommen zum Essen, und die Mädchen haben ihr Schulsportfest …«
»Na gut«, sagt Dan und klingt dabei, als fiele es ihm schwer, die Ruhe zu bewahren. »Dann eben im Monat danach. Oder in den Sommerferien.«
»Da sind wir im Lake District«, rufe ich ihm in Erinnerung, schrecke allerdings angesichts seiner Miene zurück. »Okay, das könnten wir noch absagen, auch wenn wir schon eine Anzahlung geleistet haben …« Meine Stimme wird immer leiser.
»Nur damit ich es richtig verstehe.« Dan klingt, als würde er gleich platzen. »Ich habe eine halbe Ewigkeit vor mir, aber keine Zeit für einen spontanen, horizonterweiternden Trip nach Ecuador.«
Wir schweigen. Ich möchte nicht sagen, was ich denke, nämlich: Selbstverständlich haben wir keine Zeit für einen spontanen, horizonterweiternden Trip nach Ecuador, denn – hallo? – schließlich haben wir einen Alltag zu bewältigen.
»Wir könnten doch in einem ecuadorianischen Restaurant essen gehen!«, schlage ich fröhlich vor.
Dans Blick nach zu urteilen, hätte ich allerdings besser den Mund gehalten.
Beim Frühstück mische ich uns ein Müsli und füge ein paar Sonnenblumenkerne hinzu. Wir werden gesunde Haut brauchen, wenn wir noch achtundsechzig Jahre durchhalten wollen.
Sollte ich mit Botox anfangen?
»Noch fünfundzwanzigtausend Mal Frühstück«, sagt Dan unvermittelt mit starrem Blick in seine Müslischale. »Hab ich gerade ausgerechnet.«
Tessa blickt von ihrem Toast auf und betrachtet Dan mit leuchtenden Augen, immer auf der Suche nach dem nächsten Lacher. »Wenn man fünfundzwanzig Frühstücke isst, platzt einem der Bauch.«
»Fünfundzwanzigtausend«, verbessert Anna.
»Hab ich doch gesagt!«, hält Tessa sofort dagegen.
»Ehrlich, Dan, denkst du immer noch daran?« Ich werfe ihm einen mitleidigen Blick zu. »Du solltest nicht ewig darauf herumreiten.«
Fünfundzwanzigtausend Mal Frühstück. Verdammt. Wie soll ich es nur so lange interessant gestalten? Vielleicht könnten wir es mal mit Kedgeree probieren. Oder ein Jahrzehnt nur japanisch essen. Tofu. Solche Sachen.
»Warum rümpfst du die Nase?« Dan starrt mich an.
»Nur so!« Eilig streiche ich meinen geblümten Rock glatt. Ich trage oft geblümte Röcke im Büro, weil die dort gern gesehen sind. Nicht dass es einen offiziellen Dresscode gäbe, aber wenn ich etwas Fröhliches oder Rosiges oder einfach irgendetwas Hübsches trage, ruft meine Chefin Mrs Kendrick unweigerlich: »Zauberhaft! Ach, wie zauberhaft, Sylvie!«
Wenn deine Chefin gleichzeitig die Besitzerin des Ladens ist, absolute Macht besitzt und hin und wieder Leute feuert, weil sie »einfach nicht zu uns passen«, möchte man sie gern »Ach, wie zauberhaft!« sagen hören. Und deshalb ist meine Garderobe im Laufe der sechs Jahre, die ich dort arbeite, immer farbenfroher und mädchenhafter geworden.
Mrs Kendrick mag Zitronengelb, Lavendelblau, Kleingemustertes, Rüschen, Perlmuttknöpfe und hübsche, kleine Ansteckschleifchen an den Schuhen. (Ich hab da eine Website gefunden.)
Ganz und gar nicht mag sie Schwarz, glänzende Stoffe, tief ausgeschnittene Tops, T-Shirts oder Plateauschuhe. (»Die sehen doch eher orthopädisch aus, meinen Sie nicht, meine Liebe?«) Und wie gesagt – sie ist die Chefin. Sie mag eine unorthodoxe Chefin sein … aber sie ist die Chefin. Und sie bekommt gern ihren Willen.
»Ha!« Dan schnaubt kurz vor Lachen. Er ist dabei, die Post zu öffnen, und liest eine Einladung.
»Was?«
»Das wird dir gefallen.« Er wirft mir einen hämischen Blick zu und dreht die Karte um, damit ich sie lesen kann. David Whittall, ein alter Freund von meinem Vater, lädt uns zu einem Charity-Event ein, das er im Sky Garden veranstaltet.
Ich kenne den Sky Garden. Er liegt fünfunddreißig Stockwerke über der Erde und besteht nur aus Glas, mit einem Rundblick über London. Und beim bloßen Gedanken daran möchte ich mich an meinen Stuhl klammern und mich fest im Boden verankern.
»Genau mein Ding«, sage ich und rolle mit den Augen.
»Dachte ich mir.« Dan grinst schief, denn er weiß es nur zu gut.
Ich habe solche Höhenangst, dass es schon nicht mehr schön ist. Ich kann keinen hohen Balkon betreten. Ich kann in keinen gläsernen Lift steigen. Wenn im Fernsehen Leute Fallschirm springen oder auf einem Drahtseil balancieren, kriege ich sofort Panik, obwohl ich doch sicher auf meinem Sofa sitze.
Ich war nicht immer so. Früher bin ich Ski gelaufen, habe hohe Brücken überquert, kein Problem. Aber dann kamen die Kinder, und ich weiß gar nicht, was mit meinem Gehirn passiert ist, aber mit einem Mal wurde mir schon schwindlig, wenn ich nur auf eine Trittleiter steigen wollte. Ich dachte, es ginge nach ein paar Monaten vorbei, tat es aber nicht. Als die Mädchen ungefähr anderthalb waren, kauften Kollegen von Dan eine Wohnung mit einer Dachterrasse, und bei der Einweihungsparty war ich nicht in der Lage, an den Rand zu treten, um den Ausblick zu bewundern. Meine Beine wollten sich partout nicht rühren. Als wir nach Hause kamen, fragte Dan: »Was war denn los mit dir?«, und ich meinte nur: »Ich weiß nicht!«
Und mir wird bewusst, dass ich das Problem schon längst mal hätte angehen sollen. (Hypnose? Kognitive Verhaltenstherapie? Konfrontationstherapie? Hin und wieder gebe ich es mal bei Google ein.) In letzter Zeit stand es allerdings nicht weit oben auf meiner Liste. Ich hatte ganz andere Sorgen, um die ich mich dringend kümmern musste. Wie zum Beispiel …
Na gut. Okay. Also, was man über mich wissen sollte: Als mein Vater vor zwei Jahren starb, war das für mich nicht einfach. Ich habe es »nicht gut verkraftet«. Das sagten die Leute. Ich habe sie gehört. Sie standen flüsternd in der Ecke und sagten: »Sylvie verkraftet es nicht so gut.« (Meine Mum, Dan, dieser seltsame Arzt, den sie hinzugezogen hatten.) Was mir irgendwann richtig auf den Geist ging. Schließlich wirft es die Frage auf: Was bedeutet »gut verkraften«? Wie konnte ich es »gut verkraften«, dass mein Vater, mein Held, ohne Vorwarnung durch einen Verkehrsunfall aus dem Leben gerissen wurde? Ich glaube, wer so etwas »gut verkraftet«, macht sich entweder etwas vor oder hatte keinen Vater wie meinen oder hat einfach keine Gefühle.
Vielleicht wollte ich es gar nicht gut verkraften. Haben die sich das mal überlegt?
Jedenfalls bin ich damals ein bisschen durchgedreht. Eine Weile konnte ich nicht arbeiten. Ich habe ein paar … dumme Sachen gemacht. Der Arzt wollte mir Medikamente geben. (Nein, danke.) Und angesichts all dieser Umstände schien mir Höhenangst doch keine sonderlich bemerkenswerte Unannehmlichkeit zu sein.
Inzwischen geht es mir wieder gut, wirklich bestens. Abgesehen natürlich von dieser Sache mit der Höhenangst, um die ich mich kümmern werde, sobald ich Zeit dafür habe.
»Du solltest wirklich dringend mit jemandem über deine Phobie sprechen«, sagt Dan, der unheimlicherweise mal wieder meine Gedanken lesen kann. »PS?«, fügt er hinzu, als ich nicht gleich antworte. »Hast du mich gehört?«
PS ist ein Spitzname, den Dan mir vor Jahren gegeben hat. Es ist die Abkürzung für »Prinzessin Sylvie«.
Dans Version unserer gemeinsamen Geschichte besagt, dass ich, als wir zusammenkamen, die Prinzessin war und er der arme Arbeiterjunge. Schon bei seiner Hochzeitsrede nannte er mich »Prinzessin Sylvie«, und mein Vater rief: »Dann muss ich wohl der König sein!«, und alle haben applaudiert, und Dan hat sich mit eleganter Geste vor seinem Schwiegervater verneigt. Daddy sah tatsächlich aus wie ein König, so distinguiert und gut aussehend, wie er war. Ich sehe ihn noch vor mir, das graublonde Haar im Sonnenlicht und er im makellosen Cutaway. Nie bin ich einem besser gekleideten Mann begegnet. Dann sagte Daddy zu Dan: »Fahre fort, Prinz Daniel!« und zwinkerte ihm freundlich zu. Später meinte der Trauzeuge, es sei eine »wahrhaft königliche Hochzeit« gewesen. Es war wirklich alles sehr komisch.
Mittlerweile jedoch – möglicherweise weil ich inzwischen etwas älter geworden bin – habe ich genug davon, »Prinzessin Sylvie« genannt zu werden. Es kommt mir irgendwie quer, ich schrecke regelrecht zusammen. Allerdings mag ich Dan davon nichts sagen, weil ich taktvoll vorgehen sollte. Das Ganze hat eine gewisse Vorgeschichte. Es ist etwas unangenehm.
Nein, nicht »unangenehm«. Das klingt zu extrem. Es ist nur … O Gott. Wie soll ich es sagen, ohne …?
Okay. Was man noch über mich wissen sollte: Ich bin ziemlich privilegiert aufgewachsen. Nicht verwöhnt, definitiv nicht verwöhnt, aber … behütet. Ich war Daddys kleines Mädchen. Wir hatten Geld. Daddy hatte in leitender Stellung bei einer Fluggesellschaft gearbeitet und war mit einem großen Anteilspaket abgefunden worden, als die Fluglinie übernommen wurde, woraufhin er seine eigene Beratungsfirma aufmachte. Und die lief prächtig. Natürlich tat sie das. Daddy besaß so eine unwiderstehliche Anziehungskraft, die Menschen und Erfolg wie magnetisch anzog. Wenn er mit einem Prominenten in der Ersten Klasse flog, hatte er am Ende des Fluges dessen Visitenkarte und eine Abendeinladung in der Tasche.
Wir hatten also nicht nur Geld, wir hatten Vergünstigungen. Teure Flüge. Sonderbehandlungen. Ich habe so viele Fotos von mir als kleines Mädchen, wie ich im Cockpit des einen oder anderen Flugzeugs sitze, mit der Kapitänsmütze auf dem Kopf. Früher hatten wir ein Haus in Los Bosques Antiguos, dieser abgeschirmten Wohnanlage in Spanien, von der oft in der Regenbogenpresse die Rede ist, weil dort gern berühmte Golfer heiraten. Wir haben sogar ein paar von denen kennengelernt. Das war das Leben, das wir geführt haben.
Dan hingegen … nicht. Dans Familie ist nett, wirklich nett, aber es ist eine vernünftige, bescheidene Familie. Dans Vater war Buchhalter, und Sparen ist ihm wichtig. Sehr wichtig. Schon mit achtzehn hatte er angefangen, sich die Anzahlung für sein Haus zusammenzusparen. Zwölf Jahre hat er gebraucht, dann war es geschafft. (Diese Geschichte hat er mir gleich bei unserem ersten Kennenlernen erzählt und dann gefragt, ob ich einen Pensionsanspruch hätte.) Er würde nie die ganze Familie spontan nach Barbados entführen, wie mein Vater es getan hat, oder bei Harrods einkaufen.
Nicht dass man mich falsch versteht: Ich möchte weder nach Barbados noch bei Harrods einkaufen. Das habe ich Dan schon tausendmal gesagt. Und trotzdem reagiert er ein bisschen … wie soll ich sagen? Mimosig. Genau. Er ist mimosig, was meine Herkunft angeht.
Frustrierend ist nur, dass er so nicht war, als wir zusammenkamen. Er verstand sich gut mit Daddy. Wir gingen zu viert segeln und hatten viel Spaß zusammen. Ich meine, Daddy war natürlich ein besserer Segler als Dan, weil der noch nie ein Boot gesteuert hatte, aber das war okay, weil sie einander respektierten. Daddy witzelte immer, so ein Adlerauge wie Dan könne er zur Kontrolle seiner Buchhaltung gut brauchen – und ein paarmal hat er Dan auch um Rat gefragt. Wir waren alle ganz entspannt miteinander.
Aber irgendwie wurde Dan mit der Zeit immer mimosiger. Irgendwann wollte er nicht mehr segeln gehen. (Fairerweise muss man sagen, dass das schwieriger wurde, seit die Mädchen da sind.) Dann haben wir vor drei Jahren unser Haus gekauft – mit einer Erbschaft von meiner Granny als Anzahlung –, und Daddy bot an, uns zu unterstützen, doch davon wollte Dan nichts hören. Plötzlich wurde er ganz seltsam und meinte, wir wären von meiner Familie schon abhängig genug. (Da war es keine Hilfe, dass Dans Dad das Haus besichtigen kam und meinte: »Das bringt einem also das Einheiraten in eine reiche Familie ein«, als wohnten wir in einem Palast, nicht einem kleinen, hypothekenbelasteten Haus in Wandsworth.)
Nach Daddys Tod erbte meine Mutter alles und bot uns wieder Geld an – doch auch das wollte Dan nicht. Er wurde immer mimosiger. Wir hatten deswegen sogar richtig Streit.
Ich kann verstehen, dass Dan stolz ist. (Mehr oder weniger. Im Grunde kann ich damit überhaupt nichts anfangen, aber vielleicht ist das was typisch Männliches.) Schlimm finde ich allerdings, dass er immer so auf Gegenwehr gepolt ist, wenn es um meinen Vater geht. Ich habe wohl gemerkt, dass ihr Verhältnis angespannt wurde, auch schon als Daddy noch lebte. Dan meinte immer, ich bilde es mir ein – was aber nicht stimmt. Ich weiß nur nicht, was da eigentlich vorgefallen ist oder wieso Dan so neinischwurde. Deshalb habe ich das Wort erfunden. Es war, als hätte er plötzlich etwas gegen Daddy.
Und selbst jetzt ist es, als fühlte Dan sich angegriffen. Nie sitzt er mal da und teilt mit mir Erinnerungen an meinen Vater – nicht so richtig. Da setze ich mich hin und blättere in Fotos herum, aber Dan will sich nicht darauf einlassen. Nach einer Weile sucht er immer eine Ausrede und geht woandershin. Und es tut mir in der Seele weh, denn wenn ich mich nicht gemeinsam mit Dan an meinen Vater erinnern kann, mit wem dann? Ich meine, Mummy … Sie ist eben Mummy. Liebenswert, aber mit ihr kann man nicht ernstlich ein Gespräch oder irgendwas führen. Und Geschwister habe ich keine.
Ein Einzelkind zu sein, hat mir lange etwas ausgemacht. Als Kind habe ich Mummy gedrängt und gedrängt, mir ein kleines Schwesterchen zu schenken. (»Nein, Süße«, sagte sie dann immer ganz lieb.) Irgendwann habe ich mir sogar eine imaginäre Freundin zugelegt. Sie hieß Lynn und hatte einen dunklen Pony und lange Wimpern und roch nach Pfefferminz. Mit ihr habe ich heimlich geredet, aber das war nicht dasselbe.
Als Tessa und Anna zur Welt kamen, habe ich beobachtet, wie sie dalagen, einander zugewandt, von Anfang an in eine Beziehung verstrickt, in die niemand eindringen konnte, und plötzlich packte mich der blanke Neid. Bei allem, was ich als Kind hatte – das hatte ich nicht.
Egal. Genug davon. Ich bin schon lange kein Kind mehr. Ich habe meine imaginäre Freundin hinter mir gelassen. Und was Dan und meinen Vater angeht: Ich habe akzeptiert, dass jede Beziehung ihre Knackpunkte hat, und das ist unserer. Am besten mache ich einen großen Bogen darum und lächle, wenn Dan mich »PS« nennt, denn was macht es schon?
»Ja«, sage ich, als ich wieder zu mir komme. »Ich werde mal mit jemandem reden. Gute Idee!«
»Und das hier sagen wir ab.« Dan tippt auf die Einladung in den Sky Garden.
»Ich schreibe David Whittall eine Mail«, sage ich. »Er wird es verstehen.«
Und dann verschüttet Tessa ihre Milch, und Anna hat ihren Haarclip verloren und will nur diesen einen bestimmten Haarclip, weil da eine Blume dran ist, und so geht unsere morgendliche Routine ihren Gang.