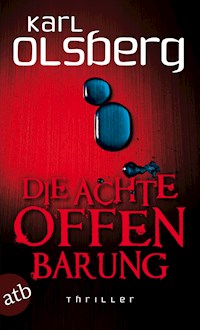Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mai 1627: Die englische Corvette "Fairwind" nimmt mitten auf dem Atlantik einen schiffbrüchigen spanischen Matrosen auf. Der halb verdurstete Mann behauptet, sein Schiff sei in einem heftigen Sturm an den Felsen eines unbekannten Kontinents zerschellt, den er Mygnia nennt. Doch im Umkreis von Hunderten von Seemeilen gibt es kein Land … Fast vierhundert Jahre später geht ein Experiment am Large Hadron Collider des CERN in Genf gründlich schief. Unerklärliche Messergebnisse und seltsame Lichterscheinungen stellen die Physiker vor ein Rätsel. Kurz darauf findet ein Bauer in der Nähe des kleinen französischen Dorfs Cessy Körperteile eines Wesens, das nicht von unserer Welt zu stammen scheint. Als der zehnjährige Sohn der Kinderbuchautorin Maja Rützi aus Cessy spurlos verschwindet, macht sie sich gemeinsam mit dem Journalisten Alex Mars auf die Suche. Die beiden entdecken, dass durch das LHC-Experiment offenbar ein Durchgang in ein Paralleluniversum aufgerissen wurde – ein Tor zu einer fremdartigen, unerforschten Welt … "Mygnia" ist mehr als ein Roman - es ist eine Einladung zu einem einzigartigen literarischen Mitmach-Projekt des Bestseller-Autors Karl Olsberg. Weitere Informationen auf mygnia.de.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Karl Olsberg
Mygnia
Die Entdeckung
Roman
Mygnia - Die Entdeckung
Karl Olsberg
Copyright 2012 Karl Olsberg
published at epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
ISBN 978-3-8442-2067-4
Mygnia ist eine eingetragene Marke der Briends GmbH, Hamburg
www.mygnia.de
www.briends.de
Gewidmet Jules Verne,
dem größten Entdecker von allen
Man entdeckt keine neuen Erdteile,
ohne den Mut zu haben,
alte Küsten aus den Augen zu verlieren.
André Gide
Prolog
Ein kühler Nordostwind blähte die Segel der Fairwind und sorgte für vereinzelte Schaumkronen auf dem endlosen Ozean. Einige Matrosen gingen ihren unbegreiflichen Aufgaben nach, während die Soldaten ihrer Majestät König Karls I. von England in kleinen Gruppen kartenspielend, scherzend und lästernd an Deck herumsaßen.
Johann von Galen stand allein an der Reling und blickte hinaus über das Meer. Es wäre ihm nicht eingefallen, sich unter das grobe Volk zu mischen, mit dem er die Enge des Schiffs zu teilen gezwungen war. Keiner von ihnen, vielleicht mit Ausnahme des Kapitäns Walter Scurrey, war in der Lage, eine gepflegte Konversation zu führen – von Diskussionen über theologische oder philosophische Fragen ganz zu schweigen.
Johann war langweilig. Schon seit einer Woche waren sie jetzt unterwegs, und es gab absolut nichts, womit er seinen wissensdurstigen Geist hätte füttern können. Natürlich hätte er beispielsweise versuchen können, zu verstehen, was die Matrosen taten, warum sie es taten, warum sie etwas überhaupt nur dann taten, wenn sie vom Maat vorher angebrüllt wurden. Doch derartige Betrachtungen waren ihm fremd. Menschen interessierten ihn nicht, er hatte sie noch nie wirklich verstanden.
Was ihn dagegen faszinierte, waren die übrigen Geschöpfe, die Gott in erstaunlicher Vielfalt geschaffen hatte – vom einfachsten Gewürm bis zum mächtigen Wal, vom Seeungeheuer in der Tiefe bis zur Möwe, die scheinbar schwerelos im Sonnenlicht dahin glitt. Besonders die Vögel hatten es ihm angetan. Glichen sie mit ihren gefiederten Flügeln nicht Engeln? Waren sie nicht Gott im Himmel näher als alles andere Getier, sogar als der Mensch? Sie waren nicht grob wie die lästernden Soldaten, sondern so zart und leicht, dass er sich als Kind gefragt hatte, ob sie nicht innen hohl sein mussten. Sie sangen ihre Melodien in einer Schönheit, die selbst der begabteste Musiker nicht übertreffen konnte. Johann war überzeugt, dass sie Gottes liebste Geschöpfe waren. Die Mönche in der Klosterschule, in der er Lesen und Schreiben gelernt und seine philosophische und theologische Grundausbildung erhalten hatte, waren dagegen der Ansicht gewesen, vor Gott seien alle Geschöpfe gleich – mit Ausnahme des Menschen natürlich, den er nach seinem Ebenbild erschaffen und zum Herrscher über die Welt erkoren hatte.
Ob Gott nun Vorlieben hatte oder nicht, er hatte jedenfalls eine erstaunliche Vielfalt von Lebewesen auf die Erde gebracht. Das faszinierte Johann schon seit seiner Kindheit. Als Schüler hatte er versucht, ein vollständiges Verzeichnis sämtlicher auf der Welt existierenden Insektenarten zu erstellen. Stolz hatte er sein Werk dem Prior des Klosters präsentiert. Alle vierzehn Arten hatte er auf ein Blatt Papier gemalt und sorgfältig beschriftet. Der Prior hatte nur geschmunzelt, ihn gelobt und ihn ermuntert, herauszufinden, ob es nicht doch noch irgendwo eine fünfzehnte Insektenart gäbe.
Längst hatte Johann den Versuch aufgegeben, ein vollständiges Verzeichnis von irgendetwas zu erstellen – gerade darin lag ja Gottes Größe, dass seine schöpferische Kraft keine Grenze kannte. Doch die Suche nach Erkenntnis hatte seitdem sein Leben beherrscht.
Besonders ein Rätsel hatte ihn nie losgelassen: Warum waren die Lebewesen nicht bunt gemischt? Wieso gab es in den Wäldern seiner Heimat, dem Bistum Münster, andere Vögel als auf den Azoren, auch wenn sich manche nur geringfügig voneinander unterschieden? Warum waren gerade sich ähnelnde Singvogelarten räumlich getrennt, so verschiedene Vögel wie Sperling und Krähe dagegen auf demselben Gebiet heimisch? Was bezweckte Gott mit diesem Ordnungsprinzip?
Johann hegte die Hoffnung, diesem Rätsel auf die Spur zu kommen. Deshalb hatte er sich erboten, diese Expedition in ferne Gefilde zu begleiten. Seine offizielle Aufgabe war die eines Kartographen und Naturkundlers. Er sollte dem König Bericht erstatten, welche Wunder und Schätze sich auf seinem Besitz, einem abgelegenen Eiland mit dem Namen Barbados, wohl finden ließen. Außerdem hatte er das Land zu vermessen und einen geeigneten Ort für die in Kürze zu errichtende Siedlung zu bestimmen. Denn zwei Schiffe mit Siedlern würden der Fairwind im Abstand von sechs Wochen folgen.
Sein persönliches Ziel allerdings bestand darin, einen Vergleich zwischen den Vögeln seiner Heimat und jenen auf Barbados zu erstellen, um so Ähnlichkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten.
Wenn sie doch bloß schon dort wären! Er konnte es kaum abwarten, die Seltsamkeiten der Inseln des Karibischen Meeres mit eigenen Augen zu sehen, von denen er in den Kneipen Dovers gehört hatte. Allerdings würden sie nach Aussage des Kapitäns noch mehr als eine Woche auf See verbringen.
Ein Schrei riss ihn aus seinen Gedanken. An der gegenüberliegenden Reling deutete ein Matrose aufgeregt auf den Ozean. Einige Soldaten liefen zu ihm. Sie diskutierten lautstark, ohne dass Johann den Grund für die Aufregung verstand. Hatten sie einen Wal entdeckt? Oder gar ein Seeungeheuer?
Mit einer Mischung aus Sorge und Neugierde lief Johann quer über das Deck und starrte angestrengt in die Richtung, in die der Matrose zeigte. Tatsächlich, dort draußen war etwas, nicht viel mehr als ein schwarzer Punkt, der hin und wieder über die Wellenkronen hinaus hüpfte. Wie ein Fisch oder ein Krake sah es nicht aus. Ein Stück Treibholz vielleicht.
Einer der Matrosen eilte in die Kapitänskajüte. Kurz darauf erschien Walter Scurrey, ein Sehrohr in der Hand. Er hielt es vors Auge, dann gab er den knappen Befehl, beizudrehen und Kurs auf das unbekannte Objekt zu nehmen.
Bald erkannte Johann, worum es sich handelte: Es war ein kleines Ruderboot, das führerlos auf den Wellen dahin dümpelte. Wie kam es hierher, hunderte von Seemeilen von der nächsten Küste entfernt?
Neue Aufregung entstand, als sie sich dem Boot näherten. Eine reglose Gestalt lag darin, ein einzelner Matrose offenbar.
Ein Beiboot der Fairwind wurde eilig zu Wasser gelassen. Zwei Seeleute kletterten über eine Strickleiter herab und ruderten hinüber zu dem fremden Boot. Sie riefen etwas, das für Johann wie „He's alive!“, er lebt, klang.
Sie nahmen das Boot in Schlepp. Mit Hilfe einer Hängematte aus dem Unterdeck wurde der unbekannte Mann an Bord gehievt. Er bot einen erbärmlichen Anblick: Ausgemergelt, die Haut von der Sonne verbrannt, die Lippen verkrustet, die Augen zugeschwollen. Ein junger Militärarzt, der mit den anderen Soldaten zur Vorhut für die Besiedlung Barbados' gehörte, beugte sich über ihn, betastete Handgelenke und Hals. Dann hielt er ihm eine Trinkflasche an den Mund.
Etwas wie ein Schauder lief durch den Körper des Mannes. Ein Stöhnen entfuhr ihm. Einige der Matrosen sprachen Dankesgebete, was Johann überraschte – Gottesfurcht schien ihm unter Seefahrern eher die Ausnahme als die Regel zu sein.
Der Schiffbrüchige schlug die Augen auf, oder versuchte es jedenfalls, doch seine Lider öffneten sich nur einen Spalt weit
„Wer seid Ihr?“, fragte der Arzt auf Englisch. „Könnt Ihr mich verstehen?“
Der Gerettete murmelte etwas. „Das klingt wie Spanisch“, sagte der Arzt. „Versteht jemand diese Sprache?“
Die Männer blickten sich betreten an. Falls einer von ihnen des Spanischen mächtig gewesen wäre, hätte er es wohl kaum zugegeben, um sich nicht des Verdachts der Spionage für den Feind auszusetzen.
Johann trat vor. „Ich habe einst eine Forschungsreise nach Katalanien unternommen und dabei einige Brocken der Sprache aufgeschnappt“, sagte er. In Wahrheit hatte er fast drei Jahre am Hofe König Philips des IV. verbracht, der Kunst und Philosophie förderte und im Vergleich zu Karl von England wesentlich weltgewandter und belesener war. Er hütete sich jedoch, das zu erwähnen.
Der Gerettete stieß ein Krächzen aus, das kaum wie Worte klang.
„Was hat er gesagt?“, wollte der Kapitän wissen.
„Er hat dem Herrn für seine Rettung gedankt, glaube ich“, sagte Johann, der kaum etwas von dem Gestammel verstanden hatte.
„Fragt ihn, wie er heißt.“
Johann wiederholte die Frage auf Spanisch.
„Pedro Manchez, Herr“, antwortete der Mann etwas deutlicher. „Wasser bitte, Herr.“
Johann übersetzte es.
„Also gut, gebt ihm noch ein paar Schlucke. Aber dann will ich wissen, von welchem Schiff er stammt und wieso er allein hier draußen auf diesem Ruderboot war.“
Johann hielt dem Spanier die Flasche an den Mund. Dieser trank gierig, würgte die Flüssigkeit jedoch kurz darauf, von Krämpfen geschüttelt, wieder heraus.
„Beeilt euch mit der Befragung, Sir Galen“, mahnte der Kapitän. „Ich will wissen, ob es hier in der Nähe eine spanische Flotte gibt, bevor er sein Leben aushaucht.“
Johann gab dem durstigen Mann noch etwas Wasser und ermahnte ihn, es langsam zu trinken. Diesmal behielt er es bei sich, doch war er immer noch geschwächt, so dass sich die Befragung mühsam gestaltete.
Er sei Matrose an Bord der Santa Cruz de Cordoba gewesen, eines Versorgungsschiffs der Spanischen Marine, konnte Johann aus ihm herausbringen. Sie hätten bei klarem Wetter südwestlichen Kurs mit Ziel Kuba gehalten, als plötzlich um das Schiff herum ein seltsames Blitzen und Leuchten erschienen sei. Auf einmal sei dort, wo zuvor nur Meer war, eine Felsenküste aufgetaucht. Man habe noch versucht, beizudrehen, doch das Schiff sei von den Wellen an eine Klippe gedrückt worden und zerschellt. Er allein habe sich in das Beiboot retten können. So unvermittelt, wie es begonnen habe, sei das Leuchten wieder verschwunden, und er habe sich allein auf dem leeren Meer wiedergefunden, ohne jede Spur von dem Schiff und der Küste.
„Der Mann redet wirr“, stellte der Kapitän fest. „Im Umkreis von tausend Seemeilen gibt es hier nichts.“
„Was war das für ein Land?“, fragte Johann auf Spanisch.
Der Schiffbrüchige röchelte etwas. Seine Augenlider begannen zu flattern.
„Redet, Mann! Was für eine Küste soll das gewesen sein, an der Euer Schiff zerschellt ist?“
Der Spanier sagte etwas, das wie „Mygnia“ klang. Dann verließen ihn die Kräfte und er verlor das Bewusstsein.
„Mygnia? Von einem solchen Land habe ich nie gehört“, bemerkte der Kapitän. „Er muss im Fieber fantasiert haben.“
Johann nickte. Doch auch wenn der Mann völlig entkräftet war, so hatte er klar gewirkt.
„Wir setzen die Befragung fort, wenn er wieder zu Bewusstsein kommt“, ordnete der Kapitän an.
Dazu kam es jedoch nicht. Pedro Manchez starb noch in derselben Nacht an Entkräftung.
Kapitän Walter Scurrey befahl eine Seebestattung. Er notierte die Begebenheit im Logbuch der Fairwind zusammen mit der Position, an der man den Schiffbrüchigen aufgenommen hatte: 31 Grad 12 Minuten nördlicher Breite, 40 Grad 36 Minuten westlicher Länge, am 12. Mai im Jahre des Herrn 1627.
Was der Spanier mit seinem rätselhaften letzten Wort gemeint hatte, ob es überhaupt die Bezeichnung des unbekannten Landes gewesen war oder vielleicht nur der Name seiner Geliebten, sollte Johann von Galen nie erfahren.
1.
Wie schon oft kam Alex Mars erst gegen 11 Uhr ins Redaktionsbüro der Zeitschrift Abenteuer Universum. Er hatte gestern noch bis spät in die Nacht an einem Artikel gearbeitet.
Die gedrückte Stimmung schlug ihm entgegen wie ein übler Geruch.
Jenny, die rundliche Assistentin am Empfang, begrüßte ihn nicht wie üblich mit einem lahmen Scherz aus dem Internet, sondern nur mit einem müden „Hallo Alex“. Im Großraumbüro herrschte nicht das normale hektische Stimmengewirr. Wenn überhaupt jemand sprach, dann gedämpft. Selbst das Tastaturgeklapper schien verhaltener zu sein als sonst.
„Morgen, Paula“, sagte Alex zu seiner Kollegin, die am gegenüberliegenden Schreibtisch saß.
„Morgen“, gab sie zurück, ohne ihn anzusehen. Sie starrte auf ihren Monitor, benutzte jedoch weder die Tastatur noch die Maus.
Alex runzelte die Stirn. „Was ist denn los? Ist jemand gestorben?“
Paula traten Tränen in die Augen. „Torben … er hat mir gekündigt“, sagte sie. „Mir, Karl, Lupo … und noch fünf anderen.“
„Was? Wieso das denn?“
Sie schüttelte nur den Kopf. „Die Auflage … die Gesellschafter … was weiß ich.“ Sie blickte ihn mit ihren geröteten Augen an. „Was soll ich bloß machen? Mit meinem abgebrochenen Germanistikstudium krieg ich doch nie wieder einen solchen Job!“
„Torben dreht jetzt wohl völlig ab!“ Alex spürte Zorn in sich aufsteigen. „Er kann doch nicht einfach ein Drittel der Redaktion feuern!“ Zwar befand sich die Auflage des Hefts schon seit Jahren im Sinkflug, und auch die Online-Zugriffszahlen waren nicht berauschend. Aber das war nichts Neues! Deswegen setzte man doch nicht auf einmal so viele Menschen an die Luft!
Alex kam nicht auf die Idee, sich darüber zu wundern oder gar zu freuen, dass es ihn nicht erwischt hatte. Er empfand nur Wut über die Ungerechtigkeit der Aktion, die Willkür irgendwelcher Konzern-Erbsenzähler, für die Menschen aus Fleisch und Blut nur Kostenstellen waren. Er stellte seine Laptoptasche auf den Schreibtisch und ging schnurstracks zum Büro des Chefredakteurs. Er klopfte, wartete jedoch keine Antwort ab, sondern riss die Tür auf und trat ein.
Der Anblick seines Chefs ließ ihn innehalten. Der Zorn, der ihn eben noch angetrieben hatte, verrauchte.
Torben Großkopf sah blass aus, beinahe krank. Obwohl er mit 35 nur ein Jahr älter war als Alex, hatte er nur die Hälfte seines ohnehin dünnen Haupthaars behalten. Der Rest hing ihm in Fransen um die Ohren, die heute noch unordentlicher wirkten als sonst. Er hielt seine Brille – im Unterschied zu Alex' eigener, schwarzer Designerbrille ein billiges Kassengestell - in der einen Hand, eine Zigarette in der anderen, und saß derart zusammengesunken in seinem überdimensionalen Chefsessel, dass er einem Leid tun konnte.
Alex kannte Torben schon seit dem Journalistik-Studium. Zwar hatte er sich den unschmeichelhaften Spitznamen „Großkotz“ nicht ganz unverdient eingefangen, denn es wirkte manchmal überheblich, beinahe arrogant, wie er mit englischen Fachwörtern um sich warf, die er in irgendwelchen Konzernmeetings aufgeschnappt hatte. Doch im Grunde war er immer ein fairer und verständnisvoller Chef gewesen. Außerdem verdankte Alex ihm seinen Job.
„Was … was soll das, Torben?“, fragte er mit weit weniger Schärfe als ursprünglich beabsichtigt.
„Hallo Alex. Setz dich.“
Er folgte der Aufforderung. „Was zum Kuckuck ist hier eigentlich los?“
„Ich hatte gestern Abend ein Meeting mit dem Kaufmännischen Leiter. Es ist leider so, dass wir massiv Kosten sparen müssen. Du kennst ja die Zahlen. Gegenüber Vorjahr ist die Auflage um 21 Prozent gesunken. Wir sind nur noch knapp über 50.000 verkauften Exemplaren. Vom Rückgang der Anzeigenumsätze mal ganz zu schweigen.“
„Damit sind wir immer noch Marktführer. Und dass sich der gesamte Zeitschriftenmarkt negativ entwickelt, dafür können wir doch nichts.“
„Nein, dafür kann keiner was. Aber das bedeutet nun mal, dass man Kosten reduzieren muss. Schließlich sind wir ein Wirtschaftsunternehmen und kein Wohltätigkeitsverein, wie der Verleger immer sagt.“
„Der soll erstmal seinen Ferrari verkaufen, bevor er hier Stellen streicht!“, protestierte Alex, obwohl er wusste, dass solche Klassenkampfparolen sinnlos waren.
„Immerhin, die Redaktion wird nicht dichtgemacht“, sagte Torben. „Wir haben noch mal sechs Monate Zeit bekommen, um wieder auf eine verkaufte Auflage von über 100.000 zu kommen.“
Alex brauchte einen Moment, bis er seine Sprache wiederfand. „100.000? Eine Auflagenverdoppelung in einem halben Jahr? Wie soll das denn gehen? Und was bitte meinst du mit ‚nicht dichtgemacht‛?“
„Du hast das schon genau richtig verstanden. Die aktuellen Stellenstreichungen sind nur der Anfang. Wenn wir die Auflage nicht steigern, wird das Magazin eingestellt.“
„Das … das können die doch nicht …“, setzte Alex an, dabei wusste er genauso gut wie Torben, dass die das sehr wohl konnten.
„Und … warum ausgerechnet Paula? Und Lupo, ist der nicht so eine Art Shooting star in der Redaktion?“
„Ist mit dem Betriebsrat abgestimmt. Sozialauswahl, du weißt schon - Betriebszugehörigkeit, Familienstand, Alter, all das. Wenn's nach mir gegangen wäre, hätte ich lieber Lupo behalten anstatt zum Beispiel Krause, aber der hat halt Kinder.“
Da war sie wieder, Torbens arrogante Ader. Doch Alex brachte nicht die Energie auf, um wütend zu werden. „Wenn es hilft, dann … dann gehe ich und du behältst dafür Paula. Die hat doch null Chancen, wieder einen Job als Redakteurin zu bekommen.“
„Hier geht es nicht bloß um Paulas Job oder deinen, Alex. Es geht ums Überleben dieses gottverdammten Magazins! Du bist nun mal der beste Redakteur, den ich habe. Wie soll ich ohne dich auf über 100.000 verkaufte Hefte kommen?“
„Genauso wie mit mir: gar nicht. Das ist schlicht nicht machbar.“
„Du findest also, wir sollten gleich aufgeben und den anderen auch noch kündigen?“
„Ich finde, wir sollten uns das nicht einfach so gefallen lassen!“
„Und was willst du tun? Streiken? Das dauert ein halbes Jahr, dann ist endgültig Feierabend.“
„Hast du eine bessere Idee?“
Torben beugte sich vor. Ein wenig der Energie, die er immer ausgestrahlt hatte, kehrte in sein Gesicht zurück. „Wir müssen das Konzept ändern! Wir müssen mehr über die Dinge schreiben, die die Leute wirklich interessieren. Dann haben wir vielleicht eine Chance!“
„Was meinst du damit?“
„Ich glaube, wir müssen das Wort ‚Abenteuer‛ in unserem Namen wieder mehr in den Vordergrund rücken. Dafür brauchen wir bloß den Begriff ‚Wissenschaft‛ etwas weiter zu fassen als bisher.“
„Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.“
„Also gut, dann werde ich konkreter: Parapsychologie, Astrologie, Religion, Leben nach dem Tod. Themen, die etwas mit dem Universum zu tun haben und die die Menschen eben interessieren. Besonders ältere Menschen, die überhaupt noch gedruckte Hefte kaufen.“
Alex starrte seinen alten Freund eine gefühlte Minute lang mit offenem Mund an. „Du … du willst über den Einfluss von Jupiter auf das Liebesleben schreiben? Das ist doch hoffentlich nicht dein Ernst, oder?“
Torben hob abwehrend die Hände. „Nein nein, so natürlich nicht. Es geht immer noch um eine wissenschaftliche Betrachtungsweise. Nur eben nicht mehr so einseitig. Wir haben uns zum Beispiel überhaupt nicht mit den Argumenten der Astrologen beschäftigt. Wir haben nicht mal einen von denen interviewt.“
„Wozu denn auch? Deren so genannte Argumente sind doch bloß Augenwischerei für leichtgläubige Laien!“
„Siehst du, das meine ich mit einseitig.“
Alex gefiel die Richtung, die dieses Gespräch nahm, immer weniger. „Die Wahrheit ist nun mal einseitig: Entweder etwas ist richtig oder es ist falsch.“
„Das magst du so sehen, aber die meisten Menschen da draußen denken anders.“
Alex stand auf. „Ich glaube, ich habe genug gehört. Wenn das hier ein pseudowissenschaftlich-esoterisches Käseblatt werden soll, bin ich draußen. Frag Paula, ob sie da mitmacht – ich definitiv nicht!“ Er wandte sich um.
„Jetzt warte doch mal!“, rief Torben. „So hab ich das doch nicht gemeint! Herrgott, Alex, glaubst du, mir macht das alles Spaß? Bitte, setz dich wieder! Außerdem muss ich noch was mit dir besprechen.“
Alex drehte sich zu ihm um. „Was denn?“
„Es geht um einen Artikel, den du schreiben sollst. Über das Hochfahren des LHC am CERN.“
Der Large Hadron Collider am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf war der größte und leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger der Welt. Nach einer fast zweijährigen Umbaupause, in der die Leistung der Anlage verbessert worden war, sollte er in wenigen Tagen wieder in Betrieb genommen werden, um nach einer kurzen Testphase Atomkerne mit annähernd Lichtgeschwindigkeit aufeinander prallen zu lassen. Eigentlich ein eher unspektakuläres Thema.
„Was soll ich tun? Darüber schreiben, ob es da spukt?“
„Ich möchte, dass du hinfährst und dir ein unabhängiges Bild machst. Die Meinung der Wissenschaftler einholst, aber auch die der Gegner.“
„Was denn für Gegner?“
„Es gibt immer noch Widerstand dagegen, dass die Anlage wieder angefahren wird. Für Donnerstag ist eine große Protestaktion angekündigt.“
„Ich dachte, das Thema wäre längst durch.“ Bevor der LHC im März 2010 in Betrieb genommen worden war, hatte es in der Öffentlichkeit umfangreiche Diskussionen gegeben. Einige so genannte Wissenschaftler hatten Befürchtungen geäußert, bei den geplanten Experimenten könnten schwarze Löcher entstehen, die die Welt vernichten würden. Alle Beteuerungen der CERN-Physiker, das sei völlig ausgeschlossen, halfen nur wenig. Erst als die Anlage in Betrieb ging und ohne Zwischenfälle lief, verstummte der Protest.
„Ist es nicht. Immerhin ist der LHC bisher bloß mit der Hälfte seiner Maximalenergie von 14 Teraelektronenvolt gelaufen. Die Einwände der Gegner sind im Prinzip immer noch dieselben.“
„Aber das ist doch Unfug! Täglich treffen Teilchen mit weit höherer Energie auf unsere Atmosphäre!“
„Mag sein. Trotzdem möchte ich, dass du vorurteilsfrei und ausgewogen über die Sache berichtest. Lass die Gegner zu Wort kommen, nimm sie genauso ernst wie die Befürworter.“
„Du meinst, ich soll hysterische Laien und paranoide Spinner auf eine Stufe mit renommierten Wissenschaftlern stellen?“
„Du weißt, was ich meine. Außerdem wurden Leute wie Darwin oder Kopernikus von ihren Zeitgenossen ebenfalls als Spinner angesehen. Am Ende haben sie recht behalten.“
Alex seufzte. „Na schön, ich rede mit denen. Aber wenn du glaubst, dass wir damit die Auflage auf über 100.000 kriegen, liegst du genauso daneben wie die Gegner des LHC mit ihren schwarzen Löchern.“
Torben zuckte mit den Schultern. „Wir werden ja sehen.“
2.
Das CERN lag nur wenige Minuten vom Genfer Flughafen entfernt. Alex hatte einen Termin mit dem Pressesprecher, Dr. Francois Delandre. Sie hatten sich am Besucherzentrum verabredet, das am Rand des ausgedehnten Campus der Forschungsanlage lag.
Auf dem Parkplatz harrte ein Dutzend Demonstranten im Nieselregen aus. Sie boten einen armseligen Anblick. Zwei von ihnen hielten ein Transparent, auf dem „End of the World – made in Switzerland“ stand. Sie alle trugen neongelbe Regencapes mit Radioaktivitäts-Warnzeichen.
Alex schüttelte den Kopf. Die Leute konnten einem fast leidtun. Kein Mensch beachtete sie.
Als er sich der Gruppe näherte, blickten ihn die Demonstranten neugierig an. Einer hob ein Megafon und begann, irgendwelche Parolen auf Französisch zu skandieren. Als Alex sich demonstrativ die Hände vor die Ohren hielt, senkte er das Gerät wieder.
Alex ging auf eine junge Frau zu, deren regennasses braunes Haar ihr im Gesicht klebte. Wenn er schon mit diesen Hysterikern reden musste, konnte er sich wenigstens einen hübschen Gesprächspartner aussuchen.
„Wogegen protestieren Sie hier eigentlich?“, fragte er auf Deutsch.
Die Frau lächelte ihn an, sichtlich froh, dass sich jemand für ihr Anliegen interessierte. „Gegen Arroganz und Überheblichkeit.“
Alex, der irgendeinen pseudowissenschaftlichen Schwachsinn oder diffuse Technologieängste zu hören erwartet hatte, blickte sie überrascht an. „Was meinen Sie damit?“
„Sind Sie Mitarbeiter des CERN?“
„Nein, ich bin Journalist.“ Er spürte, wie sich bei dieser Aussage Köpfe in seine Richtung drehten.
„Oh!“ Ihr Lächeln wurde breiter. „Welche Zeitung?“
„Eine Zeitschrift. Abenteuer Universum.“
„Schön, dass Sie hier sind! Ich …“, begann die Frau, doch in diesem Moment zog einer der Demonstranten Alex an der Jacke.
„Mein Name ist Richard Forster“, sagte er auf Englisch. „Ich bin Physiker. Nach meinen Berechnungen besteht eine signifikante Gefahr, dass bei Protonenkollisionen mit Energien von mehr als 12 Teraelektronenvolt Seltsame Materie entsteht. Sie wissen, was das ist, Seltsame Materie?“
Alex wollte sich wieder der jungen Frau zuwenden, doch der Physiker ließ nicht locker. „Seltsame Materie entsteht, wenn sich ein Down-Quark unter großem Druck in ein Strange-Quark verwandelt und so aus einem Baryon ein Hyperon wird. Die so genannten etablierten Wissenschaftler behaupten, Hyperonen könnten auf der Erde nicht stabil existieren. Doch das Perfide ist, dass sie das sehr wohl können, vorausgesetzt, es gibt genug von ihnen. Die haben nämlich eine selbststabilisierende Wirkung. Und wenn genügend Hyperonen auf engem Raum entstehen, haben Sie Seltsame Materie. Und dann? Dann setzt eine Kettenreaktion ein, bei der immer mehr normale Materie in Seltsame Materie umgewandelt wird. Das ist unumkehrbar. Die gesamte Welt wird in Sekunden zu einem Klumpen Hyperonen zusammenschmelzen. Begreifen Sie, was das heißt?“
Alex nickte pflichtschuldig. Er hatte einen Artikel über das Thema geschrieben und wusste genug darüber, um die Argumentation nachzuvollziehen. Tatsächlich würde eine erbsengroße Kugel aus Seltsamer Materie ausreichen, um die Erde zu vernichten. Doch wenn sie so leicht entstünde, wie dieser Forster behauptete, gäbe es das Sonnensystem schon längst nicht mehr. Außerdem existierte sie bisher bloß in der Theorie – im gesamten Universum hatte man noch keinen Hinweis darauf gefunden, dass bei natürlichen Prozessen tatsächlich Seltsame Materie in signifikanten Mengen entstanden war. Er hütete sich jedoch, Gegenargumente zu nennen – das fanatische Leuchten in den Augen des Mannes signalisierte, dass er nicht klein beigeben würde, bis er entweder sein Gegenüber überzeugt hatte oder vor Entkräftung zusammenbrach.
Torben Großkopf hatte schon eine Menge bescheuerter Ideen gehabt, aber diese gehörte definitiv zu seinen schlechtesten.
„Es tut mir leid, ich habe jetzt einen Termin“, sagte Alex und drängelte sich an dem immer noch lamentierenden Physiker vorbei in Richtung des Besucherzentrums. Er warf der jungen Frau einen bedauernden Blick zu.
Dr. Francois Delandre ließ Alex fast eine halbe Stunde in einem schlicht eingerichteten Besprechungsraum warten. Er entschuldigte sich nicht für die Verspätung. Der Druck seiner perfekt manikürten Hände war fest, sein Lächeln professionell.
„Was kann ich für Sie tun, Monsieur Mars?“, fragte er auf Deutsch mit leichtem französischen Akzent. „Möchten Sie eine Führung durch die Anlage?“
„Später vielleicht. Zuvor würde ich gern mit Ihnen über mögliche Risiken beim Wiederanfahren des LHC sprechen.“
Delandre lächelte milde. „Risiken? Ich verstehe nicht, was Sie meinen.“
Alex spürte, wie seine intuitive Abneigung gegenüber diesem gelackten Schnösel zunahm. Immerhin hatte er seinen Terminwunsch in einer langen E-Mail begründet, in der er explizit auf die im Internet veröffentlichten Argumente der LHC-Gegner eingegangen war. Entweder hatte Delandre sie nicht gelesen, oder er tat bloß so.
„Da draußen stehen Demonstranten, die vor möglichen Gefahren eines Wiederanfahrens warnen“, sagte Alex und zeigte auf das Fenster.
Delandre nickte. „Sehen Sie, wenn man etwas Neues macht, gibt es dagegen immer Widerstand. Menschen misstrauen dem Unbekannten. Das ist ein Impuls, den uns die Evolution mitgegeben hat. In der Steinzeit war er sicher nützlich, aber heute behindert er den Fortschritt. Wenn wir jedes Mal auf die Zweifler und Mahner gehört hätten, dann würden wir noch mit Pferdekutschen herumfahren und Kranke zur Ader lassen, statt ihnen Medikamente zu verabreichen.“
„Sie sind also der Meinung, dass man die Risiken der Forschung ignorierten sollte?“, fragte Alex.
Delandre machte ein erschrockenes Gesicht. „Selbstverständlich nicht! Aber um diese Risiken zu beurteilen, benötigt man Fachkompetenz. Die ist hier am CERN in einer Menge vorhanden wie an keinem anderen Ort der Welt. Mehrere Nobelpreisträger arbeiten an unseren Experimenten mit. Glauben Sie mir, wir haben sämtliche Risiken, die sich aus dem Betrieb des Beschleunigers ergeben könnten, sehr sorgfältig geprüft. All das ist längst öffentlich ausdiskutiert worden. Es gab mehrere Gerichtsverfahren, die Gegner gegen uns eingeleitet hatten. In allen Fällen haben wir obsiegt. Außerdem betreiben wir hier schon seit Jahren Forschung, ohne dass irgendetwas passiert wäre. Aber das wissen Sie sicher alles, als Redakteur, der seine Hausaufgaben gemacht hat, nicht wahr?“
Alex fühlte sich mehr und mehr genötigt, die Kritiker der Experimente zu verteidigen. Dabei war er doch selbst der Meinung, dass die Ängste der Menschen irrational und unbegründet waren. Doch Delandres arrogante Art machte es ihm unmöglich, einfach zuzustimmen. „Bis jetzt ist der LHC nur bis zur Hälfte seiner maximalen Energie hochgefahren worden. Woher wollen Sie wissen, was passiert, wenn Sie 14 Teraelektronenvolt erreichen?“
„Das Standardmodell der Physik sagt ziemlich genau voraus, was dann passieren wird“, erklärte Delandre.
„Wenn das schon vorher klar ist, warum bauen Sie dann eine Anlage, die viele Milliarden Euro kostet? Ist das nicht eine enorme Verschwendung von Steuergeldern?“
Delandres Miene verdüsterte sich. „Die Investitionen in diese einzigartige Forschungseinrichtung werden von zwanzig Ländern gemeinsam getragen. Ähnlich wie die Internationale Raumstation ISS sind wir ein Projekt, an dem fast die gesamte Menschheit beteiligt ist und von dem alle Menschen profitieren. Wir tragen also nicht nur zur Forschung bei, sondern auch zur Völkerverständigung. Und um Ihre Frage zu beantworten: Wir wissen zwar schon ziemlich viel über den Aufbau des Universums, aber einige wichtige Details fehlen uns noch, und genau die erforschen wir hier.“
„Mit ‚Details‛ meinen Sie sicher die Tatsache, dass Sie keine Ahnung haben, woraus 95 Prozent aller Energie und Materie bestehen, nicht wahr?“
„Ich würde nicht sagen, dass wir ‚keine Ahnung‛ haben“, widersprach Delandre. „Es gibt verschiedene Theorien dazu. Wir wissen nur noch nicht, welche richtig ist.“
„Und wenn sie alle falsch sind? Wenn sich herausstellt, dass wir genauso daneben liegen wie die Physiker gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit ihrer Äther-Theorie? Was, wenn die Gegner da draußen am Ende recht behalten? Immerhin hat man auch Kopernikus und Darwin als Spinner abgetan.“ Alex stellte verblüfft fest, dass er gerade dieselben fadenscheinigen Argumente benutzt hatte wie Torben vorgestern. War es wirklich so leicht, auf den wissenschaftlichen Holzweg zu geraten? Bloß weil einem jemand, der die Wahrheit vertrat, unsympathisch war?
„Nur, weil manche Zeitgenossen Kopernikus als Narr bezeichnet haben, heißt das nicht, dass jeder Narr ein Kopernikus ist“, sagte Delandre mit süffisantem Lächeln. „Natürlich wissen wir vieles noch nicht, sonst bräuchten wir den LHC nicht, da haben Sie recht. Vielleicht stellen sich am Ende alle unsere Theorien über das Universum als falsch heraus. Aber deswegen geschehen hier noch lange keine Wunder.“
„Einige Physiker behaupten, dass bei den Teilchenkollisionen unter bestimmten Umständen Schwarze Löcher entstehen könnten.“
Delandre setzte wieder sein arrogantes Lächeln auf. „Diese Argumentation wurde bereits 2007 überzeugend widerlegt. Wenn tatsächlich winzige Schwarze Löcher entstehen würden, was extrem unwahrscheinlich ist, so wären diese instabil und würden innerhalb von Nanosekunden zerstrahlen.“
„Was ist mit Seltsamer Materie?“, fragte Alex, dem die Argumente ausgingen.
Delandre zog eine Augenbraue hoch. „Wie kommen Sie darauf, dass hier Seltsame Materie entstehen könnte?“
„Es ist eine Theorie, die die Gegner der Versuche vertreten.“
„Sie meinen die Pamphlete von diesem Scharlatan Richard Forster? Sie wollen ernsthaft, dass wir uns mit diesem Unfug auseinandersetzen? Dr. Forster hat hier am CERN gearbeitet. Es gab einige Unregelmäßigkeiten, daraufhin wurde er entlassen. Seitdem führt er einen persönlichen Rachefeldzug gegen uns. Seine Argumente halten einer wissenschaftlichen Prüfung nicht stand. Sehen Sie, es ist nämlich so …“
Delandre ging zum Flipchart und schrieb ein paar komplizierte Formeln auf. Er begann in einem langen Monolog die physikalischen Grundlagen der Seltsamen Materie zu erläutern und darzulegen, warum es völlig unmöglich sei, dass sie bei Teilchenkollisionen mit einer Energie von maximal 14 Teraelektronenvolt entstehen könne. Alex, der als Journalist nur über Grundkenntnisse der theoretischen Physik verfügte, konnte den Ausführungen kaum folgen, schwieg jedoch. Er wusste, dass Delandre hier bloß eine Show abzog, um ihn mit seinem Wissen zu beeindrucken.
„Ich hoffe, damit ist alles geklärt“, sagte der Pressesprecher schließlich. „Haben Sie noch weitere Fragen? Ansonsten schlage ich vor, dass Sie den Globe of Science and Innovation, unser populärwissenschaftliches Museum, besuchen. Dort erhalten Sie detaillierte Informationen über die Experimente, die wir hier durchführen. Ich habe jetzt leider den nächsten Termin. Herzlichen Dank, dass Sie sich herbemüht haben, Monsieur Mars. Auf Wiedersehen.“
Alex bedankte sich für das Gespräch. Als Delandre gegangen war, sah er auf die Uhr. Der Termin hatte kaum mehr als eine halbe Stunde gedauert. Sein Rückflug ging erst am späten Nachmittag. Was für eine Geld- und Zeitverschwendung!
Auch wenn ihm der Mann unsympathisch war, wusste Alex, dass der Pressesprecher mit seinen Argumenten recht hatte. Es gab nichts zu sagen, was nicht schon gesagt worden war. Wie er aus dieser Lappalie einen spannenden Artikel machen sollte, war ihm schleierhaft.
Als Alex aus dem Besucherzentrum heraus trat, hatte der Regen aufgehört. Die Demonstranten diskutierten mit ein paar in Jeans und T-Shirts gekleideten jungen Leuten, wahrscheinlich Studenten oder Mitarbeiter des CERN. Der englische Physiker textete gerade einen bärtigen Mann zu, wobei er seine Ausführungen mit ausladenden Armbewegungen unterstrich.
Die Frau, mit der Alex vorhin hatte sprechen wollen, stand etwas abseits, ohne sich an den Gesprächen zu beteiligen. Sie wirkte gelangweilt.
Alex ging auf sie zu. Sie lächelte, als sie ihn wiedererkannte. „Haben Sie Antworten auf Ihre Fragen bekommen?“
„Noch nicht auf alle“, sagte er. „Haben Sie Lust, einen Kaffee mit mir zu trinken?“
Die Frau erschrak ein wenig und blickte sich hilfesuchend um, doch alle ihre Mitstreiter waren in Diskussionen vertieft. Gerade lachte einer der Studenten laut über eine Behauptung eines CERN-Gegners und tippte sich an die Stirn.
„Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht viel erzählen“, sagte sie. „Ich verstehe ehrlich gesagt kaum etwas von Physik.“
„Umso besser“, erwiderte Alex. „Kommen Sie, ich glaube, hier wird Sie bis auf Weiteres niemand vermissen.“
Sie lächelte. „Da haben Sie wohl recht. Also schön.“