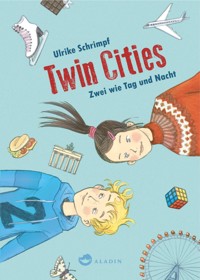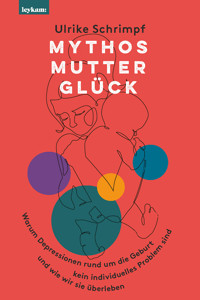
17,99 €
Mehr erfahren.
Mentale Gesundheit und Elternschaft Eine persönliche Geschichte verwoben mit wissenschaftlichen Fakten und einem hoffnungsvollen Blick nach vorn Schwangerschaft, Geburt und die ersten Jahre mit einem Kind werden in unserer gesellschaftlichen Erzählung als etwas Selbstverständliches dargestellt, das für alle Beteiligten in einem Happy End mündet. Ulrike Schrimpf erkrankte nach der Geburt ihres zweiten Sohnes an einer postpartalen Depression. Ihre Erfahrungen teilt sie in hier in einer fesselnden Mischung aus persönlichem Memoir, wissenschaftlicher Erkundung und wertvollen Einblicken in die Gedanken- und Empfindungswelt von Betroffenen. Berührend und informativ schildert sie Krankheitsbild, Therapiemöglichkeiten und wie es ihr gelang, den Mut aufzubringen, um danach ein weiteres Kind zu bekommen. Wir müssen realistisch und nuanciert über Mutter- und Elternschaft sprechen, um falsche Ideale zu entlarven und um den Weg zu bereiten für politische und gesellschaftliche Veränderungen, die Eltern und Kindern wirklich helfen – und damit uns allen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Mythos Mutterglück - Warum Depressionen rund um die Geburt kein individuelles Problem sind und wie wir sie überleben
Schwangerschaft, Geburt und die ersten Jahre mit einem Kind werden in unserer gesellschaftlichen Erzählung als etwas Selbstverständliches dargestellt, das für alle Beteiligten in einem Happy End mündet.
Ulrike Schrimpf erkrankte nach der Geburt ihres zweiten Sohnes an einer postpartalen Depression. Ihre Erfahrungen teilt sie in hier in einer fesselnden Mischung aus persönlichem Memoir, wissenschaftlicher Erkundung und wertvollen Einblicken in die Gedanken- und Empfindungswelt von Betroffenen. Berührend und informativ schildert sie Krankheitsbild, Therapiemöglichkeiten und wie es ihr gelang, den Mut aufzubringen, um danach ein weiteres Kind zu bekommen.
Wir müssen realistisch und nuanciert über Mutter- und Elternschaft sprechen, um falsche Ideale zu entlarven und um den Weg zu bereiten für politische und gesellschaftliche Veränderungen, die Eltern und Kindern wirklich helfen – und damit uns allen.
Peripartale Depressionen betreffen bis zu 27 Prozent aller Mütter und mindestens 5 Prozent aller Väter.
Über die Autorin:
Ulrike Schrimpf hat Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Französische Philologie studiert. Seit 2010 lebt und arbeitet sie als freie Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Dozentin in Wien. Sie publizierte Romane, Lyrik, Fach- und Sachbücher, für die sie verschiedene Auszeichnungen und Stipendien erhalten hat. Ihr aktueller Roman »Lauter Ghosts« (Literatur Quickie Verlag) erschien 2023.
Newsletter des Leykam Verlags
In unserem Newsletter informieren wir Sie über aktuelle Veranstaltungen unserer Autor*innen, neue Bücher und besondere Angebote. Hier geht es zur Anmeldung: https://mailchi.mp/leykamverlag/newsletter
leykam:seit 1585
Für
Claudia
(Dr. Claudia Reiner-Lawugger)
und
Maria
(Dr. Maria Weissenböck),
die meine behandelnden Ärztinnen und Psychotherapeutinnen in Wien waren und Freundinnen geworden sind.
Dr. Brigitte Schmid-Siegel,
meine behandelnde Psychiaterin im Allgemeinen Krankenhaus Wien, in das ich 2011 mit einer postpartalen Depression aufgenommen wurde, und die sich 2018 das Leben genommen hat.
Das lässt mich nicht los.
Sie war ein beeindruckender, besonderer Mensch.
Und sie hat mir sehr geholfen.
Für alle Menschen, die an einer Depression rund um die Geburt erkranken.
Für ihre Kinder und Angehörigen.
Inhalt
Vorwort Du erkennst dich nicht wieder.
I Mutter werden
II Mutter sein
Du kommst dir selbst abhanden. Die Diagnose „peripartale Depression“
Vielleicht sind Sie auch einfach eine Frau, die immer besonders viel auf einmal will? Perfektionismus und Isolation
Die Rückbildung der Gebärmutter auf ihre normale Größe. Der Verlust des Wochenbetts
Was unsere Identität bestimmt
Eine gute Mutter stillt ihr Kind.
Ein Hort ist gut, eine Mutter ist besser. Rabenmütter, Pelikanmütter und das Projekt Kind
Eine Phase der Indifferenz. Der sogenannte Mutterinstinkt
Mutterschaft als Stigma?
Muttergöttinnen. Mutterbilder des kollektiven Unbewusstseins in Mythen, Religion und Märchen
Fremdbetreuung
Ein Schreckgespenst: die Mutter-Kind-Bindungsstörung
Utopische Mütter. Gesellschaftliche und individuelle Mutterbilder
Mutter Seelen allein. Mütter und ihre eigenen Mütter
Wer ist diese Frau? Die Situation der Partner und Angehörigen
#regrettingmotherhood vs. Mütter mit peripartaler Depression
III Risikofaktor Leben
Vulnerabilität und Vorgeschichte
Umzug nach Wien
Er hat so ein freundliches Gesicht. Patchworkfamilie
IV Psychische Erkrankungen rund um die Geburt
Babyblues
Die postpartale Belastungsstörung und die postpartale Depression
Die postpartale Psychose
V Behandlung
Keiner wird dir glauben, dass du krank bist! Aufnahme ins Krankenhaus
Psychopharmaka allgemein und in der Schwangerschaft und Stillzeit
Das ist oft wie ein Dammbruch. Verschiedene Therapieformen
Heilsames Denken – Beneficial Thinking
VI Wie ein Delphin, der aufwärts schwimmt. Heilung?
Einmal depressiv – immer depressiv?
Noch ein Kind? Bist du verrückt?!
VII Familie
Unsere Zukunft. Kinder von Betroffenen
Wenn gar keine Feinfühligkeit von Seiten der Mutter spürbar ist. Folgen für die Kinder
Die haben das jetzt auch noch? Männer mit peripartaler Depression
VIII Wie es weitergehen kann
Vorschläge und Beispiele
Die im Dunkeln bleiben
Anhang
Anmerkungen
Quellenverzeichnis
Informationszentren, Websites usw.
Dank an
Die einzige einigende, von allen Frauen und Männern geteilte, unbestreitbare Erfahrung besteht aus der monatelangen Zeit, die wir im Innern eines Frauenkörpers gelebt haben, um uns zu entfalten. Die meisten von uns erfahren Liebe und Enttäuschung, Macht und Zärtlichkeit zuerst in der Person einer Frau. Den Stempel dieser Erfahrung tragen wir unser Leben lang mit uns herum, sogar bis zur Stunde unseres Sterbens.
Adrienne Rich
Vorwort
Du erkennst dich nicht wieder.
Im Halblicht der nachlassenden Nacht stehe ich im Badezimmer und sehe in den Spiegel. Vor mir steht ein Mensch, den ich nicht kenne. Ich kann ihn nicht identifizieren. Erst recht nicht mit mir. Der Mensch ist wahrscheinlich eine Frau. Sie hat ein bleiches Gesicht und aufgerissene Augen. Ihre Gesichtszüge erscheinen mir seltsam verwaschen und aufgequollen. Die Frau hebt ihre Hand und streicht sich durch die Haare. Sie zittert, obwohl es nicht kalt ist. Sie schwitzt, obwohl es nicht heiß ist. Ihr Oberkörper schwankt, als könnte sie sich nicht aufrecht halten. Ihre Beine knicken ein. Sie beugt sich nach vorne und legt den Oberkörper und den Kopf in dem Waschbecken ab. Im Hintergrund klingelt ein Wecker. Kurz darauf beginnt ein Baby zu quäken.
Ich beobachte die Frau im Spiegel. Sie ist eine Fremde. Ich weiß, dass sie ich ist, aber ich fühle es nicht. Schon lange spüre ich mich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo mein Körper anfängt und wo er aufhört. Ich kann nichts mehr mit ihm anfangen.
Langsam, mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt, lasse ich mich zu Boden gleiten. Meine Beine zucken unkontrolliert. In dem Moment verstehe ich, dass ich nicht mehr kann. Ich kann nicht mehr und ich muss mir Hilfe holen.
Ich bin damals fünfunddreißig Jahre alt und habe vor knapp drei Monaten meinen zweiten Sohn auf die Welt gebracht. Mika war ein absolutes Wunschkind. Mein erster Sohn Johannes, für den das Gleiche gilt, ist fünf, und wir leben seit vier Monaten zusammen mit meinem Mann Jens in Wien. Er ist auch der Vater von Mika.
Ich verstehe nicht, was mit mir los ist und warum es mir schlecht geht, zumal ich schon einmal eine Geburt und die erste Zeit nach der Entbindung erlebt habe. Ich begreife nicht im Ansatz, was mit mir passiert. Und ich fühle mich unbehaust: Ich habe kein Zuhause mehr in mir selbst. Das ist das furchtbarste Gefühl, das ich kenne.
Stellt man die Frage, woran mehr Mütter* erkranken, die ein Kind bekommen haben – an einer Brustentzündung oder an einer peripartalen Depression –, so kommt die immer gleiche Antwort: Natürlich häufiger an einer Brustentzündung! Tatsächlich liegt die Vermutung nahe: Seit das Stillen in den 1980er-Jahren neu propagiert wurde, wissen viele Menschen, was eine Brustentzündung ist. Zu wenige sind jedoch bis heute über die peripartale Depression informiert, also über eine bestimmte Form von Depression, die rund um die Geburt eines Kindes bei den Müttern auftreten kann. Allerdings stimmt die Antwort nicht: Während nur fünf Prozent der stillenden Mütter an einer Brustentzündung erkranken, leiden bis zu 30 Prozent aller Frauen, die ein Kind auf die Welt bringen, an einer peripartalen Depression und – auch das wird erst seit kurzer Zeit immer bekannter – mindestens 15 Prozent aller Männer, die Vater werden.
Über Depressionen im Allgemeinen wissen wir mittlerweile immer mehr und genauer Bescheid, auch weil immer mehr Prominente sich zu ihnen äußern und über sie schreiben. Die Informationslage in Bezug auf die peripartale Depression ist aber immer noch unzureichend, sowohl unter medizinischem Fachpersonal als auch unter Lai*innen.
Bei der Erkrankung geht der Schrecken einer Depression einher mit einem der schönsten, überwältigendsten Ereignisse auf der ganzen Welt: mit der Geburt eines Kindes. Die Person, die die beiden Extreme gleichzeitig erlebt, gerät in einen Widerspruch, der sie zu zerreißen droht. Denn die Erfahrung, ein Kind zu bekommen und Mutter oder Vater zu werden, ist und bleibt ein irreversibles Wunder. Etwas, was man nie vergisst. Es ist ein totaler Einschnitt in das eigene Leben, der die Welt stillstehen lässt und den Dingen eine neue Dimension verleiht. Man sieht und erlebt von dem Moment an die Welt mit anderen Augen. Das ist nicht nur für gesunde, glückliche Eltern so, sondern auch für Eltern, die an einer peripartalen Depression leiden.
Bei rund 800.000 Geburten in Deutschland und Österreich im Jahr 2022 sind gemäß der bekannten Prozentzahlen rund 250.000 Frauen an einer peripartalen Depression erkrankt sowie rund 125.000 Männer. Das macht 375.000 direkt von der Krankheit betroffene Menschen in beiden Ländern und in einem Jahr. Diese Zahl verdoppelt sich jedes Jahr, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, abhängig von der Anzahl der Geburten. Nicht nur die Mütter und die Väter sind von der Krankheit betroffen, sondern indirekt auch ihre Kinder: die, die gerade geboren wurden, und die, die zum Zeitpunkt der Geburt ihrer Geschwisterkinder schon auf der Welt waren.
„Der häufigste Grund für Müttersterblichkeit in Deutschland ist immer noch der Suizid aufgrund einer postpartalen Depression“, schreibt Jana Heinicke in ihrem Buch Aus dem Bauch heraus. Wir müssen über Mutterschaft sprechen.1 Das ist ein Zustand, der nicht angeht. Den ich nicht ertrage. Und den ich nicht – mehr – hinnehmen will. Deshalb habe ich dieses Buch über die peripartale Depression geschrieben: für alle Betroffenen, ihre Angehörigen, die Menschen, die sie behandeln und medizinisch sowie therapeutisch mit ihnen zu tun haben, Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen, Hebammen und Doulas, und für die Kinder der Betroffenen. Denn es gibt auch gute Nachrichten. Besonders diese liegen mir am Herzen, und ich will dazu beitragen, sie mehr zu verbreiten:
•
Die peripartale Depression ist keine schwierige oder komplizierte psychische Erkrankung.
•
Sie ist gut behandelbar und geht wieder vorbei.
•
Es gibt Medikamente, die effektiv und sicher helfen und die man auch in der Schwangerschaft und danach problemlos und ohne Nebenwirkungen für das Kind einnehmen kann.
•
Kinder von Eltern, die an einer peripartalen Depression erkranken, können selbst zu vollständig gesunden und glücklichen Menschen heranwachsen.
•
Die Tatsache, dass man bei der Geburt eines Kindes an einer peripartalen Depression erkrankt, bedeutet nicht, dass man automatisch immer und bei jeder Geburt eines Kindes daran erkranken wird.
Irgendwann wird die Erkrankung, wenn wir sie behandeln lassen, nur noch als dunkler Schatten der Vergangenheit in unserem Leben aufscheinen, vielleicht als Mahnmal, eine schreckliche Erinnerung, ein Meilenstein, möglicherweise auch als Wendepunkt. Aber sie wird es nicht mehr bestimmen, und wir werden wieder dazu in der Lage sein, uns im Spiegel zu erkennen und zu fliegen „bis ans Ende der Stadt, ans Ende der Welt und über den Rand“:
Ich erkenn mich nicht wieder
Nur mein Herz das noch schlägt
Und ich hebe die Arme
um zu sehn ob die warme
Nachtluft mich trägt
Du erkennst mich nicht wieder
Unerkannt
flieg ich ans Ende der Stadt
ans Ende der Welt
und über den Rand
Wir sind Helden,Du erkennst mich nicht wieder
Psychische Erkrankungen rund um die Geburt
Man unterscheidet allgemein zwischen dem Babyblues – manchmal ist auch von den „Heultagen“ die Rede –, der peripartalen / postpartalen Belastungsstörung bzw. der peripartalen / postpartalen Depression, der postpartalen Psychose und noch einigen anderen Erkrankungen, die jedoch deutlich seltener auftreten. Der sogenannte Babyblues ist keine Depression. Es handelt sich dabei um eine depressiv labile Stimmungslage, die wenige Tage nach einer Entbindung bei Müttern auftreten kann. Ungefähr die Hälfte aller Mütter, die gerade ein Kind bekommen haben, erlebten diese Tage.
Bei jeder Depressionserkrankung, die innerhalb der ersten beiden Jahre nach der Geburt eines Kindes bei Frauen auftritt, spricht man von einer postpartalen Depression bzw. Belastungsstörung. Meist setzt diese etwa sechs bis zwölf Wochen nach der Geburt ein. Bis zu 30 Prozent aller Mütter und 15 Prozent aller Väter erkranken an einer peripartalen Depression. Bei der Krankheit handelt es sich um eine emotionale Verstimmung und Anpassungsstörung, die rund um die Geburt eintreten kann (= „peripartal“), schon in der Schwangerschaft (= „präpartal“) oder erst nach der Geburt in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren danach (= „postpartal“). Sie beginnt meistens mit Schlafstörungen und geht mit Konzentrationsstörungen und stark und häufig wechselnden Emotionen und Affekten einher. Auch die Entwicklung von zahlreichen negativen Gedanken, Sorgen und Ängsten, die vor allem das geborene Kind betreffen, ist typisch.
Bei der postpartalen Psychose handelt es sich um eine der schwierigsten psychiatrischen Erkrankungen überhaupt. Nur knapp ein Prozent der Mütter erkrankt an ihr. Die Erkrankung beginnt, anders als die Depression, gleich nach der Geburt des Kindes und geht mit Wahnvorstellungen und Halluzinationen einher, die zu einer akuten Gefährdung des Kindes führen können.
* In dem Buch ist immer wieder die Rede von „Müttern“ oder „Frauen, die an peripartalen Depressionen leiden“, weil sie die entschiedene Mehrheit der Menschen ausmachen, die daran erkranken. Selbstverständlich sind damit ebenfalls alle anderen Menschen gemeint, die Kinder bekommen und / oder sich als Mütter oder Eltern fühlen. Der Tatsache, dass auch Männer an peripartalen Depressionen erkranken, ist ein eigenes Kapitel in dem Buch gewidmet. Zudem sind immer, wenn ich im Text von „Partnern“ spreche, alle möglichen Partner*innen gemeint. Ich beziehe mich im Text auf die soziale Rolle des Vaters, die natürlich auch von einer oder mehreren Personen ausgefüllt werden kann, die nicht männlich gelesen werden.
I
Mutter werden
Ich war neunundzwanzig Jahre alt, als ich meinen ersten Sohn Johannes bekam. Heute ist er achtzehn Jahre alt, ein selbstständiger junger Mann, der gerade sein Abitur bzw. seine Matura gemacht hat und endgültig flügge wird. Mein erster Ehemann, den ich eine gewisse Zeit lang leidenschaftlich geliebt habe, und ich lebten zu der Zeit, als ich mit Johannes schwanger wurde, in einem Szenebezirk in Berlin, tanzten Tango, hatten nicht viel Geld und doch genug. In gewisser Weise waren wir ein Vorzeigepaar. So verliebt. So hingegeben. So komplementär. Wie aus dem Bilderbuch. Er kam aus dem ehemaligen Ostteil der Stadt, ich aus dem ehemaligen Westteil der Stadt. Er arbeitete als Projektleiter und ich als Literaturagentin und Lektorin, später dann auch als Dozentin für medizinische Fachsprache. Sobald wir uns dazu entschlossen hatten, gemeinsam ein Kind zu bekommen, wurde ich schwanger. Die ersten vier Monate lang war mir ununterbrochen übel – so war es bei allen meinen drei Schwangerschaften – und ich quoll auf, denn das Einzige, was meine Übelkeit kurzfristig eine Spur milderte, war die Essensaufnahme. Ich wurde mir also äußerlich fremd, was eine für manche mit Sicherheit zu vernachlässigende Veränderung ist, aber dennoch beunruhigend sein kann, denn die eigene Körperlichkeit ist ein wesentlicher Teil der Identität. Nicht wenige Frauen beschreiben das unangenehme Gefühl, sich als Schwangere körperlich fremd geworden zu sein; andere wiederum finden sich so schön wie nie und fühlen sich rundum wohl in ihrer Schwangerschaft, so wohl, dass sie immer wieder schwanger sein wollen.
Abgesehen von meiner körperlichen Mutation in ein Ungetüm – so empfand ich es –, das nur noch wenige Gerüche und Geschmäcker ertragen konnte, verlief die Schwangerschaft komplikationslos. Zu keinem Zeitpunkt kam ich auf die Idee, etwas könnte schiefgehen. Ich hatte nie Angst, mein Sohn könnte behindert sein oder krank, die Entbindung könnte problematisch werden oder mir würde es nicht gelingen, meinem Kind auf Anhieb eine gute Mutter zu sein. Ich war jung, ahnungslos und zuversichtlich. Voller Liebe und Vorfreude.
Ich habe Kinder immer geliebt, besonders geliebt, schon als kleines Mädchen. Ich befasste mich gerne mit ihnen, ich hatte „ein Händchen“ für sie, so sagte man. Neben meiner Zwillingsschwester habe ich eine fast acht Jahre jüngere Schwester, um die ich mich in meiner Kindheit oft kümmerte mit allem Drum und Dran, wickeln, spazieren fahren, spielen, vorlesen, ins Bett bringen. Ich tat das meistens richtig gerne und gehörte also, als mein erstes Kind geboren wurde, nicht zu den „völlig ahnungslosen Müttern“, die die Psychiaterin Claudia Reiner-Lawugger oft in ihrer Ambulanz für Peripartalpsychiatrie erlebt: Sie haben sich noch nie in ihrem Leben um ein Baby und Kleinkind gekümmert und sind, wenn sie ihr erstes eigenes Kind bekommen, hoffnungslos damit überfordert.1 Diese Mütter wissen nicht, wie man ein Baby hält, wie man es wickelt, an- und auszieht und beruhigt, und sie haben auch keine Ahnung davon, wann das Schreien und Weinen eines Kindes normal und harmlos und wann es Anzeichen für ein ernsthaftes Problem ist, für Schmerzen, Krankheit oder Ähnliches. Laut Claudia Reiner-Lawugger lernten die Menschen, die früher in Großfamilien lebten, auf natürliche Art und Weise, wie man mit Babys und kleinen Kindern umging, indem sie beobachteten und nachahmten: „Das war ein unbewusst tradiertes Wissen, das wir nicht mehr haben, und das ist ein großer Kulturverlust.“2
Die Geburt von Johannes wurde wegen eines hohen Blasensprungs eingeleitet, und da das Wehenmittel zunächst nicht wirkte, verabreichte man mir eine entschieden zu hohe Dosis, die zur Folge hatte, dass ich einen Wehensturm bekam, und Johannes innerhalb von zwei Stunden – rasend schnell für eine erste Geburt – auf die Welt brachte. Unter „Wehensturm“ versteht man Wehen, die zu stark und / oder zu häufig auftreten. Er ist extrem schmerzhaft und erschreckend, zumal man in den Geburtsvorbereitungskursen lernt, dass die Wehen zunächst nur alle zehn, dann alle fünf, schließlich alle drei Minuten kommen und dass die Gebärende zwischen den Wehen immer wieder Zeit hat, sich auszuruhen, Luft zu holen, Kraft zu sammeln. Nichts davon war bei mir der Fall, und ich erinnere mich, wie ich irgendwann keuchend hervorstieß: „Wann kommt denn mal eine Pause? Ich dachte, zwischen den Wehen sind immer Pausen.“
Die Turbogeburt setzte nicht nur mich, sondern auch mein Baby so unter Stress, dass es zu wenig Sauerstoff bekam und seine Herztöne schlecht wurden. Der Kreißsaal füllte sich mit Ärzt*innen, Hektik brach aus, und ich bekam es mit der Angst zu tun, bis eine männliche Stimme beruhigend zu mir sagte: „Ich helfe Ihnen jetzt.“ Noch heute habe ich sie im Ohr.
Nur wenige Momente später kam Johannes auf die Welt, als Zangengeburt, was schon damals, vor achtzehn Jahren, eine veraltete Methode war, mich schmerzhaft aufriss, aber den Vorteil hatte, dass kein Notkaiserschnitt vorgenommen werden musste, der es geworden wäre, wäre nicht ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ein Oberarzt in dem Krankenhaus zugegen gewesen – oder war es ein Chefarzt? Ich weiß es nicht mehr –, der die Technik der Zangengeburt noch beherrschte.
Direkt nach der Geburt war ich total weggetreten, aber nicht zu weggetreten, um zu begreifen, dass etwas anders gelaufen war als gewünscht und dass sich alle Sorgen machten. Ich fühlte mich kaputt, körperlich und mental, und ich hatte Angst. Denn mein Sohn wurde mir nicht, wie ich es erwartet und erhofft hatte, auf den Bauch gelegt, nackt und nur in ein Handtuch gewickelt, wir konnten uns nicht in Ruhe annähern und kennenlernen, und ich hatte nicht die Gelegenheit, ihn in Frieden das erste Mal zu stillen.
Im Gegensatz dazu wurde Johannes in aller Eile für verschiedene Untersuchungen aus dem Zimmer gebracht, und auch mein damaliger Mann wurde aus dem Kreißsaal gebeten. Ich blieb allein mit dem medizinischen Fachpersonal zurück, und eine der Ärztinnen machte sich daran, mich wieder zusammenzunähen, was lange dauerte. Offensichtlich stöhnte ich dabei die ganze Zeit, ohne es zu merken, denn irgendwann sagte sie zu mir: „Es ist gleich vorbei. Es tut mir leid, dass Sie solche Schmerzen haben.“ Wie sie darauf komme, fragte ich die Ärztin verwundert, und sie antwortete: „Weil Sie die ganze Zeit jammern.“
Als mein Sohn mir endlich zurückgebracht wurde, sagte der Arzt, der ihn mir in die Arme gab, einen Satz, den ich nie vergessen werde und den ich damals, benebelt, nicht verstand: „Ihr Sohn kann Abitur machen.“ – Ein Paradebeispiel an Einfühlsamkeit und psychologischem Geschick, und ja, das meine ich ironisch.
Natürlich gibt es Ärzt*innen, und zunehmend mehr, die kompetenter mit solchen Situationen umgehen, aber ich hatte nicht das Glück, mit ihnen zu tun zu haben, und die unzureichende Kommunikation des Arztes beschäftigte mich noch länger. Es kam vermutlich nicht von ungefähr, dass das Gebiet der medizinischen Fachkommunikation, auch das „Überbringen von schlechten Nachrichten“, später in meinem Brotberuf als Projektleiterin und Dozentin im Bereich der medizinischen Fachsprache eines meiner Lieblingsgebiete wurde, das ich mit besonderer Begeisterung unterrichtete.
Johannes wurde spät abends geboren. Als eine Pflegekraft mich mit ihm in das Drei-Bett-Zimmer brachte, in dem wir die nächsten Tage verbringen sollten, war ich aufgedreht und redselig, vollgepumpt mit Glückshormonen. Sie sagte dann einen Satz zu mir, den ich auch weder vergessen werde noch verstanden habe: „Sie müssen jetzt schlafen. Sie haben eine wirklich heftige Geburt hinter sich und brauchen all Ihre Kräfte.“ In dem Moment dachte ich nur: Wieso war das eine besonders heftige Geburt? Immerhin ging sie schnell, und jetzt ist doch alles gut. Ich habe den Satz in der Tat mehr als ein Jahrzehnt lang nicht verstanden, denn ich begriff nicht, vielleicht gestand ich es mir auch nicht ein, dass die Geburt von Johannes alles andere als eine Bilderbuchgeburt gewesen war, sondern ein schockartiges, besonders schmerzhaftes Erlebnis, das für mich, aber auch für meinen Mann und für das medizinische Fachpersonal mit mehr Sorgen und Stress verbunden war als normalerweise.
Auch als ich später, bei den Geburten meiner anderen beiden Söhne, jeweils an einem gewissen Punkt schlimme Atemnot bekam, begriff ich nicht, dass das keine körperlichen Gründe hatte, sondern psychische, die mit meinen Erinnerungen an die Geburt von Johannes zu tun hatten: Ich bekam es jedes Mal mit der Angst zu tun, und mein Körper und mein Gehirn wurden zurückversetzt in meine erste Geburtssituation.
Am nächsten Tag waren mein Sohn und ich immer noch erschlagen. Johannes schlief und schlief, entkräftet, und war so gut wie gar nicht dazu zu bewegen, wach zu bleiben oder gar an meiner Brust zu trinken, wodurch unmittelbar das einsetzte, was ich als „Stillwahnsinn“ bezeichne: Eine Pflegekraft nach der anderen gab mir unterschiedliche Tipps bzw. Anordnungen, wie ich mein Kind zu stillen hätte oder nicht, teilweise gegensätzliche, und schon am ersten Tag nach der Geburt sollte ich unbedingt abpumpen und zufüttern, weil mein Kind sonst verhungern würde.
Erschwerend kam hinzu, dass mein Sohn sich im Bauch ein falsches Saugverhalten angewöhnt hatte, sodass er nicht gut an meiner Brust trinken konnte. Das Stillen wurde also für uns beide, auch wegen des äußeren Drucks, der auf uns ausgeübt wurde, schnell zu einer Qual, was mich natürlich verunsicherte. Es kostete mein Baby und mich damals fast einen Monat Nerven, Tränen und durchwachte Nächte inklusive aller brauchbaren und unbrauchbaren Hilfsmittel, die man sich vorstellen kann – Stillhütchen, Milchpumpe, Fingerfeeding –, bis das Stillen funktionierte.
Ich hatte zudem, auch aufgrund einer Anämie, Kreislaufprobleme und Angst, ich könnte beim Wickeln in Ohnmacht fallen, was mir bereits einige Male in meinem Leben passiert war. Da ich Johannes auf keinen Fall gefährden oder ihm gar schaden wollte, bat ich meinen Mann, das Wickeln vorerst zu übernehmen, was eine der Pflegekräfte dazu veranlasste zu sagen, ich müsse mich in meine Rolle einfinden, immerhin sei nur ich die Mutter des Kindes und niemand anderes. Schon am ersten Tag nach der Geburt meines ersten Sohnes wurde mir also vermittelt, nur ich, die Mutter, könne sich adäquat um ihn kümmern. Gleichzeitig wurde mir ein schlechtes Gewissen gemacht, weil ich nicht sofort alle Anforderungen an den Prototyp einer glücklichen jungen Mutter erfüllte.
Entgegengesetzt zu dem, was ich erwartet hatte, war ich also nach der Geburt meines ersten Sohnes nicht unmittelbar eine erfüllte, selbstsichere und intuitiv agierende Mutter, sondern vor allem körperlich angeschlagen. Verunsichert. Ich fühlte mich schwach. Hilflos. Ängstlich. Gleichzeitig voller Liebe, Glück und Staunen über meinen ersten Sohn. Mich beherrschten viele verschiedene Gefühle auf einmal und damit scheine ich nicht allein zu sein. Nur sprechen die meisten nicht darüber.
Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was die erste Zeit mit Johannes aber bestimmt auch unbewusst belastete, war die Tatsache, dass mein Mann in der Schwangerschaft eine Affäre mit einer anderen Frau begonnen hatte. Ich gehe hier nicht näher auf unsere zerklüftete Geschichte ein, denn immerhin betrifft sie auch seine Privatsphäre, und er würde bestimmte Aspekte mit Sicherheit, das liegt in der Natur der Dinge, anders erzählen, als ich es tue. Somit halte ich mich nur an das, was unbedingt relevant ist für dieses Buch.
Natürlich erleben Frauen, die eine glückliche, unterstützende und stabile Liebesbeziehung mit ihrem Partner haben, die erste fragile, aufregende Zeit mit einem Kind besser und sicherer als Frauen, die nicht in einer solchen Beziehung sind. Es liegt auch auf der Hand, dass Erfahrungen wie die, von dem Partner hintergangen und im Stich gelassen zu werden und dann auch noch in so umwälzenden Situationen wie in der Schwangerschaft und nach der Geburt, sich auf das weitere Leben und mögliche neue Liebesbeziehungen auswirken sowie auf das spätere Erleben der ersten Zeit mit einem weiteren Kind. Demgemäß habe ich in den Selbsthilfegruppen für Mütter mit peripartaler Depression überdurchschnittlich viele Frauen getroffen, die die Beziehung zu ihrem Partner eher negativ beurteilt haben: Sie fühlten sich nicht ausreichend geliebt, gesehen, unterstützt und angenommen. Andererseits ist natürlich schwer zu trennen, welche Gefühle die Depression auslösen und welche Gefühle die Depression auslöst: Waren zuerst die Probleme in der Partnerschaft da oder zuerst die Depression, die dazu führte, dass die Partnerschaft komplizierter wurde und die Frau sie kritischer betrachtete und erlebte? Zudem gibt es auf jeden Fall auch Frauen, die in einer glücklichen, liebevollen und harmonischen Partnerschaft leben und dennoch an einer peripartalen Depression erkranken. Es muss immer ein vielschichtiges Geflecht von Beziehungen, Erfahrungen und Gefühlen gesehen und auf möglichst differenzierte Art und Weise untersucht werden, wenn es darum geht, herauszufinden, was wann wie und bei wem eine peripartale Depression auslöst.
Als das Stillen meines Sohnes immer besser klappte, und ich zunehmend lernte, seine verschiedenen Zeichen und Gefühlsregungen zu lesen und zu verstehen, wurde ich selbstsicherer, ausgeglichener und glücklicher als Mutter und auch als Mensch, und eine wirklich schöne, gute Zeit begann. Mit meinem Mann allerdings blieb es schwierig, ambivalent. Mit allem, was mich ausmachte, glaubte ich trotzdem immer noch, dass er die Liebe meines Lebens wäre, dass ich weitere Kinder mit ihm bekommen und bis an unser Lebensende mit ihm zusammenleben würde. Dass ihm das offensichtlich nicht so ging, verstand ich erst, als ich herausfand, dass er eine weitere Affäre eingegangen war. Es war nun endgültig klar, dass wir nicht weiter zusammenleben konnten noch wollten. Johannes war zu dem Zeitpunkt knapp zwei, und für mich brach eine Welt zusammen.
Eine fordernde Zeit folgte. Mehr als ein Jahr kämpfte ich um den mir rechtmäßig zustehenden Unterhalt. Auch war ich meistens alleinverantwortlich für meinen Sohn. Mein Ex-Mann kümmerte sich jedes zweite Wochenende um ihn und später noch einen zusätzlichen Nachmittag in der Woche. Den Rest der Zeit war Johannes bei mir. Das war einerseits schön und das wollten wir auch alle so: Mein Sohn war noch zu klein, sodass ein Wechselmodell für ihn nicht gut gewesen wäre. Zudem hatte mein Ex-Mann nie den Wunsch danach, und ich hätte mir das unter den gegebenen Umständen auch nur schwer vorstellen können. Andererseits war diese Hauptverantwortung natürlich kräftezehrend, denn ich musste mich parallel um eine neue Arbeit und diverse andere Probleme kümmern. Erst kurz vor der Trennung hatte ich mich im gemeinsamen Einverständnis mit meinem Ex-Mann selbstständig gemacht. An allen Ecken und Enden fehlte meinem Sohn und mir das Geld, und die nervenaufreibende Kommunikation mit diversen Anwält*innen und Mediator*innen belastete mich – mein Ex-Mann und ich hatten mindestens ein Jahr lang nach der Trennung erhebliche Kommunikations- und Verständnisprobleme. Über allem schwebte mein Anspruch, Johannes so glücklich, unbeschwert und liebevoll aufwachsen zu lassen wie möglich, auch ohne eine gewöhnliche „heile Familie“. Ich bildete mir ein, dass ich jetzt eine noch verständnisvollere, einfühlsamere, tollere Mutter sein musste als vorher schon, um ihm den Schmerz der Trennung zu erleichtern. Oft war ich gezwungen, Babysitter*innen zu organisieren, um zu arbeiten. Als Freiberuflerin in der Erwachsenenbildung fallen die Arbeitszeiten häufig leider nicht in die Betreuungszeiten im Kindergarten, denn Fortbildungen und Zusatzausbildungen finden in der Regel außerhalb der regulären Arbeitszeiten statt. Ich hatte aber kein Geld, um eine professionelle Kinderbetreuung zu bezahlen, und war daher immer auf Freundschaftsdienste oder Unterstützung durch meine Familie angewiesen. Zeit zum Trauern, Aufarbeiten, Verstehen und Abschiednehmen blieb mir so gut wie nicht.
Knapp zwei Jahre später lernte ich dann meinen jetzigen Ehemann kennen, und wir beschlossen schnell, zusammenzuleben und gemeinsam Kinder zu haben. Mittlerweile hatte ich mir eine feste Stelle als pädagogische Leiterin eines Fortbildungsprogramms für Ärzt*innen und Pflegekräfte erarbeitet, denn mir war klar geworden, dass ich als Freiberuflerin in der Anfangsphase nicht regelmäßig genug Geld für meinen Sohn und mich verdienen würde. Ich hatte daher alles darangesetzt, fest angestellt zu werden, obwohl das meinen Vorlieben und Begabungen nicht besonders gut entsprach. Die Auseinandersetzungen mit meinem Ex-Mann waren endlich durch eine gemeinsame Mediation geschlichtet: Er zahlte Unterhalt, ich hatte keine gravierenden Geldsorgen mehr. Alles hatte sich also beruhigt, ich konnte wieder frei atmen und fühlte mich besser.
Bevor ich mit meinem zweiten Sohn schwanger wurde – Jens war zu diesem Zeitpunkt seit einem halben Jahr in Wien, wo er eine Sechsjahresstelle an der Universität angetreten hatte, aber wir besuchten uns natürlich –, hatte ich zwei frühe Fehlgeburten. Natürlich macht es einen Unterschied, ob man erst ein paar Wochen lang glaubt, ein Kind zu bekommen, oder ein paar Monate lang, ob man weiß, dass sich „ein Zellhaufen nicht weiterentwickelt hat“, so beschrieb es mein Gynäkologe in Berlin, um meine Schmerzen zu mildern, oder ob ein mehr oder weniger vollständiger Fötus im Mutterleib stirbt. Dennoch gehen beide Vorgänge mit Schmerzen und Traurigkeit einher, mit Hoffnungen, die sich zerschlagen, und mit Verlustgefühlen. Vor allen Dingen führten die Fehlgeburten bei mir dazu, dass mir der natürliche Prozess des Schwangerwerdens und Gebärens mit einem Mal nicht mehr selbstverständlich erschien, sondern eher als gefährdete Unwahrscheinlichkeit. Auch das Verhalten der Ärzt*innen, mit denen ich konfrontiert war, trug dazu bei. Ich war jetzt fünfunddreißig und galt mit einem Mal offiziell als Spätgebärende. Mein Gynäkologe legte mir also zahlreiche Zusatzuntersuchungen nahe, die bei meiner ersten Schwangerschaft noch keine Rolle gespielt hatten: das Ersttrimester-Screening mit Nackenfaltenmessung und Blutuntersuchung, verschiedene Tests auf bestimmte Antikörper und andere mehr. Ich erlebte meine zweite Schwangerschaft demnach ganz anders als meine erste.
In ihren ersten Monaten war ich von der zwanghaften Sorge befallen, ich könnte eine weitere Fehlgeburt erleben, und ich rannte immer wieder auf die Toilette, um zu überprüfen, ob noch alles in Ordnung war. Auch im Alltag war ich nervöser und angespannter als bei meiner ersten Schwangerschaft. Immer begleitete mich die Furcht, meinem ungeborenen Kind könnte etwas passieren, es könnte krank sein oder gar sterben. Wie viel diese Anspannung mit meiner persönlichen Geschichte und Verfassung zu tun hatte und wie weit sie auf die medizinische Behandlung von sogenannten Spätgebärenden in unserer heutigen Gesellschaft zurückzuführen ist, kann ich nicht beurteilen. Ich bin mir aber sicher, dass die Somatisierung der Schwangerschaft zu meiner psychischen Labilität beigetragen hat: die Tatsache, dass Schwangerschaft heutzutage in unserem Kulturkreis als eine Art Krankheit gesehen wird, die durch zahlreiche hochtechnisierte Kontrollen begleitet werden muss. Immer mehr Frauen leiden parallel dazu unter einem Vertrauensverlust in ihren Körper. Verunsichert durch die heute hochdifferenzierte Pränataldiagnostik und die zahlreichen verschiedenen Untersuchungen, die diese miteinschließt, glauben viele Frauen nicht mehr daran, dass sie einfach ein Kind bekommen können.
Die Idee, dass Schwangere medizinische Unterstüzung brauchen, ist dabei relativ jung: Sie kam erst in den 1960er-Jahren auf und führte zur Einführung von regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen und dem Mutterpass. Das hatte einerseits den positiven Effekt, dass die Sterbefälle während Schwangerschaft und Geburt gesenkt wurden. Andererseits wurde dadurch aber auch aus der Schwangeren eine Patientin gemacht. Der Ultraschall, mit dem Eltern bereits ab dem vierten Monat der Schwangerschaft ihr Kind auf faszinierenden 3-D-Bildern erkennen können, schafft eine Bindung zum Kind, die es früher zu diesem Zeitpunkt so nicht gegeben hat. Gleichzeitig lenkt die Technik, so die Meinung von einigen Expert*innen, aber ab vom Selbstempfinden der Frau und ihrem Vertrauen in dieses. Auch die Ärzt*innen würden nicht mehr danach fragen, was die Frau fühle, sondern stattdessen den Ultraschall konsultieren. Zudem führen die zahllosen Ratgeber, Zeitschriften und Eltern-Kind-Kurse, die werdende und junge Eltern mit den unterschiedlichsten Ratschlägen und Studien über den optimalen Umgang mit dem Kind bombardieren, zu einer Verunsicherung. Zu jedem noch so kleinen Problem werden Bücher, das Internet und Expert*innen zu Rate gezogen. Immer weniger Mütter, so mein Eindruck und der der Expertinnen, die ich für dieses Buch interviewt habe, vertrauen „nur“ auf ihren gesunden Menschenverstand, auf das grundlegende, vertrauensvolle Gefühl: Ich werde das schon irgendwie richtig machen.
Der Druck, der gegenwärtig auf Müttern lastet, ist hoch. Er wird von medizinischem Fachpersonal und – teilweise selbst ernannten – Expert*innen für die Themen rund um die Geburt aufgebaut, aber auch von Hersteller*innen, die Möbel, Kleider, Geräte für Babys und Kinder verkaufen: Nur in dieser Babywanne können Sie Ihr Kind absolut sicher baden! Nur mit diesem Kontrollsystem können Sie Ihr Baby sicher vor dem plötzlichen Kindstod bewahren!
Ich kenne die Verunsicherung der Mütter nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch aus meinem Freundeskreis. Als eine meiner engsten Freundinnen, eine erfolgreiche Anwältin, mit Ende dreißig schwanger wurde, hatte sie seit mehr als zehn Jahren darauf gewartet, endlich ein Baby zu bekommen. Entweder hatte sie keinen Mann an ihrer Seite – oder einen, der (noch) keine Kinder haben wollte. So hatte sich der Traum ihres Lebens, so zumindest dachte sie zu diesem Zeitpunkt, bislang nicht erfüllt. Je länger sie sich nach einem Kind sehnte, umso fantastischer schien das Unterfangen für sie zu sein.
Nun, da ihr Traum endlich in Erfüllung ging und sie schwanger war, wurde sie von zahllosen Ängsten geradezu verfolgt, und die meisten waren irrational: Ständig fürchtete sie, das Kind könnte nicht weiterwachsen in ihrem Bauch, sein Herz aufhören zu schlagen, es könnte behindert sein.
Meine Freundin ist eine wunderbare und selbstbewusste Frau. Sie malt, kann großartig kochen, nähen und Räume gestalten, und sie hat viele verschiedene und interessante Freund*innen. Sie hatte bis zu dem Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft vieles in ihrem Leben geschafft, was anderen Frauen nie vergönnt sein wird. Das schien ihr aber in ihrer Schwangerschaft nicht mehr bewusst zu sein oder sie empfand es als völlig normal und daher nicht bemerkenswert. Das Normalste auf der Welt aber, die Tatsache, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, war für sie plötzlich ein nahezu unmögliches Wunder.
Depressionen in der Schwangerschaft
Peripartale Depressionen beginnen häufig schon während der Schwangerschaft. Das wird leider zu selten erkannt und deshalb auch oft nicht rechtzeitig behandelt. Eine unbehandelte präpartale psychische Depression führt u. a. zu stressbedingten erhöhten Cortisolwerten der Mutter, die sich wiederum negativ auf das Kind im Mutterleib und seine Entwicklung auswirken. Zudem erhöht die oft aus der Krankheit resultierende mangelhafte Ernährung der Mutter, ihr Stress, ein häufig zu beobachtender Medikamenten-, Alkohol- und Nikotinmissbrauch sowie eine unzureichende Schwangerenvorsorge das Frühgeburtsrisiko des Kindes und führen zu einem niedrigen Geburtsgewicht. Über alledem schwebt ein akutes Suizidrisiko der Mutter.
Diese Erkenntnisse sollen nicht dazu führen, dass betroffene Schwangere oder auch nur möglicherweise Betroffene sich verstärkt Sorgen machen. Vielmehr muss es darum gehen, das Gespür der Ärzt*innen und Hebammen für die Erkrankung zu intensivieren und die Früherkennung zu optimieren. Nur so kann verhindert werden, dass die Depression sich im Laufe der Schwangerschaft und nach der Geburt weiter verschlimmert und schließlich chronisch wird.
Trinity:
furschbar, fast in jedem film, in jedem buch is det drin, dass die mütter dafür verantwortlich gemacht werden für die erziehung, und dann sindse schuld da dran. oder im film werdense dargestellt als die hyäninnen, die, was weiß ich, den mann immer unter kontrolle halten oder ausgeflippte nervöse hysterische dinger oder oder … es ist eigentlich so ne anhäufung, dass man einfach nur abkotzen kann. det is für mich so furchtbar. also es ist selten, dass ’ne mutter wirklich mal positiv dargestellt wird, und das ist leider immer noch so.
Katharina Kummer,Wir werden alle unsere Mütter
II
Mutter sein
Du kommst dir selbst abhanden. Die Diagnose „peripartale Depression“
Die peripartale Depression betrifft weltweit bis zu 30 Prozent aller schwangeren Frauen bzw. Frauen, die gerade ein Kind auf die Welt gebracht haben, und 15 Prozent aller Männer, die ein Kind bekommen werden bzw. gerade ein Kind bekommen haben. Bei der Krankheit handelt es sich um eine emotionale Verstimmung und Anpassungsstörung, die rund um die Geburt eintreten kann (= „peripartal“), schon in der Schwangerschaft (= „präpartal“) oder erst nach der Geburt in einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren danach (= „postpartal“). Sie beginnt meistens mit Schlafstörungen und geht mit Konzentrationsstörungen und stark und häufig wechselnden Emotionen und Affekten einher. Auch die Entwicklung von zahlreichen negativen Gedanken, Sorgen und Ängsten, die vor allem das geborene Kind betreffen, ist typisch: Entwickelt sich das Baby richtig? Geht es ihm auch wirklich gut? Gehe ich adäquat mit dem Baby um? Bin ich meinem Kind eine gute Mutter / ein guter Vater? Werde ich jemals eine gute Mutter / ein guter Vater sein?
Die peripartale Depression kann von Antriebslosigkeit und Apathie begleitet sein, aber auch von Hyperaktivität und übersteigerter Nervosität. Es gibt verschiedene Risikofaktoren dafür, an einer peripartalen Depression zu erkranken. Mehrere davon müssen zusammenkommen, um sie auszulösen. Ein wichtiger Faktor ist die umfassende hormonelle Umstellung nach der Geburt. Manche Frauen tragen auch eine genetische Disposition für Depressionen in sich oder haben in ihrem Leben traumatische Erfahrungen gemacht, die ihre Vulnerabilität erhöhen, also die Anfälligkeit für die Erkrankung. Frauen, die selbst depressive Mütter haben und keine positive Mutterbeziehung entwickeln konnten, sind ebenfalls besonders gefährdet, auch solche, die eine unglückliche Beziehung zu ihrem Partner haben oder die wenig oder keine Unterstützung durch ihr soziales Umfeld erfahren. Zudem können eine schwierige Schwangerschaft, die mit starken Ängsten behaftet war, und eine traumatische Geburt wie ein Notfallkaiserschnitt, eine Frühgeburt oder eine besonders schmerzhafte und lange Geburt eine peripartale Depression auslösen. Auch Armut und geringe Bildung sind Risikofaktoren, andererseits der Perfektionismus und eine gute berufliche Ausbildung der Mutter sowie die Tatsache, dass das Neugeborene besonders anstrengend ist, weil es beispielsweise ein sogenanntes Schreikind ist.
Dadurch, dass Schwangere vor der Geburt nahezu „überbetreut“ werden mit zahlreichen Untersuchungen, die das Kind in ihrem Bauch betreffen, nach der Geburt aber kaum noch beachtet und auch nicht zu ihrem Gefühlszustand befragt werden, kann auch das Entstehen einer peripartalen Depression befördert werden. Die Frauen fallen nach der Geburt ihres Babys in ein schwarzes Loch, fühlen sich wertlos und leer ohne Baby im Bauch, wie eine nutzlose Hülle.
Die Psychologin und Psychotherapeutin Maria Weissenböck, die sich seit vielen Jahren unter anderem auf die therapeutische Arbeit mit Schwangeren und Frauen, die gerade Mutter geworden sind, spezialisiert hat, beschreibt die peripartale Depression als „Anpassungsstörung, die einerseits durch die hormonellen Gegebenheiten bedingt ist und andererseits durch die eigene Lebensgeschichte der Frau. (…) Es ist eine Störung im Wohlbefinden, bei der es auch um eine Nichterfüllung der Erwartungshaltung geht. Die Frauen (…) denken und empfinden: Das wird nie ein Ende haben, das ist meine neue Normalität. Es wird mir ab jetzt nur noch mittelmäßig bis schlecht gehen.“1
Ansonsten hat die peripartale Depression ähnliche Symptome wie Depressionen im Allgemeinen. Dazu gehören Appetitlosigkeit, das andauernde Unvermögen, abzuschalten oder sich zu entspannen, Traurigkeit, Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit, das Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins, das Fehlen von Ausgelassenheit, eine grundlegende Fühllosigkeit und Entfremdung vom Leben, anderen Menschen, aber auch von sich selbst und eine fundamentale, das Leben unerträglich machende Angst vor allem und jedem. Der Schriftsteller Till Räther fasst das in seinem Buch Bin ich schon depressiv, oder ist das noch das Leben? zusammen: „… die Angst vorm nächsten Tag, vorm Montag, vorm Ferienende, vorm Ferienanfang, vorm Nichtschlafenkönnen, vorm Aufwachen, vor jedem Gesicht auf der Straße und jedem Gesicht zu Hause, dieser Widerwille gegen die eigenen Gedanken, gegen den eigenen Atem, die eigenen Schritte, das eigene Gesicht im Spiegel, gegen die schleppende Stimme, gegen die Haare, weil man selbst denen ansieht, dass sie sich an ihrem Ort nicht mehr wohlfühlen.“2
Noch mehr als die „normale“ Depression ist die peripartale Depression eine einsame Krankheit, denn sie bedeutet einen unfassbaren Tabubruch: Die junge Mutter eines neugeborenen Kindes leidet trotz ihres „objektiven“ Mutterglücks an grenzenloser Traurigkeit. Wer kann das verstehen? Andrew Solomon, der mit Saturns Schatten. Die dunklen Welten der Depression DAS Standardwerk zu dem Thema „Depressionen“ geschrieben hat, schreibt über den Unterschied der postpartalen Depression zu anderen Depressionen: „Am radikalsten unterscheidet sich eine postpartale Depression von anderen Formen vielleicht darin, dass sich die Betroffenen nicht in eine stille Ecke zurückziehen können, sondern ständig für eine hilflose Kreatur sorgen müssen.“3