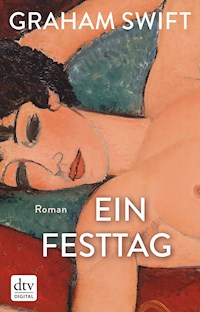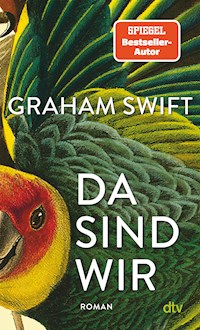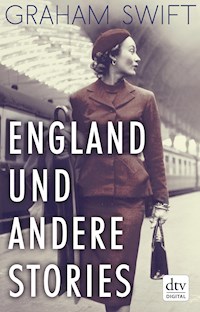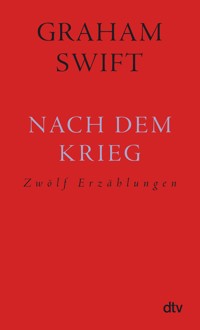
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über Krieg und Frieden nach 1945 1959: Im Rathaus einer deutschen Kleinstadt steht Hans Büchner einem britisch-jüdischen Soldaten gegenüber, der den Verbleib seiner deutschen Verwandtschaft in Erfahrung bringen möchte. 1962: Kurz vor der Hochzeit seiner Tochter plagen Frank Green, einen ehemaligen Bomberpiloten, Sorgen um den Ausbruch eines Atomkriegs. 11. September 2001: Lucy, die philippinische Hausangestellte einer amerikanischen Diplomatenfamilie, besucht mit deren vierjährigem Sprössling den Londoner Zoo und fragt sich, inwieweit ihre Geburt am Tag des Attentats auf John F. Kennedy ihren Lebensweg geprägt hat. Frühjahr 2020: Dr. Cole fährt durch pandemie-geleerte Straßen zu seiner Schicht im Krankenhaus und denkt zurück an ein einschneidendes Ereignis in seiner Kindheit. Was machen Krieg, Terror und gesellschaftliche Ausnahmezustände mit uns Menschen, unmittelbar und noch Jahre und Jahrzehnte später? Gab es je eine Zeit, in der die Angst vor Zerstörung, Tod und Chaos uns nicht beherrscht hat? Überaus genau, zärtlich und weise reflektiert Graham Swift in diesem Erzählband die Nachwirkungen des Krieges und verwebt dabei Dramatisches und Alltägliches, Persönliches und Universelles zu einem meisterhaften Panorama. »In Swifts bewegenden, zutiefst menschlichen Kurzgeschichten, hinterlässt das Leben auf mysteriöse und manchmal humorvolle Weise seine Spuren. Seine Gabe, die Innenleben von Menschen detailliert einzufangen und offenzulegen und wie sie erfahrene Enttäuschungen bewältigen – oder nicht bewältigen – verleiht jeder dieser Geschichten eine ungewöhnliche Tiefe.« Kirkus Reviews »Swift zeigt in wunderbarer Vielfalt, auf welche unterschiedliche Weise seine Figuren von dem dunklen Schatten von Krieg oder Katastrophe gezeichnet sind. Diese meisterlich fein gearbeiteten Geschichten verleihen dem Ausdruck ›Konfliktbewältigung‹ eine neue Bedeutung.« Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
ÜBER KRIEG UND FRIEDEN NACH1945
1959: Im Rathaus einer deutschen Kleinstadt steht Hans Büchner einem britisch-jüdischen Soldaten gegenüber, der den Verbleib seiner deutschen Verwandtschaft in Erfahrung bringen möchte. 1962: Kurz vor der Hochzeit seiner Tochter plagen Frank Green, einen ehemaligen Bomberpiloten, Sorgen um den Ausbruch eines Atomkriegs. 11. September 2001: Lucy, die philippinische Hausangestellte einer amerikanischen Diplomatenfamilie, besucht mit deren vierjährigem Sprössling den Londoner Zoo und fragt sich, inwieweit ihre Geburt am Tag des Attentats auf John F. Kennedy ihren Lebensweg geprägt hat. Frühjahr 2020: Dr. Cole fährt durch pandemie-geleerte Straßen zu seiner Schicht im Krankenhaus und denkt zurück an ein einschneidendes Ereignis in seiner Kindheit.
In wundervoll geschliffener Prosa, klug und subtil untersucht Graham Swift zwölf Schicksale und zeigt uns dabei, was er wie kein anderer vermag: große menschliche Belange auf allerkleinstem Raum zu verhandeln.
Graham Swift
Nach dem Krieg
Zwölf Erzählungen
Aus dem Englischenvon Susanne Höbel
Für Candice
The fundamental things apply As time goes by
Herman Hupfeld, As Time Goes By, Song, 1931
IDas Nächstbeste
Die Sache verlangte eigentlich nicht, dass er sich ihrer persönlich annahm, aber da sein Englisch als sehr gut – gelegentlich sogar als »perfekt« – betrachtet wurde und hier womöglich der Besuch eines britischen Militärangehörigen bevorstand, hatte Herr Büchner beschlossen, sich selbst um die Angelegenheit zu kümmern. Ohnehin war das Gesuch bei ihm gelandet, was oft geschah, wenn die Post an keine bestimmte Person adressiert war; es kam von einem Major Wilkes, dem befehlshabenden Offizier des Betroffenen – geschrieben, das musste man sagen, in ziemlich dürftigem Deutsch.
Wie passend, dass der Brief in die Hände eines Mannes mit (fast) perfektem Englisch gelangt war.
Ein paar nützliche englische Ausdrücke waren ihm auf Anhieb wieder eingefallen, Wendungen wie »wrong channels« oder »knocking on the wrong door«. Aber da es sich um besondere Umstände handelte – hier ging es nicht um einen Deutschen, sondern um ein Mitglied der Alliierten –, und da die britische Armee das Anliegen sozusagen unterstützte …
Nachdem Büchner den Brief gelesen und die beigefügten Blätter überflogen hatte, einschließlich der ernüchternd langen Namensliste, hatte er nachdenklich geseufzt. Selbstgerechte Wichtigtuerei erkannte er auf den ersten Blick. Er mochte von diesem Major Wilkes nicht herumkommandiert werden, auch nicht indirekt, gerade so, als stünde er selbst unter dem Kommando des Mannes. Dies war Deutschland im Jahr 1959, nicht 1949. Und sein Amt war lediglich eins von vielen im Rathaus.
»To whom it may concern.« Na gut.
In der Tat war es so, dass sein Amt fortwährend – fast, so dachte er manchmal, als wäre es dessen Hauptaufgabe – Anfragen und Bittgesuche entgegennahm, die hier am falschen Platz waren, und sie höflich, geduldig und gezielt umleitete. Er hätte Major Wilkes’ Anfrage schriftlich – und selbstverständlich in ausgezeichnetem Englisch, jenem unterkühlten Englisch, das die Engländer so hervorragend beherrschten – beantworten und ihm, wenn auch nicht derart unverblümt, mitteilen können, dass dies tatsächlich die falsche Stelle sei und dass solche Angelegenheiten, wie Major Wilkes eigentlich wissen müsste, nicht in die Zuständigkeit des Rathauses fielen. Gleichzeitig hätte er ihn, beiläufig, daran erinnert, dass Deutschland kein besetztes Land mehr war.
Herr Büchner war der Auffassung, dass dies eine durchaus angemessene Antwort gewesen wäre. Aber ihm war auch klar – und wieder seufzte er –, dass die richtige Reaktion darin bestand, vorbildliche Bereitwilligkeit zur Zusammenarbeit zu zeigen, was vielleicht miteinschloss, denjenigen, der in dem Brief genannt wurde, den Betroffenen, mit fast so etwas wie Demut in seinem Büro zu empfangen.
Und jetzt stand dieser Betroffene, der Gefreite Caan, Joseph Caan aus London N8, derzeit mit der britischen Rhein-Armee in Deutschland stationiert, vor ihm und war offenkundig verunsichert, dass er von einem Amtsleiter begrüßt wurde, der ein erstaunlich präzises Englisch sprach, und ebenso offenkundig war er bemüht, wenn auch vergeblich, eine Parallele zwischen diesem Gespräch und dem durchaus schwierigen Gespräch zu ziehen, das er zuvor mit Major Wilkes, seinem »C. O.«, geführt haben musste.
Offenkundig war der junge Mann verunsichert, aber – und das erregte Büchners Interesse – verunsichert aus freien Stücken.
»Wollen Sie nicht Platz nehmen, Mr Caan?«
Büchner begrüßte den Mann mit einem routinemäßigen Handschlag, sah ihn aber freundlich lächelnd an. Er hatte ihn mit »Mr« angeredet, was zunächst verwirrend erscheinen mochte, aber dies war schließlich eine zivile Einrichtung, und er wollte dem Mann helfen, eine entspannte Haltung zu finden, ohne ihn gleich aufzufordern, »at ease« zu stehen. Das war doch der Jargon der britischen Armee – »Rührt euch!«.
»Ich bin nicht Ihr befehlshabender Offizier.« Er lächelte wieder. »Sie haben keinen Grund, vor mir strammzustehen.« Er bemühte sich, den richtigen Ton zu treffen. Er hatte sich erhoben, um den Mann zu begrüßen, dann auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch gedeutet, bevor er selbst wieder Platz nahm.
»Wollen Sie nicht Ihr Barett abnehmen?«
Herr Büchner war mehr als doppelt so alt wie der Mann vor ihm und selbst Soldat gewesen. Das lag lange zurück, aber aus seiner Militärzeit war ihm die Sichtweise geblieben, dass viele Männer, vielleicht die meisten, wie Soldaten aussahen und auch Soldaten sein konnten, ja, dass sie sogar so aussahen, als sollten sie Soldaten sein, dass hingegen andere Männer nie wie Soldaten aussahen und auch keine Soldaten sein konnten, obwohl sie zu ihrem Unglück genau das waren: Soldaten. Er ordnete den Gefreiten Caan, Mr Caan, unverzüglich der letzteren Kategorie zu. Sich selbst hätte er früher auch so eingeordnet, obwohl der Mann vor ihm das vielleicht nicht gedacht hätte – falls ihm solche Gedanken überhaupt durch den Kopf gingen.
Aber vielleicht gingen sie ihm in ebendiesem Moment durch den Kopf. War das nicht immer noch der allgegenwärtige Gedanke der in Deutschland stationierten britischen Wehrpflichtigen: Was hat dieser scheißfreundliche Kerl im Krieg gemacht?
Der Mann nahm sein Barett ab, sodass sein kurzes, lebhaft gelocktes dunkles Haar zu sehen war, was Büchner sofort an den englischen Ausdruck »short and curlies« erinnerte, der fast ausschließlich zusammen mit »got you by« verwendet wurde. »Jemanden bei den Eiern packen.«
Aus seiner Militärzeit hatte Herr Büchner – Hans Büchner – auch die Einsicht mitgenommen, dass im Leben viele Dinge geschahen, die außerhalb der eigenen Kontrolle lagen und vielleicht sogar darauf abzielten, einem die Kontrolle zu nehmen – wenn man zum Beispiel auf der falschen Seite des Schreibtisches stand –, doch selbst wenn sich die Dinge unter Umständen ereigneten, die innerhalb der eigenen Kontrolle lagen, geschahen sie doch nur deshalb – und ganze Lebensläufe mochten davon abhängen –, weil jemand das Gesicht desjenigen, der vor ihm stand, mochte oder nicht.
Das Gesicht des Gefreiten Caan war sympathisch, denn er sah nicht aus wie ein Soldat. Er sah auch nicht unbedingt wie ein »Mister« aus. Wurde er zu Hause »Joe« genannt? Er sah jungenhaft aus. Er war erst neunzehn und hatte nicht nur dunkles lockiges Haar, sondern auch kleine dunkle Augen, die angestrengt dreinblickten, was bedeuten konnte, dass er eine Brille brauchte, oder einfach grundsätzlich größere Klarheit, aber zur Freistellung wegen eines nicht bestandenen Sehtests hatte es offenkundig nicht gereicht.
Die dürftigen Details in der aufgeschlagen auf dem Tisch liegenden Akte nannten als Beruf des Mannes »Schneiderlehrling«. Hatte er, seit er fünfzehn war, zu viel mit Nadel und Faden gearbeitet? Aber als seine Augen endlich denen Büchners begegneten, war der Blick durchaus nicht schwach. Eher ein bisschen »needling« – »stechend«.
Die Wörter strömten zurück.
Joseph Benjamin Caan. Name der Mutter: Eva Adele, gebürtige Rosenbaum. Vater: Benjamin Franz, verstorben. Major Wilkes hatte es für wichtig erachtet, zu ergänzen: »Gefallen im Gefecht in Nordafrika«.
Joe Caan, Sohn des Ben Caan, aus London N8.
Die Liste, um die es im Wesentlichen ging, enthielt hauptsächlich die Namen der Caans und Rosenbaums. Es gab einen Jakob, einen Leopold, eine Hanna, eine Leah, einen Bruno, eine Elsa, einen Ruben … sogar einen Hans. Offenbar hatten die meisten in Hannover gelebt.
Major Wilkes hatte es auch für wichtig erachtet, darauf hinzuweisen, dass das »Ansinnen« des Gefreiten Caan mit den Wünschen seiner Mutter abgestimmt war, was bedeutete, so vermutete Büchner, dass der Junge im Auftrag von wenigstens einem älteren Mitglied seiner Familie handelte.
Aber der mit einem Mal scharfe, unbestechliche Blick vermittelte etwas anderes. Vielleicht hatte der Gefreite Caan dies so dargestellt, um sein Ansinnen abzusichern, oder vielleicht hatte Major Wilkes ihn dazu gedrängt, schließlich könne er nicht jedem seiner Soldaten erlauben, wegen einer aufgebauschten Privatangelegenheit dem Dienst fernzubleiben. Und der Gefreite Caan hatte klug geantwortet, dass er in der Tat gemäß dem Wunsch seiner Mutter handle.
Aber »bollocks«. Büchner benutzte, für sich im Stillen, dieses englische Wort, an das er sich gut erinnerte und das hier überaus passend schien. »Blödsinn«. Büchner war ein ziemlich geübter Menschenkenner. Dass dies nicht die Idee der Mutter, Eva Adele, gewesen war, lag für ihn klar auf der Hand. Die Mutter, vielleicht Anfang vierzig wie er selbst, würde die Sache wahrscheinlich lieber auf sich beruhen lassen, sie beiseiteschieben – was oft das Leichteste und manchmal auch das Beste war. Es war einfach Pech, dass ihr Sohn nicht nur eingezogen, sondern dann auch nach Deutschland geschickt worden war. Ausgerechnet. Das war der Kern der Sache, die vor ihm, Büchner, lag. Hatte dieser Major Wilkes das nicht in der Miene des jungen Mannes gesehen?
Auch für den Sohn war es ein Pech, aber daran konnte der Sohn nichts ändern. Deutschland war das Land, in das die meisten jungen Rekruten geschickt wurden. Hatten Mutter und Sohn nicht damit gerechnet? Hinzu kam der andere, ebenfalls bittere Aspekt: Er, der Sohn, war jetzt Soldat, so wie sein Vater, Benjamin Franz – der zwar in Deutschland geboren, aber offenbar als Soldat der britischen Armee ums Leben gekommen war.
All das war sehr interessant. Er hätte sich gern mit dem Gefreiten Caan unterhalten, ein entspanntes, freimütiges Gespräch mit ihm geführt, und hier, in diesem stillen Büro, bot sich doch die ideale Gelegenheit, aber schließlich war es nicht das, worum es eigentlich ging. Außerdem bestand die Möglichkeit schon deshalb nicht, weil es dem jungen Mann vor ihm eindeutig an Konversationsgabe fehlte. Wenn auch nicht an Initiative.
Büchner hätte gern, mit dem passenden Lächeln, gesagt: »Ihr C. O. hat ja beachtliche Deutschkenntnisse …«
Der Gefreite Caan handelte nicht auf Anweisung seiner Mutter, das erkannte Büchner – man sah es in seinen Augen. Er war kein Muttersöhnchen. »A mother’s boy«, wie es im Englischen hieß. Wahrscheinlich war er in diesem Moment von seiner Mutter weiter entfernt denn je zuvor. Sicher, er hätte auch woanders als in Deutschland stationiert werden können, dann wäre die Sache gar nicht erst aufgekommen. Er hätte nach Hongkong geschickt werden können. Aber jetzt war er hier, für mehrere Monate sogar, und Joseph Caan hatte offenbar beschlossen, dass er sich der Sache stellen musste. »To face the music«, wie man im Englischen so schön sagte.
Der junge Mann hatte sein Barett umgehend abgenommen, wie auf Befehl, schien aber nicht zu wissen, was damit tun. Er hielt es mit beiden Händen auf dem Schoß und drückte es wie ein Plüschtier. Etwas war in sein Leben getreten, etwas Großes, Drängendes, nicht zu vergleichen mit dem, was er kannte, und er hatte allein für sich beschlossen, dem nicht auszuweichen. Joseph Caan würde nicht zulassen, dass sein zukünftiges Ich später, wenn es für immer zu spät war, zu ihm sagte: Du warst in Deutschland, du warst da und bist der Sache nicht nachgegangen. »You prick.« Du Versager.
Die Wörter fielen Büchner wieder ein, die Wörter der englischen Soldaten. Und hatte dieser junge Mann nicht das Recht und allen Grund zu fragen, was dieser scheißfreundliche Kerl – oder dieser »prick« – im Krieg gemacht hatte? Trotzdem wirkte er wie auf dem falschen Fuß erwischt, in diesem Gespräch mit einem Deutschen, der besseres Englisch sprach als er selbst.
Als Soldat war der Gefreite Caan zwar daran gewöhnt, ständig Befehle auszuführen, aber hier handelte er, wenn auch mit einiger Befangenheit, allein und aus eigenem Antrieb. Büchner mochte nicht nur sein Gesicht, er mochte ihn.
Zugleich war es äußerst deprimierend. Was konnte er, selbst als Amtsleiter, schon für ihn tun? Sollten sie sich nicht doch einfach unterhalten? Würde er noch rauchen, könnte er dem jungen Mann eine Zigarette anbieten. Aber bei seiner Rückkehr nach Deutschland, vor Jahren, hatte er das Rauchen aufgegeben. Rauchen tat man – wenn man Zigaretten bekommen konnte –, um die Zeit totzuschlagen. Trotzdem könnte er den jungen Mann auffordern, sich eine Zigarette anzuzünden. War das eine Zehnerpackung da in seiner Brusttasche? »Player’s, Please.«
Herr Büchner musste daran denken, wie er vor sehr langer Zeit, in einem anderen Leben, zum Offizier gemacht worden war. Er wurde Offizier, nicht Kadett. Offizier untersten Ranges zwar, gleichwohl Offizier. Er hatte nicht mit der unsichtbaren Schwelle gerechnet, die er zu überwinden hatte, der Prüfung, die ihm noch bevorstand. Wenn er Offizier war, musste er wie ein Offizier handeln.
Ein Mann hatte vor ihm gestanden. Die Situation ähnelte im Grunde dieser hier, wenn sie sich auch nicht in einem Büro im Rathaus zutrug und der Mann vor ihm tatsächlich stillstand und keinen Stuhl angeboten bekam. Und obwohl dieser Mann um viele Jahre älter war als er, Büchner, hatte er salutieren und die Hacken zusammenschlagen müssen, weil er vor einem Offizier stand – der hinter einem kleinen Schreibtisch saß, um einiges kleiner und schlichter als dieser hier –, ein Offizier, der vermutlich eher aussah wie ein Schuljunge beim Nachsitzen.
Büchner hatte sich nicht vorgestellt, dass er zu urteilen hätte. Dass er die Macht hatte, Strenge oder Milde walten zu lassen, als wäre er Gott der Allmächtige.
Es ging um eine Lappalie. Der Mann bat, zweifellos aus privaten und ihm persönlich wichtigen Gründen, um einen Tag Urlaub. Es war keine anmaßende Bitte, und ihr stattzugeben, wäre ein Leichtes gewesen. Doch weil Büchner Offizier war und gerade erst dazu gemacht worden war, durfte er nicht führungsschwach erscheinen. Deshalb hatte er die Bitte des Mannes mit knappen Worten abschlägig beschieden und ihn fortgeschickt.
Warum? Der Mann – er hieß Krüger, das wusste er heute noch – hasste ihn jetzt bestimmt. Und auch Büchner hasste sich, auch in Zukunft würde er sich dafür hassen. Er würde diesen Vorfall nicht vergessen – auch jetzt erinnerte er sich daran –, obwohl er mit unsäglich viel schlimmeren Dingen konfrontiert worden war. Seine miese kleine Machtdemonstration.
Das war über zwanzig Jahre her. In Koblenz. Und Jahre zuvor hatte er sich gesagt: Melde dich, tu’s freiwillig, selbst wenn du noch zur Schule gehst. Geh hin, bevor sie dich holen. So bringst du es vielleicht zum Offizier. Das war sein verdeckt defensives Denken gewesen. Betrachte alles als eine Gelegenheit – als einen Weg, der, das meinte er damit, die geringste Gefahr barg. »Play your cards right«, wie die Engländer sagen.
Und wie sie Karten gespielt hatten, tagein, tagaus, um die Zeit totzuschlagen, im regennassen Lincolnshire. Er hätte diesen Landstrich sonst niemals kennengelernt. Sie spielten, bis die Karten feucht und pappig waren und zerfledderten, jede auf ihre eigene traurige Weise, bis man sie – wenn man schlau war, wenn man seine Karten richtig spielte – erkennen konnte, ohne sie umzudrehen.
Der junge Mann umklammerte noch immer sein Barett. Er schien außerstande, es zusammengerollt, wie es sich gehörte, unter den Schulterriegel zu schieben. Auch konnte er sich anscheinend nicht entspannt zurücklehnen und die Beine übereinanderschlagen. Aber wie sollte man das auch tun, mit diesen Donnerstiefeln und diesen anderen lachhaften Dingern – wie hießen sie noch im Englischen? »Gaiters«? Richtig, das war das Wort. Gamaschen.
Wie erniedrigend musste es sein, selbst für einen einfachen Schneiderlehrling, in diese entsetzliche Bekleidung gesteckt zu werden, die Standarduniform britischer Soldaten. Eine Absurdität, »Kampfausrüstung« genannt.
»Zünden Sie sich gerne eine Zigarette an, Mr Caan.« Büchner schob einen Aschenbecher über den Tisch.
Aber der junge Mann sagte: »That’s all right«. Was in diesem Fall hieß, wie Herr Büchner wusste: »Nein, danke«, und nicht: »Vielen Dank, gern«.
Überwältigt, in dieser städtischen (und deutschen) Umgebung zu sitzen, erwartete der Gefreite Caan offensichtlich, dass er nach ein bisschen »buttering up«, ein paar Höflichkeiten, die ja schon im Gange waren, seiner Wege geschickt werden würde. »Fobbed off.« Das Übliche im Leben.
Wie recht er damit hätte haben können. Und wie wenig er vielleicht je begreifen würde, warum sich die Dinge zu seinen Gunsten wendeten.
»Sie müssen verstehen, Mr Caan – verzeihen Sie, wenn ich das so unumwunden sage –, aber leider haben Sie sich an die falsche Stelle gewendet, oder vielmehr haben Ihre Vorgesetzten Sie an die falsche Stelle verwiesen. Angelegenheiten dieser Art fallen nicht aufgrund einer Ortszugehörigkeit in die lokale Zuständigkeit. Dies hier ist ein gewöhnliches Rathaus – Town Hall. Und dies ist das lokale Archiv. Im Erdgeschoss sind Sie am Standesamt – dem Registry Office – vorbeigekommen. Geburten, Todesfälle, Eheschließungen. In Ihrem Land werden die drei, soweit ich weiß, immer in dieser befremdlichen Reihenfolge genannt.«
Da waren wir also. Die Augen des Mannes flackerten plötzlich auf. Er hätte es wissen können – Joseph Caan hätte es wissen können! Er war Punkt elf Uhr gekommen, wie zum Appell. Er hatte um Erlaubnis ersuchen und zweifellos von seinem Stützpunkt außerhalb der Stadt für den Weg hierher eine Fahrgelegenheit finden müssen. Jetzt wurde er seiner Wege geschickt – »fobbed off« –, wenn auch in elegantem Englisch (Büchner fiel das Wort »poncy« ein, großkotzig). »Given the brush off« – ihm wurde die Tür gezeigt, er wurde weitergeschickt.
Alle diese Ausdrücke kamen ihm wieder in den Kopf.
»Angelegenheiten dieser Art sind auch nicht Sache der Bundesregierung oder des Bundesarchivs, sondern gehören – und Ihr befehlshabender Offizier hätte das wissen können – zu den Aufgaben des Tracing Service, des Suchdienstes. Er hat seinen Sitz in Arolsen, in der Nähe von Kassel. Der Suchdienst ist keine deutsche Institution, sondern wird vom Internationalen Roten Kreuz geleitet.« (Er hätte hinzufügen können: »Was Ihre Mutter, hätte sie wirklich etwas tun wollen, schon längst hätte herausfinden können.«) »An den sollten Sie sich wenden, den ITS, den Internationalen Suchdienst, das ist die richtige Anlaufstelle für Ihr Anliegen.«
Aber er hatte den jungen Mann lange genug hingehalten, dies war der Moment nachzugeben.
»Nonetheless … nonetheless …«
Diese langen englischen Konjunktionen, »nonetheless«, »nevertheless«, er mochte sie zu gerne.
»Dennoch, da Sie nun schon einmal hier sind, oder vielmehr mit Ihrer Einheit hier stationiert sind, und da Sie in Ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind und Ihre Anfrage von Ihrem befehlshabenden Offizier voll unterstützt wird, werde ich mich – nach Kräften, Mr Caan – gerne für Sie verwenden.« Sein freundliches Lächeln vom Anfang kehrte zurück. »Ich will damit sagen, ich werde mich in Ihrem Namen an den Suchdienst wenden – ich weiß, wen ich kontaktieren kann – und alles mir Mögliche tun, um etwas über das – Schicksal – Ihrer Verwandten in Erfahrung zu bringen.«
Er hoffte, dass sein Lächeln jetzt voller Wohlwollen und Wärme war. Das Wort »fate«, Schicksal, in ein Gespräch einfließen zu lassen, war immer heikel. Aber es war auch ein sehr bewegliches und vielseitiges Wort. »Schicksal« – wenn man eine Karte aufnahm oder ein Dokument unterschrieb, wenn einer schroff abgewiesen oder ein Gewehr auf ihn gerichtet wurde. Oder – wie viele waren so verloren oder gerettet worden? – mit einem schlichten Fingerschnippen.
Die Haltung des jungen Mannes änderte sich jetzt wahrnehmbar. Er gab zu erkennen, dass er sich bis zu diesem Moment in einem Zustand großer Anspannung und Beklommenheit befunden hatte. Er sagte: »Thank you, Sir«, fast als wäre ihm eine Missetat vergeben worden.
»Thank you«, das war ein guter Ausdruck, viel besser als »fate«.
»Ich bitte Sie – lassen Sie das ›Sir‹ weg. Ich bin Beamter im öffentlichen Dienst, ich sollte Sie mit ›Sir‹ anreden. Ich werde tun, was ich kann, seien Sie dessen versichert. Und was ich an Erkenntnissen zusammentrage, werde ich Ihnen über Ihren befehlshabenden Offizier zukommen lassen. Das ist meiner Auffassung nach der richtige Weg, meinen Sie nicht auch? Aber seien Sie darauf gefasst, dass das, was ich an Neuem in Erfahrung bringen kann, möglicherweise sehr wenig ist. Vielleicht kaum mehr als das, was Sie – wenn ich das so sagen darf – ohnehin schon ahnen. Es gibt erstaunlich detaillierte Dokumente. Und es ist sowohl erschütternd als auch nützlich, dass es sie gibt. Andererseits wurde gegen Ende des Krieges viel vernichtet, wie Sie verstehen werden.«
Der Mann sah ihn immer noch dankbar an, aber in seinen Blick trat wieder eine gewisse Schärfe.
»Eins würde ich gern noch sagen, Mr Caan, wenn Sie mir gestatten … Ungeachtet dessen, was ich herausfinden und an Sie weiterleiten kann, empfehle ich Ihnen, der Sache, so weit es Ihnen möglich ist, selbst nachzugehen, solange Sie hier in Deutschland sind. Ich empfehle Ihnen, den Suchdienst persönlich aufzusuchen, die Dokumente einzusehen und mit den Leuten dort zu sprechen. Zugegeben, es ist ziemlich weit weg von hier. Sie müssten sich um eine Erlaubnis und die entsprechende Unterstützung bemühen – aber schließlich sind Sie schon bis hierher gekommen. Ich überlasse das Ihnen und Ihren Vorgesetzten. Doch vorerst können Sie auf meine Unterstützung zählen. In manchen Dingen, das ist meine Überzeugung, Mr Caan, ist es wichtig, nicht zu zögern, wenn die Gelegenheit da ist, sondern sich der Sache unmittelbar anzunehmen – »head on«, wie Sie vermutlich sagen würden. Ich bin mir sicher, Sie verstehen. Damit haben Sie schon begonnen. Sehr anerkennenswert, wenn ich das sagen darf.«
Da. Er hatte es gesagt. Zu einem Soldaten. Jetzt würde sich der junge Mann tugendhaft und gerechtfertigt fühlen. Es war sogar möglich, dass er hier – an einem Donnerstagvormittag, in einem gewöhnlichen deutschen Rathaus – von einem heldenhaften Gefühl erfüllt war. Selbst wenn er nichts weiter erfuhr, was von Bedeutung war, konnte er sich immerhin sagen: Ich war in Deutschland, und ich hab meinen Arsch hochgekriegt.
Eines Tages würde er es vielleicht sogar seiner Mutter erzählen.
Und in der Zwischenzeit würde er seinem befehlshabenden Offizier vielleicht sagen (aber diese Wunschvorstellung behielt Herr Büchner für sich), dass es keinem britischen Offizier mehr gebührte, mit den Fingern zu schnippen und eine deutsche Behörde in wackligem Deutsch »auf Trab bringen« zu wollen – »keep them on their toes«, »make them jump to it«.
Himmel, Deutschland kam gerade wieder auf die Beine, war das Major Wilkes noch nicht aufgefallen? Und diese armen Kerle – seine Männer – in ihren Kampfuniformen, die einstigen großspurigen Eroberer, die jetzt immer mehr aussahen wie Flüchtlinge, da draußen in ihren schäbigen Kasernen. Wie es wohl zurzeit in ihrem berühmten Großbritannien aussah?
Herr Büchner wünschte, der Mann vor ihm besäße die Gabe der Konversation, dann könnte er ihm diese Frage frei und unverhohlen stellen. Aber es war offensichtlich, dass der Gefreite Caan, aus welchen Gründen auch immer – und sei es nur deshalb, dass er sich seit ein paar Monaten an die Regel halten musste, nur dann zu sprechen, wenn er angesprochen wurde – kein Redner war. Ein Denker vielleicht, aber kein Redner.
Und er, Herr Büchner, oder Leutnant Büchner, wie sein Titel damals lautete, hatte einst reichlich Zeit gehabt – war der junge Mann zu diesem Sprung der Fantasie nicht imstande und erriet es? –, sich ihr Großbritannien anzusehen, so wie es damals war. Hatte Zeit gehabt, sich an Sätze wie: »Now look here, my man« und: »Now listen here, my good chap«, zu gewöhnen. Jetzt hören Sie mir mal gut zu.
Aber dies war seine letzte Gelegenheit, und er wollte den Mann nicht einfach ›entlassen‹.
»Ich würde Ihnen gern eine Tasse Kaffee anbieten, Mr Caan, stünde es in meiner Macht. Aber es wird Ihnen nicht verborgen geblieben sein, dass das Rathaus kein Ort des Luxus ist.« Er lächelte und hob entschuldigend die Hände. »Ein bisschen besser hoffentlich als eine Kaserne.«
»That’s all right.«
Der Mann knetete sein Barett. Natürlich – was für eine furchterregende Vorstellung, als Soldat, der er ja war, mit dem Amtsleiter Kaffee trinken zu müssen. Oder gar ein Gespräch führen zu müssen.
»Nun gut, ich habe hier – Ihre Liste. Sollte es noch andere Einzelheiten geben, die Sie – ergänzen möchten …?«
Wieder überflog Herr Büchner das Blatt Papier mit den Namen. Jakob, Leopold, Hanna … Der junge Mann würde nur wenig über sie wissen, er konnte keinen von ihnen gekannt haben. Neben einigen stand eine einst zutreffende (jetzt zweifellos erloschene) Adresse, oder der vermutete Beruf. »Schneider?« »Juwelier?« »Lederwarenhändler?« Die Angaben waren kaum dürftiger als die zu Joseph Caan selbst. Aber das Eigentliche starrte einem natürlich ins Gesicht.
Wie schrecklich eine einfache Namensliste sein konnte. »Da, bitte«, mochte Major Wilkes gedacht haben, als er sie dem Brief beilegte.
»Ihr C. O. erwähnt, dass Ihr Vater in Nordafrika gefallen ist.«
Das sagte er beiläufig, als wäre es ihm gerade erst aufgefallen, während er das Blatt vor sich noch einmal überflog, und als hätte er die Erwähnung nicht schon beim ersten Lesen als signifikant, um nicht zu sagen ostentativ registriert. Zweifellos sollte das ebenfalls ein: »Da, bitte!« sein. Ein: »Jetzt machen Sie mal.«
Und zweifellos hatte dieser Major Wilkes Ruhmreiches in der Normandie vollbracht oder, wer weiß, den Rhein überquert.
»Ja«, sagte der Gefreite Caan schlicht.
Herr Büchner hatte den Eindruck, der Gefreite war bemüht, das Wort so neutral wie möglich klingen zu lassen.
Er lächelte ihm wieder zu und hoffte, sein Lächeln – wie kompliziert doch alles war – möge bloß nichts Herablassendes haben.
»Dann sollte ich Ihnen erzählen, dass auch ich in Nordafrika im Einsatz war. Auf der anderen, der Gegenseite, versteht sich.«
Da. Er versuchte, den Gesichtsausdruck des jungen Mannes zu deuten. Er wirkte lediglich überrascht – und jung. Aber wenigstens hatte Büchner jetzt Joseph Caan die unausgesprochene Frage ansatzweise beantwortet, nämlich: Was hat dieser scheißfreundliche Kerl im Krieg gemacht?
War er jetzt aus der Kategorie der ›scheißfreundlichen Kerle‹ aufgestiegen? Herr Büchner hoffte es.
»Ist Ihr Vater – dort begraben? In Nordafrika?«
Wie schwierig doch ein Gespräch war.
»In Tobruk.«
»Tobruk.«
Plötzlich drang das Wort in Herrn Büchners Büro ein. Und stürzte dann schwerfällig und abrupt aus seinem eigenen Munde. Er hatte immer gefunden, dass es wie ein Stück herausgebrochenes Mauerwerk klang, wie ein anderes Wort für »Bruchstein«. Fast als wäre es ein deutsches Wort.
Aber zu dem jungen Mann sagte er nicht – und ihm war unklar, warum nicht –, dass er selbst auch in Tobruk gewesen war, oder ganz in der Nähe. Natürlich als es unter der Belagerung deutscher Truppen stand.
Das sagte er nicht. Würde er das bedauern? Unterließ er damit nicht genau das, was er zuvor empfohlen hatte – sich der Sache zu stellen, »head on«? Er hatte den Namen einfach plump wiederholt, als hätte er ihn zum ersten Mal gehört.
Schicksal: insgesamt eine unbequeme Angelegenheit.
Und der Vater des Mannes vor ihm hatte »auf der anderen Seite« gestanden, falls dieser Ausdruck heute noch einen Sinn ergab. Es ließ sich leicht ableiten – ein Deutscher, der Brite geworden war und gegen die Deutschen kämpfte. Und dazu Jude war.
»Tobruk«, sagte Herr Büchner. »Ich verstehe.«
Warum hatte er nicht mehr gesagt? Konnte der junge Mann ihm nicht helfen – und das lose Ende, ja, das angebotene Seil in dieser stockenden Zwiesprache, aufnehmen? Aber er war erst neunzehn, und die Zähne nicht auseinanderzubekommen, schien seiner Wesensart zu entsprechen, und jetzt saß ihm jemand gegenüber, der in dem Moment, untypisch für ihn, die Zähne ebenfalls nicht auseinanderbekam.
Der Ortsname hatte wie ein Klumpen in seinem Mund gelegen. Wann hatte er ihn das letzte Mal ausgesprochen?
Er stand auf, zum Zeichen, dass die Unterredung beendet war, und streckte abermals – jedoch weniger förmlich, hoffte er – seine Hand aus.
»Sie dürfen die Angelegenheit ruhig mir überlassen. Ich melde mich wieder bei Ihnen – über Ihren befehlshabenden Offizier, versteht sich.«
Dann ging der junge Mann – er war seines Baretts endlich wieder Herr geworden und hatte es aufgesetzt. Zum Glück kam ihm nicht der unwillkürliche Impuls zu salutieren. Sobald er durch den Hauptausgang auf den Platz getreten war, würde er zweifellos mit einem Gefühl der Befriedigung und Befreiung tief einatmen. Auch wenn überhaupt nichts weiter geschah, würde er vielleicht mit dem Gefühl gehen, dass er seine Pflicht, wie er sie verstand, getan, sein Gewissen beruhigt und seinen verschwundenen und ermordeten Verwandten Ehre erwiesen hatte.
Und seine Mutter würde es erfahren oder auch nicht.
Herr Büchner setzte sich wieder an seinen Schreibtisch und legte die Hände auf die noch geöffnete Akte vor sich. Seine Hände – in Nordafrika hatte er sie ein einziges Mal erhoben, das war die Entscheidung. Er hatte sein Ticket, seinen Freispruch, sein Alibi, wie immer man es nennen mochte, erwirkt. Seine Hände waren sauber – später würde der Krieg in Afrika sogar »der saubere Krieg« genannt werden. Aber in Wirklichkeit war alles – seine Hände, sein Gesicht, seine Augen, seine Ohren, seine Uniform – bis zum Ersticken mit Staub bedeckt. Selbst sein Mund war voller Staub. Er hätte es nie für möglich gehalten, dass man von einer so dicken Staubschicht überdeckt sein konnte.
Er hatte seine Entlassung bekommen, die Erlaubnis zu gehen, so wie gut zwanzig Jahre zuvor Herr und Frau Caan – später Mr und Mrs Caan – ihre Ausreiseerlaubnis erhalten haben mussten und das Schiff, sei es in Bremerhaven oder anderswo, nach London genommen hatten. Zwei von denen, die Glück hatten.
Auch er, Herr Büchner, bestieg schließlich ein Schiff, auch er gehörte zu denen, die Glück hatten, und gelangte nach England, oder nach Großbritannien, was einem lieber war. Er kam schließlich nach Lincolnshire. Und wie war das Leben in Lincolnshire? Es war nicht Afrika. Zunächst einmal war es grün und oft sehr nass. Und jeden Abend, allerdings nicht bei starkem Regen, formierten sich am Himmel die Bomber und flogen über die Nordsee hinaus, um die da unten in ihrem Lager daran zu erinnern, dass ihr Land »what-for« bekam. Das war der Ausdruck: »what-for« – die Hucke voll.
Und vielleicht war es einer dieser Bomber, der eines Nachts seine Bomben über Mannheim abwarf, oder ganz in der Nähe, und wie das Schicksal es wollte – er erfuhr erst sehr viel später davon –, waren seine Eltern Ernst und Clara Büchner dabei umgekommen. Im Jahr 1943, in einem Dorf unweit von Mannheim, wo Ernst Büchner Pastor gewesen war.
Aber er, ihr Sohn Hans, war davongekommen und hatte mit all dem nichts zu tun. Er hatte sein POW-Zertifikat, das ihn von allem befreite. Noch heute spürte er die Initialen, als wären sie ihm eingebrannt: Pe-O-We. So wie er auch den Staub in seinem Mund spürte und das Wort Tobruk – gewissermaßen ähnelte es dem Wort »kaputt« – an seine Zunge prallte. Der Preis, der für dieses Zertifikat erhoben wurde, waren sechs Jahre seines Lebens, »the best years of your life«, wie es immer heißt.
Aber sag das mal denen, die viel Schlimmeres erlitten hatten.
Wäre er richtig schlau gewesen – er, der geübt darin war, Chancen zu wittern –, wäre er eine riskante Liaison mit der Tochter eines Farmers eingegangen und – was? – Schweinezüchter geworden? Er hätte sich unter die Einheimischen mischen und Engländer werden können, oder Brite.
Stattdessen fand er hinten in einer der Lagerhütten ein paar Borde mit einer Auswahl von Büchern, ein funktionierender Ofen stand gleich daneben. Meine Güte, eine Bibliothek. Wer hatte sie bestückt? Welcher freundliche oder törichte Mensch war auf die Idee gekommen, eine Schiffsladung deutscher Offiziere könnte sich an Büchern erfreuen, alle auf Englisch? Eine kleine propagandistische Kostprobe englischer Literatur. Dr. Johnson. Pride and Prejudice.
Während also der Regen niederprasselte, nutzte er die Gelegenheit, sein Englisch zu verbessern, auf Hochglanz zu bringen, in der Annahme, eines Tages, wenn das hier vorbei war, könnte das auch eine Art Ticket sein. So wie er mussten etliche gedacht haben.
Alles um ihn herum – das Lager und die Arbeit, für die sie auf die Felder von Lincolnshire geschickt wurden, wo es auch »with a war on« immer reichlich Kartoffeln gab – war das Alltägliche oder das Schmutzige, die Bücher waren die Sahne. In den sechs Jahren erwarb er sich ein fast perfektes (und bei Bedarf schmutziges) Englisch, doch welchen Nutzen hatte es ihm gebracht, seit er wieder in Deutschland war?
Bis jetzt, vielleicht, bis zu diesem Tag, einem gewöhnlichen und bewölkten Donnerstag, an dem sein Englisch die Gelegenheit bekommen hatte, zu glänzen, zu leuchten, sich zu beweisen.
Und sich mit einem Engländer zu messen, der so gut wie stumm war.
Eines Tages in Lincolnshire sagte man ihnen mit knappen Worten, Adolf Hitler sei tot, Berlin sei dem Erdboden gleichgemacht, und in der Nähe der Kleinstadt Bergen seien unaussprechliche Dinge entdeckt worden. Da, bitte.
Und eines Tages, oder eines Nachts, stiegen die Bomber nicht mehr auf.
Es dauerte dann noch einmal zwei Jahre, bis sie zurückgeholt wurden, das hatte viel für sich, und als sie zurückkamen, hatten sie Angst, richtig Angst – und zu Recht – vor dem, was sie erwartete. Und dann noch einmal mehrere Jahre, wie eine weitere Gefangenschaft, Jahre der nationalen Buße. Aber ihre Hände waren sauber. Hier, bitte, vollkommen sauber.
Und welche Entdeckung hatte er gemacht, von der er dann überrascht war? Dass er Deutscher war, ja, und dass er hierhergehörte. Dies war seine lang vermisste Heimat. Auch wenn es sein Zuhause und seine Eltern nicht mehr gab – dies war das Land, wo er geboren war.
Büchner stand auf und ging zum Fenster, von dem aus er gleich den Gefreiten Caan sehen würde, wie er den Platz überquerte und wartete, bis die Straßenbahn vorübergefahren war. Da war er auch schon. Büchner fragte sich, ob Joseph Caan dieser Tag in Erinnerung bleiben würde, ob er in seinem Gedächtnis haften und eine Bedeutung für ihn behalten würde. Ob er sich daran erinnern würde, wie er als Soldat einen deutschen Platz überquert hatte, den Karlsplatz, und sich einen Moment lang nicht als Soldat gefühlt hatte (falls er sich je so gefühlt hatte), sondern trotz Uniform ein junger Mann war, frei und ungebunden. Das ganze Leben vor sich.
Die Engländer hatten einen seltsamen kleinen Abzählreim: Tinker, tailor, soldier …
Ja, immer wieder kamen Menschen ins Rathaus, in sein Amt, und wollten Dinge herausfinden, suchten Informationen, und mussten erfahren, dass dies nicht Sache des Rathauses sei. Sie sollten sich an den Suchdienst wenden, war ihnen das nicht bekannt? Hier – nehmen Sie dieses Faltblatt mit nützlichen Hinweisen.
Trotzdem kamen sie, obwohl es 1959 war, und dies nur eine Stadt von vielen. Offenbar gab es sogar mehr Anfragen als zuvor. Vielleicht mussten viele erst den Mut finden, sich ein Herz fassen. Oder vielleicht hatte es in den ersten Jahren so viel anderes zu tun gegeben, mussten so viele Dinge angepackt werden. Oder vielleicht wurde mit der vergehenden Zeit die Frage immer dringlicher: Wenn nicht jetzt, wann dann? Wirst du es nie angehen? Lässt du dein Leben einfach verstreichen – dein Leben – und nie –?
Er sah, wie der Gefreite Caan die gegenüberliegende Seite des Platzes erreichte und hinter der Reihe neu gepflanzter Linden verschwand.
Natürlich, man konnte auch gar nichts tun, sich abwenden, vergessen, weiterleben. Es war eine Entscheidung.