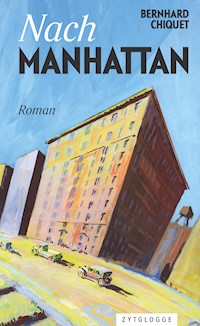
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der nach Manhattan ausgewanderten Chiquets, die als Butler und Kindermädchen für illustre Persönlichkeiten der Upperclass arbeiten, lädt ein in die turbulente Zeit der Zehner- und Zwanzigerjahre des letzten Jahrhunderts in New York. Während Alcide Chiquet im Hause Rockefeller engagiert wird, entdecken seine Schwestern den Jazz und den Sog des Großstadttaumels. Alcide kehrt 1917 nach Cornol zurück, um den elterlichen Hof zu übernehmen. Jahre später folgt ihm seine Schwester Julia nach. Im Dorf sind sie als «Américains» Gegenstand ambivalenten Interesses – und beindrucken den Autor als Kind nachhaltig. Ein liebevoller, eindringlicher Text, der die großen Träume und Abenteuer einer besonderen Generation erzählt – und immer wieder Raum für die Frage lässt, mit wie viel Fantasie jene Anekdoten gespickt waren, die sie bis zuletzt umrankten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Impressum
Titel
Prolog
Teil I
Aufbruch
Reisen Sie mit Zwilchenbart!
Sterling, Ohio
For Men May Come
Wirst du auf mich warten?
Dazwischen
Zur Probe
Bei den McCurdys
Das Hütchen
Irritationen und Umbrüche
Entreacte 1
Teil II
Im neuen Haus
Die Belagerung
Und die Zukunft?
Geburtstage und andere Feiern
Zu spät
Bewegte Bilder
Weiß, schwarz, Übergänge
Druckwellen
Spiel und Ernst
Der Konvoi (Heimkehr)
I vôs sailue Mairie
Coughs and Sneezes
Entreacte 2
Teil III
Bei den Baileys
1920 – ein neues Jahrzehnt
Jenseits des Horizonts
Die Chiquet Sisters
Im Jazz Age
Scharfe Gegensätze
Becoming Mrs. Jean Dirand
Tote und Phantome (Epilog)
In Erinnerung an die Cornoler Chiquets
Dank
Über den Autor
Buchrückseite
Bernhard Chiquet
Nach Manhattan
Autor und Verlag danken für die Unterstützung:
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
© 2023 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Alisa ChartéKorrektorat: Anna Katharina MüllerUmschlagbild: Bernhard Chiquet
Bernhard Chiquet
Nach Manhattan
Roman
Fifth Avenue and Forty-Fourth Street swarmed with the noon crowd. The wealthy, happy sun glittered in transient gold through the thick windows of the smart shops, lighting upon mesh bags and purses and strings of pearls in gray velvet cases; [...].
Prolog
«Ah, da ist ja Long'Alcide!», rief mein Vater aus. In meinen Kinderohren klang das nach Abenteuer, ein amerikanischer Name aus einer Geschichte von Karl May, eines Helden wie Old Firehand, Dick Hammerdull, Hobble Frank – und Long'Alcide, warum nicht? Tatsächlich war dieser Name eine in der Gegend übliche Verkürzung vom französischen l'oncle Alcide.
An dieses erste Mal, als ich nach Cornol mitgenommen wurde, kann ich mich erinnern, da war ich vielleicht sechs oder sieben Jahre alt. Mit meinem Vater kam ich von der Kirche her, und als wir beim Haus in der Gabelung der Dorfstraße nach rechts in das Sträßchen La Rasse einbogen, begriff ich, dass hier meine Verwandten wohnten. Der Großonkel war am Holzspalten vor dem Scheunentor. Der Spaltstock stand zwischen zwei großen Haufen, links das schon Zerkleinerte, rechts die groben Klötze. Er hielt das Scheit mit einer Hand und hieb die Axt dicht neben seinen Fingern ins Holz. Er brauchte nur einen Schlag, um es zu teilen. Als wir ins Haus gingen, machte er noch eine Weile weiter und kam dann nach. Tant'Julia konnte ich bei der Begrüßung nicht ausweichen. Sie packte mich mit hartem Griff und drückte mir links und rechts einen stacheligen Kuss auf die Wange.
Viele Personen saßen am Stubentisch beim Essen des weichgekochten Sonntagsbratens. Mein Vater, meine Mutter – die kam nur dieses eine Mal mit, meine ich –, mein Bruder, meine Schwester. Long'Alcide, Tant'Joséphine, Tant'Julia. Sie und Long'Alcide neckten einander immer wieder. Mein Vater lachte und übersetzte, was sie sagten: «Sèrre-te, véye toétchon! – Quetsch dich mal zusammen, alter Lappen!» Long'Alcide trug ein Gebiss im Oberkiefer, eine Reihe blendend weißer Zähne, die sichtbar wurden, wenn er sprach oder lachte. Der Unterkiefer war eingefallen, als hätte er dort keine Zähne. Ich meine mich zu erinnern, wie er und Tant'Joséphine Mühe hatten beim Beißen, dass auch deshalb alles sehr weichgekocht war. Long'Alcide gab sich lustig, gut gelaunt. Er hörte allerdings fast nichts. Ein altmodisches Hörrohr wie das von Professor Tournesol im Tintin lag herum. Er benutzte es aber nicht, sondern formte stattdessen mit der Hand eine Muschel hinter seinem Ohr.
Wir Kinder verstanden kein Wort von dem, was die Erwachsenen sprachen. Mein Vater redete Französisch mit dem Onkel und den Tanten, sie antworteten in einer Mischung aus Französisch und Patois. Kaum hatten wir gegessen, wollten deshalb meine Schwester und ich den Tisch verlassen. Wir schlichen uns davon in die Scheune. Sie wurde schwach beleuchtet von Sonnenstrahlen, die ihren Weg fanden durch die Lüftungsschlitze zwischen den Brettern. Es gab zwei Holzböden auf verschiedenen Ebenen, die vertikal etwa drei Meter voneinander entfernt waren. Eine Leiter mit ausgedörrten und deshalb wackeligen Sprossen stand angelehnt am oberen Boden. Wir stiegen hinauf, das Heu lag schon ewig dort und war staubtrocken. Weil wir es bewegten, wurde der Raum jetzt von schrägen Lichtbahnen durchschnitten. Wenn wir von der oberen zur unteren Heubühne hinunterschauten, war da ein schwarzer Abgrund. Wir kletterten nochmals hinunter und schaufelten mit Händen und Armen alles Heu auf einen Haufen zusammen, von dem wir hofften, er werde unseren geplanten Flug sicher abbremsen. Wieder oben, warteten wir so lange, bis jemand den Mut hatte zu springen. Schon nach dem ersten Sprung waren wir süchtig.
Tant'Julia kam in die Scheune und schimpfte. Es war uns klar, was sie sagen wollte. Dass gefährlich sei, was wir da machten, und wir zurück in die Stube kommen sollten. Wir taten so, als verstünden wir nichts, und sprangen weiter. Da kam sie zurück mit meinem Vater. Sie wiederholte, dass wir aufhören sollten, redete auf meinen Vater ein. Er sagte: «Mais, laisse-les!»
Sie gab auf, schimpfte aber vor sich hin, als sie die Scheune verließ. Vater ermahnte uns nur, auf unsere Zungen aufzupassen.
Wer war wie viele Male in Cornol, wer hat sich um die alten Leutchen mehr gekümmert? Diese Fragen wurden immer wieder mal gestellt in der Familie. Mein Vater, meine Mutter, die jüngere Schwester, der ältere Bruder und ich waren nicht die fleißigsten Besucher. Der Mutter hat es gegraust in dem kleinen Häuschen, zum Beispiel, wie ich mich erinnere, vor dem Schüsselchen mit Zucker, aus dem die Cornoler mit dem Kaffeelöffel schöpften, wenn dieser schon in die braune Brühe und in den Mund gesteckt worden war. Es war alles ein bisschen verklebt, die Tischdecke voller Flecken. Oder vor dem Kirschkuchen, der zwar sehr gut schmeckte, dabei aber, weil er aus so kleinen ç'liejes gemacht war, hauptsächlich aus Steinen bestand. Deshalb blieb nach dem Essen eines Stücks ein schwarzroter Haufen davon auf dem Teller übrig, mehr oder minder manierlich ausgespuckt. Mein Bruder durfte – oder musste – ein-, zweimal im Sommer mit dem Vater zur Heuernte nach Cornol. Er kam von den Bremsen zerstochen zurück, war aber stolz auf sein Abenteuer. Er erzählte, dass ihn der Vater dort einmal angestupst und auf Long'Alcides Hose gezeigt habe. Diese war mit eingetrocknetem Mist beschmutzt und zog die Fliegen in Massen an. Das gab dann so ein Bild, Long'Alcides Hintern, umkreist von einer Wolke von Fliegen. Es war unmöglich zusammenzubringen mit anderen Bildern von ihm, mit bräunlichen Fotos aus den USA, auf denen er in tadellosen Anzügen und noch ohne Schnurrbart zu sehen war, vor teuren Autos und in Gesellschaft vornehmer Damen.
Da die Cornoler mehrere Flecken Land besaßen, auf denen Obstbäume standen, vor allem mit Äpfeln und Zwetschgen, musste im Herbst bei der Obsternte geholfen werden. Das haben nach Long'Alcides Tod andere aus der Familie übernommen, die Brüder des Vaters mit ihren Familien. Jemand, vielleicht eine Cousine, erzählte, dass Tant'Julia dann in der Mittagspause im Schatten eingeschlafen sei und wie ein Bär geschnarcht habe.
Als nur noch die beiden Großtanten allein im Haus lebten, wurde es kritisch. Tant'Julia ernährte sich überwiegend von Rotwein, Tant'Joséphine hatte schon lange böse Beine, war fast blind und konnte sich nur schwer bewegen. Ihre Neffen sorgten dafür, dass die zwei Alten einmal am Tag eine warme Mahlzeit bekamen, geliefert aus dem Gasthaus Boeuf. Aber Mitte der Siebzigerjahre begannen sich die Leute im Dorf Sorgen zu machen, die Frauen könnten im Haus stürzen oder unbemerkt versterben. Dazu feuerte Tant'Julia immer noch den Herd in der Küche ein, was zu weiteren Befürchtungen Anlass gab. In der Familie war man sich uneins darüber, ob man die beiden alten Frauen in ein Pflegeheim bringen solle oder nicht. Weil aber die Gemeindeverwaltung den Druck verstärkte, machte man sich auf die Suche nach einem geeigneten Heim. Man fand eines, das von Nonnen geführt wurde, und es gelang, die beiden dorthin zu bringen. Tant'Joséphine soll es sehr genossen haben, umsorgt und gepflegt zu werden, zum ersten Mal seit Jahren wieder einmal richtig gewaschen. Sie starb kurze Zeit später. Man würde gerne erzählen, sie sei in dem Heim verstorben. Friedlich eingeschlafen, nachdem man sich gut um sie gekümmert hatte, und sie ihr anstrengendes Leben in dem unbequemen Haus loslassen konnte. Aber es war anders. Sie starb im Spital von Pruntrut, nachdem sie im Heim gestürzt war und sich den Schenkelhals gebrochen hatte. Tant'Julia aber packte ein ums andere Mal ihr Köfferchen und haute ab, stellte sich mit erhobenem Daumen an die Landstraße und wollte nach Hause gefahren werden. Irgendwann wurde es den Nonnen zu viel. Sie musste in die halbgeschlossene Abteilung der Alterspsychiatrie von Bellelay gebracht werden. Dort lebte sie noch fünf Jahre, bis sie 1979 im nahen Spital von Tavannes starb. In Bellelay ging ich sie einmal besuchen mit meinem Vater. Wir holten sie ab für eine Spritzfahrt durch die Freiberge. Tant'Julia genoss das sehr. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie auf einem Bänklein sitzt, in die weite Landschaft blickt und befriedigt seufzt. Als wir sie gegen Abend zurückbringen, kommen wir am Ortseingang beim Schild vorbei. Da ruft sie: «È Bellelay, c'ât li qu'demoerant les fôs! – Da wohnen die Verrückten!»
Bevor sie im Portal der Anstalt verschwindet, dreht sie sich um und winkt uns fröhlich zu.
Nach dem Tod der Cornoler Verwandten ging das Haus in den Besitz der Erbengemeinschaft über. Die bestand zur Hälfte aus meinem Vater, unseren Onkeln und einer Tante, das heißt, aus den Söhnen und der einen Tochter meines Großvaters Jean Baptiste, dem ältesten der Cornoler Brüder. Die andere Hälfte wurde der Tochter von Célina zugesprochen, der jüngeren Schwester von Long'Alcide. Der älteste meiner Onkel, mit dem Namen Jean Baptiste wie sein Vater, verwaltete die Angelegenheiten und versuchte, das Haus der Gemeinde oder einem Nachbarn zu verkaufen. Nachdem dieser Plan fehlgeschlagen war, beschloss er zusammen mit den Geschwistern, es zu einem sehr niedrigen Preis einem Neffen zu überlassen. Dieser begann, zusammen mit einem befreundeten Schreiner, das Haus zu renovieren. Weil man nicht gleichzeitig darin wohnen konnte, stellten sie einen Sommer lang ein Zelt in den Obstgarten neben der Kirche. Leider stürzte der Schreiner in der Scheune mehrere Meter tief und ruinierte sich die Schulter. Zudem begann der Cousin eine Ausbildung als Goldschmied und wurde Vater, sodass das Projekt auf Eis gelegt wurde. Der Dorfbach unterspülte in der Zwischenzeit das Fundament. Eine Zeit lang hauste ein Künstlerfreund im Haus, dann verkaufte es der Cousin an einen Spekulanten, der es wiederum veräußerte an ein Paar aus Basel. Wie man heute sieht, blieben deren Bemühungen um eine Erneuerung irgendwann stecken. Es wirkt heute unbewohnt und präsentiert sich mitsamt dem Garten in erbärmlichem Zustand. Zwei Obstgärten, im Kern des Dorfes, direkt neben dem Friedhof, sind noch im Besitz von Nachfahren. Sie kümmern sich um die Ernte und die Pflege der Bäume.
Im Laufe der Zeit werden die ursprünglich detailreichen Erzählungen einer Familie abgeschliffen wie die Steine in einem Fluss. Auch bei uns Chiquets, von denen ich hier erzähle. Von den komplexen, zerklüfteten, vieldeutigen Geschichten bleiben grob zusammenfassende, schablonenhafte Sätze übrig, die halbe Leben zu umfassen behaupten.
Eine Tante ist in den USA verstorben, alle anderen Geschwister kamen arm zurück.
Der Pionier und Erfolgreichste war Long'Alcide, Kammerdiener bei Rockefeller Junior.
Eine Tante war drüben verheiratet, mit so einem Erfinder. Als er starb, kehrte sie zurück.
Was auch bleibt, sind farbige, mit Emotionen verbundene Anekdoten. So soll ein Neffe der Ausgewanderten bei Vorstellungsgesprächen in einem Smoking von Rockefeller aufgetreten sein, mit einem roten Pullover unter dem Kittel. Eine gute Geschichte, aber eher unwahrscheinlich, da der Neffe viel größer war als der Millionär. Es gibt in der Familie keine Kleidungsstücke und Schuhe von Rockefeller Junior mehr, von denen man erzählte, Long'Alcides Patron habe sie ihm großzügig überlassen. Es ist aber nicht zu bestreiten, dass es sie gegeben hat, denn mehrere Familienmitglieder erinnern sich übereinstimmend und detailliert daran. Mein Vater erhielt vom Onkel mehrere Paare identische, handgefertigte Schuhe, hellbraun, rahmengenäht und im Stil von Golferschuhen mit Lochgirlanden geschmückt. Er trug sie so lange, bis das Leder brach. Long'Alcide habe berichtet – so die Erzählung des Vaters –, dass Rockefeller von jedem Schuhtyp mehrere Paare anfertigen ließ und dieselbe Schuhgröße gehabt habe wie er, sein Diener. Mir waren diese Schuhe leider zu klein. Ich durfte als Halbwüchsiger dafür einen halblangen, schwarzen Mantel aus feinem Wollstoff austragen, mit Applikationen aus schwarzer Seide auf dem Kragen. Auf der Innentasche war eine Stoffetikette aufgenäht mit der Aufschrift John D. Rockefeller Jr. Esq. Der Mantel erregte zu jener Zeit, um 1969, Bewunderung und Neid bei meinen Schulkameraden. Meine damalige Freundin strickte mir dazu einen roten Wollschal, mit dem ich, wie sie fand, Aristide Bruant auf dem Plakat von Toulouse-Lautrec glich.
Hat man dem Großonkel Long'Alcide seine Geschichten über die Zeit in Amerika geglaubt? Dass er Kammerdiener von Rockefeller Junior war? Es war nicht einfach, sich das vorzustellen, wenn man ihn danach, nach 1917, wieder im kleinen jurassischen Dorf antraf, als Kleinbauer mit zwei, drei Kühen, ein paar Obstbäumen. In der eigentümlichen Sprache der Ortsansässigen seine Erlebnisse zum Besten gebend. Alle wussten zwar, dass er Geld besaß, seitdem er aus den Staaten zurückgekommen war. Er verteilte es großzügig, wo er dies für nötig erachtete. Aber dass er es im Dienste eines der reichsten Männer der Welt verdient haben sollte, dazu in dessen größter Nähe, das glaubten ihm sicher nicht alle. Er lachte gerne über seine eigenen Worte, was Zweifel an seinen Geschichten nährte. Nie wusste man, ob er sich über den Zuhörer oder über sich selbst lustig machte. Und weil er fast taub war, war es schwierig, ihn nach Details seiner Erlebnisse zu fragen.
Ich werde erzählen, wie er aus dem Tausendseelendorf Cornol aufbricht. 1907 gilt in der Geschichte der Vereinigten Staaten als Rekordjahr, in dessen Verlauf erstmals mehr als eine Million Auswanderer in Manhattan ankamen. Seine ältere Schwester Joséphine ist bereits vier Jahre in New York gewesen, wo sie sich als Kindermädchen und Näherin durchgeschlagen hat. Wir werden sehen, was Alcide sich erhoffte, und was er schließlich erreicht hat jenseits des Atlantiks.
Teil I
Aufbruch
Über die Eisheiligen war es in jenem Mai 1907 für mehrere Tage sommerlich warm. Weil die Bauern von Cornol danach mit Gewittern rechneten, brachten sie das erste Heu noch vor dem Elften in den Schobern unter.
Die Heuernte hinterließ Spuren in seinen Handflächen, er hat Blasen wie lange nicht mehr. Das Brennen erinnert ihn an die Freude vorgestern, als die letzte Fuhr geschafft war. Er schließt für mehrere Schritte die Augen, eine alte Gewohnheit. Öffnet sie, macht sie wieder zu. Es ist nicht schwer, die Richtung zu halten, er spürt die sanfte Steigung der Dorfstraße unter den Füßen. Sie führt ihn geradeaus. Kopfnüsse hat er einstecken müssen als Bub, weil er das einfach nicht lassen konnte, den aiveuye, den Blinden machen. Er liebt die Steigerung der anderen Sinne, wenn er die Augen schließt. Die Geräusche. Er würde Cornol immer an seinen Geräuschen wiedererkennen. Man kann sich einbilden, den Klang der weiten, leicht schiefen Ebene zwischen Jura und Vogesen zu hören, an deren oberen Rand, am Ausgang des Tals der Coroline, das Dorf liegt. Dessen Geräusche nur einen Teil dieses Klangs ausmachen, den nahen und lebendigen. Mit Gegacker von Hühnern, Rauschen und Gurgeln des Bachs, Plätschern der Brunnen. Immer klopft, hämmert, dengelt jemand. Menschen locken ihre Tiere mit seltsamen Lauten, unterhalten sich rufend über mehrere Gärten hinweg auf Patois, im vertrauten Niainiainiai. Ein Hund bellt, ein anderer antwortet ihm aus der Ferne.
Das gilt ihm jetzt.
«Träumst du schon von drüben, vom Schlaraffenland?»
Gelächter von mehreren Seiten, als er die Augen aufschlägt.
«Wann geht's los?»
«Morgen!»
«Alles gepackt? Kommt dich jemand abholen in New York? Joséphine ist ja noch hier. Die kommt später nach, oder?»
Er bleibt bei Emile und Armand stehen, beide tragen Werkzeug auf den Schultern, eine Heugabel, eine Axt.
«Zuerst muss ich im Havre ankommen. Es ist nicht mehr so wie früher mit den Extrazügen. Da konnte man sitzen bleiben, sogar durch Paris.»
Von der anderen Seite des Sträßchens kommt Armands Schwester Célestine dazu.
«Musst du übernachten?»
«Ja.»
«Wir haben gehört, du gehst mit Henri zusammen. Stimmt es, dass ihr auf diesem schnellen Dampfer fahrt? Wie heißt er, La Prudence?»
«La Provence!»
«Der ist ganz neu, sagen sie. War sicher teuer, dazu zweite Klasse. Chic, chic, Monsieur Chiquet!»
Er macht sich los von dem Grüppchen.
«Also, bis dann!»
«Ja, bis dann.»
«Vergiss uns nicht!» Célestine sagt es leise. Sie errötet, als er sie angrinst, noch rückwärtsgehend. Dann dreht er sich ganz weg.
Heute hat er es nicht weit, die drei Kühe stehen auf einer Weide fast am Waldrand, beim oberen Dorfeingang. Er ruft sie, und als er beim Zaun ankommt, stehen sie schon brav bereit, die beiden älteren mit prallem Euter. Er öffnet ihnen das Gatter. Es folgt ein kurzes Hin und Her, wer zuerst hindurchstaksen darf. Als das geklärt ist, machen sie sich muhend auf den Heimweg, er trottet ihnen hinterher, muss überlegen, was noch zu tun ist bis zum Schlafengehen.
Ihr Haus steht auf einer dreieckigen Fläche, in der Gabelung zwischen Bach und Dorfstraße auf der linken Seite und einem kleinen Weg mit dem Namen La Rasse auf der rechten. Als Alcide in der Kurve beim Lion d'Or angekommen ist, sieht er, dass der Vater die Stalltür aufgemacht haben muss, denn die Kühe sind nicht mehr zu sehen.
Er tritt ins Halbdunkel, Papa ist schon, den runden Schädel gegen die Flanke der Kuh gedrückt, beim Melken. Alcide holt seinen Stuhl vom Haken und setzt sich zum zweiten Tier. Er muss nochmals aufstehen, den Kuhhintern geraderücken und den verdreckten Schwanz mit einer Schnur hochbinden.
«Mach vorwärts, dann kannst du die Kanne dem Pierre in die laiterie mitgeben.»
Alcide taucht aus seinen Gedanken auf, das Euter seiner Kuh ist leer. Er steht auf, schüttet den bläulich schimmernden Inhalt des Kessels in die Kanne. Der Deckel ist schmutzig, also geht er in die Küche, um ihn abzuspülen. Maman steht am Herd, und als er hinter ihr vorbeigeht, streift ihn ihr Geruch. Rauch, Essen, und ganz leise, muguet-Seife. Ohne aufzublicken setzt sie ihre Litanei fort, die sie am frühen Morgen begonnen und ununterbrochen weitergeführt hat, bei fehlenden Zuhörern als inneren Monolog, jetzt bei seinem Erscheinen wieder als Rezitativ einer Liste, was alles getan wurde und was noch alles zu tun sei vor seiner Abreise, alles in ihrer einzigen und ureigenen Patois-Sprache, ohne Punkt und Komma.
«... und Joséphine hat dir noch die Hemden geplättet wir haben sie schon eingepackt damit du sie nicht wieder zerknüllst nur das welches du morgen auf die Reise anziehst liegt zuoberst mach die Knöpfe auf wenn ...»
Er ist schon wieder aus der Küche verschwunden. Zu antworten hätte nichts geändert. Zurück im Stall drückt er den Deckel auf die Kanne, kippt an und rollt sie in Schräglage aus dem Tor ins Helle. Papa ist nicht zu sehen, ist wohl nochmals hinüber in den Boeuf, um sich vor dem Abendessen ein Gläschen zu genehmigen und um die Stimmung im Dorf zu erschnuppern. Er wartet auf Pierres Karren, den er hört, bevor er auftaucht. Davor ein mageres Pferdchen, das den Einachser mit hängendem Hals hinter sich herschleppt, als sei er mit Steinen beladen. Pierre sitzt mit dem Rücken zur Fahrtrichtung am Rand der schrägen Ladefläche, hüpft, als er auf Alcides Höhe angelangt ist, herunter. Für das Tier Signal zum Stehenbleiben.
Während sie gemeinsam die Kanne hochheben und zu den anderen rücken, druckst Pierre herum.
«Wir, also die Jungen vom unteren Dorf, haben uns gefragt ...»
Pause.
«... also eigentlich: Der Girard-Joseph hat mich gefragt, warum ...»
Pause.
«... also, warum ihr eigentlich rüber gehen wollt. Ich meine, beim Henri ist es klar, der Hof ist schon in den Händen des Ältesten, und er kann nichts außer bauern. Aber ihr?»
Er hofft, dass Alcide endlich etwas sagt, aber der schweigt. Also muss er weitermachen, auf zweifelhaftem Gelände.
«Die Joséphine könnte doch auch hier nähen? Und du und dein Papa ... es ging doch in letzter Zeit eher aufwärts mit den Uhren. Was willst du denn anfangen drüben?»
«Ich schaue mal.»
«Entschuldige, ich wollte nicht ...»
«Schon gut, ich weiß es selbst noch nicht genau. Es gibt Möglichkeiten. Ich gehe zuerst mal mit Henri zu seinem Cousin nach Ohio. Ist ja auch ein weit entfernter Onkel von mir. Henri will etwas mit Früchten machen, aber ich glaube, das Klima ist dort nicht so mild, wie er meint. Wir werden sehen. Vielleicht gehe ich auch gleich wieder zurück nach New York. Es soll Reiche geben dort, die viele Hausangestellte haben. Die Ajolais sind beliebt, man verdient gut.»
«Hausangestellter? Du meinst Diener? Dann müsstest du ...?»
«Ja, warum nicht?»
Pierre wiegt den Kopf hin und her, will noch etwas sagen, lässt es dann doch, setzt sich wieder auf seinen Karren. Kaum spürt es den Ruck, setzt sich das Pferdchen in Gang. Während er rittlings davonfährt, hält Pierre seinen Blick auf Alcide gerichtet.
«Also, pass auf dich auf!», ruft er, bevor er hinter der Wegbiegung zur Route de la Baroche verschwindet.
«Ja, mach ich», murmelt Alcide, und wieder wird er von einer körperlichen Unruhe überrascht. Der Magen krampft sich zusammen, die Kehle wird trocken, da kann er schlucken, so oft er will. Es kribbelt ihn in Händen und Füßen, er weiß nicht, wie ihm geschieht. Heute Morgen, kurz bevor er wach wurde, hat es ihn so gepackt. Julia, die Einzige, der er davon erzählt hat, lachte nur.
«Du hast das Reisefieber.»
Er geht ins Haus zurück und die Treppe hoch in die kleine Werkstatt. Setzt sich an seinen Arbeitsplatz, und obwohl alles weggeräumt und versorgt ist, ein handlicher Teil eingepackt in seine Reisekiste, zieht er eine Schublade nach der anderen auf. Holt sich aus der untersten die kleine Drehbank, mit der er bis vor einem Jahr Zapfen an die Enden winziger Achsen gedreht hat. Er spannt sie in den Schraubstock, holt ein paar feine Dreheisen aus einer zweiten Schublade, dann aus der obersten die Schachtel mit Rohlingen, Reste der letzten Bestellung. Nimmt seine Uhrmacherlupe vom Schaft über dem Werktisch und klemmt sie ans Auge. Er beginnt zögernd mit dem Einspannen des kleinen Werkstücks, versucht sich an den Ablauf der einst mit viel Routine ausgeführten Arbeitsgänge zu erinnern. Die Ruhe kehrt in seinen Körper zurück, und als er die nur mit der Lupe zu sehenden Drehspäne wegpinseln und zum ersten Mal nachmessen kann, ist er wieder er selbst.
Julia stürmt herein, mit roten Backen, zieht ihn mitsamt dem Stuhl weg vom Tisch, platscht sich lachend auf seinen Schoß, gerade noch kann er die Hand mit dem scharfen Werkzeug von ihr weg strecken. Er will etwas sagen, doch sie überfährt ihn mit der überschäumenden Kraft ihrer Halbwüchsigkeit.
«Das darfst du jetzt nicht mehr!» Sie imitiert Tonfall und Dialekt der Mutter. Plaudert weiter, blubbernd, mit Überdruck.
Alcide fasst die Schwester bei der Taille und schiebt sie vom Schoß weg auf Vaters Stuhl. Dabei spürt er unter seinen Fingern die Rundungen der Fünfzehnjährigen. Maman hat recht: Das geht nun nicht mehr.
«Ist es wahr, dass in New York der reichste Mann der Welt lebt? Und gibt es dort ein Theater mit Bildern, die sich bewegen? Ist es das größte und schnellste Schiff, mit dem du fährst?»
Eine Frage nach der anderen stößt sie aus. Sie erwartet keine Antwort, beendet ihren Schwall, indem sie noch einmal tief Luft holt für einen langgezogenen Seufzer. Dann, jedes Wort einzeln ausrufend: «I – want – to – go – to – America – too!»
In seinem Zimmer überprüft er sein Gepäck, die Papiere, das Geld, das kleine Wörterbuch. Ihm fällt nichts ein, was er vergessen haben könnte. Doch: Schreibzeug! In einer Schachtel entdeckt er seine Schulfedern, die Tinte im Fläschchen ist aber eingetrocknet. Er wird Joséphine fragen, sie hat immer alles. Er findet ein halb leeres Schreibheft, das er in einer Außentasche unterbringen kann. Als er die Schublade zustoßen will, sieht er das Foto, das sie vor einem Jahr in Pruntrut hatten machen lassen, Henri, Armand und er. Henri sitzt in der Mitte auf einem Stuhl, sie stehen links und rechts hinter ihm. Wie etwas zwielichtige Geschäftsmänner schauen sie aus. Jünglinge, die auf Männer machen. Er als einziger ohne Schnurrbart, die Haare links gescheitelt, seine Tolle über der Stirn nach rechts gebürstet. Er findet, er sieht noch immer gleich aus. Die Krawatte vom Foto mit den Edelweiß hat er eingepackt für Amerika. Er steckt das Bild zum Notizbuch. Dann geht er nach unten zu seiner Familie.
Mutter hat einen toétché gebacken, dessen Duft sich im ganzen Haus ausgebreitet hat. Nun sitzen alle um den runden Tisch, Vater ist rechtzeitig, ohne dass ihn jemand holen musste, aus dem Boeuf zurückgekehrt. Sie falten die Hände und beten, danken für das abendliche Brot. Nach dem gewohnten Ritual fährt Joséphine mit ruhiger, fester Stimme fort. Sie bittet Gott um den Segen für die Reise ihres Bruders. Amen. Alcide hat es wieder die Kehle zugeschnürt. Er gibt sich Mühe, vom Sauerrahmkuchen zu essen, den Maman speziell für ihn und zu diesem Anlass des Abschieds gebacken hat. Er taucht ab. Papa muss ihn anstupsen.
«Jean Baptiste hat geschrieben, er wünscht dir eine gute Reise.»
Alcide hat sich schon länger nicht mehr bei seinem älteren Bruder gemeldet. Muss er ein schlechtes Gewissen haben? Maman fügt noch etwas hinzu.
«Er wird im Sommer nach Basel verlegt, an die Burgfelder Grenze. Dann kann er auch einmal nach Célina schauen. Hast du ihre Adresse?»
«Ja, ja, ich werde ihr schreiben.»
Julia plaudert, ohne sich darum zu kümmern, ob ihr jemand zuhört, Joséphine und Mathilde essen schweigend.
Er schläft unruhig, wacht immer wieder auf, zählt die Glockenschläge, die ihm nah und laut erscheinen. Wie hatte er schlafen können in all den Jahren bisher? Wenn er aufschreckt, meint er, im Traum noch oder im Halbschlaf, etwas Wichtiges verpasst zu haben. Er kontrolliert den Wecker, dreht sich hin und her, sinkt schließlich doch in den Tiefschlaf.
Er wird gerüttelt, Vaters Hand legt sich auch auf den Wecker und würgt das Gerassel ab.
«Komm, aufstehen. Es ist schon halb vier.»
Auch Maman steht da, musste ihrem Sohn einen Kaffee kochen. Er verbrennt sich den Gaumen, denn der Wagen des quincailler, der sie nach Pruntrut fahren wird, steht schon auf der Dorfstraße, auf der anderen Seite des Bachs. Zwei Pferde sind eingespannt, und Henri ist auch schon da. Jetzt stellt sich ihm die Mutter in den Weg, bedeutet ihm mit knapper Geste, den Kopf zu senken. Sie taucht den Daumen ins Weihwasserbecken neben dem Türpfosten und malt ihm, senkrecht und waagrecht, das Kreuzzeichen auf die Stirn. Um ihren Mund zuckt es, fast wäre er ihr übers Haar gestrichen.
«Gesegnete Reise», murmelt sie. Dann, überraschend: «Sei schlau!» Zögernd hebt Alcide die Hand und berührt sie an der Schulter, und als sie nicht zurückweicht, drückt er sie ein wenig, streicht ihrem Arm entlang hinunter und dreht sich ab.
Er bringt seine Kiste zum Wagen, Vater trägt Tasche und Koffer, im Marschtritt, den er auf einmal mit nachgeahmtem Bumbabumba der Tuba begleitet. Er bricht in Lachen aus.
«Wenn es heute keine Musik gibt, mach ich sie halt.»
Nun lachen sie beide. Als Joséphine vor vier Jahren mit fünf anderen jungen Frauen nach Amerika aufbrach, hat die Dorfmusik gespielt. Vater und Sohn brauchen einen Moment, bevor sie, zwei gleich große, drahtige Gestalten, sich umarmen.
Als Alcide aufsteigt, bemerkt er, dass doch einige Cornoler zusammengekommen sind, um sich zu verabschieden und wieder zwei davonfahren zu sehen.
Reisen Sie mit Zwilchenbart!
Henri war aus demselben Dorf, elf Jahre älter als Alcide. Sie waren gleich groß, Henri aber kräftiger gebaut. Bei ihm schlug das Essen besser an, er zeigte einen Ansatz von Bauch, während Alcide schon als Kind immer sehr mager gewesen war. Henri pflegte sorgfältig einen dichten blonden Schnurrbart und zähmte die Haare mit Öl. Alcide war glattrasiert, und für die Haare begnügte er sich mit einer Bürste. Damit teilte er sie links im Scheitel und zog über der Stirn eine Strähne in kühnem Schwung nach rechts.
Eigentlich war Henri sein Onkel, er sah ihn aber eher als Cousin. Sie waren sich nie besonders nahegestanden. Henri, aus einer Familie von Obstbauern, wollte nach Amerika gehen, weil er kaum eine andere Wahl hatte. Der Hof wurde vom ältesten Bruder geführt, ein Auskommen in dessen Abhängigkeit und Nähe war nicht mehr denkbar. Mehrere Versuche, in Cornol eine passende Frau zu finden, waren gescheitert, also hielt ihn nichts mehr im heimatlichen Jura. Er wollte in Ohio, wo ein Cousin mit zufriedenstellendem Erfolg wirtschaftete, ein Stück Land erwerben und darauf Obst anbauen. Alcide wusste, dass er seine bescheidenen Ersparnisse bereits nach drüben hatte überweisen lassen und nun auf geringe Reisekosten achtete, indem er in der dritten Klasse reiste. Noch war unsicher, ob sie sich auf dem Schiff sehen könnten, denn Alcide fuhr zweiter Klasse.
Er hatte sich nicht nur von seinem Freund Pierre die Frage anhören müssen, weshalb er überhaupt nach Amerika auswandere. Zwar waren die letzten Jahre härter geworden für die Heimarbeiter, die Konkurrenz durch den Import billiger Uhren aus den USA zwang zu schnelleren, moderneren Produktionsformen. In Fabriken, nicht mehr in Heimarbeit. Alcides Vater war alt und müde geworden. Manchmal befürchteten sie, es sei eine schleichende Krankheit, welche ihm die Arbeit verleide. Ob es mit der Uhrenfabrik im Dorf etwas werden könnte, war wieder ungewiss. Aber die Familie hatte über lange Zeit etwas auf die Seite legen können. Der Älteste war versorgt, machte seine Ausbildung im Grenzwachtkorps und sollte bis in ein paar Jahren ein Einkommen haben als Zollbeamter. Wenn der Vater also gar nicht mehr mochte, könnte der kleine Hof an ihm, an Alcide hängenbleiben. Aber noch war es nicht so weit. Er hatte Lust auf Neues, so einfach war das! Und seine korrekte, fromme Schwester Joséphine hatte den Sprung gewagt, vor vier Jahren zum ersten Mal, zusammen mit fünf anderen jungen Frauen aus dem Dorf. Sie schlug sich drüben als Kindermädchen und Näherin durch ohne unterzugehen und wollte nun nach ihrem Besuch in der Heimat bald wieder zurück über den Atlantik. Auch das trieb ihn an, wie er zugeben musste.
Die unzeitgemäße frühsommerliche Wärme saugte über Westeuropa das Wasser aus dem Boden. Thermische Aufwinde türmten die Kumuluswolken über dem Burgund auf zu barocken Ungetümen. Wenn sie gegen Abend die Form von Ambossen annehmen sollten, waren kräftige Gewitter zu erwarten.
«Da kommt noch etwas!», meinte Henri, als sich nach einer Kurve eine besonders eindrückliche Wolkenformation in die kleinen, hochstehenden Rechtecke der Fenster schob. Es war heiß im Abteil, mit sechs Menschen war es voll besetzt. Man war sich beim Essen der mitgebrachten Brote nähergekommen, beim Herumreichen von Taschentüchern, Einmachgläsern und Weinflaschen. Nun einigte man sich darauf, ein Fenster zu öffnen. Schloss es bald wieder bis auf einen kleinen Spalt, weil sich kleine Rußpartikel schmerzhaft hinter Augenlidern und in den Kehlen einnisteten.
Sie schauten hinaus, sahen, wie eine schwarze Wand den nahen Horizont zusammenpresste. Die Pappeln einer vorbeiziehenden Allee wurden silbern überschauert. Jetzt verbogen sie sich unter den Fallwinden des aufziehenden Gewitters, begannen auch schon, abgerissene Äste von sich zu werfen. Die vom Sturm zerzauste Landschaft wurde überdeutlich klar, als Dampf und Rauch der Lokomotive vom Wind auf die gegenüberliegende Seite geblasen wurden. Das Gespräch im Abteil verebbte, man machte sich gegenseitig auf die Phänomene aufmerksam, die sich vor den Fenstern abspielten. Erste große Tropfen zerplatzten an den Scheiben zu schrägen Wasserstrichen, dann setzte mit schnell anschwellendem Rauschen ein gewaltiger Regen ein. Die Landschaft verdunkelte sich und verschwand hinter einer bewegten Schraffur, Blitze verkehrten Helligkeit und Schatten für Sekunden in ihr Gegenteil. Der Donner übertönte in Wellen das Geratter von Rädern und Kupplungen.
Das Gewitter zog schnell weiter, trotzdem fuhr man mit verminderter Geschwindigkeit. Wegen der plötzlichen Dunkelheit wurden in den Abteilen die Gaslaternen angezündet. Dann bremste der Zug brüsk. Gepäckstücke fielen herunter, Passagiere wurden aus ihren Sitzen gehoben und auf ihr Gegenüber geworfen, angsterfülltes Geschrei mischte sich ins Kreischen der Räder, dann stand alles still. Sofort wurden Abteilungstüren geöffnet, und obwohl zwei Beamte in Uniform durch laute Rufe und eifriges Wedeln mit den Armen versuchten, die Passagiere am Aussteigen zu hindern, wuchs schnell die Menge der gaffenden und laut den Grund des erzwungenen Halts diskutierenden Menschen entlang der Reihe der Waggons. Ein Ast, am abgebrochenen Ende so dick wie ein Baum, war auf das Geleise gefallen.
Da an der Lokomotive keine geeignete Vorrichtung zur Räumung der Schienen angebracht war, musste aus der nächstgelegenen Lokremise eine Maschine angefordert werden, die dem Hindernis gewachsen war. Es ergab sich eine Wartezeit von zwei bis drei Stunden, und man musste einsehen, dass sich die Ankunft im Gare de l'Est in Paris um diese Dauer verzögern würde.
Alcide verließ das Abteil und stolperte über den Schotter hinunter auf einen kleinen Gehweg, musste dabei hohes Gras durchqueren und bekam nasse Füße. Er beachtete es nicht, fühlte sich auf einmal in einer eigenartigen Hochstimmung. «Unterwegs, ich bin unterwegs», murmelte er vor sich hin. Wenn er sich jetzt aus dem Staub machte – er wusste nicht einmal, wo sie sich befanden, irgendwo zwischen dem Jura und Paris –, niemand könnte wissen, wo er steckte. Er freute sich auf Paris. Auf die Fahrt nach Le Havre morgen, und dann ...
Es begann schon einzudunkeln, als sie sich den Vororten der Hauptstadt näherten. Gaslaternen warfen ihr gelbes Licht auf die Fassaden hoher Mietshäuser. Der Schaffner steckte den Kopf ins Abteil und erinnerte die Passagiere daran, ihr Gepäck zusammenzusuchen, nichts zu vergessen. Sie standen sich bereits auf den Füßen herum, zwischen Koffern, stießen aneinander beim Zusammensuchen der Taschen und Körbe. Der Schaffner sagte noch: «In fünf Minuten sind wir da. Paris, Gare de l'Est!», und zog weiter.
Sie wurden im Bahnhof empfangen von einer Angestellten der Reiseagentur, einer resoluten Frau, die ein Pappschild hochhielt und durch laute Rufe auf sich aufmerksam machte: «Zwilschenbarte, Zwilschenbarte!» Sie erklärte ihnen, man begebe sich nun zu Fuß zum Hotel, wo es zuerst um den Zimmerbezug gehe. Es sei zwar angesichts der Verspätung – sie betonte das Wort, als seien die Reisenden daran schuld – ein eher symbolischer Akt, die Zimmer zu beziehen, denn schon um Mitternacht, in wenigen Stunden also, müsse man wieder bereitstehen für den Omnibus, der einen zum Gare St. Lazare bringen würde. Immerhin könne man sich aber im Zimmer vor dem Abendessen, das durch die Gesellschaft organisiert und bezahlt sei, kurz frisch machen. Auch nach dem Essen sei es möglich, sich im Zimmer kurz – sie betonte wieder: kurz! – hinzulegen. Alcide und Henri zwinkerten sich zu. Die Zwilschenbarte erinnerte sie an ihre frühere Dorfschullehrerin.
Der Name des Hotels passte, es hieß La Ville de New York. Die Qualität des Abendessens erstaunte sie. Sie wurden wieder munter, als der Pot au Feu aufgetischt wurde. Dazu gab es frisches Weißbrot. Der Rotwein war trinkbar und so anregend, dass der Lärmpegel im hohen Speisesaal in kurzer Zeit anschwoll. Alcide versuchte, Henris Aufmerksamkeit durch Gesten auf sich zu lenken. Den Mund übertrieben bewegend und dazu gestikulierend teilte er ihm mit, dass er, Alcide, genug gegessen habe und einen Spaziergang durchs Quartier machen werde.
Draußen entfaltete er im Schein einer Gaslaterne einen kleinen Plan der Stadt, den er vom Stapel auf der Theke des Empfangs mitgenommen hatte. Auf keinen Fall wollte er sich verirren in der kurzen Zeit, die ihm für die Erkundung blieb. Er ging den Weg, auf dem sie gekommen waren, zurück bis zur Kreuzung, um die Straßenschilder lesen zu können. Seinen Standpunkt fand er auf der Karte, Ecke Rue d'Hauteville, Rue de Paradis, im zehnten Arrondissement. Daran grenzte zu seinem Erstaunen das zweite, bis er merkte, dass die Nummerierung einer nach rechts drehenden Schneckenspirale folgte, deren Zentrum beim Louvre lag. So weit durfte er sich aber nicht vom Hotel entfernen. Er war unversehens vom Trottoir auf die Straße geraten, was ein sehr lautes Geräusch auslöste, wie von einem röhrenden Hirsch. Ein Automobil war ihm gefährlich nahegekommen, und nun sah er den Beifahrer, der wütend einen dicken Gummiball traktierte und damit, durch einen Messingtrichter, den Hirschschrei erzeugte. Er hatte sich durch einen Sprung gerettet, dorthin, wo er als Fußgänger hingehörte. Er nahm sich vor, bei der nächsten Seitenstraße nach rechts abzubiegen, dann wiederum noch zweimal nach rechts. Damit würde ihn sein Weg automatisch wieder in dieselbe Straße zurückführen, und er müsste nicht mehr dauernd auf den Plan schauen. Konnte einfach beobachten, hören, riechen. Genießen.
Als er um halb zwölf wieder beim Hotel eintraf, waren die meisten der Reisenden mit Sack und Pack auf dem Vorplatz versammelt. Henri hatte freundlicherweise auch sein Gepäck heruntergebracht. Gemeinsam luden sie es auf den bereitstehenden Lastwagen.
«Kontrollieren Sie Ihre Sachen! Haben Sie alles?»
Die Zwilschenbarte hatte wieder das Kommando übernommen.
In der Erinnerung kam Alcide die nächtliche Zugreise nach Le Havre wie ein mehrfach unterbrochener Traum vor. In Rouen war er aufgewacht, weil der Zug angehalten und noch mehr Reisende aufgenommen hatte. Ab dann war es ihm nicht mehr möglich gewesen zu schlafen, weil die Banknachbarn zu beiden Seiten ihre Köpfe auf seine Schultern sinken ließen. Einer von ihnen schnarchte laut.
Übermüdet und steif waren sie schließlich ausgestiegen. Erfahrene Amerikareisende hatten Henri und ihm geraten, sich vor der medizinischen Kontrolle und der Befragung durch die Beamten das Gesicht zu waschen, sich zu kämmen und die Kleider in Ordnung zu bringen. Sie hatten daraufhin keinerlei Anstoß erregt. Man leuchtete ihnen in die Augen, Henri musste noch eine Impfung nachholen. Der anschließende interrogatoire war Alcide absurd vorgekommen und in seinem tranceartigen Erschöpfungszustand begann er zu kichern. Wer würde wohl auf die Frage, ob er Anarchist sei oder Polygamist, mit Ja antworten, fragte er Henri, der daraufhin auch Mühe hatte, ernst zu bleiben.
Dann waren sie auf dem Quai gestanden, in Sichtweite des Schiffs, das ihnen kolossal vorkam. Tische waren für sie aufgestellt, und man hat sich aus großen Suppentöpfen, dazu Bergen von Brotschnitten, bedienen können. Wie er schließlich in die Kabine gelangt war, wusste er nicht mehr. Es gab nochmals eine mühselige Plackerei mit dem Gepäck. Die Kisten hatten sie gegen eine Quittung in einem Depot abgeben können, dann mussten sie einen Treffpunkt für einen späteren Zeitpunkt abmachen, weil Henris Massenquartier in der Nähe des Bugs lag. Alcides Logis in der Zweiten dagegen befand sich fast über dem Heck. Die Taschen musste er über Treppen und lange, schwach beleuchtete Gänge bis zur Kabine tragen. Sein Zimmergenosse für die beginnende Reise war, wie sich herausstellte, ein Auswanderer aus dem Südtirol, der sich als Silvius Alfreider vorstellte. Er sprach Deutsch und Italienisch. Sie machten ab, auf Englisch miteinander zu verkehren, um zu üben. Sie waren sich sympathisch.
Mit Henri zusammen hatte er noch vom unteren Rundgang zugeschaut, wie der von Zuschauern und Abschiednehmenden schwarz getupfte Quai langsam seitlich wegzog. Als das dicke Tau auf dem Schleppboot gelöst war und ins Wasser platschte, ließ die Provence zweimal ein heiseres Hornsignal ertönen, woraufhin über der Menschenmenge am Ufer die Taschentücher wie übergroße Schneeflocken hin und her wehten. Der Dampfer hatte sofort Fahrt aufgenommen. Alcide musste ein ums andere Mal gähnen, und so verabredeten sie sich für den nächsten Tag und gingen, obwohl es Morgen war, schlafen.
Er lernte, seine Bewegungen dem Rhythmus der Umgebung anzupassen. Mit seinem anfänglichen, ungeduldigen Trippeln und Drängen, wenn er hinter Passagieren herging, die in aufreizend langsamem Gang und ohne erkennbares Ziel die ganze Breite von Treppen und Durchgängen einnahmen, hatte er Missfallen erregt. Einmal war er von einem korpulenten Herrn im Smoking sogar eines Ortes verwiesen worden mit der hervorgepressten Bemerkung, er habe dort nichts verloren, obwohl er als Passagier zweiter Klasse dazu durchaus berechtigt gewesen war. Seit er gelernt hatte, zu schlendern, seit er auch seine Kleidung mit Bedacht an die Situationen anpasste, in die er sich begab, eckte er kaum mehr an. Für Spaziergänge in seinem eigenen Tempo wählte er die ganz frühen Morgenstunden, während derer die Herrschaften noch schliefen. Der Blick auf den Atlantik war unwiderstehlich zu dieser Zeit.
Er konnte sich nicht sattsehen an der Heckwelle des Dampfers. Sie kam ihm majestätisch vor, wie eine Schleppe aus zwei glitzernden Bahnen, gezöpfelt und gewoben von der stählernen Maschine eines Riesen. Sie schoss unter dem Heck hervor, schneller als das Auge die Wirbel verfolgen konnte. Erst indem er sich weiter wegbewegte, beruhigte sich der Teppich, die Strudel breiteten sich aus und verschwammen mit dem Gewebe aus Gischt. Und immer weiter zog das Band von ihm weg, schnürte sich zusammen auf einen schwer bestimmbaren Punkt am Horizont. Er begann zu frieren und ging wieder hinein. Nachsehen, ob er schon ein Frühstück bekommen könnte. Er freute sich auf die Pampelmusen.
Henri erhielt nicht zu allen Orten Zutritt, an denen sich Alcide aufhalten durfte. Aber sie fanden bald heraus, wo sie sich ohne Schwierigkeiten treffen konnten. Auf dem hinteren Deck zum Beispiel oder auch im Entrée der zweiten Klasse, einem Aufenthaltsraum, der sich im hintersten der Deckaufbauten befand. Der Raum strahlte den Charme einer französischen Gaststube aus, und zu bestimmten Zeiten konnte man etwas essen und trinken.
Sie ließen sich Wasser, eine kleine Karaffe Wein, Paté und Weißbrot bringen. Die Ankunft in New York musste besprochen werden, ebenso die anschließende Weiterreise nach Ohio. Henris Entschluss, in der dritten Klasse zu reisen, hatte zur Folge, dass er bei der Ankunft als Erstes mit der Fähre nach Ellis Island, ins dépôt des immigrants, gebracht werden sollte. Es war nicht vorauszusehen, wie lange die medizinischen und administrativen Abklärungen dort dauern würden – es konnte ein paar Stunden dauern, aber auch mehrere Tage –, also musste für Alcide eine Unterkunft gefunden werden, in der er auf seinen Cousin warten konnte. Sie machten aus, dass er in dieser Zeit die Billette für die Bahnreise nach Cleveland besorgen würde. Sie schauten sich die Strecke auf einer kleinen Karte an, die Henri mitgebracht hatte. Von seinem Onkel in Ohio kannte er Länge und Stationen der Fahrt. Über Albany und Syracuse nach Buffalo dauerte sie etwa zwölf Stunden, dann musste man nach dem Umsteigen nochmals sechs Stunden dem Lac Érié entlang fahren bis nach Cleveland.
«Es gäbe einen Nachtzug mit Schlafwagen», meinte Henri etwas zögernd.
«Das wäre wieder etwas Neues! Warum nicht?», fand Alcide und setzte nach: «Komm, wir machen das. Ich bezahle dir den Aufpreis.»
Henri sträubte sich, ließ sich aber schließlich überreden. Die Erinnerung an die nächtliche Fahrt durch Frankreich machte es ihm leichter, sich vom jüngeren Vetter etwas schenken zu lassen.
«Wie wir von Cleveland nach Sterling kommen, zum Hof von Onkel Stöckli, weiß ich noch nicht. Es muss sehr ländlich sein dort.»
Alcide munterte ihn auf.
«Wie zu Hause! Wir finden schon etwas.»
Vom vierzehnten auf den fünfzehnten Mai schwächte sich das Hochdruckgebiet über den Azoren markant ab, wodurch sich ein Tief bei Neufundland ausdehnen und langsam in Richtung Südosten in Bewegung setzen konnte. Eine erste Regenfront erreichte die Route der Provence gegen Abend des Fünfzehnten.
Zuerst dachte Alcide, er habe es sich nur eingebildet. Als er durch einen der langen Gänge des Schiffs ging, meinte er, dieser würde sich ganz leicht krümmen, zuerst nach oben, dann fast unmerklich in einem Bogen nach rechts und wieder in die Ausgangslage zurück. Es kam ihm eine Gruppe junger Leute entgegen, die übertrieben schwankten und sich kichernd an den Handläufen festhielten, was zeigte, dass die Bewegung auch von anderen bemerkt worden und also real war. Als er in die Kabine kam, saß Silvius auf seinem Bett und hatte einen farbigen, über einen Meter breiten Faltprospekt vor sich ausgebreitet.
«Look what I found! Ze longitudinal section of ze Provence!»
Er erzählte, er sei Maschinenbauer, darum interessiere er sich dafür, wie der Dampfer funktioniere. Als ihm Alcide von seinem Erlebnis im Gang berichtete, verstand Silvius sofort und behauptete zu seinem Schrecken, das sei keine Täuschung gewesen. Ein Rumpf aus Stahl könne sich bei starkem Wellengang um bis zu einem halben Meter oder noch mehr in alle Richtungen verbiegen. Davon gehe aber keinerlei Gefahr aus, solange die Konstruktion clever auf die Elastizität des Materials eingehe und sie nicht an ungünstigen Stellen blockiere. Solche Fehler könnten allerdings zu Rissen führen. Alcide stand auf, er wollte sich das nicht weiter anhören. Jetzt spürte er, dass das Schiff sanft, aber vernehmlich schwankte. Es war eine Drehbewegung um alle Achsen, und als er das festgestellt hatte, wurde ihm schlecht.
Es hieß, sie würden in zwei Tagen, im Verlaufe des Freitags, in Manhattan ankommen. Er konnte an diesem Abend nichts mehr essen und ging möglichst oft nach draußen, bis er völlig durchgefroren und durchnässt war. Inzwischen bewegte sich die Provence durch dichten Nebel und ließ immer wieder ihr Horn ertönen. Der Regen peitschte ihm waagrecht ins Gesicht, die Seile an den Ladebäumen heulten im Wind. Das Meer war zerwühlt, Schaumkronen wurden von den Kämmen der Wellen weggerissen. Alcide konnte nicht herausfinden, wie weit die Sicht reichte, das Schiff fuhr dahin auf einem kreisrunden Ausschnitt des Meeres, der sich mitzubewegen schien und so die Empfindung von Stillstand erzeugte. Vielleicht hatte der Kapitän die Geschwindigkeit drosseln lassen, um Hindernisse frühzeitig erkennen zu können. Es war zu hoffen, dass die von der Gesellschaft angepriesene neue Funktechnik an Bord zur Sicherheit beitrage. Er versuchte, seine ängstlichen Gedanken zu zerstreuen und beschloss, sich im gemeinschaftlichen Duschraum der zweiten Klasse aufzuwärmen. Als er sich in der Garderobe ausgezogen hatte und die Tür aufzog, schlug ihm heißer Dampf entgegen. Der Raum war gefüllt mit den Schemen nackter Männer. Es ging sehr laut zu und her. Trotzdem blieb er so lange unter dem heißen Wasserstrahl, bis seine Füße krebsrot waren und nicht mehr weiß.
Am letzten Abend der Überfahrt war es bei der Transatlantique üblich, für die Passagiere der ersten Klasse im großen Salon einen Tanzabend zu veranstalten. Es war den Reisenden der zweiten Klasse zwar nicht verboten, an dieser Galaveranstaltung teilzunehmen, aber die Kleiderregeln schrieben für Männer den Smoking vor, sodass Alcide höchstens von außen einen Blick auf das Geschehen werfen konnte. Nach dem Abendessen traf er sich mit Henri im Entrée zur Zweiten, wo sie mit einer Flasche Wein auf ihre Ankunft am nächsten Tag anstießen. Danach wollte sich Henri frühzeitig hinlegen. Alcide zog es auf das hintere obere Deck. Der Himmel hatte aufgerissen, in den Lücken der Wolken waren Sterne zu sehen, und es war wärmer geworden. Als er sich auf der oberen Promenade dem Eingang zum Salon näherte, hörte er an- und abschwellende Musik. Herren im Smoking und Damen in Abendkleidern standen vor dem Eingang, um zu rauchen und zu plaudern. Wenn sich die Tür öffnete und jemand heraustrat oder hineinging, wurde die Musik für einen Moment lauter. Alcide war unschlüssig, ob er sich vorbeidrücken oder bleiben sollte. Die Neugier siegte schließlich. Er stellte sich ein paar Schritte von der Gruppe der vornehmen Raucher entfernt an die Reling.
«Could you light my cigarette?»
Eine junge Frau, in der weißen Kleidung einer maid, hatte sich neben ihn gestellt, hielt ihre Zigarette lässig zwischen den Fingern der angewinkelten Rechten und sah ihm herausfordernd in die Augen. Er war überrascht und verlegen, denn er hatte sie in den vergangenen Tagen schon öfter beobachtet, diskret, wie er gemeint hatte. Er musste nach dem Feuerzeug suchen. Als er es ihr entgegenstreckte, schloss sie ohne zu zögern ihre Hände um seine, schützte die Flamme vor dem Wind und tat einen tiefen Zug. Sie schenkte ihm ihr schönstes Lächeln.
«Sie reisen in der Zweiten. Ich bin das Mädchen von Mrs. Blum. Mein Name ist Fiona Walsh, aus Irland. Darf ich fragen, wie Sie heißen?»
Alcide stellte sich vor.
«Aus der Schweiz? Dann sprechen Sie Deutsch?»
Er erklärte ihr, dass er aus dem Jura komme. Man spreche dort Französisch und das Patois, eine eigene Sprache.
«Wie bei uns das Gälische?»
Alcide musste überlegen. Er glaubte, das Patois sei nicht ganz so verschieden vom Französischen wie das Gälische vom Englischen. Gewisse Wörter seien ganz anders, man sage, dass es Keltische darunter gäbe, aber auch viele deutsche Ausdrücke. Und die Aussprache sei ... Na ja, die Franzosen rümpften die Nase darüber. Sie musste lachen. Sah dann aufgeschreckt über seine Schulter hinweg und drückte hastig die Zigarette aus.
«Sie ruft mich. Vielleicht komme ich gleich wieder, bleiben Sie noch?»
Sie war schon weg, als er bejahte.
Sie gefiel Alcide. Mit ihrer sprudelnden, selbstsicheren Art erinnerte sie ihn an seine Schwester Julia, aber sie war hübscher. Größer, fast größer als er. Und die rötlichen Haare! Er hatte gesehen, wie Fiona mit ihrer Herrin ins Innere gegangen war und rechnete nicht damit, dass sie nochmals zurückkäme. Trotzdem wartete er eine Weile. Als er sich schon entschlossen hatte zu gehen, stand sie wieder neben ihm.
«Da bin ich wieder. Ich musste den Kellner auf Mrs. Blums leeres Champagnerglas aufmerksam machen, das möchte sie nicht selbst tun.»
Alcide wurde von ihrem Lachen angesteckt. Sie wollte mehr über ihn wissen.
«Fahren Sie zum ersten Mal nach Amerika? Was wollen Sie dort machen?»
Alcide setzte schon zu seiner üblichen, komplizierten Erklärung an, als es spontan aus ihm herausbrach: «Ich will Diener werden bei den Reichen und Schönen, wie Sie! – Ja, das ist mein erstes Mal.»
Was sagte er da? Das war bisher immer eine von vielen Möglichkeiten gewesen, eine eher unwahrscheinliche obendrein. Sie sah nichts Ungewöhnliches in seiner Äußerung, sondern hob zu Ratschlägen an. Wie er vorgehen sollte bei der Suche nach Anstellungen.
«Die Iren sind beliebt wegen der Sprache und den gemeinsamen Wurzeln. Aber auch die Schweizer, wie ich gehört habe, wohl wegen ihrem Ruf, pünktlich und sauber zu sein. Sind Sie ein pünktlicher und sauberer Mensch, Monsieur Chiquet?»
Wieder dieses Lachen mit zurückgeworfenem Kopf. Das Glitzern der hellen Augen.
«Vielleicht sehen wir uns dann einmal in New York? Mr. Blum arbeitet meist in seiner Kanzlei in Manhattan. Die Lady begleitet ihn, wenn er länger bleibt. Dafür haben sie eine Wohnung in der mansion seines Bruders, und die beiden Kleinen werden bei den Großeltern untergebracht. Sonst sind wir im Norden von New York zu Hause. Die Blums haben ein großes Haus in Hardsdale. Ich gebe Ihnen die Adresse.»
Alcide nahm sein Notizbuch hervor und zog den kleinen Stift aus der Lasche, hielt ihr dann beides hin. Er schrieb ihr auch seine Adresse in Ohio auf ein herausgerissenes Blatt, ohne Überzeugung, dass er lange dort bleiben werde.
Sie las seine Anschrift und meinte: «Ohio? Da ist es schwierig, Reiche zu finden. Schöne ... noch schwieriger!»
Am Freitag, den siebzehnten Mai, gegen Mittag, kreuzte die Provence mit gedrosselten Maschinen die Freiheitsstatue. Auf den Decks und Gängen herrschte dichtes Gedränge, alle wollten diesen Teil der Ankunft mit eigenen Augen sehen und miterleben. Als sie sich auf der Höhe von Ellis Island befanden, erzählten sich Passagiere, die in Alcides und Henris Nähe standen, allerlei schlimme Geschichten. Alcide war das unangenehm, aber Henri winkte ab.
«Das wird schon. Ich bin ja kein Anarchist!»
«Und auch kein ... wie hieß das?»
«Polygamist!»
Sie lachten und wechselten auf die andere Seite des Schiffs. Es wurde nun von zwei Schleppbooten den Hudson River hinaufgezogen. Man zeigte und erklärte sich gegenseitig die prominenten Gebäude, die aus der Silhouette von Manhattan herausragten, und nachdem sie an der endlosen Reihe von Piers vorbeigeglitten waren, kam schließlich ihrer in Sicht. Eine Ankunftshalle aus Stahl und Glas stand darauf, auf der Frontseite in großen Buchstaben angeschrieben mit FRENCH LINE. Sie waren angekommen.
Sterling, Ohio
Florent Stöckli war einer der ersten Automobilbesitzer von Sterling, Ohio. Wenn er sich hinter das Steuerrad seines Premier 24 setzte, ein Steuerrad, das Alcide so groß vorkam wie die Räder der Güllewagen zu Hause in Cornol, dann war sein Stolz deutlich zu sehen. Er hatte sich mit seinem ersten großen Geld einen kindlichen Wunsch erfüllt, dabei nicht gezögert, sich statt eines der Modelle aus dem nahen Werk in Cleveland einen der teuren, schnellen und technisch ausgefeilten roadster aus Indianapolis anzuschaffen. Um trotzdem Geld zu sparen, und weil er ein begabter Mechaniker war, ließ er das Gefährt in Einzelteilen und in Kisten verpackt nach Sterling spedieren. Als Alcide und Henri ankamen, hatte er gerade damit begonnen, Chassis und Fahrwerk in seiner Scheune zusammenzusetzen. Er konnte nur in seinen freien Stunden daran arbeiten und auch am Sonntag durfte er in der Nachbarschaft frommer Baptisten keinen Lärm veranstalten. Er war daher froh, als Alcide sofort zusagte, ihm zur Hand zu gehen. Florent kaufte ihm ein Paar dungarees aus dickem Drillich, wie er sie selbst bei dem öligen Handwerk trug, und es zeigte sich bald, dass sie hervorragend zusammenarbeiten konnten. Der Premier stand in verblüffend kurzer Zeit für die erste Ausfahrt bereit.
Henri schüttelte den Kopf über dieses ihm nutzlos erscheinende Gerät. Alcide aber war stolz auf seinen Beitrag an dessen Fertigstellung. Zudem zog ihn Florents übermütig lebenslustige Art an. Da dieser seit der Bestellung sehr lange auf sein Automobil hatte warten müssen, benutzte er es nun für jede noch so kurze Strecke. Alcide war als Mitfahrer willkommen, weil seine Anwesenheit auf dem Beifahrersitz die vielen Fahrten weniger unnütz erscheinen ließ. Zudem konnte ihm das Automobil während Florents Besorgungen in der Township zur Bewachung überlassen werden, was angesichts der sich jeweils darum versammelnden Neugierigen ratsam war.
Es gab nur wenige Automobile auf den breiten Straßen, dafür eine erstaunliche Anzahl an Pferdekutschen, die zur Miete an einem Hauptstandplatz beim großen Warenhaus bereitstanden. Nach jedem Regenguss bildeten sich ausgedehnte Pfützen und es war trotz der seitlich der Straßen angelegten, leicht erhöhten Plattenwege für Fußgänger nicht einfach, die Schuhe vor Durchnässung zu bewahren. Deshalb, und weil die Fahrten so billig waren, wurden die Kutschen auch für kleine Distanzen gerne genutzt.
Abgesehen vom Schlamm, der nach dem Regen alles vollspritzte und verklebte, war Sterling in Alcides Augen ordentlich, gepflegt und sauber. Die Menschen achteten sehr auf ihr Äußeres. Sie waren dezent, aber gut gekleidet, schwarz die Männer, die Frauen in Weiß. Sie rochen gut. Wenn er an die Tage in der Lower Eastside zurückdachte, an Dreck, Lärm und Gestank der überfüllten Straßen, an die vielen so augenfällig Armen, die mit schwarzgrauen Händen Abfallberge und Ascheeimer durchwühlt hatten, stellte er verwundert fest, dass er sich trotz allem dort dazugehörig gefühlt hatte. Den flackernd suchenden, hungrigen Blick armer Leute kannte er aus seiner Kindheit, auch ihren muffigen Geruch. Die Körper der Sackschlepper, Kohleschaufler, Straßenwischer und Bauarbeiter, die er gesehen hatte, waren wie sein eigener. Mager und drahtig muskulös, die Hände voller Schwielen. Hier nun kam er sich wie ein Bauer vor, wie der einzige fast. Florent behauptete, noch vor wenigen Jahren einer gewesen zu sein. Er hatte es zuerst mit Vieh versucht, danach mit Obstbau. Er besaß immer noch einige acres mit Obstbäumen, ließ sie aber von anderen bewirtschaften. Von Pächtern und während der Ernte von Wanderarbeitern. Henri und Alcide staunten, wie groß die Flächen waren und wie endlos die Reihen mit den zwergenhaft niedrigen Bäumen. Auf die Frage, ob es keine Kleinbauern mehr gebe wie in der Ajoie, mit ein paar Kühen und Schweinen, vielleicht noch mit Hühnern und Kaninchen, mit Weiden, so viele es eben brauche für das Heu, mit Obst und Gemüsegärten, alles in einem Maß, das neben der eigenen Versorgung noch ein bisschen etwas abwerfe, schüttelte er den Kopf: «Hier geht alles über Größe und Menge. Und über Spezialisierung, die Konzentration auf ein oder zwei Produkte.»
Das war einer seiner Ausdrücke, eine spezielle Sprechweise, die in Henris und Alcides Ohren fremd klang. Sie saßen am Stubentisch bei Kaffee und Kuchen, den Florents Frau Alice gebacken hatte. Zum Trost. Es hatte seit zwei Tagen geregnet und Florent konnte keine Spazierfahrten unternehmen, weil er befürchtete, im Morast stecken zu bleiben.
«Was in Cornol funktioniert, würde hier keinen Erfolg bringen. Mit harter Arbeit allein kommst du auf keinen grünen Zweig. Hier stehst du im Wettstreit zu einer Landwirtschaft mit riesenhaften Dimensionen an Land, Geld, der Anzahl von Arbeitern und Angestellten, Transportmitteln, Verpackungshallen, Lagerhäusern und so weiter. Wer über die Mittel verfügt, kann seine Ware zu einem Preis anbieten, mit dem du niemals gleichziehen könntest, ohne zu verhungern.»
Henri war unruhig, er hatte vom ersten Tag an gemerkt, dass seine Vorstellungen von dem, was er in Ohio hatte anfangen wollen, falsch waren.
«Was soll ich tun? Was rätst du mir?»
Florent sah ihn nachdenklich an. Wie Alcide spürte er Henris Enttäuschung. Er tat ihnen leid.
«Du willst in der Landwirtschaft bleiben und nicht den Weg einschlagen, den ich gewählt habe?»
Henri nickte, obwohl er noch nicht verstanden hatte, worauf die Entscheidung seines Cousins hinauslief. Auch Alcide konnte aus Florents Vorträgen nur wenig begreifen. Florent nannte sich einen Händler, der Dinge – Werte, wie er das nannte – kaufte und verkaufte, die er weder brauchte noch herstellte. Manchmal gehörten sie ihm nicht einmal. Alcide hatte von ihm Äußerungen gehört, die seine Eltern, vor allem seine Mutter, entsetzt hätten. Schulden machen, hatte Florent ihnen erklärt, sei von Vorteil, ja geradezu geboten, wenn man mit dem geliehenen Geld mehr Gewinn machen könne, als man dem Ausleihenden an Zinsen schulde. Alcides Maman hätte geantwortet, Schulden seien immer Sünde, und dass man sich von einem solchen Verwandten fernhalten solle.
Florent fuhr fort: «Ich denke, du solltest ein richtig großes Stück Land kaufen. Für einen acre zahlst du hier im Moment siebzig bis achtzig Dollar. Ihr rechnet in Tagwerken, oder? Was kostet eines in der Ajoie?»
«Wir zahlen achthundert Franken für ein djoénâ», meinte Henri.
«Du brauchst neun bis zehn Tagwerke zu Beginn, sonst wird das nichts. Das macht ...»
Florent holte sein Notizbuch heraus und kritzelte Zahlen. Blitzschnell war er im Rechnen, da konnten die Cornoler nur staunen.
«Du kaufst dir siebeneinhalb acres à fünfundsiebzig Dollar, das heißt, du zahlst etwa fünfhundertsechzig Dollar für das Land. Zu Hause müsstest du mehr als das Zehnfache dafür ausgeben!»
Henri musste nachdenken, Alcide fragte: «Am Stück soll er die zehn Tagwerke kaufen? Ist das ... Kann man das hier?»
Florent lachte.
«Ja, natürlich. Wenn ihr in Cornol einmal ausrechnen wolltet, wie viel Arbeitszeit ihr vergeudet auf dem Weg zwischen euren Parzellen!»
Alcide dachte an die Streitereien im Dorf, die auf jeden Vorschlag zu einem Abtausch von Land folgten. Florent musste seine Frage wiederholen: «Und was willst denn du machen, Alcide? Du hast es uns noch immer nicht verraten.»
«Diener will er werden, bei den ganz Reichen, bei Rockefeller zum Beispiel!», rief Alice aus der Küche. Man hörte ihr glucksendes Lachen. Florent sah Alcide mit offenem Mund an.
«Was ist das?»
Alcide rutschte unruhig hin und her, lächelte verlegen. Er sah, dass Florent mindestens so erstaunt war über den Wissensvorsprung seiner Frau wie über den spaßhaft verratenen Plan.
Alice Stöckli, geborene O'Donell, hatte irische Vorfahren. Für Alcide war sie eine waschechte Amerikanerin. Wobei er nicht hätte sagen können, was genau er darunter verstand. Jedenfalls gefiel sie ihm sehr, obwohl sie ihn schon einige Male in Verlegenheit gebracht hatte mit ihrer unverblümten Art. Wie sie Fragen stellte, Situationen beurteilte und Äußerungen anderer kommentierte. Sie hatte mit Florent zwei Kinder, die sechsjährige Kathleen und den zweijährigen Douglas. Florent und Alice leisteten sich eine Nanny, weil Alice etwas außerhalb des Hauses machen wollte, wie sie sagte. Sie hatte vor zwei Jahren Sterlings kleine Bibliothek von einer älteren Lady übernommen und führte sie, wie Florent stolz erzählte, wie eine Unternehmerin. Etwas unsicher hatte er hinzugefügt, sie engagiere sich auch bei den Suffragetten. Alcide hörte ihr gerne zu, auch wenn sie manchmal in dozierendem Tonfall über politische und wirtschaftliche Verwicklungen sprach, die er nur halbwegs verstand. Bei einem dieser Gespräche, am Küchentisch, hatte er ihr von seinen noch unausgereiften Plänen erzählt. Dabei, vielleicht weil sie ihn an die irische lady's maid auf der Provence, an Fiona Walsh, erinnerte, wiederholte er den Satz: «Ich will Diener werden bei den Schönen und Reichen.» Alice hatte ihn von der Seite angesehen, lauernd, und gefragt: «Bei Rockefeller zum Beispiel?»
Alcide ahnte, dass die Frage eine Falle war, trotzdem versuchte er es: «Warum nicht?»
«Warum nicht!?»
Sie holte tief Atem, dann erklärte sie ihm über eine Stunde lang, was alles an seiner Idee fragwürdig, ja vollkommen verkehrt war. Beim Junior sei sie sich nicht sicher, wie der noch herauskomme. Wahrscheinlich sei er ein Hosenscheißer, der versuche, sich der amerikanischen Öffentlichkeit als Philanthrop zu präsentieren. Der Alte aber sei ein Monster, der alles verschlinge, was ihm in die Quere komme. Mit der Standard Oil





























