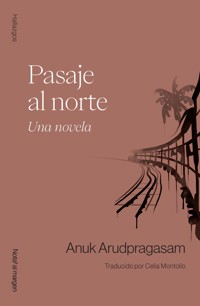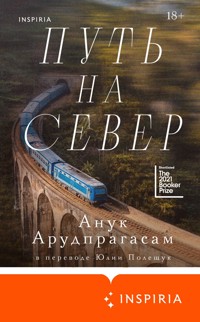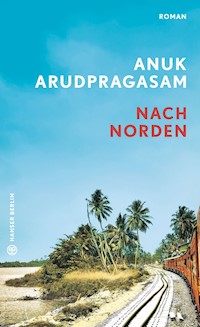
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben ist kurz, aber die Erinnerung ist lang – Anuk Arudpragasams Roman über die erschütternden Nachwirkungen des Krieges und die Kraft der Sprache. Am Anfang zwei Nachrichten: Eine E-Mail von Anjum, einer Aktivistin, in die sich Krishan vor Jahren in Delhi verliebt hatte, und ein Anruf aus dem Norden Sri Lankas. Rani, die Haushälterin seiner Großmutter, ist mit gebrochenem Genick am Grunde eines Brunnens gefunden worden. Getrieben von der Sehnsucht nach einem anderen Leben und einer unterdrückten Trauer, tritt Krishan die Zugfahrt von Colombo in die vom Krieg zerrüttete Nordprovinz an. Je näher er seinem Ziel kommt, desto klarer nimmt er die brutale Geschichte seines Landes wahr, vor dessen Hintergrund sich in seinen Gedanken die Schicksale dreier Tamil-Frauen leuchtend abheben. Anuk Arudpragasams meisterhafter Roman, mit Präzision und Anmut geschrieben, ist ein Versuch, mit dem Leben nach der Zerstörung zurechtzukommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Das Leben ist kurz, aber die Erinnerung ist lang — Anuk Arudpragasams Roman über die erschütternden Nachwirkungen des Krieges und die Kraft der Sprache. Am Anfang zwei Nachrichten: Eine E-Mail von Anjum, einer Aktivistin, in die sich Krishan vor Jahren in Delhi verliebt hatte, und ein Anruf aus dem Norden Sri Lankas. Rani, die Haushälterin seiner Großmutter, ist mit gebrochenem Genick am Grunde eines Brunnens gefunden worden. Getrieben von der Sehnsucht nach einem anderen Leben und einer unterdrückten Trauer, tritt Krishan die Zugfahrt von Colombo in die vom Krieg zerrüttete Nordprovinz an. Je näher er seinem Ziel kommt, desto klarer nimmt er die brutale Geschichte seines Landes wahr, vor dessen Hintergrund sich in seinen Gedanken die Schicksale dreier Tamil-Frauen leuchtend abheben. Anuk Arudpragasams meisterhafter Roman, mit Präzision und Anmut geschrieben, ist ein Versuch, mit dem Leben nach der Zerstörung zurechtzukommen.
Anuk Arudpragasam
Nach Norden
Aus dem Englischen von Hannes Meyer
Hanser Berlin
NACHRICHT
1
Die Gegenwart, so glauben wir, begleitet uns auf ewig, eins der wenigen Dinge im Leben, von denen man uns nicht trennen kann. Sie überwältigt uns in den schmerzhaften ersten Momenten auf der Welt, wenn sie noch zu neu ist, um sie zu meistern oder zu überwinden, sie bleibt die Kindheit und Jugend über an unserer Seite, in jenen Jahren vor dem Gewicht der Erinnerung und Erwartung, also sind wir bedrückt und etwas verstört, wenn uns auffällt, dass wir sie mit zunehmendem Alter immer weniger berühren, streifen oder auch nur einen Blick auf sie erhaschen können, dass wir der Gegenwart nicht näher kommen können als in den kurzen Momenten, wenn wir innehalten und den jeweiligen Ort betrachten, an dem unser Körper sich aufhält, die intime Wärme der Laken, in denen wir aufwachen, das zerkratzte Fensterglas eines Zuges, der uns anderswohin bringt, als könnten wir die Zeit einzig und allein festhalten, indem wir physisch versuchten, die Gegenstände um uns herum an jeglicher Bewegung zu hindern. Wir merken, dass die Gegenwart uns mit den Jahren immer mehr entwischt, sich nur noch in flüchtigen Augenblicken zeigt, bevor sie uns wieder im ewigen Gewimmel der Welt abschüttelt, flieht, sobald wir wegschauen, und kaum eine Spur hinterlässt, zumindest scheint es rückblickend so, wenn wir im nächsten kurzen Besinnungsmoment, bei der nächsten Gelegenheit, in der wir die Dinge festhalten können, merken, wie viel Zeit vergangen ist, seit wir uns das letzte Mal unserer selbst bewusst waren, wenn wir merken, wie viele Tage, Wochen und Monate ohne unser Einverständnis vorübergehuscht sind. Ereignisse finden statt, Stimmungen schwellen an und ab, Menschen und Situationen kommen und gehen, aber wenn wir an den seltenen Punkten zurückblicken, an denen wir, aus welchem Grunde auch immer, dem kreisenden Tagtraum des Alltags enthoben werden, sind wir etwas überrascht, uns an unserem jeweiligen Ort wiederzufinden, als wären wir nicht dabei gewesen, während alles passierte, als hätten wir uns anderswo aufgehalten während jener Zeit, die man allgemein unser Leben nennt. Wir wachen jeden Morgen auf und folgen auf verschlungenen Routen dem Gewohnheitsfaden aus dem Haus in die Welt und abends wieder ins Bett, bewegen uns geschlossenen Auges entlang vertrauter Wege, während ein Tag dem anderen weicht und eine Woche der nächsten, sodass wir, wenn inmitten dieses Tagtraumes etwas passiert und der Faden endlich gekappt wird, wenn in einem Augenblick großen Verlangens oder unerwarteten Verlustes die Rhythmen des Lebens unterbrochen sind, uns umschauen und im Stillen wundern, dass die Welt weiter ist, als wir glaubten, als hätte man uns ausgetrickst oder um all jene Zeit betrogen, Zeit, die rückblickend scheinbar nichts von Substanz enthielt, keine Veränderung oder Dauer, Zeit, die gekommen und vergangen ist, ohne uns zu berühren.
Während er in seinem Zimmer vor dem Fenster stand und durch das staubbedeckte Glas das leere Grundstück nebenan betrachtete, den gras- und unkrautüberwucherten Boden, die leeren Arrakflaschen vor dem Tor, war es dieses seltsame Gefühl, aus der Zeit geworfen zu sein, das Krishan dort verharren ließ, während er den Anruf zu begreifen versuchte, den er eben bekommen hatte, den Anruf, der all seinen Plänen für den Abend ein jähes Ende gesetzt hatte, den Anruf, der ihn informiert hatte, dass Rani, die ehemalige Pflegerin seiner Großmutter, gestorben war. Er war gerade erst vom Büro der NGO nach Hause gekommen, bei der er arbeitete, hatte die Schuhe ausgezogen und war nach oben gegangen, wo wie gewohnt seine Großmutter vor seinem Zimmer stand und ungeduldig darauf wartete, dass sie ihm all die Gedanken mitteilen konnte, die sie sich den Tag über aufgespart hatte. Seine Großmutter wusste, dass er das Büro an den meisten Tagen zwischen fünf und halb sechs verließ und, wenn er direkt nach Hause kam, zwischen Viertel nach fünf und Viertel nach sechs zu erwarten war, je nachdem, ob er mit einer Autorikscha fuhr, den Bus nahm oder zu Fuß ging. Seine pünktliche Ankunft war ein organisatorischer Fixpunkt ihres Tages, und sie verpflichtete Krishan mit solcher Strenge darauf, dass sie bei jeglicher Abweichung von der Norm nur mit einer ausführlichen Erklärung zu beschwichtigen war, eine dringende Konferenz oder Frist habe ihn länger als gewöhnlich im Büro festgehalten, oder die Straßen seien von einer Demonstration oder Prozession blockiert gewesen, wenn sie also zu der Überzeugung gekommen war, dass es sich um eine außerordentliche Verzögerung handelte und die Gesetze, die sie in ihrem Zimmer für den Lauf der Welt festgelegt hatte, noch in Kraft waren. Er hatte zugehört, wie sie von den Kleidern erzählte, die sie waschen musste, von ihren Mutmaßungen, was seine Mutter wohl zum Abendessen kochen werde, von ihren Plänen, sich am nächsten Morgen die Haare zu waschen, und als ihr Redefluss endlich etwas stockte, war er langsam davongeschlurft und hatte gesagt, er wolle später seine Freunde treffen und müsse sich noch ein bisschen in seinem Zimmer ausruhen. Sein unerwarteter Abgang tat ihr sicher weh, aber er hatte schon den ganzen Nachmittag darauf gewartet, eine Weile allein zu sein, damit er Ruhe und Frieden hatte, um über die E-Mail nachzudenken, die er früher am Tag bekommen hatte, die erste Nachricht von Anjum seit langem, ihre erste Bemühung seit dem Ende ihrer Beziehung, herauszufinden, was er machte und wie sein Leben nun aussah. Sobald er die Mail fertiggelesen hatte, hatte er den Browser geschlossen und seinen Wunsch unterdrückt, jedes Wort dreimal umzudrehen und zu zerpflücken, denn er wusste, dass er seine Arbeit dann nicht würde abschließen können, dass er am besten wartete, bis er zu Hause war, wo er ungestört über alles nachdenken konnte. Er hatte noch etwas mit seiner Großmutter gesprochen — sie hatte die Gewohnheit, besonders viele Fragen zu stellen, wenn sie wusste, dass er loswollte, um seinen Aufbruch aufzuschieben oder zu verzögern —, dann hatte er zugesehen, wie sie sich widerwillig in ihr Zimmer zurückzog und die Tür hinter sich schloss. Er war noch einen Moment auf dem Flur geblieben und dann in sein Zimmer gegangen, hatte die Tür zugezogen und zweimal den Schlüssel umgedreht, als könnte ihm das Verriegeln die Einsamkeit garantieren, die er suchte. Er hatte den Ventilator angeschaltet, sich aus den Klamotten geschält, ein frisches T-Shirt und eine Shorts angezogen, und gerade als er sich auf dem Bett ausgestreckt hatte, gerade als er wieder über die E-Mail und die Bilder nachdenken wollte, die sie ihm vor Augen rief, drang das hartnäckige, schrille Klingeln des Telefons durch seine Tür. Er hatte sich aufgesetzt und ein paar Sekunden abgewartet, ob es vielleicht aufhörte, aber es hatte pausenlos weitergeklingelt, also war er genervt aufgestanden, um das Telefonat so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, zur Not auch auf schroffe Weise.
Die Anruferin hatte sich etwas zögerlich als Ranis älteste Tochter vorgestellt, was er erst nach ein paar Sekunden einordnen konnte, nicht nur, weil er wegen der E-Mail nicht ganz bei der Sache war, sondern auch, weil es einige Zeit her war, dass er an Rani gedacht hatte, die Pflegerin seiner Großmutter. Das letzte Mal gesehen hatte er sie vor sieben oder acht Monaten, als sie vermeintlich für höchstens fünf Tage in ihr Dorf im Norden abgereist war. Sie wollte den fünften Todestag ihres jüngsten Sohnes vorbereiten, der am vorletzten Tag des Krieges im Artilleriefeuer umgekommen war, und am nächsten Tag die kleine Gedenkfeier besuchen, die die Überlebenden am Schauplatz des letzten Kampfes abhielten, der nur wenige Stunden mit dem Bus von ihrem Zuhause entfernt war. Eine Woche später hatte sie angerufen und erklärt, sie brauche noch etwas länger, es gebe da ein paar wichtige Angelegenheiten zu erledigen, bevor sie zurückkomme — sie hätten für den Jahrestag mehr Geld ausgegeben als geplant, und nun müsse sie ins Dorf ihres Schwiegersohns fahren, um mit ihm und ihrer Tochter persönlich über das Finanzielle zu sprechen, was nicht mehr als ein, zwei Tage dauern werde. Es dauerte dann aber zwei Wochen, bis sie wieder von ihr hörten, als sie anrief und erklärte, sie sei krank geworden, es habe viel geregnet, sie habe eine Grippe bekommen und sie brauche noch ein paar Tage mehr, um sich auszukurieren, bevor sie die lange Rückreise antreten werde. Es war schwer vorstellbar gewesen, dass eine Grippe Rani viel anhaben könnte, auch wenn sie schon Ende fünfzig war, denn ihr breiter Körperbau und ihre stämmige Gestalt vermittelten den Eindruck eines außerordentlich robusten Menschen, der sich nicht ohne weiteres von einem herkömmlichen Virus niederstrecken ließ. Krishan konnte sich noch erinnern, wie sie am vorletzten Neujahrstag frühmorgens im Garten Milchreis gekocht hatten und einer der drei Ziegelsteine weggerutscht war, auf denen der volle Stahltopf stand, sodass dieser kippte, und wie Rani sich, ohne zu zögern, gebückt und den glühend heißen Topf mit bloßen Händen gerade gehalten und ohne jede Dringlichkeit darauf gewartet hatte, dass er den Ziegelstein wieder aufrichtete, damit sie loslassen konnte. Wahrscheinlich war sie weder zu schwach noch zu krank für die Rückfahrt, hatten seine Mutter und er sich überlegt, wahrscheinlich war der Grund für die Verzögerung viel eher, dass der Jahrestag und die Gedenkfeier Ranis ohnehin labile Psyche weiter belastet hatten. Da sie keinen unnötigen Druck auf Rani ausüben wollten, sagten sie ihr, sie solle sich keine Sorgen machen, sich ruhig Zeit lassen und erst wiederkommen, wenn es ihr besser gehe. Appammas Zustand habe sich deutlich gebessert, seit Rani bei ihnen war, und man müsse sie nicht mehr rund um die Uhr betreuen, also würden sie beide schon noch ein paar Tage ohne Hilfe auskommen. Drei weitere Wochen vergingen ohne Neuigkeiten, und nachdem Krishan und seine Mutter mehrmals vergeblich versucht hatten anzurufen, mussten sie sich eingestehen, dass sie die Lage falsch eingeschätzt hatten und Rani schlicht und ergreifend nicht mehr zurückkommen wollte. Es war untypisch, dass sie sich nicht die Mühe gemacht hatte, anzurufen und ihnen Bescheid zu sagen, weil Rani in solchen Dingen eigentlich sehr pflichtbewusst war, aber wahrscheinlich hatte sie es so satt, ewig mit Appamma allein zu sein, dass es ihr gar nicht eingefallen war, sich noch einmal zu melden. Eingepfercht in ein kleines Zimmer am anderen Ende des Landes hatte sie Appammas unentwegtes Geschwätz Tag und Nacht ertragen müssen, ohne je für längere Zeit aus dem Haus zu können, weil sie hier niemanden kannte und auch kein Singhalesisch sprach, also erschien es nur logisch, da waren sich Krishan und seine Mutter einig, wenn Rani nach fast zwei Jahren in Colombo beschlossen hätte, dass es endlich Zeit war zu gehen.
Krishan hatte Ranis Tochter erklärt, seine Mutter sei nicht zu Hause und werde erst in ein paar Stunden wiederkommen, er hatte gefragt, ob er etwas ausrichten könne, und nach kurzem Zögern hatte sie ihm ohne besondere Regung in der Stimme gesagt, dass Rani, ihre Mutter, gestorben sei. Erst hatte er überhaupt nicht reagiert, die gehörten Worte waren in seinem Kopf seltsam bedeutungslos, dann nach einigen Sekunden hatte er die Frage herausgebracht, wie, was denn passiert sei und wann. Es sei gestern Abend geschehen, erklärte sie, nach dem Essen sei ihre Mutter Wasser vom Brunnen holen gegangen und hineingefallen, wie genau, das wisse keiner. Als sie etwa zwanzig Minuten fort gewesen sei, hätten sie nach ihr gesehen, hätten eine Dreiviertelstunde überall gesucht, bis ihr ältestes Kind, Ranis Enkelin, direkt an den Brunnen getreten sei, sich über den Rand gebeugt habe, um hineinzuschauen, und dann geschrien habe. Rani sei kopfüber hineingefallen und habe sich das Genick gebrochen, entweder als sie im Fall gegen die Wand geschlagen sei, oder am Boden des Brunnens, in dem kaum ein halber Meter Wasser stehe. Ohne zu ahnen, dass es vielleicht naiv oder unsensibel war, fragte Krishan, wie sie denn hineingestürzt sei, ob es ein Unfall gewesen sei, und Ranis Tochter antwortete, natürlich sei es einer gewesen, es sei dunkel gewesen und es gebe dort keine Lampe, also sei ihre Mutter wohl auf der Betonplattform am Brunnen gestolpert oder sie sei beim Kurbeln ohnmächtig geworden, schließlich habe sie früher am Tag schon über Kopfschmerzen und ein Schwindelgefühl geklagt. All dies erzählte sie in einem etwas mechanischen Ton, als hätte nichts an dem Geschehenen sie allzu sehr schockiert oder überrascht, und dann war sie verstummt, als gäbe es zu der Angelegenheit nichts mehr zu sagen. Krishan wollte mehr wissen, und wie um weitere Fragen abzuwenden, fügte Ranis Tochter hinzu, dass die Beerdigung am Sonntagnachmittag stattfinde, falls er und seine Mutter es schaffen könnten. Krishan sagte, er werde seiner Mutter Bescheid geben, und sie wollten auf jeden Fall kommen, wenn es möglich war, eine Aussage, die ihm sofort absurd erschien, nicht nur, weil er sich unsicher war, ob Ranis Tochter sie wirklich dort haben wollte oder ob die Einladung nur eine Formsache war, sondern auch, weil er bei seiner Antwort merkte, dass er noch nicht ganz glaubte, was sie ihm gesagt hatte. Er verspürte den Drang, weitere Fragen zu stellen, wer letzten Abend sonst noch dabei gewesen war, ob es am Tag noch andere Hinweise gegeben hatte, hatte Rani irgendetwas Seltsames gesagt oder getan, hatte sie öfter Kopfschmerzen oder Schwindelanfälle gehabt, hatte sie aufgegessen, was hatte es gegeben, er wollte nach allen Einzelheiten fragen, so trivial sie auch scheinen mochten, denn in solchen Situationen hat man immer ein Bedürfnis nach mehr Information, nicht weil diese selbst wichtig wäre, sondern weil man ohne sie das Ereignis als Ganzes nicht glauben kann, so als müsste man alle Begleitumstände kennen, die den unwahrscheinlichen Tod mit der sogenannten Wirklichkeit verbinden, bevor man hinnehmen kann, dass dieser nicht den Naturgesetzen widerspricht. Vor allem die Tatsache, dass ein plötzlicher oder gewaltsamer Tod nicht nur in einem Kriegsgebiet oder bei einem Pogrom stattfinden konnte, sondern auch im langsamen, unscheinbaren Lauf des Alltags, machte ihn so verstörend und inakzeptabel, als liege selbst in jeder Routinehandlung, in jedem gewöhnlichen, unbemerkten Augenblick des Lebens die Möglichkeit des Todes verborgen. Auf einmal bekamen die kleinen Details, die man in seiner normalen Lebensbetrachtung kaum wahrnimmt, eine geradezu kosmische Bedeutung, als hinge das eigene Schicksal davon ab, ob man nicht versäumt hatte, vor Einbruch der Dunkelheit Wasser zu holen, ob man sich beeilt hatte, den Bus zu erwischen, oder sich lieber Zeit gelassen hatte, ob man die zahllosen trivialen Entscheidungen mit Ja oder Nein beantwortet hatte, die erst rückblickend, wenn das Ereignis vorüber und nichts mehr zu ändern ist, wichtig erscheinen. Krishan kam keine Frage in den Sinn, die nicht taktlos oder allzu neugierig geklungen hätte, da er das Gespräch aber noch verlängern wollte, hatte er sich erkundigt, wie weit ihr Dorf von Kilinochchi entfernt war und wie man dort am besten hinkam. Das wisse seine Mutter sicher, sagte Ranis Tochter, von Kilinochchi aus müssten sie noch zwei Busse nehmen und dann zu Fuß oder mit einer Autorikscha weiter zum Dorf kommen. Es gab noch eine Pause, und da Krishan nichts mehr einfiel und er verstand, dass Ranis Tochter nichts mehr sagen oder ergänzen wollte, musste er sich verabschieden.
Er hatte noch eine Weile mit dem Hörer in der Hand dagestanden, lange nachdem er es am anderen Ende hatte knacken hören, und erst als das Telefon zum dauerhaften und unangenehm schrillen Tuten überging, stellte er es wieder ab und kehrte in sein Zimmer zurück. Er schloss ab, ging langsam zum Bett und setzte sich wieder dorthin, wo er vorher gesessen hatte. Er griff zu seinem Handy, weil er seiner Mutter Bescheid sagen wollte, dann fiel ihm aber ein, dass sie noch unterrichtete und erst ab sieben Uhr dreißig rangehen konnte. Er legte das Handy wieder weg und sah sich ruhelos im Zimmer um, schaute die Sachen auf dem Ankleidetisch gegenüber an, seine umgekrempelte Arbeitskleidung auf dem Boden, die Bücher und Klamotten und DVDs, die auf dem unbenutzten Bett seines Bruders verstreut lagen. Er hob seine Hose auf, entkrempelte sie wieder, faltete sie und legte sie säuberlich aufs Bett. Dasselbe tat er mit dem Hemd, dann sah er sich noch einmal um, stand auf und ging ans Fenster. Er stützte sich mit beiden Händen auf die Fensterbank, lehnte die Stirn sanft ans Gitter und betrachtete den Balkon am Haus auf der anderen Seite des leeren Grundstücks, die Wäsche auf der Leine und die kleine Satellitenschüssel auf dem Terrakottadach. Er wollte über den Anruf nachdenken und über das, was er erfahren hatte, aber es kam ihm noch so unwirklich vor wie etwas, was er noch nicht einschätzen oder verstehen konnte. Er war weniger traurig als eher verlegen, weil ihn die Neuigkeiten inmitten seiner selbstbezogenen Gedanken an Anjums E-Mail erreicht hatten, und wegen seiner Ungeduld mit seiner Großmutter, als hätte der Anruf ihn aus seinem gewöhnlichen Bewusstsein geschreckt und ihn paradoxerweise nicht über Rani, sondern über sich selbst nachdenken lassen, sich von außen betrachten und aus der Distanz das Leben sehen lassen, in dem er versunken war. Er dachte an seine Reaktion auf die E-Mail am Nachmittag, wie er sich näher an den Laptop gebeugt und reglos den Bildschirm angestarrt hatte, an die stille Verwunderung, als er die Nachricht gelesen hatte, und die leise Vorfreude, die folgte und die er nach Kräften unterdrückt hatte, weil der Inhalt der Mail selbst sie nicht rechtfertigte. Die E-Mail war recht kurz gewesen, nur drei oder vier sorgfältig formulierte Sätze, wohlüberlegt und doch von leiser Poesie, Sätze, die nicht mehr und nicht weniger preisgeben sollten, als Anjum es wollte. Sie verrieten nur wenig über ihr Leben und fragten ebenso wenig nach seinem, was eben Anjums Art war, und zwar nicht nur, wenn sie schrieb, sondern allgemein, doch vielleicht, dachte er sich, hatte sie nur so wenig geschrieben, weil sie sich ihm nicht ungebeten aufdrängen wollte, weil sie ihm die Möglichkeit eines Austauschs anbieten wollte, ohne ihn zu einer ausführlichen Antwort zu nötigen. Sie sei ein paar Wochen in Bombay gewesen, hatte sie geschrieben, wo sie eine kurze Pause von ihrer Arbeit in Jharkhand eingelegt habe, das erste Mal, dass sie wieder in die Stadt gekommen sei, nachdem sie vier Jahre zuvor gemeinsam dort gewesen waren. Sie sei an der Küste spazieren gegangen und habe daran denken müssen, wie sie beide am letzten Tag ihrer Reise das Gleiche getan hatten, sie habe sich gefragt, wie es ihm gehe und ob die Zeit seit seiner Rückkehr nach Sri Lanka ihm gegeben habe, was er suche. Sie denke hin und wieder an ihn und hoffe, es gehe ihm gut und er habe in seinem neuen Zuhause mit der Zeit eine Lösung für all seine Sehnsucht gefunden, sie beendete den Text der E-Mail damit, dass sie diesem sehr konkreten Wort, Sehnsucht, die geradezu paradoxe Vorstellung einer Lösung anfügte, bevor sie sich mit nur ihrer ersten Initiale verabschiedete.
Die Nachricht offenbarte nichts über die Natur Anjums gelegentlicher Gedanken an ihn, wie Krishan sofort aufgefallen war, und sie erwähnte ebenso wenig, wie es Anjum in den letzten Jahren ergangen war, ob ihr neues Zuhause, das sie sich mit ihren Aktivistenfreunden im ländlichen Jharkhand eingerichtet hatte, ihr gegeben hatte, was sie wollte, ob sie erfüllt oder desillusioniert war, zufrieden oder enttäuscht mit dem, was das Leben gebracht hatte. Es war unklar, ob ihre Entscheidung, jetzt zu schreiben, etwas mit einer Bestandsaufnahme zu tun hatte, mit einem Reflektieren über andere Wege, die sie hätte gehen können oder womöglich noch immer gehen konnte, oder ob sie einfach nur von beiläufiger Neugier angetrieben war, von dem gewöhnlichen, vorübergehenden Interesse am Leben ehemaliger Partner, das einen manchmal überkommt. Sie hatte auch so geschrieben, als wären sie damals im gegenseitigen Einverständnis auseinandergegangen, als hätten jeden von ihnen die eigenen Wünsche und die jeweilige Geschichte in eine andere Richtung getrieben, sie gestand ihm eine Handlungsmacht zu, die er in ihrer Beziehung nie besessen hatte, das wusste er. Schon lange bevor sie ihn kennenlernte, hatte Anjum entschieden, Delhi zu verlassen, sie hatte bereits eine ganze Weile geplant, sich mit ihren Freundinnen und anderen Aktivisten, die sie kannte, in Jharkhand einzurichten, mit ihren Genossinnen und Genossen, wie sie es oft ohne jegliche Ironie ausdrückte. Also war die begrenzte Natur ihrer gemeinsamen Zeit in Delhi von Anfang an beschlossene Sache, und er musste ihre zukünftige Trennung mit einplanen und erwarten. Bevor er Anjum kennengelernt hatte, hatte er selbst die Möglichkeit in Erwägung gezogen, Delhi zu verlassen, das Leben aufzugeben, das er sich dort über einige Jahre aufgebaut hatte, das Promotionsstudium abzubrechen, das er kürzlich angetreten hatte, und nach Sri Lanka zurückzukehren, um irgendwie zu den Bemühungen des Wiederaufbaus nach dem Krieg beizutragen. In den Jahren seit dem Ende der Kämpfe war er besessen geworden von den Massakern, die im Nordosten stattgefunden hatten, mehr und mehr hatte ihn die Schuld des Überlebenden ergriffen, und er sehnte sich nach der Art Leben, die er vielleicht führen könnte, wenn er die träge akademische Welt verließ, in die er sich abgesondert hatte, und an einem Ort lebte und arbeitete, der ihm etwas bedeutete. Doch die abstrakte Sehnsucht nach dieser Vorstellung seiner Heimat hatte sich bald an den Rand seines Bewusstseins zurückgezogen, als er Anjum kennengelernt hatte, für die er all seine Hoffnungen und Pläne aufzugeben bereit war, so beispiellos war ihre gemeinsame Zeit, so anders als alles andere, was vorher oder seitdem gewesen war. Als ihre Beziehung enger wurde, hatte er gehofft, Anjum würde ihre Pläne vielleicht überdenken, könnte in Betracht ziehen, ihn in ihr neues Leben einzuschließen oder ihn zumindest zu Besuch kommen zu lassen, wenn sie weggezogen war, aber sie ging selten darauf ein, wenn er auf eine gemeinsame Zukunft anspielte, und deutete mal durch Schweigen, mal durch eine beiläufige Bemerkung an, dass ihr baldiges Projekt einen vollständigen Bruch mit ihrem Leben in Delhi bedeutete, der es nicht zuließ, dass sie nach dem Umzug mit ihm zusammenblieb.
Ironischerweise hatte gerade diese Beziehung seiner bisher abstrakten Idee einer Rückkehr Form gegeben, und zwar weniger durch ihre Gespräche, da Anjum nur ungern mit ihm über die Einzelheiten ihrer Arbeit sprach, sondern vielmehr durch ihr Vorbild, wie ein auf eine gesellschaftliche oder politische Vision ausgerichtetes Leben aussehen konnte. Sie zeigte zwar keine offene Geringschätzung für sein akademisches Streben, aber er spürte, dass sie diesem keine große Bedeutung beimaß, und je länger er mit ihr zusammen war, desto achtbarer wirkten seine früheren Ideen, den Elfenbeinturm zu verlassen, desto ernsthafter fragte er sich, ob auch ihm ein vom Ideal des kollektiven Handelns bestimmtes Leben möglich war. Anjums unerschütterliche Hingabe für die Frauen- und Arbeiterbewegungen, für die sie in Delhi arbeitete, hatte ihm, beinahe als eine Art Selbstschutz, das Gefühl gegeben, dass auch er sich einer Sache widmen müsste, die größer und bedeutender war als er selbst, und da er wusste, dass er nicht in Delhi bleiben konnte, wenn sie einmal fort war, hatte er, angetrieben von dem Bedürfnis, sich und ihr zu beweisen, dass auch er einen eigenen Lebenszweck hatte, ein unabhängiges Schicksal, das ihn mit ihr oder ohne sie an ein bestimmtes Ziel führen konnte, bewusst seine Zukunftsgedanken auf ein mögliches Leben im Nordosten Sri Lankas ausgerichtet. In mancher Hinsicht war das eine naive Vorstellung, denn er hatte keine Ahnung, worin soziale Arbeit in einem ehemaligen Kriegsgebiet bestand, hatte weder entsprechende Kenntnisse noch Erfahrungen, die ihm in diesem Feld helfen könnten, doch da er es nicht ertrug, tatenlos abzuwarten, während Anjums Abreise näher rückte, hatte er erneut angefangen, das Gefühl zu kultivieren, dass an jenem Ort, an dem er nie selbst gewohnt hatte, sein Schicksal lag, und er stellte sich vor, wie es wäre, auf demselben Boden zu wandeln wie seine Ahnen und dabei zu helfen, aus beinahe totaler Vernichtung die Möglichkeit einer neuen und erstrebenswerten Zukunft zu schaffen, so als könnte auch er etwas finden, dem es sich zu ergeben lohnte, wenn er selbst eins dieser Leben führte, die der Krieg auf das Grundlegendste reduziert hatte.
Es war ein seltsamer Gedanke, wie viel sich seitdem geändert hatte, überlegte Krishan, während er dort vor dem Fenster stand, und zwar nicht auf plötzliche oder endgültige Art und Weise, sondern wie allein mit der Entscheidung, zurückzukehren, und der langsamen Ansammlung von Zeit dieser einst ferne, scheinbar unerreichbare und nahezu mystische Ort zu einem wesentlichen Teil von ihm geworden war. Die meisten seiner Vorstellungen vom Nordosten hatten sich auf kurzen Reisen nach Trincomalee und Vavuniya als Kind und bei einem längeren Aufenthalt in Jaffna während des Waffenstillstands gebildet, als er siebzehn oder achtzehn war, und aus den wehmütigen Schilderungen älterer Verwandter, die im Ausland lebten, wie idyllisch ihre dörfliche Kindheit gewesen sei. Den Großteil seines Lebens hatte er beim Gedanken an den Nordosten weite Landschaften mit Salzmarschen und Palmyrapalmen vor Augen gehabt, die kupferfarbenen Lehmstraßen von Vanni und die Landstriche aus harter, trockener Erde, aus der die Halbinsel überwiegend bestand, die durchdringenden, beschwingten Rhythmen, die während der Feiertage aus den Tempeln schallen, den Klang all der Leute, die laut und melodisch und ohne Zurückhaltung ihr makelloses Tamil sprechen. Diese Bilder hatten ihm ein Gefühl der Freiheit vermittelt, der Möglichkeit eines Lebens, das radikal anders war als das seine, aber sie waren zugleich erfüllt von einer traumartigen Qualität, die es erschwerte, sie sich konkreter vorzustellen, so wie die Nachrichten von Bombardements und Gefechten, von Vormärschen, Rückzügen und Waffenstillständen, die jeden Tag in der Zeitung standen, stets wichtig und besorgniserregend gewesen waren, aber nur selten den Lauf der Dinge in seinem eigenen Leben im Süden des Landes unterbrochen hatten, sondern Teil des Hintergrundrauschens blieben, das er seit seiner Kindheit hinzunehmen wusste.
Erst viel später drangen die Ereignisse im Nordosten tiefer ins Muster seines Alltags vor, gegen Kriegsende 2008 und 2009, als es zum ersten Mal schien, als könnten die Tiger besiegt werden und mit ihnen die Idee eines tamilsprachigen Staates im Nordosten. Er war damals im letzten Jahr seines Bachelorstudiums in Delhi gewesen, hatte sich gerade für Graduiertenprogramme in Politikwissenschaften beworben, und er wusste noch, wie er tagelang erfolglos versucht hatte, in der selig unwissenden Stille der Universitätsbibliothek zu arbeiten, während er immer wieder die Nachrichtenseiten aktualisierte, die er auf seinem Computer permanent offen hatte. Es gab Gerüchte von gewaltigen Zahlen an Zivilisten, die vom Militär getötet wurden, und er wusste genau, dass die Schilderung der Regierung einer humanitären Rettungsmission im Nordosten eine Nebelkerze war, dass er nichts von dem trauen konnte, was er in der Zeitung las. Er durchsuchte stundenlang das englisch- und tamilsprachige Internet, arbeitete sich Stück für Stück durch Blogs, Foren und Nachrichtenseiten, die Bilder und Videos aus den letzten Monaten der Kämpfe zeigten. Die meisten dieser Seiten waren von Tamilen in der Diaspora eingerichtet worden, die Material posteten, das Überlebende mit Handys und Kameras aufgenommen und irgendwie ins Ausland geschickt hatten. Er verstand, dass das Internet voller ziviler Fotoarchive der jüngsten Kriege auf der ganzen Welt war, jedes davon ein scheinbar endloses Labyrinth namenloser Gewalt, und in den Monaten nach Kriegsende hatte er einen Großteil seiner Zeit mit der sorgfältigen Erforschung dieser Archive verbracht, fassungslos die Bilder von aufgeblähten Leichen und abgetrennten Gliedmaßen betrachtet, von geschundenen Toten, brennenden Zelten und schreienden Kindern, von denen sich ihm viele mit verstörender Klarheit ins Gedächtnis eingebrannt hatten. Hatte man diese Bilder einmal gesehen, waren sie unmöglich zu vergessen, nicht allein wegen der abgebildeten Gewalt, sondern auch wegen ihrer augenfällig amateurhaften Qualität, denn anders als die höchst ästhetisierten, beinahe geschmackvollen Kriegsaufnahmen, die man oft in Büchern und Zeitschriften sah, waren die Bilder, die er online fand, von extrem schlechter Komposition. Die Fotos waren körnig oder unscharf, der Bildausschnitt und Fokus nachlässig gewählt — eine geplatzte Zahnpastatube auf dem Boden neben einer Leiche, eine benommene alte Frau, die Fliegen von ihrem verwundeten Bein wegscheucht —, als wären sie im Laufen aufgenommen worden oder als wollte die Person hinter der Kamera selbst nicht so genau hinschauen. Ihm drängte sich das Gefühl auf, dass es Bilder waren, die er eigentlich nicht sehen sollte, Bilder, die Menschen in einer derartigen Lage zeigten, dass sie lieber sterben würden, als sich so anschauen zu lassen, die Angst in ihren Augen weniger dem Schrecken der Situation geschuldet als dem Schock, in einem Zustand intimster Qual fotografiert zu werden, sodass ihre Blicke ihn beschämten, auch wenn er nicht wegsehen konnte.
Lange blieb der Schrecken dieser Bilder in ihm vergraben, eine düstere Realität, die er immer weiter nährte, aber nicht äußern konnte, als könnte er nicht ganz glauben oder verstehen, was sie zeigten. Erst als Channel Four 2011 den Dokumentarfilm zeigte, der der Regierung Kriegsverbrechen und Völkermord vorwarf, und später im Jahr die Vereinten Nationen ihren Bericht veröffentlichten, der abschätzte, wie viele Zivilisten gestorben waren, konnte er endlich über das Geschehene sprechen, konnte er akzeptieren, dass die Bilder, von denen er so besessen war, kein schräges, perverses Werk seines Unterbewusstseins waren, sondern dass sie Dinge darstellten, die in seinem Heimatland wirklich vorgefallen waren. Auch jetzt noch schämte er sich für seinen anfänglichen Widerwillen, das Ausmaß dessen anzuerkennen, was gegen Kriegsende geschehen war, als hätte er den Beweisen auf seinem Computerbildschirm zunächst nicht glauben wollen, weil seine armen, geschundenen, staatenlosen Volksgenossen selbst die Anschuldigungen erhoben, als hätte er das Leid seines eigenen Volkes nicht ernst nehmen können, bevor es von einer Jury ausländischer Experten bestätigt worden war, legitimiert durch einen Dokumentarfilm, geschildert von einem säuberlich rasierten weißen Mann, der mit Schlips und Kragen vor der Kamera stand. Wie die meisten Tamilen in seinem Alter, die außerhalb des Kriegsgebietes lebten, ob nun in Colombo oder Chennai oder Paris oder Toronto, hatte er den Film mehrmals gesehen und den Bericht mehrmals gelesen, hatte auch hinterher weiter versucht, so viel herauszufinden wie möglich, hatte jeden Artikel und Essay aufgestöbert, der auf Englisch oder Tamil erschien, hatte alle Interviews mit Überlebenden geschaut, die er auf Youtube finden konnte. Aus seinem anfänglichen Unglauben wurde erst Schock, dann Wut und dann Scham wegen seines eigenen leichten Lebens, und diese Scham beförderte über die folgenden Monate ein unheimliches Gefühl der Unwirklichkeit, als wäre seine Welt in Delhi wirklichkeitsfremd, seine Kurse an der Universität und seine akademischen Zukunftspläne, die Proteste und Demonstrationen, zu denen er fast zum Zeitvertreib ging, die verschiedenen Freundinnen, Freunde und Schwärme, die sein Sozialleben ausmachten. Nichts um ihn herum schien das Ausmaß des Geschehenen widerzuspiegeln — selbst am letzten Tag des Krieges lief das Leben an der Uni mehr oder weniger wie gewohnt weiter, alle waren versunken in die Vorbereitungen für die Abschlussprüfungen —, und dieses Missverhältnis zwischen seiner Umgebung und dem, was sich in ihm abspielte — das wachsende Gefühl, dass die Welt, wie er sie verstand, untergegangen war —, brachte ihn zu der Überzeugung, dass den Räumen, in denen er lebte, eine zentrale Dimension der Realität fehlte, dass sein Leben in Delhi eine Art Traum oder Halluzination war. Wahrscheinlich, dachte er sich nun, war es eine derartige Dissonanz, die so viele Tamilen in fremden Ländern zu solchen Verzweiflungstaten getrieben hatte, die den Jungen, dessen Name ihm nicht mehr einfiel, im Februar 2009 von London nach Genf reisen ließ, damit er sich dort vor dem Gebäude der Vereinten Nationen in Brand setzen konnte, die Zehntausende von Demonstranten, die meisten von ihnen Geflüchtete, drei Monate später spontan auf eine der größten Straßen Torontos trieb, womit sie den Verkehr der gesamten Stadt zum Erliegen brachten — als wären diese Exiltamilen zu jedem Mittel bereit, um diese fremden Umgebungen, in denen sie nun lebten, so fern vom Nordosten Sri Lankas, zumindest einen Augenblick lang zum Innehalten zu bringen, zum irgendwie gearteten Wahrnehmen oder Anerkennen all der Tode, die im Land ihrer Geburt geschahen.
Vielleicht hatte er die Ungeheuerlichkeit der Ereignisse erst begriffen, als alles vorbei war, als nichts mehr zu machen war, vielleicht weil er in Delhi keine tamilischen Freunde hatte, mit denen er reden oder seine Gefühle verarbeiten konnte, hatte seine persönliche Reaktion auf das Kriegsende sich eher nach innen gerichtet. Wenn er jetzt an jene Zeit zurückdachte, wunderte er sich ein bisschen über die stille Wucht seiner Reaktion, über den ungesunden Eifer, mit dem er sich auf alle Bilder und Videos stürzte, die er finden konnte, die Sorgfalt, mit der er die Lage zu rekonstruieren versuchte, die ihm erspart geblieben war. Er hatte im Kopf eine Chronologie der Vertreibung von Zivilisten aus ihren Dörfern im Nordosten angelegt, die Standorte der verschiedenen Krankenhäuser vermerkt, die von der Regierung bombardiert worden waren, die Schutzzonen, in denen die schlimmsten Massaker stattgefunden hatten, er hatte alle Karten des Kriegsgebietes studiert, die er finden konnte, und alles über diese Orte gelesen, worauf er Zugriff hatte. Er hatte sein Bestes getan, um auch den letzten Informationsfetzen zu erwischen, hatte sich die verschiedenen Arten von Artilleriegranaten notiert, die das Militär benutzt hatte, und die verschiedenen Geräusche, die sie im Flug machten, die Wetterbedingungen und Bodenzusammensetzungen all der unterschiedlichen Tötungsschauplätze, hatte die Einzelheiten, die er nicht in Erfahrung bringen konnte, geraten oder sich ausgemalt, hatte diese Orte der Gewalt in seinem Kopf so detailliert nachgebildet, dass er beabsichtigt haben musste, sich in gewisser Weise persönlich dorthin zu versetzen. In dieser Arbeit lag ein Element von Selbsthass, das wusste er, der Wunsch, sich zu bestrafen, weil er davongekommen war, indem er sich dieser Sache so brutal wie möglich aussetzte, aber nun fiel ihm auf, dass vielleicht auch etwas Religiöses an seinem Streben war, die Umstände zu verstehen, unter denen so viele Menschen ausgelöscht worden waren, so als wollte er durch diesen Vorstellungsakt eine Art privaten Schrein zum Gedenken all dieser anonymen Leben erschaffen.
Während er aus dem Fenster in den leeren, endlosen Himmel blickte, der noch goldgelb war, aber nun durchzogen mit langen, rosafarbenen Bänderwolken, fiel Krishan ein Gedicht ein, das er viele Jahre zuvor im Periya Purānam gelesen hatte, aus dem sie in der Schule etliche Abschnitte ausführlich behandelt hatten. Damals hatte er sich eigentlich nicht weiter für alte tamilische Literatur interessiert und die meisten Stunden durchs Fenster den Cricketplatz nebenan beobachtet, aber aus irgendeinem Grunde war ihm die Geschichte Pusals immer präsent geblieben. Dem Gedicht nach war Pusal ein armer Mann aus einem abgelegenen Dorf, der von ungewöhnlich starker Religiosität beseelt war. Von Kindheit an hatten sich seine Gedanken und Gefühle immer liebevoll Siva gewidmet, und sein ganzes Erwachsenenleben hatte er diese instinktive Liebe gehegt und bestärkt. Lange hatte er überlegt, wie er seinen Herrn ehren könne, hieß es in dem Gedicht, und nach reiflicher Überlegung hatte er beschlossen, einen Tempel zu bauen, in dem Siva leben konnte, woraufhin Pusal sich voller Tatendrang auf die Suche nach dem nötigen Land und den Baumaterialien gemacht hatte. Über mehrere Monate ergründete er jede Möglichkeit, besuchte jede Stadt und jedes Dorf in der Gegend und traf sich mit jeder bedeutenden Persönlichkeit, die er kannte, doch nach vielen gescheiterten Versuchen wurde ihm allmählich klar, dass er niemals die zum Bau des Tempels nötigen Ressourcen zusammenbekommen würde, dass er schlichtweg zu arm war, seinem Herrn so zu dienen, wie er es wollte. Er versank in tiefer Verzweiflung, in einen Zustand der Hoffnungslosigkeit, aus dem er einige Zeit nicht wieder auftauchte, bis ihm eines Tages, während er seine Lage erwog, einfiel, dass er Siva anstelle eines physischen Tempels auch einen in seinem Bewusstsein bauen konnte. Hellauf begeistert von dieser naheliegenden Idee hatte Pusal sich gleich ans Werk gemacht. Zunächst suchte er sich den perfekten Bauplatz in seinem Kopf aus, um dann in seiner Vorstellung alle für sein Werk benötigten Materialien zu beschaffen, von den filigransten kleinen Werkzeugen bis hin zu den schwersten Steinplatten. Im Geiste heuerte er die besten Zimmerleute, Steinmetze, Kunsthandwerker und Künstler an, und an einem günstigen Datum legte er schließlich behutsam und liebevoll den imaginären Grundstein tief im Herzen des Bodens, wobei er alle in den relevanten Texten festgelegten Vorgaben befolgte. Mit großer Sorgfalt und gelehrsamem Ernst begann er die Arbeit am Tempelgebäude, ohne auch nur des Nachts zum Schlafen innezuhalten, vollendete er als Erstes das Fundament, dann eine um die andere Schicht des Bauwerks, sodass der Tempel über eine Spanne mehrerer Tage in seinen Gedanken Form annahm, von den Hallen und Pfeilern bis hin zu den Ornamenten über den Portalen und an den Postamenten. Als alle Türme und Nebenschreine fertig waren, als der Tempelteich ausgehoben und aufgefüllt und endlich die Außenwände hochgezogen waren, setzte er die Bekrönung auf die Spitze des Gebäudes, kümmerte sich um die letzten notwendigen Details und wählte schließlich erschöpft und zufrieden einen verheißungsvollen Zeitpunkt, um den Tempel Siva zu weihen.
Dem Text zufolge vollendete zur gleichen Zeit auch der König einen Tempel, den er zu Ehren Sivas errichtet hatte, und zufällig wählte er denselben günstigen Tag zur Weihung des seinen. Der königliche Tempel war von beispiellosen Ausmaßen, über viele Jahre und unter immensen Kosten erbaut, doch in der Nacht, bevor Sivas Bildnis dort aufgestellt werden sollte, erschien Siva dem König im Traum, so das Gedicht, und sagte ihm, er könne der Zeremonie leider nicht beiwohnen und man müsse sie verschieben, da er sich entschlossen habe, stattdessen zur Weihung eines großen Tempels zu erscheinen, den ein Mann namens Pusal ihm erbaut habe, ein hingebungsvoller Anhänger aus dem fernen Dorfe Ninravur. Als der König am nächsten Morgen erwachte, staunte er, dass ein einfacher Mann einen Tempel gebaut hatte, den Siva dem seinen vorzog. Also brach er mit seinem Gefolge auf gen Ninravur, und als sie nach vielen Tagen der Reise endlich die üppigen Haine des Dorfes erreichten, befahl der König den Menschen dort, ihn zu Pusals Tempel zu bringen, damit er sehen könne, was Pusal gebaut habe. Sie wüssten, wer Pusal sei, antworteten sie, doch er sei ein armer Mann und habe gewiss keinen Tempel gebaut. Der König war verwirrt, als er dies hörte, ließ sich aber dennoch zu Pusal bringen, aus Respekt vor dem Gläubigen stieg er vom Pferd und näherte sich Pusals bescheidener Behausung zu Fuß, wo er einen ausgezehrten Mann im Schneidersitz auf dem Boden sah, die Augen geschlossen und in seliger Unwissenheit über seine Umgebung. Der König rief dem Mann zu und fragte ihn, wo denn sein Tempel sei, den alle Welt preise — er wolle ihn sich ansehen, denn Siva selbst habe gesagt, er werde ihn sich an diesem Tage weihen lassen. Verblüfft von der königlichen Stimme öffnete Pusal die Augen und sah auf zu dem Mann, der ihn angesprochen hatte und den er sogleich als den König erkannte. Voller Bescheidenheit schilderte Pusal, dass ihm die Mittel gefehlt hätten, Siva einen Tempel aus Stein zu bauen, woraufhin er stattdessen mit großer Sorgfalt in seinem Kopf einen Tempel erschaffen habe, und beeindruckt von der Hingabe dieses Gläubigen, der nichts hatte und doch seinen Herrn auf diese Weise ehrte, war der König auf die Knie gefallen, dass seine duftenden Girlanden im Staube lagen.
Während Krishan dort in seinem Zimmer stand, hätte er nicht sagen können, in welchem Maße das Gedicht, das er vor so langer Zeit gelesen hatte, seine Reaktion auf die Ereignisse des Krieges beeinflusst hatte, doch nun fiel ihm auf, dass das so sorgfältig in Pusals Bewusstsein errichtete Gebäude in mancher Hinsicht durchaus dem ähnelte, was er selbst in den Monaten und Jahren seit Kriegsende errichtet hatte. Auch er hatte die Welt um sich herum weitgehend verlassen, um im Kopf eine Art alternativen Raum zu erschaffen, und obwohl er dort stets nur Schmerz erlebt hatte statt Freude, obwohl ihn ebenso sehr die Scham angetrieben hatte wie die Liebe, so hatte auch er irgendwie gehofft, dass der Gegenstand seiner Gedanken, das Leid seiner teils realen, teils vorgestellten Gemeinschaft, durch seine Arbeit eine Anerkennung erfahren konnte, die in der Wirklichkeit ausgeblieben war. Wenn er an die ersten Monate nach der Rückkehr auf die Insel bei seiner Arbeit im Nordosten dachte, erinnerte er sich deutlich an das Gefühl, einen Ort zu betreten, den er selbst herbeigedacht hatte, an den Eindruck, er bewege sich dort weniger über festen Erdboden als vielmehr über einen Ausläufer seines Bewusstseins. Er hatte bei einer kleinen, lokalen, unterfinanzierten NGO in Jaffna angefangen, bei der er kaum mehr verdiente, als er zum unmittelbaren Überleben brauchte, und wenn er auf kaputten Straßen zwischen ausgebombten Dörfern hin- und herfuhr, die vom Wellblech und Aluminium der Behelfsbehausungen schimmerten, vorbei an den bitteren Blicken von Männern, die nicht mehr beschützen konnten, an den müden Augen von Frauen, die nun die alleinige Verantwortung für den Fortbestand des Lebens trugen, war es, als lägen über allem, was er dort sah, die Szenen vergangener Gewalt, die er im Kopf nachgestellt hatte. Die letzten Granaten waren lang gefallen, die letzten Leichen fortgeschafft, aber die Stimmung und Textur der Gewalt durchzog diese Orte so deutlich, dass er sogar anders ging, wenn er im Nordosten war, denn er bewegte sich dort stets mit der stillen Ehrfurcht, die einen auf einem Friedhof oder Aschefeld überkommt. Gelegentlich gab es auch schöne, leichte Augenblicke, Anklänge eines anderen Lebens — das fröhliche Lachen zweier Mädchen, die sich morgens auf dem Schulweg ein Fahrrad teilten, das sorglose Geplätscher, wenn ein alter Mann in der Abenddämmerung am Brunnen Wassereimer füllte —, und weil Krishan um sich herum die Gewalt der letzten Kriegsjahre ebenso sah wie solche Visionen einer möglichen Zukunft, hatte er sich der Arbeit mit zielstrebiger Disziplin gewidmet.
Die Zeit im Nordosten hatte ihn geerdet, er war weniger verkopft geworden, enger mit dem Land und den Menschen verbunden, die er bis dahin hauptsächlich auf Bildschirmen gesehen hatte, während er allmählich die zyklischen Rhythmen des Landlebens annahm, in dem die Zeit nie ein Ziel zu haben schien, sondern immer kreiste, wiederkehrte, sich wiederholte und das Selbst zu sich zurückbrachte. Anfangs hatte er sich ausgemalt, an einem dramatischen Wandel teilzuhaben, an einem plötzlichen Emporstreben oder Aufblühen nach all dem Schmerz und Leid, doch als aus den Monaten ein Jahr wurde und aus einem Jahr zwei, verstand er langsam, dass diese Vorstellungen nicht wahr werden konnten, dass manche Formen der Gewalt so tief in die Psyche eindrangen, dass eine vollständige Genesung außer Frage war. Die Erholung würde Jahrzehnte dauern und auch dann unvollständig und zwiespältig bleiben, und wenn seine Hilfe etwas bedeuten sollte, dann musste er sie so gestalten, dass er sie langfristig durchhalten konnte, ohne dafür all seine eigenen Bedürfnisse zu ignorieren. Als seine anfängliche Getriebenheit und Zielstrebigkeit etwas nachließen, nahm er öfter die siebenstündige Reise auf sich und verbrachte zwei oder sogar drei Wochenenden im Monat zu Hause in Colombo. Die Stadt hatte sich in den Jahren seit Kriegsende stark verändert, die verbreiterten Straßen erstrahlten vor Ladenschildern und elektronischen Anzeigetafeln, die Skyline war gespickt mit schnittigen Hotels und Hochhäusern voller Luxusapartments, während sich in den neuen Cafés, Bars und Restaurants Leute tummelten, die er weder kannte noch einordnen konnte. Krishan nahm diese Veränderungen mit Verbitterung wahr, als stünde die plötzliche Modernität der Stadt in unmittelbarer Verbindung mit dem Martyrium des Nordostens, dennoch ließ er sich von den leichten Vergnügungen des Stadtlebens verlocken, und als es bei einer der großen ausländischen NGOs in Colombo eine Stelle gab — hochbürokratisch, gut bezahlt und hauptsächlich für Anträge und Berichte zuständig —, hatte er beschlossen zurückzukehren, nicht für lange Zeit, sagte er sich, nur bis er etwas Geld angespart und ein besseres Gefühl dafür bekommen hatte, was er als Nächstes vorhatte. Nach einem knappen Jahrzehnt in der Ferne hatte er sich wieder in das Leben zu Hause bei seiner Mutter und Großmutter eingewöhnt, alte Gewohnheiten und Routinen waren zurückgekehrt, allerdings vermischt mit den Freiheiten des Erwachsenenlebens, so hatte er sich in seiner Freizeit mit alten Freunden und neuen Bekanntschaften getroffen, die eine oder andere Liebschaft gepflegt oder angestrebt und zu Hause gelesen oder Filme geschaut. Diese kleinen, aber vielfältigen Freuden hatten ihn eine Weile abgelenkt, aber es gab einen Unterschied zwischen einem Vergnügen, das tröstet und einlullt, und einem solchen, das einen vollständiger und lebhafter in die Welt zieht, und wenn er dort am Fenster nun an seine Rückkehr nach Colombo zurückdachte, hatte er den Eindruck, ihm sei im Laufe des letzten Jahres etwas Zentrales verloren gegangen, nämlich das in seinen Zwanzigern noch so deutliche Gefühl, dass sein Leben Teil von etwas Größerem sein könnte, von einer Bewegung oder Vision, der er sich verschreiben könnte.
Krishan wandte sich vom Fenster ab und sah sich im Zimmer um, in dem er mit seinem jüngeren Bruder aufgewachsen war, das er aber die letzten paar Jahre weitgehend für sich hatte, seit dieser ins Ausland gezogen war. Das Zimmer lag immer noch im warmen Leuchten des frühen Abends, aber der Lichtstrahl, der durch die Scheibe hereinfiel, hatte sich über den Boden bewegt, was bedeutete, dass Krishan eine ganze Weile so dagestanden hatte. Ihm fiel wieder der Anruf von Ranis Tochter ein, und er merkte, dass er nur über sich selbst nachgedacht hatte, seit er wieder im Zimmer war, dass er sich der Tatsache Ranis Todes nicht angenähert hatte, als wollte er der Bedeutung des eben Erfahrenen ausweichen. Er trat an den Ankleidetisch, nahm sein Handy und wählte nach kurzem Zögern die Nummer seiner Mutter. Ihr Unterricht war noch nicht vorbei, aber er hoffte, dass sie trotzdem dranging, denn vielleicht würde er die Neuigkeiten selbst besser verstehen, wenn er sie erst einmal weitergegeben hatte. Es klingelte eine Weile, bevor die automatische Nachricht des Dienstanbieters kam und ihn informierte, dass die angerufene Nummer nicht verfügbar sei, also legte er auf und dachte an seine Großmutter, die wahrscheinlich in ihrem Zimmer saß und nichts zu tun hatte. Er hatte ihr noch nicht von dem Anruf erzählt, und vielleicht sollte er es jetzt tun. Die Neuigkeiten würden sie sicher traurig stimmen, andererseits war seine Großmutter niemand, der sich vom Tod eines anderen aus der Ruhe bringen ließ, und vielleicht wäre sie ja dankbar, zu erfahren, was mit Rani geschehen war, möglicherweise würde sie die Dringlichkeit und Aufregung erleben, die sogar ein schmerzhaftes Ereignis im Leben eines Menschen auslösen kann, der nicht viel zu tun hat. Erleichtert, dass er jemanden zum Reden hatte, nämlich die eine Person, die ohnehin immer mit ihm reden wollte, trat er an seine Tür, drehte den Schlüssel um und ging die vier kurzen Schritte über den Flur zwischen ihren Zimmern. Erst als er die Hand auf den Türknauf legte, bekam er Zweifel und dachte sich, dass es vielleicht doch nicht am klügsten war, es seiner Großmutter gleich zu sagen. Schließlich würde Ranis Tod Appamma, die mehr als anderthalb Jahre das Zimmer mit Rani geteilt hatte, am schwersten treffen, und möglicherweise war es sogar am besten, ihr die Neuigkeiten ganz vorzuenthalten, sodass sie ohne die Vorstellung weiterleben konnte, dass Rani am Abend zuvor allein in einem Brunnen gestorben war. Er blieb vor der Tür seiner Großmutter stehen, wollte eigentlich hineingehen und sich mit ihr unterhalten, wusste aber nicht, ob das eine gute Idee war, bis er schließlich den Drang verspürte, in ihr Zimmer zu spähen, so als könnte ihr Anblick ihm verraten, was zu tun war, also ließ er den Knauf los, kniete sich vor die Tür, schloss das linke Auge und schaute mit dem zusammengekniffenen rechten durchs Schlüsselloch.
2
Appammas Tür lag