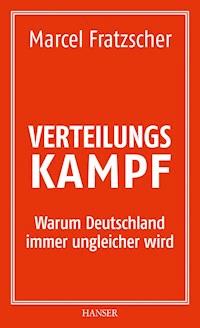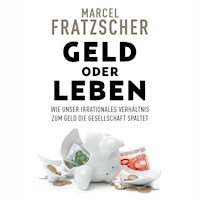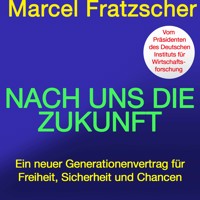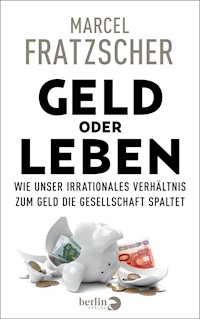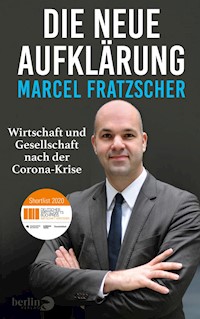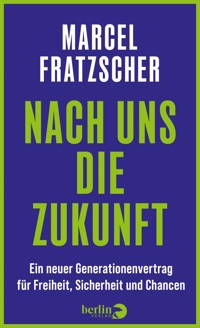
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Generationenvertrag unserer Gesellschaft ist gebrochen. Selten waren die Sorgen und Ängste junger Menschen so groß wie heute. 84 Prozent aller Menschen in Deutschland sind überzeugt, dass es künftigen Generationen schlechter gehen wird als ihren Eltern. Aber muss es wirklich so kommen? Anleitung für einen neuen Generationenvertrag Marcel Fratzscher plädiert für einen neuen Generationenvertrag mit konkreten Rechten und Pflichten - vor allem für die Generation der Babyboomer. Wir haben bereits heute das Wissen und die technologischen Voraussetzungen, um künftigen Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Die mentale Depression ist Deutschlands größtes Problem heute. Der Grund dafür liegt in unseren Köpfen und unserer Mentalität und weniger in der politischen und wirtschaftlichen Realität. Wirtschaft für alle Generationen Der Wirtschaftsexperte zeigt Wege auf, wie wir uns aus der Lähmung befreien können und einen lebenswerten Lebensraum, Wohlstand und Frieden auch für künftige Generationen sichern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2025
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Zitat
Einleitung
Die Sorgen und Ängste der jungen Generation
Der Verteilungskampf zulasten künftiger Generationen verschärft sich
Die drei Elemente eines neuen Generationenvertrags
Ein neuer Generationenvertrag ist möglich
Teil I:
Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben
1. Die Würde eines jeden Menschen
»Die Würde des Menschen ist unantastbar«
Respekt versus Geld
Der Wunsch nach sozialer Teilhabe
Chancen auf Bildung und Qualifizierung
Der blinde Fleck bei Gesundheit und Einsamkeit
2. Chancengleichheit
Gleichstellung von Mann und Frau vollenden
Fehlende Bildungschancen bei jungen Männern beheben
Die Diskriminierung nach sozialer Herkunft beenden
Ethnizität darf keine Ursache für Armut sein
Die Benachteiligungen bei der sexuellen Orientierung und Identität stoppen
Gleichstellung und Freiheit für alle
3. Gute und sinnstiftende Arbeit
Eine mangelnde Arbeitsmoral der jungen Generation?
Mehr Flexibilität durch eine Viertagewoche
Technologischer Wandel als Chance
Gute und weniger ungleiche Löhne und Einkommen sind möglich
Ein Anstieg des Mindestlohns als Gewinn für alle
Das Recht auf Arbeit und ein solidarisches Grundeinkommen
4. Finanzielle Autonomie und Sicherheit
Bessere Chancen und Schutz vor Krisen
Ein Grunderbe für junge Menschen einführen
Das bedingungslose Grundeinkommen besser verstehen
Armut von Kindern beenden
Teil II:
Das Recht auf einen lebenswerten Planeten
5. Schutz von Klima, Umwelt und Biodiversität
Unkontrollierbare Kosten für künftige Generationen
Wohlstand ist sehr viel mehr als nur Wirtschaftswachstum
Der Schutz von Klima und Umwelt sichert die Freiheit künftiger Generationen
Klimaschutz ist gute Wirtschaftspolitik
Die Energiewende ist gute Finanzpolitik und schafft Souveränität
6. Unserer Verantwortung gerecht werden
Ungleichheiten bei Emissionen und Klimaschutz reduzieren
Ein bedingungsloses Klima-Grundeinkommen für den Globalen Süden
7. Soziale Akzeptanz schaffen
Verzicht zugunsten künftiger Generationen
Subventionen für fossile Energie beenden
Ein soziales Klimageld
Ein Soli zum Schutz gegen Naturkatastrophen
Teil III:
Das Recht auf Solidarität und Frieden
8. Sozialer Frieden und Solidarität
Ode an die Solidarität
Populismus gegen den Sozialstaat beenden
Ein Umbau zu einem aktivierenden Sozialstaat
Das Bürgergeld weiterentwickeln
Solidarität mit Geflüchteten ist Solidarität mit uns selbst
Ein gerechtes und effizientes Steuersystem
9. Daseinsfürsorge und soziale Teilhabe
Die unzureichende Daseinsvorsorge schwächt die Demokratie
Eine Investitionsoffensive für die Kommunen
Wohnen als soziale Frage durch eine Mietensteuer adressieren
Ein soziales Pflichtjahr für die Babyboomer
Eine Wehrpflicht für die Babyboomer
10. Eine generationengerechte Schuldenbremse
Kluge Schulden heute sind der Wohlstand von morgen
Nachhaltige Schulden durch eine nominale Ausgabenregel
Staatlicher Vermögensaufbau als Pflicht
Begrenzung der Umverteilung von Jung zu Alt
Sicherung von Daseinsfürsorge und Chancengleichheit
11. Eine ausgewogene Finanzierung der Rente
Die Zunahme der Umverteilung von Jung zu Alt beenden
Die Umverteilung von Arm zu Reich umkehren
Die private Altersvorsorge stärken
Die Pflegeversicherung zukunftsfest machen
12. Funktionierende Demokratie und Freiheit
Die Tyrannei der Minderheit
Das Recht auf verlässliche Informationen und Schutz vor Manipulation
Demokratische Institutionen und Eigenverantwortung stärken
Kapitalismus reformieren und Freiheit sichern
Danksagung
Literatur
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Widmung
Für meine Eltern, denen die Zukunft ihrer Kinder stets die Welt bedeutete
Zitat
Das Problem unserer Zeit ist, dass die Zukunft nicht mehr das ist, was sie einmal war.
Paul Valéry, Regards sur le monde actuel (1931)
Einleitung
Der Generationenvertrag unserer Gesellschaft ist gebrochen – und damit jener Vertrag, der seit jeher auf dem Versprechen beruhte, dass es der Generation der Kinder einmal besser gehen soll als der der Eltern. Dass den Nachkommenden eine intakte Welt hinterlassen werden soll, eine, die ein hohes Maß an Sicherheit, guter Arbeit, gesellschaftlichem Zusammenhalt sowie an Absicherung gegen Krisen und existenzielle Bedrohungen bietet.
Doch seit den Zeiten der Aufklärung und der industriellen Revolution hat kaum eine Generation ihren Kindern und Enkelkindern so viele Chancen auf ein gutes und selbstbestimmtes Leben geraubt wie die Babyboomer heute. Sie tun es in einer Welt, die von existenzbedrohenden Konflikten, einem irreversiblen Schaden für Klima und Umwelt und zunehmenden sozialen Ungleichheiten geprägt ist.
Dabei hat die Generation der Babyboomer viel Positives in den letzten Jahrzehnten erreicht. Nach dem Ende des Kalten Krieges erhielten viele Menschen die Möglichkeit, in einer Demokratie und mit mehr politischen und gesellschaftlichen Freiheiten zu leben als jemals zuvor. Zahlreiche Volkswirtschaften, darunter auch Deutschland, konnten beträchtlichen materiellen Wohlstand aufbauen. In China und Indien gelang es, viele Hundert Millionen Menschen aus der Armut zu bringen. Die Kindersterblichkeit in Afrika ist deutlich gesunken, die Lebenserwartung im Globalen Süden ist gestiegen. Und die Weltgemeinschaft hat sich vor über zwanzig Jahren zur Einhaltung der siebzehn nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der Vereinten Nationen verpflichtet, um allen Menschen, auch den nach uns Kommenden, ein gutes Leben zu ermöglichen – und hat doch bisher fast alle dieser Ziele verfehlt.
Die Errungenschaften der Babyboomer-Generation sind zunehmend bedroht. Die Demokratie befindet sich auf dem Rückzug. Das Erreichen der Ziele in Bezug auf den Schutz von Klima und Umwelt, auf die Bekämpfung von Armut und die Entwicklung von Nachhaltigkeit rückt in immer weitere Ferne. Geopolitische und geoökonomische Konflikte nehmen zu. Der technologische Fortschritt hat zwar die Bildung unserer materiellen Lebensgrundlagen ermöglicht, gleichzeitig bedeutet er mittlerweile aber auch die größte existenzielle Bedrohung für die Menschheit. Es droht mehr und mehr ein Kontrollverlust über neue Technologien. Mit der Konsequenz, dass Klima und Umwelt als Existenzgrundlage zerstört werden; dass Kriege und gesellschaftliche Konflikte eskalieren und Digitalisierung und Künstliche Intelligenz nicht zum Wohle aller Menschen genutzt werden. Die Macht der Manipulation, ausgeübt durch einige wenige Superreiche, die mithilfe ihres Vermögens und der Kontrolle der (sozialen) Medien Demokratie und Marktwirtschaft unterminieren, nimmt zu.
Dagegen steht Hoffnung. Hoffnung auf eine kluge Nutzung unseres existierenden Wissens und unserer Technologien, um einen lebenswerten Planeten zu sichern, allen Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen und gesellschaftlichen wie geopolitischen Frieden zu gewährleisten. Hoffnung gibt auch die Tatsache, dass heute generationsübergreifend große Einigkeit über die Kernpunkte eines guten Lebens besteht. Den Babyboomern liegt das Schicksal der Kinder und Enkelkinder nicht weniger am Herzen als vorangegangenen Generationen.
Doch mit Hoffnung allein ist es nicht getan. Ein neuer Generationenvertrag erfordert die Rückbesinnung auf gemeinsame Werte, eine Änderung liebgewonnener Gewohnheiten und die Solidarität mit künftigen Generationen. Er verlangt Zukunftsinvestitionen und damit zwingend auch ein gewisses Maß an Bescheidenheit und Verzicht.
In den Industrieländern leben die Babyboomer weit über ihre Verhältnisse. Sie verbrauchen viel zu viele natürliche Ressourcen. Sie ignorieren die durch ihre Lebensweise verursachte Belastung von Klima und Umwelt und sorgen kaum für Kompensation, obwohl das durch vorhandene Technologien durchaus möglich wäre. Kurz: Sie handeln im Namen von Freiheit und Marktwirtschaft allzu oft nach dem Motto »Nach uns die Sintflut«. Damit hinterlassen sie ihren Nachkommen eine weniger lebenswerte, eine in ihrer Existenz bedrohte Welt, die gekennzeichnet ist von sozialen und politischen Konflikten und nicht zuletzt vom Verlust an Freiheit.
Die Sorgen und Ängste der jungen Generation
84 Prozent aller und ein noch größerer Anteil junger Menschen in Deutschland sind heute davon überzeugt, dass sich die Lebensbedingungen für künftige Generationen verschlechtern werden. Die Angst um die Zukunft betrifft vor allem den Planeten: die Zerstörung des Klimas, das Schaffen einer Welt, die von Naturkatastrophen und lebensfeindlichen Veränderungen heimgesucht wird. Veränderungen, die viele Menschen dazu zwingen werden, ihre Lebensweise massiv einzuschränken oder sogar ihre Heimat zu verlassen, weil ihnen dort die Lebensgrundlage entzogen ist.
Die zweite Sorge junger Menschen gilt der Freiheit auf ein selbstbestimmtes Leben. Gerade in Deutschland hängen heute die Bildungschancen vieler nicht von vorhandenen Talenten und Fähigkeiten ab, sondern von der Frage, in welche Familie jemand hineingeboren wurde. Selten in den letzten achtzig Jahren waren so viele Kinder und junge Menschen in Deutschland von Armut bedroht.
Dazu kommt, dass für die junge Generation die wirtschaftliche und finanzielle Belastung durch die Sozialsysteme – das betrifft vor allem Rente, Pflege und Gesundheit – gerade in demografisch schwachen Ländern wie Deutschland immer erdrückender wird. Kaum gelingt es noch, zu sparen oder sich gar ein Eigenheim zu leisten. Und obwohl die Babyboomer selbst viel zu wenige Kinder bekommen haben, bürden sie den nachfolgenden Generationen die Sorge um ihren Wohlstand im Alter auf – während sie gleichzeitig einen späteren Renteneintritt oder sonstige Beschränkungen vehement ablehnen.
Durch die steigenden Staatsschulden wird den Kindern und Enkelkindern eine riesige finanzielle Last auferlegt. Die expliziten Staatsschulden in Deutschland von etwas mehr als 60 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung sind dabei noch das vergleichsweise kleinere Problem. Die impliziten Verbindlichkeiten des Staats (in Form von Ansprüchen auf Rente, Pflege und Gesundheit) belaufen sich auf ein Vielfaches davon. Empfänger und Profiteure dieser Verpflichtung sind vor allem die Babyboomer. Über die kommenden dreißig Jahre werden sie vom Staat – aber eigentlich vor allem von der jungen Generation – Sozialleistungen fordern, die sie sich selbst einst genehmigt haben: eine gigantische Umverteilung von Jung zu Alt. Mit der Konsequenz, dass sich der Staat viele dringend benötigte Investitionen in Bildung, Sicherheit oder in den Schutz von Klima und Umwelt künftig nicht mehr wird leisten können.
Der Verteilungskampf zulasten künftiger Generationen verschärft sich
Sozialer und geopolitischer Friede wirken heute so fragil wie lange nicht. Die soziale Ungleichheit innerhalb vieler Gesellschaften, was die Chancen auf Bildung, gute Arbeit und Einkommen betrifft, auf Gesundheit, Glück und Lebenszufriedenheit, hat vor allem in den reichen Industrieländern zugenommen. Die Mitte der Gesellschaft schrumpft. Einige haben es geschafft, ihren materiellen Wohlstand zu vergrößern, sie genießen ein hohes Maß an Selbstbestimmung und individueller Freiheit. Aber viele andere rutschen aus der Mittelschicht nach unten ab und müssen ihren Lebensstandard einschränken. Sie finden deutlich schlechtere Bedingungen vor als noch ihre Eltern. Alles weist darauf hin, dass sich diese Ungleichheit in den kommenden Jahrzehnten noch deutlich verschärfen wird.
Auch im Bundestagswahlkampf 2025 lautete die zentrale Botschaft fast aller Wahlprogramme: Wir können uns die Zukunft gerade nicht leisten. Die Parteien versprachen eine Umverteilung von Jung zu Alt vor allem in Bezug auf Geld, Freiheit und Chancen. Die jungen und zukünftigen Generationen sind die Hauptleidtragenden einer Politik, die hauptsächlich auf die Bewahrung von Besitzständen und alten Strukturen ausgerichtet ist. Hoffnung auf einen Kurswechsel kam im März 2025 auf, als Union und SPD, die die neue Bundesregierung bilden, 500 Milliarden Euro für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur versprachen. Die Koalitionsverhandlungen bestätigten jedoch bereits die Befürchtungen, dass ein erheblicher Teil dieses Gelds wohl entweder überhaupt nicht oder – durch Verschiebungen im Bundeshaushalt – für konsumtive Ausgaben für die Babyboomer, insbesondere für die Rente, genutzt werden wird.
Selbst nach dem Beginn des Handelskonflikts durch Donald Trump, Anfang April 2025, konnten sich die Koalitionäre nicht zu einem Richtungswechsel durchringen. Die Wahrung von Besitzständen, insbesondere der Babyboomer, genießt weiterhin oberste Priorität. Es bleibt nur die Hoffnung, dass mit einer zunehmenden Vertiefung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krise allen Verantwortlichen die Unausweichlichkeit eines Kurswechsels bewusst wird, bevor der Schaden irreparabel geworden ist.
Noch immer fehlen den Parteien ein Konzept und eine Vision, wie Deutschland in zehn oder in dreißig Jahren aussehen soll. Es fehlt ein Angebot für die junge Generation. Die Zukunft hat aktuell keine Mehrheit. Wir dürfen uns also nicht wundern, wenn sich viele junge Menschen nicht nur bei Wahlen aus Protest zukünftig nicht mehr an der Demokratie beteiligen wollen oder gegen sie stimmen.
Eine Politik auf Kosten der jungen und zukünftigen Generationen bedeutet ein grundlegendes Versagen der Demokratie. 59 Prozent der Wählerinnen und Wähler bei den Bundestagswahlen am 23. Februar 2025 waren über fünfzig Jahre alt – aber nur 13 Prozent waren jünger als dreißig. Den Interessen von Menschen in ihren letzten dreißig Lebensjahren kommt in unserer Demokratie also ein viermal höheres Gewicht zu als denen von Menschen in ihren ersten dreißig Lebensjahren. Dieser Makel, dieses Versäumnis der Demokratie muss und kann behoben werden, indem die wesentlichen Anliegen der jungen und künftigen Generationen als Grundrechte gestärkt werden.
Die drei Elemente eines neuen Generationenvertrags
Das vorliegende Buch analysiert die Ursachen für die Dysfunktionalität des heutigen Generationenvertrags und leitet daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab, wie eine Erneuerung eines solchen Vertrags gestaltet werden sollte. Zentral sind dabei drei Elemente, die aus der Epoche der Aufklärung im 18. Jahrhundert hervorgegangen sind: Autonomie, Universalismus und Humanismus.
Autonomie zielt auf die Freiheit jedes Einzelnen ab, die eigenen Wünsche und Lebensvorstellungen zu realisieren. Universalismus benennt die Überzeugung, dass diese individuellen Rechte auf Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben jedem Menschen gleichermaßen zustehen müssen. Und Humanismus betont den Menschen als ein soziales Wesen, für das gesellschaftlicher Zusammenhalt und Solidarität essenzielle Voraussetzungen für ein gutes Leben sind. Ein neuer Generationenvertrag sollte sich auf diese drei Elemente rückbesinnen und sie als konkrete Rechte und Ansprüche künftiger Generationen formulieren.
Mit der Autonomie rückt das Recht auf ein selbstbestimmtes, in Freiheit verbrachtes Leben in den Mittelpunkt. Erforderlich dafür ist eine wirkliche Chancengleichheit in Bezug auf Bildung, Qualifizierung, Sicherheit und Vorsorge. Auch der Wunsch der Generation Z nach einer sinnstiftenden Arbeit, nach mehr Flexibilität und einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss größeres Gewicht erhalten.
Nie zuvor existierte eine so große Vielfalt von unterschiedlichen Lebenswünschen und Konzepten für ein erfülltes und gutes Dasein. Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben darf nicht einer immer kleiner werdenden privilegierten Gruppe vorbehalten bleiben, sondern muss als Grundrecht für alle in einem neuen Generationenvertrag verankert sein. Voraussetzung dafür sind massive Investitionen in ein besseres Bildungssystem, in eine Modernisierung der Sozialsysteme, in eine leistungsfähige Infrastruktur sowie in eine größere soziale und politische Teilhabe.
Das zweite Element eines neuen Generationenvertrags, der Universalismus, betrifft die permanente Sicherung eines lebenswerten und intakten Planeten für jeden Menschen heute und in der Zukunft. Nicht länger dürfen die Babyboomer ihr Leben zulasten künftiger Generationen führen und immer noch größeren Schaden verursachen.
Noch lautet das dominante Narrativ der reichen Industrieländer, dass wir es uns schlicht nicht leisten könnten, technologische Veränderungen und Beschränkungen zum Schutz von Klima und Umwelt schnell und zügig umzusetzen. Doch dieses Narrativ ist falsch. Alle technologischen Voraussetzungen existieren längst. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht können wir es uns nicht mehr erlauben, die notwendigen Veränderungen aufzuschieben. In den nächsten zwanzig Jahren, also während der verbleibenden Lebenszeit der Babyboomer, wird die Bewahrung des Wohlstands vor allem in Deutschland entscheidend davon abhängen, ob die Transformation schnell genug vonstattengeht. Ansonsten werden nachhaltige Technologien anderswo in der Welt entwickelt werden und viele gute Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen. Eine Deindustrialisierung würde dann unumkehrbar sein.
Das dritte Element eines neuen Generationenvertrags umfasst die Stärkung des geopolitischen Friedens und des gesellschaftlichen Zusammenhalts als Teil eines neuen Humanismus. Dies erfordert nicht nur eine Modernisierung der Sozialsysteme, sondern vor allem die Wahrnehmung von Verantwortung. Gemeint ist die Verantwortung des Globalen Nordens für den Globalen Süden. Noch immer betrachten wir in Europa die Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas primär als Produktionsorte günstiger Güter und Dienstleistungen für unseren Wohlstand. Alle großen Herausforderungen heute – vom Schutz des Klimas und der Umwelt über Digitalisierung, Lieferketten und Migration bis hin zu geopolitischen Konflikten – sind jedoch globaler Natur und können nur gemeinsam gelöst werden. Der Norden darf nicht länger über seine Verhältnisse leben, sondern muss seine Versprechen gegenüber den Ländern des Globalen Südens erfüllen und diese zu wirklichen Partnern machen. Globale Institutionen müssen gestärkt werden. Nur so lassen sich fairer marktwirtschaftlicher Wettbewerb und sozialer Ausgleich schaffen.
Ein neuer Generationenvertrag ist möglich
Die fehlende Generationengerechtigkeit ist das vielleicht größte Versagen der heutigen Gesellschaft. Die Menschheit läuft sehenden Auges in eine existenzielle Bedrohung, wenn sie den Schutz der Lebensgrundlage für künftige Generationen nicht in den Mittelpunkt ihres Handelns rückt.
Dieses Buch möchte einen Weg aus diesem Dilemma aufzeigen. Das Kernargument lautet: Eine grundlegende Änderung unseres Verhaltens ist möglich. Und sie sollte durch einen neuen Generationenvertrag, der konkrete Rechte und Pflichten festhält, verbindlich vereinbart werden. Wir verfügen über das Wissen und die technologischen Voraussetzungen, die nötig sind, damit Menschen auch in ferner Zukunft auf einem intakten Planeten ein selbstbestimmtes und gutes Leben führen können, gemeinsam, in friedlicher und solidarischer Koexistenz.
Die Versöhnung zwischen den Generationen, zwischen Jung und Alt, muss zu den wichtigsten Prioritäten in unserer Gesellschaft zählen. Eine solche Erneuerung des Generationenvertrags mag ambitioniert erscheinen. Die gute Nachricht ist jedoch, dass es zwischen den Generationen eine große Übereinstimmung der Werte gibt. Die Generation der heutigen Babyboomer wünscht sich für ihre Kinder und Enkelkinder genauso eine bessere Zukunft, wie dies ihre Eltern getan haben. Die Hoffnung ist, dass die Babyboomer ihre Fehler erkennen und sich für das unerlässliche Umsteuern in der Klima-, Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie in der Beziehung zum Globalen Süden einsetzen.
Noch mangelt es am Mut der Entscheider in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die notwendigen Veränderungen vorzunehmen. Und es fehlt an einer Vision, wie all diese Veränderungen gelingen können. Ein neuer Generationenvertrag könnte jedoch die Grundlage bilden für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Mit warmen Worten ist es dabei nicht getan. Es braucht konkrete Versprechen und verbindliche Vereinbarungen.
Teil I:
Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben
1. Die Würde eines jeden Menschen
Die Würde des Menschen ist unantastbar – so lautet der erste und vielleicht wichtigste Satz in unserem Grundgesetz. Aber trifft er noch zu? Viele, vor allem junge Menschen sind besorgt um ihre Zukunft, fürchten um ein menschenwürdiges Dasein. Das zeigen die großen, regelmäßig erstellten Jugendstudien.
Wie geht es den jungen Menschen heute? Und was wünschen sie sich von der Generation der Babyboomer als Grundlage für ihre Zukunft? Insbesondere die Shell Jugendstudie und die Sinus Jugendstudie zeigen eine tiefe Besorgnis junger Menschen heute in Bezug auf globale und persönliche Herausforderungen; aber sie zeigen auch einen bemerkenswerten Pragmatismus der Jugendlichen im Umgang mit Problemen sowie klare, an die Gesellschaft und an die Entscheider aus der Generation der Babyboomer adressierte Erwartungen.
Jugendliche nehmen die multiplen Krisen der Gegenwart sehr bewusst wahr. Der Krieg in der Ukraine dominiert dabei die Ängste; 81 Prozent der Befragten nennen einen sich auf Europa ausweitenden Krieg als größte Bedrohung. Dazu kommen wirtschaftliche Unsicherheiten: Zwei Drittel der Jugendlichen fürchten Inflation, Armut und den Verlust von Wohlstand.
Die Klimakrise bleibt ein zentrales Thema. 80 Prozent der Jugendlichen machen sich deshalb große Sorgen um ihre eigene Zukunft und um die ihrer Familie. Eine große Mehrheit empfindet die drohenden Folgen der Klimakatastrophen, für die der Mensch als Hauptverursacher verantwortlich gemacht wird, als besonders belastend. Diese globale Unsicherheit führt bei vielen zu einem Gefühl des Kontrollverlusts.
Neben globalen Themen belasten soziale Spannungen die Jugendlichen stark. 64 Prozent sorgen sich wegen einer wachsenden Feindseligkeit zwischen Menschen, wobei Diskriminierung und gesellschaftliche Spaltungen als große Herausforderungen gesehen werden. 40 Prozent der Jugendlichen fühlen sich persönlich benachteiligt, vor allem durch soziale Ungleichheit, Diskriminierung und mangelnde Chancengleichheit in der Bildung. Besonders Jugendliche aus sozial schwächeren Milieus oder mit Migrationshintergrund erleben diese Hürden. Jungen Menschen sind generell alle Formen sozialer Spaltung sehr bewusst.
Dennoch bewahrt sich die Mehrheit eine positive Grundhaltung. Dieser Optimismus ist jedoch nicht blind. Die Jugendlichen verbinden ihre Hoffnungen mit deutlichen Forderungen nach Veränderung. Sie erwarten von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, dass Krisen entschlossener angegangen werden – durch deutlich mehr Anstrengungen und Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Sicherstellung sozialer Gerechtigkeit und zur Verbesserung der Bildungsangebote. Die Wünsche betreffen sowohl strukturelle Veränderungen als auch persönliche Unterstützungsangebote.
Nachhaltigkeit ist dabei ein zentraler Wert. Die Shell Jugendstudie hebt hervor, dass 57 Prozent der Jugendlichen dazu bereit sind, ihren Lebensstandard zugunsten des Klimaschutzes einzuschränken. Der Klimawandel wird als eine Herausforderung betrachtet, die nicht aufgeschoben werden kann. Ambitioniertere Klimaziele sollen von Politik und Gesellschaft ausgerufen und mithilfe nachhaltiger Lösungen auch erreicht werden. Die Befragten wünschen sich mehr Innovationen in der Energiewirtschaft, eine bessere Unterstützung, was den Ausbau erneuerbarer Energien betrifft, sowie verbindliche Maßnahmen, um den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren.
Ferner wünschen sich die Jugendlichen eine sinnstiftende Arbeit, die ihnen nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch persönliche Erfüllung bietet. Bevorzugt werden flexiblere Arbeitsmodelle, die eine bessere Balance zwischen Beruf und Privatleben ermöglichen. Insgesamt wird Arbeit nicht nur als Last, sondern auch als Chance zur Selbstverwirklichung wahrgenommen. Junge Menschen erwarten daher von Unternehmen faire Arbeitsbedingungen, eine gute Bezahlung und Möglichkeiten zur Weiterbildung.
Die Befragten möchten zudem stärker in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Sie fordern mehr Gehör, wenn es um Themen wie Bildung, Klima und soziale Gerechtigkeit geht. Die Sinus-Studie hebt dabei die Bereitschaft der Jugendlichen hervor, sich in Schulen und kommunalen Projekten für mehr Mitbestimmung aktiv einzusetzen. Das Wahlrecht ab sechzehn Jahren wird von vielen als logische Konsequenz eines solchen politischen Verantwortungsbewusstseins betrachtet.
Die genannten, aber auch andere Studien zeigen, dass vor allem bei jungen Menschen die Unzufriedenheit mit dem demokratischen System, mit Marktwirtschaft und Kapitalismus wächst. Nicht selten resultiert daraus eine politische Radikalisierung, die sich in der Wahlentscheidung für antidemokratische Parteien niederschlägt.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Jugendstudien das Bild einer Generation zeichnen, die mit multiplen Krisen umzugehen gezwungen ist, sich aber dennoch größtenteils optimistisch zeigt. Sorgen und Ängste gehen einher mit der Bereitschaft, selbst Verantwortung zu übernehmen, sowie mit klaren Forderungen an Politik und Gesellschaft, die Rahmenbedingungen für eine nachhaltigere und gerechtere Welt zu schaffen.
»Die Würde des Menschen ist unantastbar«
Der Nobelpreisträger Angus Deaton schrieb vor Kurzem: »The deepest forms of inequality are these sort of personal inequalities where not everyone is given equal value as a human being« – die tiefsten Formen der Ungleichheit sind die Art der persönlichen Ungleichheiten, bei denen nicht jede und jeder den gleichen Wert als Mensch erhält. Dass die Würde des Menschen unantastbar ist, wie es der erste Satz unseres Grundgesetzes formuliert; dass jedem Menschen die gleiche Wertschätzung und der gleiche Respekt entgegenzubringen sind, muss auch heute noch die Grundlage für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft bilden.
Aber wie ist es um die Würde des Einzelnen heute bestellt? Umfragen, etwa die erwähnten Jugendstudien, zeigen, dass die meisten Menschen in Deutschland unsere Gesellschaft als ungerecht empfinden, obwohl es ihnen persönlich wirtschaftlich gut geht. Wie passt das zusammen?
Eine überwältigende Mehrheit kann die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen dann als gerecht betrachten, wenn diese Ungleichheit das Ergebnis freier Entscheidungen und eines fairen Wettbewerbs, also von Leistungsgerechtigkeit, ist. Genauso große Wichtigkeit wird jedoch der Bedarfsgerechtigkeit beigemessen, also der Fähigkeit jedes Einzelnen, individuelle Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung, Anerkennung oder Sicherheit befriedigen zu können. Der US-amerikanische Philosoph John Rawls nannte dies in seiner Theorie der Gerechtigkeit die »Notwendigkeit der Selbstachtung«.