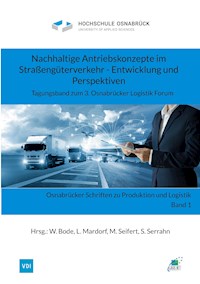
Nachhaltige Antriebskonzepte im Straßengüterverkehr - Entwicklung und Perspektiven E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Osnabrücker Schriften zu Produktion und Logistik
- Sprache: Deutsch
Nach über 100 Jahren Verbrennungsmotoren läutet die Politik nun hörbar das Ende dieser Antriebstechnologien ein und verschiedene Alternativen sind dabei, erprobt zu werden oder sich zu etablieren. Der Straßengüterverkehr stellt dabei besondere Herausforderungen an neue Antriebe: Große Reichweiten bei hohen Gesamtgewichten der Fahrzeuge sind dabei ebenso erforderlich wie kurze Lade- bzw. Tankzeiten. Unternehmen werden schon in den kommenden Jahren mit der Frage konfrontiert sein, wie ein klimaneutraler Fuhrpark bei möglichst gleichbleibender Performance umgesetzt werden kann. Das diesjährige Osnabrücker Logistik Forum widmet sich dieser Frage aus unterschiedlichen Perspektiven und wendet sich gleichermaßen an Unternehmer wie Forscher: Welche alternativen Antriebstechnologien stehen zur Verfügung, wie ist deren heutige und perspektivische Leistungsfähigkeit, wie weit ist die Nutzfahrzeugindustrie und welche Umsetzungsbeispiele gibt es bereits? Forscher, Hersteller und Anwender geben hier einen Überblick über das Wünschenswerte und Mögliche in eine klimaneutrale Zukunft des Straßen-güterverkehrs. Als Ausrichter geben Logis.Net, das Institut für Produktion und Logistik an der Hochschule Osnabrück, sowie die Arbeitskreise Energietechnik und Technische Logistik des VDI Osnabrück-Emsland e.V. den Kongressteilnehmern auch den Raum, Praxis-erfahrungen mit den Experten zu diskutieren und sich zu vernetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von
Marcus Seifert, Fakultät Management, Kultur und Technik, Hochschule Osnabrück, Osnabrück, Deutschland
Vorwort
Nach über 100 Jahren Verbrennungsmotoren läutet die Politik nun hörbar das Ende dieser Antriebstechnologien ein und verschiedene Alternativen sind dabei, erprobt zu werden oder sich zu etablieren. Der Straßengüterverkehr stellt dabei besondere Herausforderungen an neue Antriebe: Große Reichweiten bei hohen Gesamtgewichten der Fahrzeuge sind dabei ebenso erforderlich wie kurze Lade- bzw. Tankzeiten. Unternehmen werden schon in den kommenden Jahren mit der Frage konfrontiert sein, wie ein klimaneutraler Fuhrpark bei möglichst gleichbleibender Performance umgesetzt werden kann. Das diesjährige Osnabrücker Logistik Forum widmet sich dieser Frage aus unterschiedlichen Perspektiven und wendet sich gleichermaßen an Unternehmer wie Forscher: Welche alternativen Antriebstechnologien stehen zur Verfügung, wie ist deren heutige und perspektivische Leistungsfähigkeit, wie weit ist die Nutzfahrzeugindustrie und welche Umsetzungsbeispiele gibt es bereits? Forscher, Hersteller und Anwender geben hier einen Überblick über das Wünschenswerte und Mögliche in eine klimaneutrale Zukunft des Straßengüterverkehrs. Als Ausrichter geben Logis.Net, das Institut für Produktion und Logistik an der Hochschule Osnabrück, sowie die Arbeitskreise Energietechnik und Technische Logistik des VDI Osnabrück-Emsland e.V. den Kongressteilnehmern auch den Raum, Praxis-erfahrungen mit den Experten zu diskutieren und sich zu vernetzen.
Prof. Dr.-Ing. Marcus Seifert
Tagungsleitung
Hochschule Osnabrück/Logis.Net
Inhaltsverzeichnis
Nachhaltige Mobilitätskonzepte – Stand der Wissenschaft und Trends
Politische Perspektiven nachhaltiger Mobilität im Straßengüterverkehr
Olaf Lies
CO
2
-Reduktion durch alternative Antriebe in der Logistik
Prof. Dr.-Ing. Lutz Mardorf
Einige Aspekte zur Vereinbarkeit von Personen- und Güterverkehr in zukünftigen Mobilitätssystemen
Prof. Dr.-Ing. Thomas Vietor, Petia Krasteva, Christian Raulf
Chancen und Risiken einer klimaneutralen Zukunft des Speditionsmarktes
Elektromobilität – Praxiserfahrungen, Bewertungen und Ergebnisse
Rolf Meyer
Technische Perspektive im Straßengüterverkehr für den energieeffizienten Gesamtzug der Zukunft
Michael Nimtsch, Uwe Sasse
LNG-Infrastruktur für Gasantriebe in der Logistik
Carsten Hemme
Erfahrungen und Strategien von Kunden und Fahrzeugbauern
LKW mit Flüssiggasantrieb im 24h Einsatz – Erfahrungsbericht eines Flottenbetreibers
Uwe Hasselberg
Alternative Antriebe mit Straßengüterverkehr – Strategien eines Fahrzeugbauers
Moritz Grüters
Elektrifizierte City Logistik – Stand der Technik und Perspektiven
Dr. Arne Kruse
Ergänzende Beiträge
Grußwort der IHK
Frank Hesse
Chancen alternativer Antriebsformen im Fuhrpark deutscher Unternehmen als Dienstfahrzeug
Patrick Börger
LNG für LKW – Ein Beitrag zum Klimaschutz?
Prof. Dr. Sandra Rosenberger, Franziska Zschausch, Niels Ruwe
Nachhaltige Mobilitätskonzepte – Stand der Wissenschaft und Trends
____________________________________
Politische Perspektiven nachhaltiger Mobilität im Straßengüterverkehr
Olaf Lies
Niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
Abstract
Um die Klimaschutzziele auch im Verkehrssektor zu erreichen, muss eine breite Palette von Maßnahmen umgesetzt werden. Die Forschung und die handelnden Akteure sind sich einig, dass eine einzelne Maßnahme nicht zum Erfolg führen kann. Ziel muss sein, Verkehre zu reduzieren und zu optimieren, wo und soweit möglich auf klimafreundliche Verkehrsmittel zu verlagern und mehr und mehr auf nachhaltige Antriebe und Kraftstoffe bzw. Energien zu setzen.
Politische Perspektive nachhaltiger Mobilität im Straßengüterverkehr
Aus Sicht des Klima- und Umweltschutzes ist die Emissionsbilanz des Verkehrssektors unzureichend. Von kleinen Ausschlägen abgesehen verharren die Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors seit 1990 auf hohem Niveau. Das erfordert, dass die Gesetzgeber auf den unterschiedlichen Ebenen handeln. Einerseits um den Treibhausgasausstoß der Fahrzeuge zu senken, Verkehre auf Verkehrsträger zu verlagern, die geringeren Treibhausgasausstoß haben sowie effektivere Logistik zu realisieren und andererseits die Produktion der Fahrzeuge treibhausgasärmer und letztlich klimaneutral zu gestalten. Und für all das bleibt wenig Zeit. 2045 will Deutschland Klimaneutral sein. Das gilt dann auch für den Verkehrssektor.
Mit den europäischen Verordnungen zur Festsetzung von CO2- Emissionsnormen für Pkw sowie für leichte und schwere Nutzfahrzeuge wird ein Regulierungsrahmen gesetzt, der auch für die Unternehmen mindestens mittelfristig Orientierung für ihre Entscheidungen zur Erfüllung der Umweltstandards bietet.
Handlungsrahmen für die öffentliche Verwaltung ist jetzt das Gesetz über die Einhaltung von Mindestzielen bei der Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (SaubFahrzeug-BeschG). Das Gesetz gilt für Beschaffungen öffentlicher Auftraggeber und Sektorenauftraggeber ab dem 2. August 2021. Es gibt für zwei Referenzzeiträume (2.8.2021 bis 31.12.2025; 1.1.2026 bis 31.12.2030) feste Quoten für die Beschaffung sauberer Pkw sowie leichter und schwerer Nutzfahrzeuge durch die öffentliche Auftragsvergabe. Das Gesetz erfasst Verträge über Kauf, Leasing oder Anmietung von Straßenfahrzeugen sowie die Beschaffung von Verkehrsdienstleistungen, v.a. der öffentliche Verkehr (Straße), die Personensonderbeförderung (Straße), die Bedarfspersonenbeförderung sowie bestimmte Post - und Paketdienste und die Abholung von Siedlungsabfällen. Die Vorgaben gelten für PKW sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge, enthalten aber Ausnahmen für verschiedene Fahrzeugkategorien (z.B. Militärfahrzeuge und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge). Das Gesetz setzt Vorgaben der 2019 in Kraft getretenen EU Clean Vehicles Directive in nationales Recht um. Ziel ist es, CO2-Emissionen im Verkehrsbereich zu reduzieren und einen Nachfrageimpuls für emissionsarme und –freie Fahrzeuge zu setzen.
Die Umsetzung einer Mobilitätswende für effektiven Klimaschutz muss zugleich auch Strategien der Verkehrsverlagerung und die Förderung der aktiven Mobilität einbeziehen. Bei der langfristigen Umstellung der deutschen Energieversorgung auf erneuerbare Energieträger stellt der Verkehrssektor eine besondere Herausforderung dar.
Um die Klimaschutzziele auch im Verkehrssektor zu erreichen, muss ein Bündel von Maßnahmen umgesetzt werden. Die Forschung und die handelnden Akteure sind sich einig, dass nicht eine einzelne Maßnahme zum Erfolg führen wird. Ziel muss sein, Verkehre zu vermeiden, wo möglich auf klimafreundliche Verkehrsmittel zu verlagern und auf klimafreundliche und letztlich klimaneutrale Antriebe und Kraftstoffe zu setzen.
Die Transformation des Mobilitätssektors erfordert vor allem die Abkehr von fossilem Kohlenstoff als Ausgangselement für flüssige und gasförmige Kraftstoffe, sprich eine Abkehr von Benzin, Diesel und am Ende auch von Erdgas. Neben den stark propagierten zukünftigen Energieträgern Strom und Wasserstoff ist der Übergang allerdings sukzessive und – aufgrund der dafür notwendigen Infrastruktur – ein längerfristiger Prozess. Während im Pkw-Bereich sich die Elektromobilität als Lösung abzeichnet, ist aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsprofile im Lkw-Bereich, insbesondere im Schwerlastverkehr, eine Vielzahl von Ansätzen gefragt.
Viel diskutiert werden synthetische Kraftstoffe zum einen für die direkte Verwendung in Verbrennungsmotoren oder für eine Übergangszeit als Beimischung zu herkömmlichem Kraftstoff und Biokraftstoffe. Sie sie könnten auch eine Lösung für Oldtimer und selbstfahrende Baumaschinen sein.
Synthetische Kraftstoffe werden voraussichtlich mit Ausnahme des Luftfahrtsektors aufgrund der hohen Herstellungskosten und des Energieaufwandes mittelfristig eher Sonderanwendungen vorbehalten bleiben, stehen ansonsten aber gleichwertig neben Elektromobilität und anderen alternativen Antrieben. Rein synthetisierte Kraftstoffe verbrennen nahezu rußfrei und erlauben es Motoren so zu verbessern, dass sie in der Gesamtbilanz sehr viel weniger CO2 und fast keinen Feinstaub oder Stickstoffoxid emittieren. Sie bleiben somit auch ein Baustein für eine treibhausgasneutrale Mobilität jenseits des Pkw-Bereichs.
Synthetische Kraftstoffe können insbesondere in Bereichen eingesetzt werden, in denen Batterien aufgrund ihrer Größe und im Vergleich geringeren Energiedichte wahrscheinlich auch in Zukunft (zumindest für längere Strecken) nicht die herkömmlichen Antriebe vollständig ersetzen können. Sie stehen in diesem Einsatzbereich in Konkurrenz zu Wasserstoff und SNG (synthetischem, klimaneutralen Erdgas). Sie liefern auch die benötigte hohe Energiedichte für Schwerlastverkehre anders als es derzeitige reine batterieelektrische Antriebe tun. Auch können synthetische Kraftstoffe zur Defossilisierung von Altfahrzeugen, Baumaschinen und Oldtimern beitragen.
Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge haben Vorteile im Schienenverkehr und im Transportsektor über große Entfernungen. Bedeutender Vorteil für synthetische Kraftstoffe ist, dass vorhandene Strukturen zum Vertrieb der Kraftstoffe (Infrastruktur, Tankstellennetze etc.) weiterhin genutzt werden könnten und nicht neu aufgebaut werden müssen. Am Ende, so sieht es derzeit aus, wird es ein Nebeneinander verschiedener klimagerechter und nachhaltiger Antriebsarten und Treibstoffe im Schwerlastverkehr geben.
Um einen größeren Anteil Erneuerbarer Energien im Verkehrssektor zu erreichen, sehen die meisten Szenarien der zukünftigen Energieversorgung auch in Biogas eine Chance zur Erzeugung von Treibstoff. Dies kann eine sinnvolle Ergänzung zur Elektromobilität wie auch zur Wasserstoffmobilität im Schwerlastverkehr sein. Biogas kann sowohl in verdichteter Form als Bio-CNG als auch in verflüssigter Form als Bio-LNG genutzt werden.
Beim Einsatz im Schwerlastverkehr und im ÖPNV konnten durch LNG Erfolge bei der Luftreinhaltung erzielt werden, da beim Einsatz von LNG in Verbrennungsmotoren im Vergleich zu konventionellen Kraftstoffen der Schadstoffausstoß, konkret der Ausstoß von Stickoxiden und Feinstaub reduziert wird. In Oldenburg – einer von der NO2-Problematik besonders betroffenen Stadt - sank beispielsweise durch den Einsatz von vom Land geförderten Bio-LNG-Bussen die Stickstoffdioxidbelastung unter die zulässigen Grenzwerte.
Der Vorteil beim Einsatz von Bio-LNG kommt gerade dann zum Tragen, wenn für die Herstellung Abfälle, Reststoffe aus der Landwirtschaft (Gülle, Mist etc.) oder – in begrenztem Maßstab - nachwachsende Rohstoff eingesetzt werden. Im Vergleich zu konventionellen Kraftstoffen können mit Biomethan aus Gülle und Mist bis zu 90 Prozent CO2-Einsparung erreicht werden. Hinsichtlich der Klimawirkung kommt es auf die LNG-Gewinnung und den Methanschlupf an, da Methan klimaschädlicher ist als Kohlendioxid.





























