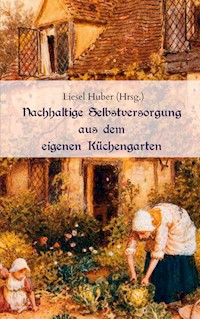
Nachhaltige Selbstversorgung aus dem eigenen Küchengarten E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Selbstversorgung aus dem eigenen Küchengarten ist auch heute noch möglich, selbst bei kleinerer Grundstücksgröße. Doch wie genau geht das eigentlich - das nachhaltige Gärtnern wie zu Urgroßvaters Zeiten? In diesem Gartenratgeber - nach einer über 200 Jahre alten Vorlage - wird detailliert beschrieben, wie man einen klassischen Küchengarten für den eigenen Gebrauch anlegt, welche einheimischen Gewächse wann, wo und wie anzupflanzen und zu pflegen sind, wann die Ernte erfolgt und wie man die Pflanzen selbst vermehrt und überwintert, um sie im nächsten Frühjahr erneut zu säen oder zu verpflanzen. Ein praktischer, kurz zusammengefaßter Gartenkalender für jeden Monat des Jahres rundet das Werk ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Auf der Suche nach einem guten, möglichst alten Gartenbuch für die Anlage eines traditionellen Nutzgartens in unserem kleinen Grundstück, stieß ich auf ein anonym herausgegebenes Buch aus dem Jahre 1793 mit dem ausladenden Titel:
„Der ökonomische Küchengarten nebst Bemerkungen und Erfahrungen von den Wirkungen der Küchengewächse auf die Gesundheit der Menschen, von dem männlichen und weiblichen Geschlecht der Pflanzen und von dem vermeintlichen Einfluß der Gestirne, wie auch dem wahrscheinlichen des Mondes auf die Gewächse; nebst einem Küchengartenkalender.“
Das klang in meinen Ohren wahnsinnig interessant, so daß ich mir eine Kopie davon beschaffte, um mich in das Werk einzulesen. Dies gestaltete sich jedoch nicht so einfach, da der damalige Druck natürlich in Fraktur erfolgt war. Zudem störte die ausladende Schreibweise das Lesevergnügen erheblich – manche der langen, verschachtelten Sätze mußte ich mehrfach lesen, um den Inhalt erfassen zu können. Daher begann ich, mir über dem Entziffern das Wesentliche zu notieren, zunächst nur für den Eigengebrauch. Allerdings stellte ich rasch fest, daß der Inhalt des Buches fast durchweg brauchbar war und so viel Interessantes, Wichtiges und heute noch Anwendbares zu bieten hatte, daß Notizen letztlich nicht ausreichen würden.
Der Titel verspricht nämlich nicht zuviel: In diesem Buch wird detailliert beschrieben, wie man einen klassischen Küchengarten für den eigenen Gebrauch anlegt, welche einheimischen Gewächse wann, wo und wie anzupflanzen und zu pflegen sind, wann die Ernte erfolgt und wie man die Pflanzen selbst vermehrt und überwintert, um sie im nächsten Frühjahr erneut zu säen oder zu verpflanzen. Ein praktischer, kurz zusammengefaßter Gartenkalender für jeden Monat des Jahres rundet das Werk ab.
Der Wissensstand des Buches ist der des 18. Jahrhundert, der vorindustriellen Zeit also, als man noch ohne Maschinen, ohne Baumärkte, die Dünger und Gartenzubehör anbieten, arbeiten mußte, als tatsächlich jedermann, sofern er etwas Land besaß, zumindest teilweise zum Selbstversorger wurde, natürlich mit (überwiegend einheimischen) „Bio“-Produkten. Es werden jedoch auch einige „ausländische“ Gewächse und deren Anbau beschrieben.
Die importierten Gewächse Kartoffel und Mais beispielsweise kannte der Autor bereits gut, dennoch waren sie seinerzeit noch relativ frisch eingebürgert. Die medizinischen Anwendungsbeispiele sind ebenfalls zeitgenössisch und heutzutage, dank unserer fortschrittlicheren Medizin, zum Glück größtenteils nicht mehr notwendig; so werden u. a. Geschwulste zerteilt und Mittel gegen Blutspeien und die Pest empfohlen. Andere Anwendungen wären zwar heute noch denkbar, allerdings fehlen oft passende Rezepte. Das vorliegende Buch ist eben ein Garten- und kein Gesundheitsratgeber. Auch die angerissene Lehre vom Einfluß des Mondes bezieht sich eher auf den Gartenbau als auf die Gesundheit des Menschen.
Wie dem auch sei – daraufhin änderte ich mein Vorgehen. Ich entschied, das gesamte Buch zu überarbeiten und meinen modernen Bedürfnissen (inklusive einer etwas leichter verständlichen Sprache) anzupassen, damit es mich in Zukunft durch das Gartenjahr begleiten und anleiten könnte. Da ich noch ein blutiger Anfänger in Gartendingen war, lernte ich bereits beim Durcharbeiten und Recherchieren alter Bezeichnungen so einiges. Das vorliegende Buch – mein „Praxisexemplar“ – ist das Ergebnis dieser Arbeit. Ich hoffe, daß der geneigte Leser, worunter vielleicht der eine oder andere künftige Selbstversorger sein wird, ebenso viel Freude und Nutzen daraus ziehen kann wie ich.
Liesel Huber, 2021.
Inhalt.
Erster Teil. Von der Bestellung des Gartenlandes, von den nützlichsten Küchengewächsen, ausländischen und Arzneipflanzen.
Erstes Kapitel.
Von der Bestellung des Gartenlandes.
Lage §. 1.
Einteilung §. 2.
Erde und Düngen §. 3.
Umgraben § 4.
Säen und Begießen § 5.
Mistbeete §. 6.
Begießen §. 7.
Jäten §. 8.
Versetzen §. 9.
Wachstum §. 10.
Mittel wider das Ungeziefer §. 11.
Beförderung des Wachstums §. 12.
Ernte §. 13.
Zweites Kapitel.
Verzeichnis der nützlichsten Küchengewächse nach alphabetischer Ordnung.
Anis.
Artischocken.
Basilikum.
Beifuß.
Blumenkohl.
Bohnen.
Borretsch.
Dill.
Endivien.
Erbsen.
Erdäpfel.
Erdbeeren.
Erdbirnen oder Kartoffeln.
Fenchel.
Gurken.
Hopfen.
Kapern.
Kerbelkraut.
Knoblauch.
Kohl.
Kohlrüben.
Krauseminze.
Kraut (Weißkohl).
Kresse.
Kümmel.
Kürbis.
Löffelkraut.
Majoran.
Meerrettich.
Melisse.
Melonen.
Mohn.
Möhren.
Pastinak.
Petersilie.
Pfefferkraut.
Portulak.
Radieschen.
Rapunzel (Feldsalat).
Raute.
Reis.
Rettiche.
Rüben.
Rote Rüben (Beete).
Weiße Rüben.
Steckrüben.
Safran.
Salbei.
Salat.
Sauerampfer.
Schalotten.
Sellerie.
Senf.
Spalz (Dinkel).
Spargel.
Spinat.
Unterkohlrüben.
Welschkraut (Wirsing).
Wermut.
Zichorie (Gemeine Wegwarte).
Zuckerwurzeln.
Zwiebeln.
Von den Wurzelgewächsen §. 15.
– über sich wachsenden §. 16.
– Hülsenfrüchten, Salat und Zwiebeln §. 17.
– Suppen-, Tee- und wohlriechende Kräuter §. 18.
Drittes Kapitel.
Von der Einrichtung und nützlichen Anwendung des Gartenlandes.
Die richtige Zeit, um zu säen und zu pflanzen §. 20.
– nützliche Anwendung des Landes §. 21.
– zwei- drei- und viermalige Nutzung desselben §. 22.
– einfache und billige Behandlung desselben §. 23.
Viertes Kapitel.
Von ausländischen Pflanzen und Küchengewächsen.
Griechischer Gewürzkümmel §. 25.
Süßer italienischer Fenchel §. 26.
Mexikanischer Tee §. 27.
Spanische Scorzoner (Schwarzwurzel) §. 28.
Süßholz §. 29.
Chinesische Rhabarber §. 30.
Weißer Mohn §. 31.
Deutscher Öldotter (Leindotter) §. 32.
Türkischer Weizen (Mais) §. 33.
Erdbirnen oder Kartoffeln §. 34.
Fünftes Kapitel.
Von Arzneigewächsen, Samen, Wurzeln und Kräutern.
Alantwurzel.
Angelika.
Benediktenwurzel (Nelkenwurz).
Borretsch.
Kardobenedikten (Benediktenkraut).
Calmus (Kalmus).
Ehrenpreis.
Eibisch.
Enzian.
Estragon.
Geißraute.
Goldwurz (Gelber Affodil).
Hirschzunge.
Koriander.
Lavendel.
Liebstöckel.
Lungenkraut.
Mariendistel.
Meerfenchel.
Meisterwurz.
Natterwurzel.
Ochsenzunge.
Polei.
Rainfarn.
Rainfarn, breitblättriger.
Römische Kamillen.
Thymian.
Weißwurzel (Weißwurz, Haferwurz).
Weißer Andorn.
Weißer Senf.
Ysop.
Sechstes Kapitel.
Von den vorzüglichsten Kräutern und Wurzeln zu Speisen und Getränken.
I.
Arten von Salatkräutern, 13 Arten §. 36.
II.
Einfache Salate, 12. – §. 37.
III.
Zum Butterbrot, 5. – §. 38.
IV.
Suppenkräuter, 13, §. 39.
V.
Gewächse, welche als Zugemüse zubereitet werden, 15 Arten, §. 40.
VI.
Inländische Gewürzkräuter, 10. – §. 41.
VII.
Süßeingemachte, 7 Arten, §. 42.
VIII.
Wurstkräuter, 4 Arten, §. 43.
IX.
Teekräuter, 4. §. 44.
X.
Fußbadkräuter, 8. §. 45.
XI.
Gurgelwasserkräuter, 6. §. 46.
XII.
Wie man Butter gelb färbt §. 47.
XIII.
Wie man wohlriechenden Schnupftabak macht, 8. §. 48.
XIV.
Kräuter, die zur Zerteilung der Geschwulste dienen, 6. §. 49.
XV.
Zur Erfrischung des Geblüts, 5. §. 50.
Siebentes Kapitel.
Vom Sammeln, Aufnehmen und Aufbewahren der Küchengewächse.
Achtes Kapitel.
Vom Samen und dem Aufbehalten desselben.
Zweiter Teil.
Bemerkungen und Erfahrungen.
Erstes Kapitel.
Von den Wirkungen der Küchengewächse auf die Gesundheit des Menschen.
Von den Speisen als ein Stück der Diät §. 53.
Allgemeine Bemerkungen §. 54.
Besondere Bemerkungen über einige Gewächse §. 55.
1.
Alantwurzel.
2.
Andorn.
3.
Angelika.
4.
Baldrian.
5.
Basilikum.
6.
Benedictwurzel (Nelkenwurz).
7.
Dill.
8.
Ehrenpreis.
9.
Erdbeeren.
10.
Hirschzunge.
11.
Koriander.
12.
Liebstöckel.
13.
Römische Kamille.
14.
Süßholz.
15.
Thymian.
Zweites Kapitel.
Von dem vermeintlichen Einfluß der Gestirne und dem wahrscheinlichen des Mondes auf die Gewächse.
Erstes Kapitel. Von der Bestellung des Gartenlandes, von den nützlichsten Küchengewächsen, ausländischen und Arzneipflanzen.
Erstes Kapitel.
Von der Bestellung des Gartenlandes.
§. 1.
Lage.
Im Küchengarten, der nicht von Gebäuden beschirmt wird, sollten einige große Bäume, wie Lindenbäume, Kastanien, Nußbäume etc. sowie kleinere Gewächse wie Haselnuß oder Holunder stehen, die Schatten vor der Morgen- und der halben Nachmittagssonne sowie Schutz vor kaltem Wind bieten. Die Bäume müssen so stehen, daß sie keinen permanenten Schatten auf die Gartengewächse werfen; außerdem muß der Platz eben sein, damit Sonne und Regen auf alles gleichmäßig einwirken können.
§. 2.
Einteilung.
Die Einteilung des Gartens muß nach Beschaffenheit der Größe eingerichtet, und ein jeder Platz, wohin gesät, gepflanzt und versetzt werden soll, bestimmt werden.
§. 3.
Erde und Dünger.
Die Erde des Gartens darf nicht zu fett, aber auch nicht zu mager sein. Ist sie nicht so beschaffen, wie sie zu den verschiedenen Gewächsen erfordert wird, so muß sie verbessert werden:
Die magere Erde wird durch Rinder-, Schaf- und Ziegenmist angereichert; die fette durch Menschen-, Pferde-, Hühner- und Taubenmist; die trockene durch Schweinemist verbessert. Besonders dienlich zur Verbesserung der Erde sind Hornspäne, Rohleder und mäßige Mengen in Wasser aufgelöster Salpeter.
Den Erdboden kann man auch leicht und mürbe machen, indem man Kohl und Kartoffeln darauf pflanzt; sollte sich viel Unkraut zeigen, so kann dieses am bequemsten zurückdrängt werden, indem man Erbsen oder Bohnen darauf pflanzt.
§. 4.
Umgraben.
Das Umgraben geschieht am besten im Herbst, weil zu dieser Zeit die Erdschollen nicht zerschlagen werden dürfen. Diese zerfallen über den Winter ohnehin, weil das Unkraut erfriert, die Fettigkeit in die Erde dringt und diese locker wird. Daher gräbt man erst im Frühling um, jedoch nicht eher, als bis der Schnee völlig vergangen und die Erde nicht allzu feucht ist; aber auch nicht zu spät, wenn die Hitze der Sonne allzusehr trocknet; auch nicht bei einem Regen. Das Umgraben selbst muß tief, besonders bei Wurzelgewächsen, jedoch bei neugebautem Erdreich das erste Jahr nicht allzu tief geschehen, auch muß der Mist nicht allzu tief, aber bald, ehe er von der Luft und dem Regen seine Feuchtigkeit verliert, untergegraben werden. Beim Umgraben dann werden die Erdschollen zerschlagen, das Unkraut mit den Wurzeln gründlich ausgelesen und das Ungeziefer, vor allem die großen Würmer, getötet.
§. 5.
Säen.
Nach dem Umgraben wird gesät. Hierzu wird guter Samen erfordert. Man gewinnt denselben, wenn man von jeder Gattung die größten, stärksten und schönsten Gewächse wählt. Diejenigen, welche im Keller aufbewahrt werden müssen, werden zu rechter Zeit in denselben, und im Frühling wieder heraus in die Erde an einen Ort, wo viel Sonne ist, gesetzt, aber so, daß sie einander nicht hindern. Der Same muß völlig reif sein, denn sonst sind schlechte Früchte darunter, wenn er das erste Jahr gesät wird, z. B. kommen von dem unreifen Samen die weißen Möhren, die weißen und rötlichen roten Rüben. Wenn er im folgenden Jahr gesät wird, geht zwar der unreife Same nicht auf; aber wenn viel dergleichen darunter ist, stehen die Früchte auch spärlich, woran man zuweilen dem Frost und der Witterung Schuld gibt, obwohl doch der viele unreife Same die Ursache davon ist. Der Same wird auch vollkommen, wenn man den Gewächsen nicht zu viel Stengel und überhaupt nicht zu viel Samen läßt, besonders dem Salat und den Rettichen. Er wird bei schönem Wetter gegen den Vollmond gesammelt und am besten in seinen Schalen, hauptsächlich Erbsen, Bohnen, Rettiche, aufbewahrt. Der beste Same ist meistenteils der vom Vorjahr, doch bleibt auch einiger lange Zeit gut, z. E. von Melonen, Spargel drei bis vier Jahre; Fenchel sechs Jahre.
Ein jeder Same muß voll, reif, schwer und gut gefärbt sein. Manche Leute pflegen etliche Arten in Milch, Honig- und Zuckerwasser, oder gar in Mist- oder Brunnenwasser zuweilen 24 Stunden einzuweichen, z. B. Melonen, Gurken in die erstere Art, Erbsen, Bohnen, Zwiebeln in die andere Art von Wasser; und die gelben Rüben werden von einigen mit Salz eingerieben. Eine jede Art von Samen wird besonders gesät, es wäre denn, daß man eine Art zeitig wegnehmen wollte. Die Zeit des Säens kommt auf die Witterung und auf die Beschaffenheit des Gewächses an. Erbsen können schon im November oder Dezember, Zwiebel, Salat, Samen des Kopfkohls im Februar oder März, und also die übrigen, welche Kälte vertragen können, zeitig; andere hingegen, als Bohnen, Gurken, Kürbisse, welchen der Frost schadet, werden spät gesät: überhaupt aber ist die beste Zeit, wenn der Boden völlig aufgetaut, die überflüssige Feuchtigkeit ausgetrocknet und der Trieb der Natur in der Erde ist.
Man hat auch die Hauptregel gemacht, daß der Same derjenigen Gewächse, welche viel Kraut bringen und über sich wachsen, im ersten Viertel des Mondes; diejenigen aber, welche unter sich wachsen, im abnehmenden Monde gesät werden soll. Bei trockenem Wetter muß die Erde nach dem Säen mit Regen- oder anderem Wasser, das von der Sonne erwärmt ist, besprengt und damit einige Zeit fortgefahren werden, da mancher Same lange liegt, ehe er aufgeht. Denn Petersilie geht erst ungefähr am 40. oder 50. Tag, Kohl hingegen am zehnten, Gurken am vierten, Rüben am dritten Tag auf. Das Begießen geschieht bei kühlen Nächten, im Frühling und Herbst, früh, im Sommer aber am besten abends; oder morgens und abends; niemals aber mittags bei heißem Sonnenschein. Der Same kann auch zum Teil reihenweise gesät werden, welches den Vorteil hat, daß das Unkraut mit ausgehackt und die Erde aufgelockert werden kann, damit die Sonnenwärme besser eindringen kann.
§. 6.
Mistbeete.
Wer einige Gewächse und Pflanzen zeitiger haben will, muß ein Früh- oder Mistbeet anlegen. Dies geschieht am bequemsten an einem warmen Ort des Gartens, wo die Morgensonne hinscheint, an einer Mauer oder einem Zaun. Dazu erwählt man sich einen Platz von einer gewissen Länge und Breite, läßt die Erde, ungefähr eine Elle tief, im Herbst ausgraben, sechs und mehr eichene Pflöcke an die Ecken und Seiten einschlagen, ein oder zwei Bretter ringsherum daran annageln, bis auf einen Schuh tief die Grube mit frischem Pferdemist füllen und jede Lage einstampfen, den Mist mit Wasser begießen, die noch übrigen Schuhtiefe mit guter Erde, welche durch ein Sieb geworfen worden, oder mit derjenigen, die man durch verfaultes Unkraut erhält, völlig zufüllen und mit Wasser begießen; alsdenn läßt man es etliche Tage liegen und sät darauf diejenigen Gewächse, welche man zeitig haben will, als: Salat, Radieschen, Kohl- und Erdrüben, Sellerie, Blumensamen etc. Und da dieses zu Ende des Januars und später geschieht, kann man fast zu der Zeit, wenn man im freien Land zu säen anfängt, schon Pflanzen aus dem Frühbeet versetzen. Diese Mistbeete werden zuweilen begossen, bei kaltem Wetter mit Fenstern und Strohdecken geschützt, und nur manchmal bei Sonnenschein halb oder auch nach einiger Zeit ganz aufgemacht; der Same und die Pflanzen aber werden mäßig, und zwar vormittags begossen; und um die Bretter über der Erde wird Pferdemist gelegt. Die gemauerten Mistbeete taugen nichts, weil sie zu kalt sind. Diejenigen, welche in einem Aufsatzkasten ohne ausgeworfene Gruben bestehen, sind dienlicher, erfordern aber mehr Mist.1
§. 7.
Begießen.
Die Saat und die aufgegangenen Pflanzen werden bei trockener Witterung mit Wasser besprengt. Das beste Wasser dazu ist aufgefangenes Regenwasser, oder doch solches, was vorher von der Sonne einige Zeit beschienen oder erwärmt worden ist. Mistwasser ist nicht dienlich, außer zu einigen Gewächsen, wie Gurken oder Kürbissen. Im Frühling begießt man die Pflanzen morgens oder einige Stunden nach Sonnenaufgang und selten vor dem Mai, im Sommer gleich morgens oder abends, oder auch, wenn die Hitze groß ist, zu beiden Zeiten, im Herbst gegen Mittag und sehr selten, nämlich dann, wenn bei warmer und trockener Witterung die Gewächse zu verwelken scheinen. Im Winter darf es in den Kellern oder Gewächshäusern mäßig und nicht oft, überhaupt nicht zu häufig und nicht zu viel auf einmal geschehen, auch müssen die Blätter und der Stamm geschont werden, wenn man des Morgens die Gewächse begießt. Daher gehört viel Vorsichtigkeit dazu, weil die Pflanzen eher vom Begießen als von der Trockenheit Schaden leiden.
§. 8.
Jäten.
Das Wachstum der jungen Pflanzen befördert das Jäten, welches am besten nach einem Regen vorgenommen wird, da das Unkraut dann nebst der Wurzel ausgerissen werden kann. In den Furchen geschieht es mit einer Schaufel, und auf den Beeten mit einer Hacke, wenn der Same reihenweise gesät ist; sonst aber mit der Hand oder einem Messer, weswegen die Beete nicht allzu breit sein sollten. Dies darf nicht eher vorgenommen werden, als bis eines von dem andern unterschieden werden kann. Das ausgejätete Unkraut kann im Garten zusammengeschüttet werden, damit es verfault, weil es dann eine gute Erde abgibt. Beim Jäten können auch die Würmer getötet, außerdem die Pflanzen, welche zu dicht stehen, auseinandergezogen werden.
§. 9.
Versetzen.
Da man die wenigsten Samen und Körner an die Orte sät und steckt, wo sie stehen bleiben, müssen die meisten Pflanzen versetzt werden. Dies geschieht, wenn sie sechs oder mehr Blätter haben. Beim Herausziehen werden sie vorher begossen, wenn das Erdreich trocken ist, damit die Wurzeln nicht beschädigt werden; die allzulangen Wurzeln und zuweilen auch das Kraut, z. B. am Sellerie, wird beschnitten; die Erde, in welche die Pflanze gesetzt wird, wird mit einer eisernen Handschaufel herausgenommen, in das dadurch gemachte Loch die Pflanze so gesetzt, daß die Wurzeln ausgebreitet werden, die Erde wird alsdenn von der Schaufel darauf geschüttet, und nicht allzu stark angedrückt, hingegen begossen, wenn es nicht kurz vorher geregnet hat, weswegen die bequemste Zeit zum Verpflanzen nach einem Regen oder bei trübem Wetter ist. Überdies ist darauf zu sehen, daß die Wurzeln sich nicht krümmen, sondern gerade unter sich gehen; und daß jede Art in ihre gehörige Weite gesetzt werde. Außerdem muß man auch mit dem Besäen und Verpflanzen abwechseln, dergestalt, daß man im folgenden Jahr ein anderes Gewächs auf das Beet setzt, als das vorhergehende Jahr darauf gestanden hat.
§. 10.
Wachstum.
Das Wachstum der Pflanzen wird am besten befördert, wenn sie freie Luft, warmen Grund und Sonnenschein, fette Erde, fruchtbaren Tau und Regen haben. Auch hier sehen einige zugleich auf den Mond, und pflanzen dasjenige, was über sich wachsen soll, im zunehmenden; was unter sich wachsen soll, im abnehmenden Mond; was groß und dick werden soll, im Vollmond; was in Samen schießen soll, vor dem Neumond.
Das sicherste ist, sich nach der Beschaffenheit der Witterung zu richten und eine bequeme Zeit zum pflanzen, z. B. wenn es geregnet hat oder wahrscheinlich Regen bevorsteht, nicht vorbeigehen zu lassen, auch wenn dieselbe nach der Beobachtung des Mondes noch nicht vorhanden ist.
§. 11.
Mittel wider das Ungeziefer.
Der Maulwurf, die Erdflöhe und Mücken, Vögel, besonders Sperlinge, der Mehltau, Regenwürmer, Ameisen, Schnecken, Raupen, Grillen, Mäuse und Ratten im Garten und in Kellern.
Die Maulwürfe, welche den Erdboden untergraben, werden am besten durch die gewöhnlichen Fallen weggefangen; wider die Erdflöhe empfiehlt man besonders neues Land: man soll nämlich ein bisher unbesätes Rasenland umgraben, und den Samen zu den Pflanzen darauf säen. Je weiter dasselbe von anderem umgegrabenen Land entfernt ist, desto besser. Die Ursache davon soll sein, weil an diesen Orten noch keine Eier von dem Ungeziefer sein sollen.
Außer diesen hat man noch einige Mittel wider dieselben angegeben, welche teils den Samen, teils die Saat vor und nach dem Aufgehen betreffen: Wenn der Same in Wasser eingeweicht wird, in welchem zu Pulver gestoßene Lorbeeren aufgekocht worden; wenn nach dem Säen gedörrter und zerriebener Hühner- oder Taubenmist auf die Erde gestreut wird; wenn nach dem Aufgehen des Samens geklopfter und im Wasser aufgelöster Ruß auf die Pflanzen gesprengt wird, nachdem sie begossen worden, sollen Erdflöhe und Mücken davon abgehalten und vertrieben werden. Das beste Mittel ist, den Samen bei gelinder und feuchter Witterung zu säen, damit er bald aufgehe und wachse. Die Vögel und besonders die Sperlinge, welche den Erbsen und anderem Samen schaden, werden abgehalten, wenn zuweilen unter sie geschossen wird, oder wenn Federn oder tote Vögel, wie auch Leinruten aufgehangen werden.
Dem Mehltau wird abgeholfen, wenn die Pflanzen öfters begossen, oder die damit behafteten Blätter abgenommen werden.
Regenwürmer müssen getötet werden, oder man schüttet an den Ort, wo sie sich befinden, Bierhefen, weil sie den dabei befindlichen Hopfen nicht vertragen können.
Die Ameisen werden vertrieben, indem Asche oder Kreide auf ihre Nester gestreut, oder einige bei denselben mit einer glühenden Kohle verbrannt werden; oder indem man ungelöschten Kalk in ihre Nester gräbt und Wasser darauf gießt, wovon sie verbrennen.
Die Schnecken werden gedämpft, indem Salz oder Ruß auf den Erdboden gestreut, oder indem sie morgens nach einem Tau oder Regen, wenn sie an den jungen und zarten Gewächsen hangen, abgelesen werden. Durch dieses Ablesen werden auch die Raupen gemindert, doch es soll sie auch abhalten, wenn der Same in Urin, der mit Branntwein und Ruß vermischt worden, eine halbe Stunde eingeweicht, und hernach, wenn er etwas getrocknet ist, gesät wird; die aufgegangenen Pflanzen soll man mit Wasser, in welchem Wermut gesotten wurde, besprengen; und zu den fortgesetzten Pflanzen, besonders in die Gänge, frische Nesseln legen.
Die Grillen, welche an den Wurzeln Schaden tun, kann man austilgen, wenn man zu Ende des Herbstes und bei Anfang der Kälte hier und dort Gruben macht und sie mit frischem Pferdemist füllt; und sie alsdenn im Frühling zeitig mit siedendem Wasser vertilgt, weil sie sich dahin begeben haben; ansonsten muß man sie ausgraben, wenn man sieht, daß die Wurzel einer Pflanze von denselben abgefressen worden ist. Den Spitzmäusen, anderen Mäusen und Ratten muß mit Fallen nachgestellt werden, doch sie können auch abgehalten werden, wenn in den Mistbeeten die Erde mit Baumsalbe und in den Wintertöpfen in den Kellern dieselbe mit trockener und durchsiebter Buchenasche, die mit einem Drittel gestoßenen Schwefels vermischt wurde, vermengt oder bestreut wird. Überhaupt soll auch Wasser, in dem Horn und Tierklauen eingeweicht wurde, Ungeziefer abhalten und vertreiben.
§. 12.
Beförderung des Wachstums.
Wenn die Gewächse vor allem, was ihnen schaden kann, geschützt worden sind, ist darauf zu achten, daß ihr Wachstum zugleich befördert werde: Dazu ist es nötig, daß Sonne und Regen in die Erde wirken können. Aus dieser Ursache muß die Erde oft aufgehackt werden, besonders ist dies bei den Wurzelgewächsen nützlich, bei welchen die Erde nicht nur tief umgegraben, und nicht frisch gedüngt sein, sondern auch oft aufgelockert werden muß. Unter die Wurzelgewächse können auch Salat und andere über sich wachsende Pflanzen, welche man bald wieder wegnimmt, gesät werden. Bei denjenigen Gewächsen, die über sich wachsen, sollen die dürren Blätter abgelesen, die frischen aber nicht abgebrochen werden, weil das Gewächs dadurch in seinem Wachstum gehindert wird. Bei einigen ist auch dienlich, daß die Erde angehäuft wird, wie dies besonders bei Kartoffeln vorteilhaft ist, wohingegen andere von der Erde entblößt werden können, wie z. B. Rettiche.
§. 13.
Ernte.
Die Gewächse werden zu der Zeit, wenn sie ihre Vollkommenheit erreicht haben, eingesammelt. Die Hülsenfrüchte werden abgenommen, ehe sie aus ihren Schalen fallen; diejenigen, welche vom Frost leicht Schaden leiden, wie die Kartoffeln, werden an einigen Orten zeitig, an anderen später, jedoch vor dem Frost, oder sobald das Kraut dürr wird, ausgegraben und in Kellern, aber nicht in Gruben, aufbehalten. Wurzelgewächse kann man in Gruben einlagern, wenn sie tief genug gemacht sind, so daß weder Frost noch Nässe ihnen schaden können. Der Same wird gesammelt, sobald er reif ist, kann zum Teil an der Sonne vollends getrocknet, und hernach ausgeklopft werden. Was über Winter teils zur Nahrung, teils zur Erzielung des Samens im Keller verwahrt wird, muß trocken hinein gebracht und in Sand oder Erde gesetzt werden.
Zweites Kapitel.
Von den Küchengewächsen nach alphabetischer Ordnung.
§. 14.
Die Garten- und Küchenkräuter sind zahlreich. Es gibt Zwiebelgewächse, Hülsenfrüchte, Wurzelwerk, über sich wachsende Gewächse, Suppen - und wohlriechende Kräuter usw. Von allen diesen aber werden sich die Nützlichsten am besten nach alphabetischer Ordnung kürzlich folgendermaßen beschreiben lassen:
Anis, wird zeitig ungefähr im März gesät, erfordert einen guten, fetten und gedüngten Boden, muß öfters begossen werden, und dient dem Magen, dem Gesicht und der Brust.
Artischocken, erfordern fette und tief gegrabene Erde, und werden durch Samen und Wurzeln fortgepflanzt. Mit dem Samen geschieht es langsamer, doch dessen Wachstum kann befördert werden, wenn er in Mistbeete gesät, oder vorher in nassen Sägespänen oder in Mistwasser etliche Tage eingeweicht wird. Wenn sie durch Wurzeln fortgepflanzt werden, ist es nicht genug, die Sprossen abzureißen, sondern es ist besser, die Äuglein mit so viel Wurzeln wie möglich mit dem Messer abzulösen; am allerbesten aber ist es, wenn der alte Stock im Boden mit einer scharfen Schaufel gespalten, tief abgestochen, die Hälfte herausgenommen und die Setzlinge an demselben mit einem Messer so abgelöst werden, daß an denselben etwas von dem alten Stock verbleibt, an dem sich die jungen Wurzeln befinden. Auf diese Art keimen sie am leichtesten und werden im darauffolgenden Herbst Früchte tragen, wenn das Verpflanzen im April oder Mai geschehen ist. Im Sommer kann zuweilen die Erde um die Stöcke aufgehackt, Mist an die Wurzel gelegt, oder auch mit Mistwasser begossen werden. Einige nehmen ihnen auch die Äuglein an den Seiten ab, um desto größere Früchte zu erlangen. Gegen den Winter müssen sie vor Kälte bewahrt werden. Einige schneiden alsdann alle Pflanzen bis auf einen Fuß von der Erde ab, werfen einen Haufen Erde darauf, daß die Blätter nur zwei Finger hoch hervorragen, und bedecken sie hernach mit warmem Mist. Andere häufen um jede Staude die Erde auf und bedecken sie mit zusammengebundenem Stroh, so, daß die obersten Blätter hervorgehen, hierauf schützen sie dieselben von oben her mit Mist, und wenn es stark friert, noch mit Erde von oben her. Die beste Art sie zu schützen, ist, wenn sie mit Blättern von Nußbäumen gut bedeckt werden, weil die Mäuse dadurch abgehalten werden; sollten aber solche Blätter nicht reichlich vorhanden sein, oder diese Bedeckung an einigen Orten unzulänglich für den Frost gehalten werden, so können doch einige Blätter auf die Erde um den Stock gelegt werden, damit die Bitterkeit aus denselben in das Erdreich dringen kann, welche den Mäusen zuwider ist.
Es können auch einige Stöcke in den Keller gesetzt werden, damit diejenigen, welche im Feld durch Frost oder Mäuse verloren gegangen sind, dadurch wieder ersetzt werden können. Im Frühling, zuweilen schon im März, können sie bei warmem Sonnenschein einige Stunden etwas aufgedeckt und des Nachts wieder zugedeckt werden, bis sie nach und nach im April, oder wenn noch Frost zu besorgen ist, später, völlig entblößt werden. Die Erde wird hierauf weggeräumt, die vielen kleinen Augen werden abgenommen, und nur ungefähr drei der stärksten gelassen. Wenn sie anfangen, schlechte Früchte zu bringen, ist es nötig, sie zu erneuern, welches alle drei Jahre geschehen kann. Sie bewirken wohlriechenden Atem, stärken den Magen, vermindern Steinleiden und erwärmen.
Basilikum, wird im April auf ein Mistbeet gesät, nach erlangter Größe verpflanzt, und von Unkraut rein gehalten. Die Pflanzen sind grün, braun und schwarz, breit und schmalblättrig, auch ganz fein. Sie geben einen angenehmen Geruch von sich.
Beifuß, gibt es zweierlei, roten und weißen: Der rote hat rote Stengel, der weiße weiße; ansonsten ist er dem Wermut ähnlich, er hat jedoch breitere Blätter und einen langen Stengel, einen angenehmen Geschmack und Geruch. Daher wird er zum Füllen der Gänse und anderen Geflügels gebraucht, und ist wider den Biß der Schlangen und wider die Pest inwendig und äußerlich gut. Er kann auch zu Asche gebrannt werden, und bei ansteckenden Krankheiten werden vier bis fünf Fingervoll von dem Pulver in Wein getan, worauf ein Schweiß erfolgt. Beifuß in die Schuhe gelegt, vertreibt die Müdigkeit im Gehen. Wenn Blätter, mit bitterem Mandelöl vermischt, auf den Magen gelegt werden, stillt dies die Schmerzen desselben.
Blumenkohl





























