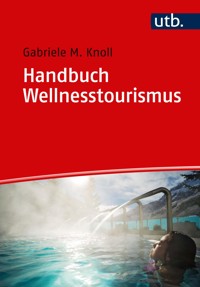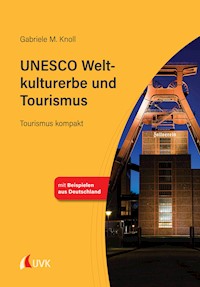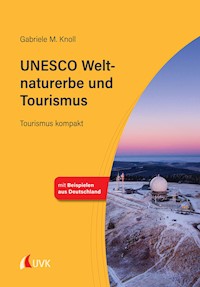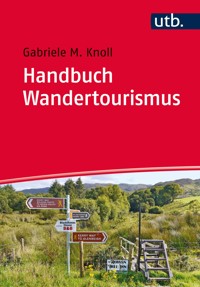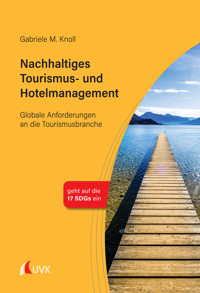
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UVK
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die globale Herausforderung meistern Nachhaltiges Handeln ist in der Tourismusbranche notwendig und herausfordernd zugleich. Gabriele M. Knoll geht dem Thema mittels der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs) auf den Grund. Die Relevanz der Tourismuspolitik und der institutionellen Nachhaltigkeit lässt sie nicht außer Acht. Konsequenzen, die sich aus dem Streben nach Nachhaltigkeit für Destinationen und Hotels ergeben, stellt sie vor. Eine spannende Lektüre für Studierende der Tourismuswissenschaft und des Hotel- sowie Nachhaltigkeitsmanagements. Es ist auch für die Tourismus-, Politik- und Hotelpraxis geeignet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriele M. Knoll
Nachhaltiges Tourismus- und Hotelmanagement
Globale Anforderungen an die Tourismusbranche
Dr. Gabriele M. Knoll lehrt Tourismusmanagement an der Hochschule Fresenius in Köln sowie im Fernstudiengang Tourismus- und Eventmanagement dieser Hochschule. Sie hat bei diversen Tourismusprojekten im In- und Ausland mitgearbeitet und ist Autorin touristischer Fach- und Lehrbücher sowie zahlreicher Reiseführer.
Umschlagabbildung: © FooTToo · iStock
Autorinnenbild: © privat
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381116423
© UVK Verlag 2025‒ Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISBN 978-3-381-11641-6 (Print)
ISBN 978-3-381-11643-0 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Ist da die Welt in Ordnung? Haben Sie das Foto auf dem Bucheinband einmal genauer angeschaut? Das glasklare Wasser lässt vermuten, dass hier die Natur intakt ist. Kein Mensch ist auf diesem Bildausschnitt zu sehen – also scheint dies kein vom Massentourismus geplagter Ort zu sein. Doch der Blick auf die Berge im Hintergrund muss angesichts des Bildtitels „Tegernsee im Winter“ nachdenklich stimmen. Es gibt nicht einmal verschneite Berge hier am Nordrand der Alpen.
Die Häufung von nachlassender Schneesicherheit bis hin zu gänzlich schneearmen Wintern und grünen Wintersportorten in den Tälern, aber auch Gefahren aus der Natur, die zunehmend den Sommertourismus treffen und durchaus katastrophale Ausmaße annehmen können, lassen sich auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurückführen. Der Tourismus ist dabei gleichermaßen Täter wie Opfer.
Verlierer und Gewinner gibt es auch im Zusammenhang mit dem Tourismus: auf der einen Seite diejenigen, für die der Urlaub die schönste Zeit im Jahr darstellt, auf der anderen Seite die zahllosen Menschen in den Destinationen, die durch einen Job im Tourismus zwar Geld verdienen können – aber trotzdem unter prekären Bedingungen leben müssen.
Mit den 17 SDGs hat die Weltgemeinschaft Ziele bekommen, u.a. für mehr Gerechtigkeit, bessere Lebensbedingungen und Umweltschutz, die ebenso für die Tourismusbranche gelten.
Dieses Buch möchte dafür mehr Bewusstsein wecken und für Missstände wider die Nachhaltigkeit im Tourismus sensibilisieren – mit Blicken in die institutionellen Vorgaben, die Praxis und Ansätze für mehr Nachhaltigkeit im touristischen Geschäft. Daneben gibt es viele Impulse zu eigener Recherche und Vertiefung durch die Reflexionsfragen am Ende jedes Kapitels.
Und dann bitte die Anwendung in der Praxis!
eLearning
Zu diesem Buch wird ein eLearning-Kurs mit rund 40 Fragen angeboten. Vor der Lektüre hilft er Ihnen dabei, Ihren aktuellen Wissenstand zu testen. Nach der Lektüre können Sie mithilfe dieses Kurses das Erlernte auf die Probe stellen und festigen.
Nutzen Sie den QR-Code oder den folgenden Link, um zu dem Kurs zu gelangen:
🔗 https://narr.kwaest.io/s/1374
1Eine große Herausforderung unserer Zeit – die 17 Sustainable Development Goals
1.1Die 17 SDGsNachhaltigkeitsziele – Ein Einstieg
17 SDGs im Überblick | [1]
Der Erste und der Zweite Weltkrieg waren Anlass für Initiativen in Europa und den Vereinigten Staaten, den Frieden wiederherzustellen und zu sichern. Nach ersten wenig erfolgreichen Ansätzen zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten der US-amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill die am 14. August 1941 veröffentlichte „Atlantik-Charta“. „Darin wurden erstmals konkrete Rahmenbedingungen für eine zukünftige internationale Politik und Maßnahmen zur Friedenssicherung festgelegt, unter anderem auch die Schaffung einer internationalen Organisation zur Friedenssicherung. Am 1. Januar 1942 unterzeichneten 26 Alliierte Länder diese „Deklaration der Vereinten NationenVereinte Nationen“ und bekräftigten damit die in der Atlantik-Charta gesteckten Ziele“ (UNRIC o.J.a).
Nach weiteren Schritten konnten 1945 schließlich die Ziele und Prinzipien der Vereinten Nationen mit der Verfassung der 111 Artikel umfassenden Charta auf der Konferenz der Vereinten Nationen in San Francisco von inzwischen 50 zusammengeschlossenen Staaten verankert und verabschiedet werden (vgl. a.a.O.). „Bereits vor der Gründung der Vereinten Nationen wurden so die Weichen für spätere UN-Sonderorganisationen wie den Internationalen Währungsfonds (IWF), die Weltbank oder die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gestellt“ (a.a.O.) – Institutionen, die u.a. auch im Engagement für eine globale Nachhaltigkeit eine Rolle spielen können.
Aktuell haben 193 Staaten die Deklaration der Vereinten Nationen unterzeichnet; die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik Deutschland wurden am 18. September 1973 noch getrennt Mitglieder der UN, nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland bilden sie einen Staat.
Box | Nachhaltige Entwicklung fördern
„Seit der Entstehung der Vereinten Nationen 1945 war es eine der Prioritäten ‚eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen‘. Die Verbesserung des Wohlbefindens der Menschen bleibt nach wie vor eine [sic] der Hauptanliegen der UN. Das globale Verständnis von Entwicklung hat sich über die Jahre verändert und Länder sind sich heute einig, dass nachhaltige Entwicklung – eine Entwicklung, die Wohlstand und wirtschaftliche Möglichkeiten, soziales Wohlbefinden und Umweltschutz fördert – den besten Weg bietet, um das Leben von Menschen überall auf der Welt zu verbessern.“
(UNRIC o.J.b)
Die Vorstufen zur Agenda 2030 sind übrigens im → Kap. 2.3 zu finden.
Am 25. September 2015 verabschiedeten 193 Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen in New York die Agenda 2030Agenda 2030. Mit der Unterzeichnung dieses Vertrags verpflichten sich die Mitgliedsstaaten, „allen Menschen bis zum Jahr 2030 ein Leben in Würde zu sichern“ (BMZ 17 Ziele).
„Die Agenda 2030 nennt fünf Kernbotschaften, die den 17 Zielen als Handlungsprinzipien vorangestellt sind: 1. Die Würde des Menschen im Mittelpunkt, 2. den Planeten schützen, 3. Wohlstand für alle fördern, 4. Frieden fördern und 5. Globale Partnerschaften aufbauen.
Im Wesentlichen sollen die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung …
Armut und Hunger beenden und Ungleichheiten bekämpfen,
Selbstbestimmung der Menschen stärken, Geschlechtergerechtigkeit und ein gutes und gesundes Leben für alle sichern,
Wohlstand für alle fördern und Lebensweisen weltweit nachhaltig gestalten,
ökologische Grenzen der Erde respektieren: Klimawandel bekämpfen, natürliche Lebensgrundlagen bewahren und nachhaltig nutzen,
Menschenrechte schützen – Frieden, gute Regierungsführung und Zugang zur Justiz gewährleisten und
eine globale Partnerschaft aufbauen.
Die Ziele berücksichtigen alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Soziales, Umwelt, Wirtschaft – gleichermaßen und gelten für alle Staaten der Welt: Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer. Sie machen deutlich, dass wir eine gemeinsame Verantwortung für die Welt tragen.“ (ENGAGEMENT GLOBAL GMBH o.J.)
Die Bundesrepublik Deutschland ist als Unterzeichnerstaat verpflichtet, die Ziele der Agenda 2030 in die nationale Politik und gegebenenfalls Gesetzgebung zu integrieren. Mit einem Blick in den Staatenbericht Deutschlands über die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sollen in der folgenden Tabelle einige Handlungsfelder („Transformationsbereiche“) und darauf ausgerichtete Aktivitäten als „Kernbotschaften“ zum Erreichen der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) auf nationaler wie internationaler Ebene skizziert werden.
Handlungsfelder und
entsprechende SDGs
Maßnahmen zum
Erreichen der Ziele
menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten, soziale Gerechtigkeit
▶ SDGs 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10
Aktionsplan Menschenrechte 2021/2022 der Bundesregierung
Gestaltung der globalen Gesundheitsarchitektur aus den Erfahrungen der Coronapandemie
One-Health-Ansatz, Schutz der Gesundheit von Nutz- und Wildtieren sowie der Biodiversität und der natürlichen Lebensräume
Kreislaufwirtschaft
▶ SDGs 8, 9, 11, 12, 13, 14
Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln
Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Lieferketten
Vermeidung, Recycling und die verantwortungsvolle Entsorgung von Abfällen
Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten sowie Multi-Akteurs-Partnerschaften
Bewusster individueller Konsum
nachhaltiges Bauen und Verkehrswende
▶ SDGs 7, 8, 9, 11, 12, 13
Nachhaltiges Bauen: Energieeffizienz, Klimaneutralität, Erhalt der Biodiversität, Ressourcenschonung, Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen, Reduzierung des Flächenverbrauchs, nachhaltige Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen, Einhaltung von Menschenrechten in der Lieferkette sowie die Sicherung von Gesundheit und Komfort von Nutzerinnen und Nutzern.
Verkehrswende: Nationale Plattform „Zukunft der Mobilität“ (2018), seit 2021 (neben dem Wärmesektor) auch im Verkehrssektor stattfindende CO2-Bepreisung
Klimaschutz durch Entwicklungen im Bereich alternativer Antriebstechnologien und Kraftstoffe
nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme
▶ SDGs 2, 3, mit Bezügen zu den SDGs 12, 15
Steigerung des Ökolandbaus in Deutschland (Ziel: 20 Prozent bis 2030)
Stärkung der Nachhaltigkeit in der Gemeinschaftsverpflegung sowie die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung
Ziele: ausreichende Versorgung mit einer Vielfalt an sicheren, erschwinglichen Lebensmitteln sowie eine gesundheitsförderliche Ernährung für alle weltweit zu sichern
Schutz der Umwelt und des Klimas, die Haltung und Gesundhaltung von Nutztieren, Arbeits- und Lebensbedingungen in der Landwirtschaft zu verbessern
ländliche Räume als attraktive Wirtschafts- und Lebensräume zu stärken
schadstofffreie Umwelt
ökologische Nachhaltigkeit:
▶ SDGs 6, 13, 14, 15
soziale Nachhaltigkeit:
▶ SDGs 3, 11
ökonomische Nachhaltigkeit:
▶ SDG 8
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen, Umweltrecht im Zusammenspiel von chemikalienrechtlichen Anforderungen, Wasser- und Immissionsschutz sowie Abfallrecht
gezielte Kommunikation für Folgewirkungen von Konsumentscheidungen
Aktivitäten der deutschen Bundesregierung zur Erreichung der 17 SDGs | [2]
Webtipp | Nachhaltigkeit Deutschlands mit konkreten Zahlen
UN-Nachhaltigkeitsgipfel: Deutschland legt in New York seine 12 Schlüsselbeiträge vor:
🔗 https://www.bmz.de/de/aktuelles/aktuelle-meldungen/un-gipfel-deutschland-legt-seine-12-schluesselbeitraege-vor-175196
Schlüsselbeiträge der Bundesregierung für den SDG Summit 2023:
🔗 https://www.bmz.de/resource/blob/175206/20230917-schluesselbeitraege-bundesregierung-sdg-gipfel.pdf
Wenn auch die Dimensionen der Nachhaltigkeit inzwischen weithin bekannt sind, so sollen sie im Folgenden in einen Bezug zu den 17 SDGs gesetzt werden und somit einige wesentliche Aspekte genannt werden.
In Zusammenhang mit der ökologischenökologische Nachhaltigkeit NachhaltigkeitNachhaltigkeit wird stets die Artenvielfalt/Biodiversität genannt, die zu den Kernen der SDGs 13 und 14 gehört. Diese biologische Vielfalt zeigt sich unter den Lebewesen tierischer wie pflanzlicher Art, die auf der Basis geographischer Gegebenheiten, wie der Lage auf dem Globus, den dort herrschenden Klimabedingungen, den Wasserverhältnissen und vielem mehr, die Ökosysteme an Land sowie in den Ozeanen prägen. So gut die Natur ohne den Menschen auskommt, so ist die Biodiversität in möglichst intakten Ökosystemen wiederum wichtig für ihn – womit deutlich wird, dass ökologische Nachhaltigkeit auch ein Bestandteil der sozialen Nachhaltigkeit sein kann, indem die Natur auch Lebensraum der Menschen darstellt und zu ihrem Lebensunterhalt wie Wohlbefinden beitragen kann. Diese Leistungen der Natur werden als Ökosystemleistungen – auch Ökosystemdienstleistungen – bezeichnet. Die Erholungsfunktion von Natur und Landschaft ist u.a. wichtig für den Tourismus. Das SDG 6 „Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“ zeigt in dieser kurzen Bezeichnung ebenso eine enge Verbindung zwischen ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Die Konkurrenz um Trinkwasser als Grundnahrungsmittel für den Menschen, aber auch unabdingbar für touristische Infrastruktur vom Swimmingpool bis zum Golfplatz, wird damit angedeutet und zu einem Handlungsfeld der Nachhaltigkeit in den Destinationen. Ähnlich steht es um das SDG 7 „Bezahlbare und saubere Energie“: Raubbau an Wäldern für das Brennholz zum täglichen Kochen oder verbesserte Öfen sowie der Einsatz erneuerbarer Energie als Alternativen?
Bei der sozialensoziale Nachhaltigkeit NachhaltigkeitNachhaltigkeit stehen die elementaren Bedürfnisse des Menschen und seine Lebensbedingungen im Vordergrund, die sich vorrangig in folgenden SDGs widerspiegeln: SDG 1 „keine Armut“, SDG 2 „Kein Hunger“, SDG 3 „Gesundheit und Wohlergehen“, SDG 4 „Hochwertige Bildung“ und SDG 5 „Geschlechtergerechtigkeit“. Diese Ziele setzen schon bei den Kleinsten an, die in widrigste Verhältnisse hineingeboren werden und damit kaum eine Chance zu einem Leben in einem gesunden wie sicheren Umfeld haben – weit verbreitet vor allem in den Slums von Entwicklungsländern, aber nicht nur dort. Verbesserungen für den Lebensweg von Kindern werden zu globalen Zielen; vom Aufwachsen, in dem die Grundbedürfnisse befriedigt werden können, es eine medizinische Versorgung ermöglicht, gesund älter zu werden und mit dem Schulbesuch die Weichen für eine gute Zukunft zu stellen. Unter der geforderten „hochwertigen Bildung“ wäre durchaus schon der Besuch von Grundschulen, als Teilhabe an elementarer Bildung zu verstehen, die, wie es SDG 5 verdeutlicht, in vielen Ländern keine Selbstverständlichkeit insbesondere für Mädchen darstellt. Die Chance, aus traditionellen Geschlechterrollen und der Abhängigkeit von männlichen Personen auszubrechen und eines Tages selbstbestimmt sein Leben zu gestalten, ist in patriarchalischen Gesellschaften eher gering. Daraus ergibt sich u.a. auch die Notwendigkeit für das SDG 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“. Arbeitsverhältnisse in extremen Verhältnissen als Ausbeutung, aber auch Jobs, die auf Dauer die Gesundheit ruinieren – sei es, dass gesetzliche und andere Regelungen fehlen oder ignoriert werden, wie beispielsweise in der touristischen Hochsaison in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel, wären hiermit angedeutet. Das angesprochene Wirtschaftswachstum soll nicht als Freibrief für einen „Raubbau“ an menschlicher Arbeitskraft gelten, sondern sich auf der Basis von Dauerhaftigkeit, Inklusion und Nachhaltigkeit entwickeln.
Mit dem SDG 8 ist auch bereits die Forderung nach einer ökonomischenökonomische Nachhaltigkeit NachhaltigkeitNachhaltigkeit verbunden, die SDG 9, 10 und 12 lassen sich ebenfalls dieser Dimension zuordnen. Eine menschenwürdige Arbeit soll den Arbeitenden ihre Existenz sichern, aber auch auf der Seite der Arbeitgeber sollte der Fokus auf einer nachhaltigen Betriebswirtschaft liegen, die nicht nur die ökonomischen Aspekte, sondern auch ihre Konsequenzen für Soziales und Ökologie einbezieht. Nicht das Denken an den schnellen Gewinn oder seine Maximierung wären dabei die obersten Ziele der Unternehmensführung. Die gesellschaftliche Verantwortung, die sich in der intergenerationellen wie intragenerationellen Gerechtigkeit ausdrückt, ist ein wesentlicher Bestandteil ökonomischer Nachhaltigkeit.
Die SDG 16 und 17 betreffen die institutionelleinstitutionelle Nachhaltigkeit NachhaltigkeitNachhaltigkeit. Für diesen Begriff gibt es unterschiedliche Definitionen, die sich u.a. auch darin widerspiegeln, dass man zum einen bei institutioneller Nachhaltigkeit als einer vierten Säule – besser: Dimension – der Nachhaltigkeit spricht, zum anderen, wie beispielsweise die UNWTO (2013) diese aufteilt in Tourismuspolitik und Governance und als Basis bzw. Säule 1 für die weiteren versteht: Säule 2 Handel, Investitionen, Daten und Wettbewerbsfähigkeit, Säule 3 Beschäftigung, menschenwürdige Arbeit und Kapazitätsaufbau, Säule 4 Armutsbekämpfung und soziale Gliederung sowie Säule 5 Nachhaltigkeit der natürlichen und kulturellen Umwelt.
1.2Die 17 SDGs und die Tourismusbranche – eine Einführung in die Problemfelder
„Die Überwindung von Armut ist die größte Herausforderung der Gegenwart. Armut gibt es in vielen Ausprägungen. Absolute Armut, die mitunter existenzbedrohend ist, ist nicht vergleichbar mit der Situation von Menschen mit niedrigem Einkommen in Deutschland. Beide Formen der Armut müssen jedoch bekämpft werden.“
Weitere Informationen:
🔗 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/armut-beenden-1537492
„Wir alle sind vor dem Gesetz gleich, haben die gleichen Chancen, etwa beim Zugang zu Bildung und zur Gesundheitsversorgung sowie sozialer und wirtschaftlicher Teilhabe. Doch in vielen Ländern ist die Ungleichheit nach wie vor sehr hoch, in einigen Ländern wächst sie sogar. Das muss geändert werden. Denn alle Menschen sollen ihr Leben selbst bestimmen können.“
Weitere Informationen:
🔗 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/weniger-ungleichheiten-1592836
„Der Klimawandel führt zu Extremwetterereignisse [sic] wie Wirbelstürmen, Dürren und Überschwemmungen. Wenn der Meeresspiegel steigt, Ernten vertrocknen und ganze Landstücke unbewohnbar werden, zieht es die Menschen dorthin, wo es sich besser leben lässt. Deshalb will die Staatengemeinschaft den Klimawandel gemeinsam deutlich begrenzen.“
Weitere Informationen:
🔗 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/weltweit-klimaschutz-umsetzen-181812
„Jeder zweite Mensch lebt heute in der Stadt. Der Zuzug ist ungebrochen. Damit wir in Zukunft gut leben, brauchen wir bezahlbaren Wohnraum und eine nachhaltige und integrierte Stadtentwicklungspolitik.“
Weitere Informationen:
🔗 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltige-staedte-gemeinden-1006538
„Ohne ein sicheres Umfeld und rechtstaatlich handelnde Institutionen ist eine nachhaltige Entwicklung unmöglich. Für Frieden, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit ist gutes Regieren ohne Korruption unerlässlich. Dafür engagiert Deutschland sich und setzt sich mit der Nachhaltigkeitsstrategie konkrete eigene Ziele.“
Weitere Informationen:
🔗 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/institutionen-foerdern-199866
„Das 17. Nachhaltigkeitsziel ist die Grundbedingung für die Erreichung aller weiteren Ziele. Die Agenda 2030 wird getragen von einer globalen Partnerschaft, die alle Akteure – Regierungen, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und jeden und jede Einzelne – in die Pflicht nimmt. Gemeinsame Verantwortung bedeutet, dass niemand zurückgelassen wird und alle für das globale Gemeinwohl je nach ihrer Leistungsfähigkeit verantwortlich sind. Das erfordert gegenseitigen Respekt, gemeinsam getragene Werte und die gebündelte Kraftanstrengung aller.“
Weitere Informationen:
🔗 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/globale-partnerschaften-1140096
Immer wieder wird der Tourismus als Chance gesehen, in bestimmten Regionen die dortige Armut zu reduzieren, die Abwanderung – oftmals eine Landflucht – zu bremsen und als Gegenmaßnahme mit dem Tourismus dort einen neuen Wirtschaftszweig einzuführen und so der Bevölkerung neue Einkommensmöglichkeiten zu verschaffen. Das SDG 10 mit seiner Forderung nach weniger Ungleichheiten bezieht sich auch auf die Benachteiligung von geographischen Räumen, wie der Peripherie eines Staates im Unterschied zu Regionen um die Hauptstadt mit ihren Wirtschaftszentren oder anderen Metropolregionen, in denen durch an diesen Standort gebundene Ressourcen, wie beispielsweise Bodenschätze, im Idealfall für ein funktionierendes Wirtschaftsleben sorgen.
Förderprogramme zur Entwicklung des Tourismus in ländlichen Räumenländlicher Raum kommen selbst in Industriestaaten zum Einsatz. Es gilt dabei, in den sich entvölkernden Landschaften mitsamt ihren verödenden Dörfern, in denen fast nur noch alte Menschen leben, Impulse für neue Wirtschaftszweige zu geben, die dann wiederum für junge Menschen und Familien attraktiv sind und sie zu einem Umzug aufs Land motivieren. So versteht in DeutschlandDeutschland das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) die Strukturschwäche vieler ländlicher Regionen fern der „Speckgürtel“ von Großstädten als einen Aufgabenbereich. Freizeitgestaltung, Erholung und Tourismus finden dort wichtige gute Voraussetzungen. „Die Großwetterlage für Tourismus in Deutschlands ländlichen Regionen ist günstig: Gesellschaftliche Trends wie Lust auf Regionalität, der Wunsch nach Authentizität, Nachhaltigkeit, Gesundheit oder Entschleunigung passen perfekt zum Image ländlicher Urlaubsregionen. Davon profitieren nicht nur etablierte Ziele wie die Nord- oder Ostseeküste, der Schwarzwald oder das Allgäu. Auch weniger bekannte Regionen wie das Havelland oder Waldhessen konnten in den vergangenen Jahren ihre Attraktivität für Touristinnen und Touristen steigern“ (BMEL 2023, S. 28). Mit Hilfe von Fördermaßnahmen durch die Bundesländer, den Bund oder auch der EU können Projekte initiiert und Probleme gelöst werden: „In Sachen Marketing und Vertrieb sowie bei der Fachkräftesicherung und im Ausbau touristischer Infrastrukturen stehen besonders ländliche Regionen und kleine Anbieter vor Herausforderungen“ (a.a.O.).
Box | Finanzquellen auch für Förderungen des Tourismus im ländlichen Raum
„BULEplus Bundesprogramm Ländliche Entwicklung und regionale Wertschöpfung; hiermit fördert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gemeinsam mit verschiedenen Partnern innovative Ansätze in der ländlichen Entwicklung.
ELER Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER); fördert die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums in der Europäischen Union.
LEADER Abkürzung für französisch „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“, („Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“) ist ein von den lokalen Akteuren getragener Förderansatz der Europäischen Union, mit dem seit 1991 seinerzeit modellhaft, inzwischen fast flächendeckend, innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden.“
(BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT 2023a, S. 43)
Die Bundesregierung sieht die Förderung des Tourismus als eine Aufgabe ihrer EntwicklungspolitikEntwicklungspolitik in Europa und auf anderen Kontinenten, wie es Beispiele aus Albanien und Malawi zeigen. Attraktive Landschaften, oftmals noch stark ländlich und traditionell geprägt als zwei Pluspunkte für eine touristische Erschließung und Entwicklung und als dritten die potenziellen Arbeitskräfte in einer wirtschaftlich eher schwach strukturierten Region zählen dann zu den guten Voraussetzungen für die Teilnahme an Förderprogrammen. Inwieweit bei einem Engagement das Wohl der Einheimischen und somit die soziale Nachhaltigkeit, aber auch der Schutz der Natur im Vordergrund stehen oder der ökonomische Erfolg von Investoren aus dem Ausland – das steht auf einem anderen Blatt.
Das Credo des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) lautet: „Tourismus bietet Schwellen- und Entwicklungsländern große Möglichkeiten: Er schafft Arbeitsplätze, fördert lokale Wirtschaftskreisläufe, stärkt die Infrastruktur vor Ort und kann dazu beitragen, Natur und Kultur zu bewahren und Armut und Ungleichheiten zu reduzieren. Dies gelingt vor allem, wenn die Menschen vor Ort an den Einnahmemöglichkeiten aus dem Tourismus beteiligt werden.“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG o.J.b).
In den ländlichen Räumen AlbaniensAlbanien sieht man bei einer nachhaltigen Entwicklung auch ein gute Chancen für den Tourismus: „Sandstrände im Norden, Felsküsten im Süden, Berglandschaften mit traditionellen Dörfern – Albanien verfügt mit seinen abwechslungsreichen Natur- und Kulturlandschaften, seiner (Agro-)Biodiversität, seinen archäologischen und historischen Sehenswürdigkeiten sowie seinen direkten Verbindungen zu Europa über ein enormes Potenzial für die Entwicklung eines umweltfreundlichen, ländlichen Tourismus“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG o.J.c). Von 2023 bis 2026 läuft in dem Staat ein Projekt mit einem Finanzvolumen von 11,85 Millionen Euro in einer Zusammenarbeit mit der albanischen Regierung und der Privatwirtschaft, „um den ländlichen Raum wettbewerbsfähiger zu machen und die dortigen Einkommen zu verbessern. Das Projekt wird durch die schweizerische Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit kofinanziert“ (a.a.O.). Ziel des Projekts ist es, den Aktivtourismus, Agrotourismus sowie einen Tourismus rund um das kulturelle Erbe des Landes zu fördern.
In der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit MalawiMalawi bildet neben weiteren Schwerpunkten der Aufbau eines nachhaltigen Tourismussektors eine Rolle. Im Rahmen des Projekts „Mehr Beschäftigung und Einkommen im ländlichen Raum von Malawi“ (MIERA) soll die touristische Wertschöpfungskette in diesem afrikanischen Land und insbesondere in dessen ländlichen Räumen gefördert werden. Der Tourismus besaß vor der Coronapandemie mit ca. 516.000 Arbeitsplätzen im Jahr 2019, die fast sieben Prozent der Gesamtbeschäftigung im Land ausmachen, in Malawi bereits eine Bedeutung; durch die Pandemie erfolgte ein Rückgang der internationalen Touristenankünfte von rund 80 %. „Zu den Maßnahmen des Programms gehören die Unterstützung lokaler Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) und Verbände, die Förderung des Dialogs zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor und die Entwicklung von Ansätzen zur besseren Vermarktung Malawis als Reiseziel. Zuletzt wurden 14 KKMU bei der Teilnahme an internationalen Tourismusmessen unterstützt. Hier wurden wichtige Kontakte zu europäischen Reiseveranstaltern aufgebaut und Malawi als Ziel für Touristen bekannt gemacht“ (BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG o.J.d).
Zu den großen Problemfeldern des Tourismus gehört ebenso der vom Menschen ausgelöste (anthropogene) KlimawandelKlimawandel. In dieser Beziehung muss der Tourismus einerseits als Täter und andererseits als Opfer betrachtet werden. Das SDG 13 fordert im Allgemeinen umgehend Maßnahmen zum Klimaschutz und damit letztendlich auch von der Tourismusbranche ein nachhaltiges Handeln, das bei der ökologischen Nachhaltigkeit mit dem Schützen von Ökosystemen und ihrer Biodiversität beginnt, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit ebenfalls einschließt und schließlich bei der institutionellen Nachhaltigkeit, die den Rahmen vorgibt, endet.
Im Zusammenhang mit dem SDG 13 muss auch das SDG 11 gesehen werden, indem Städte und Gemeinden besser im Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels aufgestellt werden müssen. Dies betrifft nicht nur die Einwohner, es kann bzw. wird auch für den Städtetourismus relevant. Bessere Aufenthalts- und Lebensbedingungen in Städten, von denen Touristen wie Einheimische profitieren, sind inzwischen in der Stadtplanung angekommen. Es gilt, Städte und Gemeinden hitzeresilienter umzugestalten, d.h. beispielsweise die Versiegelung der Böden zu reduzieren und an diesen Stellen mehr Grün oder auch zusätzliche Wasserflächen in die Stadt zu bringen. Dies wirkt sich wiederum positiv auf das Stadtklima aus, erhöht hier die Lebensqualität und kann in zentralen Lagen attraktive Orte für Freizeit und Tourismus schaffen. Gute Beispiele wären hierfür in Düsseldorf der Kö-Bogen I und Kö-Bogen II für kreative moderne Grünanlagen an ungewöhnlichen Standorten oder in Bordeaux der Miroir d’eau („Wasserspiegel“) an prominenter Stelle in der Altstadt – die immerhin als Weltkulturerbe der UNESCO gelistet ist.
Durch die Hitzephasen, die von Jahr zu Jahr neue Rekordwerte erreichen, scheint sich ein Trend in kühlere Destinationen zu entwickeln, wobei sich in Europa Deutschland, Irland, Großbritannien und Skandinavien aufgrund ihrer klimatischen Bedingungen als Gewinner sehen können.
Schäden durch Hitze und Dürre in den Landschaften des Mittelmeerraumes und anderen vergleichbaren Klimaten, wie zum Beispiel Kalifornien – insbesondere durch die großflächigen Waldbrände in diesen Regionen – beeinträchtigen bis gefährden das Leben der Einheimischen und machen auch nicht vor Destinationen Halt.
Mit den SDGs 16, 17 wird u.a. die institutionelleinstitutionelle Nachhaltigkeit NachhaltigkeitNachhaltigkeit als vierte Dimension eingefordert. Aufgaben von Institutionen, Branchenverbänden, aber auch der Politik, die für Wirtschaft, Verkehr, ländliche Entwicklungen und andere den Tourismus tangierende Bereiche zuständig sind, liefern Vorgaben mit ihren Zielsetzungen und Koordinierungen. Dazu gehören beispielsweise das Programm der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, die Handlungsfelder des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft mit einem Fokus auf Entwicklung des Tourismus im ländlichen Raum oder auch das Bundesumweltministerium, das einen nachhaltigen Tourismus mit Naturschutz in Einklang bringen möchte. (Mehr zur institutionellen Nachhaltigkeit in Kapitel 6.1)
➲ Zusammenfassung
Die Vereinten Nationen sind Urheber der 17 Ziele zur Entwicklung von Nachhaltigkeit – Sustainable Development Goals, kurz SDGs, die 2015 mit der Agenda 2030 veröffentlicht wurden. Die Unterzeichnerstaaten der Agenda 2030 verpflichten sich, diese Handlungsfelder für ökologische, soziale, ökonomische und institutionelle Nachhaltigkeit in ihre Regierungsprogramme aufzunehmen und umzusetzen. „Als Kompass für die Zukunft“ hat die Bundesregierung eine Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, die im Turnus weniger Jahre jeweils aktualisiert wird.
Aus den allgemein gültigen 17 SDGs lassen sich ebenso spezielle Handlungsfelder für einen nachhaltigen Tourismus ableiten, die über die für den Tourismus naheliegenden Forderungen von intakten Ökosystemen an Land und im Wasser hinausgehen. Aspekte der sozialen, ökonomischen wie institutionellen Nachhaltigkeit müssen auch als Herausforderungen und Ziele für die Tourismusbranche gesehen werden.
➲ Reflexionsfragen
Welche SDGs haben eine besondere Relevanz für Destinationen in Entwicklungsländern? Begründen Sie Ihre Zuordnungen!
Welche Voraussetzungen müssen existieren oder erst geschaffen werden, damit das SDG 5 umgesetzt werden kann? Welche Handlungsfelder gibt es dabei? Eine gute Quelle für den Einstieg in das Thema: 🔗 https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/gleichberechtigung/
Welche Rolle kann der Tourismus bei einer Gleichstellung der Geschlechter spielen? Welche Beobachtungen haben Sie vielleicht auf Ihren Reisen gemacht?