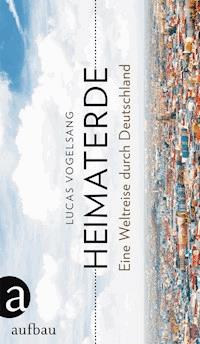10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
König Otto auf dem Thron. Der Kaiser in New York. Ein Torhüter als Wrestler. Fußball war immer schon mehr als nur Fußball. Deshalb macht sich Lucas Vogelsang auf den Weg, an die Ränder des Spiels, zu den Helden von einst, trifft Paul Gascoigne und Vinnie Jones in England, Mehmet Scholl in München und Rehhagels rechte Hand in Thessaloniki. Er tanzt mit Beckenbauer und Pelé im Studio 54, wirft sich mit Tim Wiese in den Ring und geht mit Häßler, Legat und Hartwig in den Dschungel. So sind seine NACHSPIELZEITEN eine Reise durch die Bilder und Biografien. Aber vor allem eine große Liebeserklärung an den Fußball und die Menschen, die ihn prägen. Wie konnte Otto Rehhagel 2004 Europameister werden, Paul Gascoigne in einer einzigen Nacht ein ganzes Land verändern und Franz Beckenbauer Ende der Siebzigerjahre New York erobern? Lucas Vogelsang schaut noch einmal genau hin und erzählt in seinem neuen Buch von den langen Augenblicken nach dem Abpfiff, dem schnellen Leben nach der Karriere, den kleinen und großen Dramen des Spiels. So nimmt er uns mit, auf eine Ehrenrunde durch die Momente und Zitate, hinein in die Erinnerungen und den Jubel. Und liefert damit, ganz nebenbei, auch die nächste Ladung Legenden. Seine NACHSPIELZEITEN sind eine literarische Verbeugung. Vor dem Fußball. Und den Menschen, die ihn prägen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Lucas Vogelsang
Nachspielzeiten
Denn der Fußball schreibt die besten Geschichten
TROPEN SACHBUCH
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Tropen
www.tropen.de
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover-Gestaltung und Illustration: © www.handsofgod.football
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-50224-4
E-Book ISBN 978-3-608-12233-6
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Das Spiel, die Welt und ich
Die Stimme des Königs
Otto, die Griechen und das Wunder
Looking for Mehmet
Scholl, die Witze und der deutsche Fußball
Profis unter Palmen
Die Männer, der Dschungel und die Authentischkeit
Die Rollen seines Lebens
Tim Wiese, der Mensch und die Maschine
Der Plattenspieler
DJ Ferry, die alte Dame und die Musik
Gute Freunde kann niemand trennen
Der Kaiser, der König und die große Liebe in New York
Schweine und Diamanten
Gazza, Vinnie und der lange Kampf
Hintermannschaft
Football, bloody hell!
Sir Alex Ferguson
Alles, was ich über Moral undVerpflichtungen weiß,verdanke ich dem Fußball.
Albert Camus
Vorwort
Erzählen ist das einzige Spiel, das zu spielen sich lohnt.
Federico Fellini
Sie sprechen mit den Füßen, die beiden Jungen im Hof. Zwischen den Pinien. Ich sitze auf meinem Balkon, während die Hitze des Tages das Tal verlässt, und höre ihnen zu. Höre ganz genau hin. Unten das Geräusch des Balles, der getreten wird. Der Ball auf Stein, immer hin und her, bald Melodie.
Die beiden Jungen spielen, gemeinsam. Der eine, zehn Jahre alt vielleicht, stammt aus Frankreich. Seine Mutter liegt hinten am Pool. Der andere, etwas älter wahrscheinlich, kommt aus Polen. Sie sind sich gerade erst begegnet. Ein Urlaubsmoment, hier in Kroatien. Sie kennen die Wörter des anderen nicht. Aber dort unten, zwischen den Büschen, lag dieser Ball. Und mehr brauchten sie nicht.
Jetzt spielen sie, wortlos fast, seit bald einer Stunde. Immer hin und her. Der Ball auf Stein, er hat kaum noch Luft, schabt über den Boden, klatscht gegen umliegende Stämme.
Es gibt keine Tore und auch kein Feld. Die Jungen zählen nicht mit, ihr Spiel hat kein Ziel, aber das kümmert sie nicht. Es geht nur um den Ball, so unterhalten sie sich.
Jeder Pass eine Frage, jeder Schuss eine Antwort. Es ist ihre Sprache. Die Bewegungen, sie sind fließend darin.
Fußball, an diesem Abend mehr als genug.
Und ich sitze oben auf dem Balkon und muss an die zurückliegenden Tage denken, die lange Fahrt von Split nach Dubrovnik. Rechts immer das Meer, links immer die Hügel, die Hänge. Aber vor allem die Mauern, Häuserwände, Steilklippen aus Beton. Darauf die Farben des Fußballs, nicht zu übersehen. Gigantische Graffiti, oft meterlang und meterhoch. Überall am Wege. Das rot-weiße Schachbrett der kroatischen Flagge, ein blauer Ring drum herum.
Die Farben von Hajduk, dem Verein hier am Meer.
Der gefährliche Stolz der Region, als würde er jeden Moment durch den Stein brechen.
Der Fußball, als wäre er Amtssprache hier.
Er hatte mich über Stunden begleitet.
Und in den Hütten, den kleinen Läden an den Hauptstraßen der Küstenorte, hingen gleich auch die passenden Trikots, natürlich schlechte Kopien. Modrić wie selbst gemalt, Perišić aus Polyester, Srna als Souvenir.
20 Euro, guter Preis. Helden für die Kinder am Strand.
Kroatien, Vizeweltmeister von 2018 und seit jeher bekannt für feine Füße und faschistische Freunde, hatte in diesem Sommer mal wieder ein Finale erreicht.
Nations League gegen Spanien, und die Flaggen hingen aus den Fenstern, schlaff, aber doch stolz in der Mittagsglut.
Der Fußball war in den Bars und in den Cafés, in den Schlagzeilen und in den engen Gassen am Rand.
Der Fußball, man entkommt ihm halt nicht.
Er lehnt an der Leitplanke.
Ein Anhalter, lächelnd im Rückspiegel.
Er steht als Rentner am Kiosk.
Oder im Blaumann zwischen den Zapfsäulen.
Er liegt an der Kasse, zwischen Kippen und Bier.
Er kennt keine Grenzen und ist meist vor dir schon da. Und, ehrlich gesagt, hatte ich ihn ja selbst mit dabei. Sauber verstaut. Der Kofferraum immer übervoll mit Momenten, seit Jahren unsichtbares Gepäck. Schließlich wusste ich, dass er mir nützlich sein würde.
Ein Kamerad, ein Freund in der Fremde.
Am Nachmittag dann, ein Tal im Hinterland von Dubrovnik, die Unterkunft noch weitestgehend verlassen, saß ein junger Schotte am Pool, die Waden im Wasser, ein Buch auf den Schenkeln. Das Cover war grün, weiße Linien dazu.
Ein Fußballfeld, Pfeile und Kringel. Taktische Striche.
The Mixer, das war der Titel.
The Story of Premier League Tactics.
Von hoch und lang zur falschen Neun.
Damit, eh klar, hatte er mich schon.
Als er schließlich aufstand und mir ein Getränk anbot, Gin Tonic aus der Dose, kamen wir gleich ins Gespräch. Er war Lehrer. Oberstufe, Psychologie und Sport, vor allem aber ein leidenschaftlicher Anhänger des Heart of Midlothian, Mittelmaß aus Edinburgh. Zuletzt abgeschlagen Vierter, sagenhafte 45 Punkte hinter Celtic, dem Dauermeister aus Glasgow. Ein hoffnungslos Verliebter also auch.
Die Hearts, darauf einigten wir uns schnell, waren im Grunde die schottische Hertha. Von windigen Präsidenten verraten, mit Punktabzügen bestraft. Die letzte Meisterschaft Jahrzehnte her. Womit wir das Schicksal der Sehnsüchtigen teilten, das dumpfe Dümpeln zwischen Tradition und Tristesse, und darauf natürlich noch einen trinken mussten.
Der Schotte holte noch zwei Gin Tonic.
Stimmungsdoping. Wacholder gegen den Wahnsinn.
Die Sonne brannte in den Nachmittag, nur die Zikaden waren zu hören. Und dort am Pool, wie zur Abkühlung, sprangen wir bald mit dem Kopf voran in die Geschichte des englischen Fußballs.
Cantonas Kragen und Fergusons Föhn.
Alan Shearer und die ersten Buden in Blackburn.
Beckham und die Klasse von 92.
Tony Adams und der Alkohol.
Und natürlich, es dauerte vielleicht fünf Minuten, standen wir schließlich auch auf dem Rasen von Wembley, Sommer 1996, 79. Minute. Zwischen uns, und gleich wieder zum Greifen nahe, Paul Gascoigne. Das Gesicht leuchtreklamerot, die Haare wasserstoffblond. Für immer 29 Jahre alt. Gazza aus der Konserve, unverbraucht in der Erinnerung.
Und er hebt den Ball über Colin Hendry, tritt dann den Ball in die Maschen. Das Tor des Turniers, der Jubel danach. Das ist hängen geblieben. Gänsehaut, auch bei 30 Grad im Schatten.
Gascoigne, sagte der Schotte schließlich.
Und schüttelte den Kopf dabei.
Dann musste er lachen. Weil wir hier am Beckenrand, schon leicht einen sitzen, natürlich die große Demütigung seiner Heimat beklatschten, die so schmerzhafte Niederlage gegen den immer schon übermächtigen Nachbarn, diesen Auld Enemy. Und weil er dennoch nur schwärmen, das Tor, den Kommentar des Reporters, den Jubel danach, immer noch auswendig konnte.
Gazza, bloody hell! Ein Genie, über Grenzen hinweg.
Die Neunziger, sie waren auch sein Jahrzehnt. Und natürlich kannte der Schotte alle Geschichten. Und jede Schlagzeile noch obendrein. Den Griff in die Eier, den Absturz mit der Sporttasche, die Talkshow-Auftritte und Entziehungskuren.
The Dentist Chair Incident.
Weshalb wir nun also, nach zwei weiteren Drinks, mittlerweile Staropramen aus der Flasche, leichtfüßig mit Anekdoten jonglierten, uns die Momente zuschoben. Und damit in diesen angenehmen Strudel gerieten, diesen gemeinsamen Rausch, wenn aus Orten Wegmarken werden.
Und aus Namen Vokabeln.
Doppelpässe, bis in den Abend hinein.
Das also, dachte ich dann, geht noch immer.
Das hat sich, Fußballgott sei Dank, nicht verändert.
Denn schon früher, unterwegs in der Welt, habe ich auf die irgendwann gestellte Frage, wie viele Sprachen ich eigentlich spreche, immer wahrheitsgemäß und ohne Zögern geantwortet.
Drei.
Deutsch, na klar.
English, for sure.
Und Fußball.
Ging gar nicht anders, stimmte ja auch. Fußball war mein persönliches Esperanto, immer schon. Er konnte Türen und Menschen öffnen, Verbündete schaffen. Im Abteil eines Zuges, an der Theke einer schummrigen Spelunke, auf der Sonnenliege eines Sternehotels. Ganz egal. Weil oft schon wenige Silben reichten, Beckenbauer, Pelé, um sich selbst im Unbekannten wiederzuerkennen, im Gegenüber Gemeinsamkeiten zu finden. Eine Grundlage, für die dann sowieso folgenden Gespräche. Diese von großen Gesten begleiteten Geschichten, fast pathologische Pantomimen.
Die Hand Gottes.
Der Kopfstoß Zidanes.
Zlatans Scherenschlag.
Fußball, erklärte der ungarische Schriftsteller Péter Esterházy im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2006, ist, eher noch als das Christentum, längst Weltsprache.
Ein Satz, der zwar als Provokation gedacht war, der Wirklichkeit aber sehr nahekam, weil es da draußen, in Südafrika, Brasilien oder Vietnam, ja durchaus Menschen geben soll, die heute, statt eines beliebigen Bibel-Psalms, viel eher die Aufstellung des FC Barcelona auswendig aufsagen können, beten sie doch, das Stadion als Hochamt, längst zu anderen Göttern.
Fußball, das Evangelium nach Matthäus.
Die Gespräche, das habe ich oft genug erlebt, in Kapstadt oder in Rio, in Sydney, in Liverpool oder Berlin, ähneln sich dann. Weil das Vertraute am Ende Vertrauen schafft. Gerade, wenn Fußball die einzige Möglichkeit ist, sich überhaupt zu verständigen.
Dann hilft Schweinsteiger gegen das Schweigen.
Und Lewandowski über die ersten Lücken hinweg.
In Thailand, Jahre her, wohnte ich einmal in einer staubigen und tagsüber eher unaufgeregten Seitenstraße, abends aber wurde es schlagartig dunkel, dann begann das Blinken der Bordelle, und mittelalte Männer in Hawaii-Hemden, Glatzen und Golduhren, warfen gierige Blicke, Ausschnitte wie Auslagen. Es roch nach billigem Sex.
An diesen Abenden, die Luft klebrig fast, saßen immer vier sehr lustige Typen auf der schmalen Holzveranda der kleinen Pension. Junge Thailänder, die Ketten trugen und Kette rauchten, die Zähne vom Tabak längst gelb. Sie verdienten ihr Geld, indem sie ihre Roller an schwere Touristen und leichte Mädchen vermieteten. Dann sahen sie den ungleichen Paaren hinterher, spuckten in den Sand, und lachten in den Rauch hinein.
Einer von ihnen hieß On.
Und On wollte sich gern unterhalten. Was jedoch gar nicht so leicht war, weil sein Englisch vor allem aus bunten Bruchstücken und ein paar wenigen, dafür aber umso ausgelatschteren Floskeln bestand. Ladyboy. Germany! Boom, boom! Damit, das merkten wir schnell, würden wir nicht weit kommen.
Weil On aber ein wirklich lustiger Typ war, mit einem Lächeln, so breit, es schien sein Gesicht jedes Mal in zwei Hälften zu teilen, und weil er sich nun mal so gern unterhalten wollte, entschied er sich für die Sprache, die wir beide verstanden.
Fußball.
So tippte er mir, in Abständen von etwa fünf Minuten, an den Arm, die Augen weit aufgerissen und stellte dann großartig groteske Halbsätze in die Gegend.
Germany, very good. Bayan Munschen, Bäckenbaua! Chwaine Staiga, yes yes!
Dann nickte ich. Und er nickte auch, sichtlich zufrieden.
So richtig los ging es allerdings erst, nachdem ich ihm meinen eigenen Namen verraten hatte.
Ah, sagte er da, Lukas! Germany, Lukas Podolski. Very good. But I am Klosi! Klosi, very good.
Dann grinste er wieder und sah dabei tatsächlich so aus, als würde er dort auf der Veranda auch gleich den entsprechenden Salto machen. Und obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass On mit der SG Blaubach-Diedelkopf und dem FC Homburg eher weniger anfangen konnte, hatten wir nun unser Thema gefunden. Denn ausgehend von Klosi, very good, lächelte er sich nun einmal von vorne nach hinten, und in wirklich wilder Betonung, durch den Kader der Nationalmannschaft.
Mertesucker, big big!
Shaneida, Leeman, yeah!
Hin und wieder legte ich einen Namen in die Pausen.
Michael Ballack, remember?
Bis aus der Mannschaft ein Mantra wurde, ein Wechselgesang. Panini in Phuket.
On und ich, wir verstanden uns prächtig. Am Ende las er mir aus der Hand. Und am Morgen meiner Abfahrt schenkte er mir noch einen Talisman, einen Anhänger mit dem Bildnis einer thailändischen Gottheit, umarmte mich dann.
Lukas Podolski, sagte er in den Abschied hinein, Germany. Klosi!
Daumen hoch. Mehr musste er gar nicht sagen. Ich wusste ja genau, was er meinte.
Fußball, damit können Freundschaften beginnen. Selbst dann, wenn man anfänglich eher wenig gemein hat.
Ein anderes Beispiel, Frühsommer auf Kreta, erzählt davon. Denn dort, am Flughafen von Chania, lernte ich Jiannis kennen.
Er ist Taxifahrer, seit 15 Jahren bestimmt. Und Olympiakos-Fan, sein ganzes Leben bereits. Wie die Männer in Split brennt er für seine Mannschaft am Meer. Und sobald es Zeit und Geld zulassen, fliegt er aufs Festland, Spieltag am Hafen, und steht mit den anderen im Feuer der Kurve. In seinem Wagen, das Lenkrad lässig in einer Hand, die Serpentinen hinter geöffneten Fenstern, spricht er nur wenig. Da bringt ihn nichts aus der Ruhe. Doch geht es um Fußball, kann er sehr schnell sehr wütend werden.
Und laut.
Und Jiannis kann fluchen, Malaka.
Wenn die Trottel vom Festland mal wieder einen sicheren Sieg verschenkt, oder, Gott bewahre, das Derby gegen Panathinaikos verloren haben. Dann brennt er im Auto, dann beschlagen die Scheiben.
Das alles weiß ich mittlerweile, wir haben schon oft gemeinsam geschimpft. Zu Beginn aber war da nur Schweigen. Da lehnte er an der Motorhaube seines Wagens, abholbereit, schwarzes T-Shirt und schwarze Jeans, die Scheiben getönt, die Sonnenbrille verspiegelt, lächelte knapp und wuchtete mein Gepäck in den Kofferraum. Dann fuhren wir los.
Vor uns lagen anderthalb Stunden Fahrt, über die Berge der Insel, sehr enge Kurven, Hinterlandschaften, und Jiannis hatte keine Lust auf Gespräche. Er war nicht wie On, er wollte sich nicht unterhalten. Also rollten wir erst mal wortlos, die Stimmung karg wie das Land.
Dann musste er tanken. Und ich kaufte zwei Bier. Eins für den Weg und eins für den Strand. Nach dem ersten bereits beugte ich mich nach vorne und fragte ihn einfach, nach seinem Verein. Damit war die Stille vorüber. Denn plötzlich saßen auch die Namen im Fond, rot-weiße Legenden. Die Heiligen von Piräus. Olympioniken, lorbeerkranzgekrönt.
Rivaldo, der große Brasilianer mit den falschen Zähnen. Oder Christian Karembeu, Weltmeister und später Berater des Klubs. Und schließlich auch Stelios Giannakopoulos und Antonios Nikopolidis, die beiden Griechen, Europameister 2004.
Ich kannte die meisten, das beeindruckte ihn.
Und weil wir dort nun mal durch Griechenland fuhren und weil sich unsere Erzählungen ohnehin schon in Richtung Olymp bewegten, Fußballgötter überall, stellte ich schließlich auch den König dazu.
Otto Rehhagel, seit zwanzig Jahren Volksheld.
Und Jiannis erzählte mir von jenen Tagen, in denen der Deutsche den Griechen ihren Stolz zurückgegeben hatte, und von den Nächten dazu, in denen an Schlaf nicht zu denken war, das ganze Dorf auf den Beinen, das ganze Land auf den Straßen. Die Sensation in der Luft, ein Flirren.
Eine nationale Aufregung.
Wenn die Spiele liefen, sagte Jiannis, standen die Fernsehgeräte vor den Wohnungen.
Die Mannschaft auf dem Bürgersteig, dann ergoss sich der Jubel in die Gassen.
Das, sagte er, werde ich niemals vergessen.
Und ich erzählte ihm von meiner Begegnung in Frankfurt, Rehhagel in der Kabine.
Kunstrasen, am Rande der Stadt. Länderspiel der Autoren, am Rande der Buchmesse. Erzählte also, wie ich einmal wirklich für den König verteidigen durfte, den Adler auf der Brust. Zweikämpfe gegen Norwegen. Und wie Otto, achtzig Jahre alt damals, zumindest versuchte, einer übersichtlich talentierten Mannschaft Tugend und Tradition an die Seite zu stellen.
Meine Herren, Sie müssen mit dem Kopf spielen!
Meine Herren, einsneunzig kann man nicht trainieren!
Meine Herren, wie Schiller schon sagte.
Die Bürgschaft in Ballonseide.
Rehhagel, sagte ich schließlich, what a show!
Und Jiannis schaute mich an, Unglaube im Schulterblick, dann machte er ein schnalzendes Geräusch mit der Zunge, das wohl Anerkennung ausdrücken sollte.
Rehhagel, Malaka! Nicht schlecht.
Seither sind wir so was wie Freunde, seither begrüßt er mich am Flughafen mit einem Lächeln und zwei Dosen Bier in der Hand. Eins für den Weg und eins für den Strand. Dann fahren wir über die Berge, tauschen Transfergerüchte, Wechselabsichten und Europacup-Träume.
Sehnsucht in den Serpentinen, Kurvendiskussionen.
Fußball, wir sind fließend darin.
Die Stimme des Königs
Meine Spieler sagen immer: Der Ioannis redet wie ich, nur auf Griechisch.Wir sprechen die gleiche Fußballersprache.
Otto Rehhagel
Wenn Rehhagel etwas Negatives gesagt hat,habe ich das einfach ein bisschen anders übersetzt.Mit Zuckerguss überzogen.
Ioannis Topalidis
Dann ist dieses Finale wirklich vorbei.
Abpfiff im Estádio da Luz, erstmal Stille in Lissabon.
Dann ist wirklich wahr, was vier Wochen zuvor noch undenkbar schien. Eine Unmöglichkeit, von Experten belächelt, von Buchmachern gefürchtet.
Eine Anomalie der Geschichte.
Die Griechen, selbst unter Außenseitern noch Außenseiter, sind Europameister. Otto Rehhagel, der Trainer aus Deutschland, hat diesem Turnier und damit sich selbst die Krone aufgesetzt. Es ist, das schwingt in den Stimmen, dem Überschlag der Reporter, schlichtweg nicht zu fassen.
A footballing fairy story, schreit der englische Kommentator.
Ein Märchen. Die Krönung. Und, natürlich, ein Wunder.
Denn drunter, das wissen die Menschen in Bremen und Kaiserslautern, in Berlin und Uerdingen seit Jahren, macht es Otto Rehhagel nicht.
Das Wunder von der Weser.
Das Wunder vom Betzenberg.
Jetzt, 4. Juli 2004, weiß es auch der Rest der Welt.
Das Wunder von Lissabon.
Das Unfassbare, wie in Stein gemeißelt, später in das Silber der Trophäe gefräst. Ein Coup, als hätten die Griechen den Pokal gestohlen, den Gastgeber beraubt.
Die Spieler, strahlend in weißen Trikots, sinken auf den Rasen. Selbst noch nicht sicher, ob das wirklich stimmen kann. Dieses 1:0 auf der Anzeigetafel.
So knien sie im Augenblick. Und Antonios Nikopolidis, der Torwart, liegt wie niedergestreckt in seinem Strafraum, im Gesicht ein griechisches Grinsen.
Dann tollt der König über den Platz, nicht mehr zu halten. Rehhagel, im schwarzen T-Shirt, drei Streifen auf der Schulter. Er hüpft, er lacht, herzt seine Spieler, herzt jeden, der ihm dort unten auf dem Rasen begegnet. Jeden, der gerade in der Nähe ist, als wüsste er gar nicht, wohin mit all dieser Freude, die Genugtuung ist und Erleichterung gleichermaßen.
Rehhagel, durch den Trubel hindurch.
Und irgendwann, es mögen Minuten vergangen sein oder doch nur Sekunden, findet er auch jenen Mann, der das alles, dieses noch größere Wunder, Otto auf dem Olymp, überhaupt erst möglich gemacht hat. Durch seine Sprache, seinen Einsatz bis zur Erschöpfung. Und der sich selbst jetzt noch, in der Umarmung seines Liberos, dem 1,96 Meter großen Traianos Dellas, ebenfalls übermannt, in diesem kolossalen Durcheinander der Euphorie also, an sein Notizheft klammert, fest in der rechten Hand, als würde es sonst verloren gehen. Darin doch all die Geheimisse und Kniffe der vergangenen Wochen, darin die Beobachtungen und Formeln, die Taktik, und vielleicht sogar das Rezept für diesen unwahrscheinlichen Triumph.
Ioannis Topalidis, als könnte er noch nicht loslassen.
Er ist Rehhagels Co-Trainer, er ist der Assistent. So steht es auf der Arbeitskarte, die er an einem Band vor dem Bauch trägt. Aber eigentlich ist er viel mehr als das. Topalidis ist seinem Chef in den vergangenen Monaten selten von der Seite gewichen, hat Brücken gebaut und die Ansprachen des Trainers, oft deutsches Graubrot, mit ordentlich Honig bestrichen.
Er ist, das wird der Spiegel später schreiben, der heimliche Star dieses Sommers.
Der unbesungene Held.
Und Otto Rehhagel öffnet die Arme, weit, es gibt ein Foto davon, für die Ewigkeit, dann springt er Topalidis auf den Rücken. Dann, Medaillen um den Hals, fallen sie gemeinsam durch die Nacht.
Ein Trainer ohne Sprache, so hat es die WELT einmal geschrieben, ist nackt.
Wenn das stimmt, hat Ioannis Topalidis damals, im Sommer 2004, den König eingekleidet. Dann war er, mit dem hier passenden Pathos gesprochen, der Schneider des Erfolgs.
Der Mann mit den Fäden in der Hand.
Doch wenn man ihn heute, bald zwei Jahrzehnte später, danach fragt, auf einer Terrasse in Thessaloniki, im Rücken das Meer, winkt er ab. Sofort. Lächelt und verwehrt sich, bewusst bescheiden. Und fängt stattdessen zu schwärmen an. Von Rehhagel, seinem Freund, von der gemeinsamen Zeit. Dann rückt er hinein in den Rückblick, bestellt einen griechischen Kaffee und ist sofort wieder in der Geschichte. Da braucht es nicht viel, da reicht ja ein Stichwort, eine Szene nur. Dann sitzt er gleich wieder an der Seite des Chefs, mit Otto auf der Bank. Und es ist, unmittelbar, noch etwas anderes zu spüren.
Der besondere Stolz, auf das Erreichte. Europameister 2004, Topalidis trägt diesen Titel wie einen Titel. Es ist die Trophäe seines Lebens, sie hat seine Biografie veredelt.
Aber wie, bitte schön, war das überhaupt möglich? Und, wenn wir schon mal dabei sind, wie wurde er, ein Namenloser zuvor, die Stimme des Königs?
Ioannis Topalidis lächelt. Und kehrt dann zurück, in den Sommer 2001.
Gerhard Schröder ist Kanzler, die Deutschen zahlen noch mit der D-Mark.
Und Otto Rehhagel, die große Überraschung, wird Nationaltrainer Griechenlands.
Denn am 9. August, während er daheim in Kaiserslautern noch mit Freunden und Familie seinen 63. Geburtstag feiert, bestätigt der griechische Fußballverband ein schon seit Tagen hartnäckiges Gerücht.
Ja, der Deutsche macht es! Otto kommt.
Vertrag bis 2004, 880 000 Mark Jahresgehalt, ein goldenes Willkommen.
Wir wollten, so heißt es in einem eifrigen Schreiben aus Athen, unserem neuen Trainer eine Freude zu seinem Geburtstag machen.
Das neue Amt also auch ein präsidiales Präsent.
Ob das Geschenk so toll ist, erklärt Otto Rehhagel daraufhin in einer improvisierten Antrittsrede, wird sich noch herausstellen.
Es ist, sagt er, eine schwierige und interessante Aufgabe.
Und natürlich lauert da schon der Herkules zwischen den Zeilen. Und Atlas sowieso, die ganze griechische Mythologie, die ihn von nun an begleiten wird.
Denn die Botschaft ist klar.
Rehhagel, gerade ein Jahr zuvor in Kaiserslautern entlassen, soll die Griechen zur Europameisterschaft in Portugal führen, auf seinen Schultern über den Kontinent tragen.
Wenige Tage später wird er auch offiziell vorgestellt, auf einer etwas behelfsmäßig zusammengezimmerten Pressekonferenz am Flughafen von Athen. Ein Interview-Marathon, die Journalisten dicht an dicht. Schon seine ersten Antworten erzeugen ein Echo.
Rehhagel bei den Griechen, das ist eine große Sache.
König Otto, so beherrscht er die Schlagzeilen.
Und da, erinnert sich Ioannis Topalidis jetzt, haben sich dann gleich die ersten Freunde bei mir gemeldet. Der Rehhagel, haben sie gesagt, der sucht doch bestimmt einen griechischen Co-Trainer. Der wird natürlich auch ein paar deutsche Trainer mitbringen, aber einen Griechen braucht der auf jeden Fall. Ioannis, haben sie gesagt, du bist doch Fußballlehrer, du bist genau der richtige Mann.
Und Topalidis muss schmunzeln. Vielleicht, weil er heute weiß, dass sie recht hatten.
Ganz so, als hätte seinem Lebenslauf, dieser Biografie des Gastarbeiterkindes, immer eine gewisse Zwangsläufigkeit innegewohnt. Und als hätte er im Grunde nur auf diesen einen Moment hingearbeitet. Vierzig Jahre lang. Mit jeder Reise, in jedem Training.
Ioannis Topalidis war schon immer Vermittler, zwischen Ländern. Ein echter Schwabe, mit griechischem Pass. Einer für hüben. Und drüben.
Mein ganzes Leben, sagt er, war immer hin und her.
Immer hin und her. Dann erzählt er davon.
Ioannis Topalidis wurde in Stuttgart geboren.
1962, da war Otto Rehhagel, 23 Jahre älter, schon Spieler bei Rot-Weiß Essen.
1962, da gab es die Bundesliga noch nicht.
Seine Eltern, ein Jahr zuvor nach Deutschland gekommen, hatten gleich richtig Arbeit. Was gut war. Aber wegen der Arbeit nicht mehr viel Zeit, was eher schlecht war. Sie haben gebuckelt. Geschafft, wie man in Stuttgart sagt, Gastarbeiterländle. An den Maschinen, am Band, Wirtschaftswundermenschen. Und deshalb, müde Körper und schwere Herzen, bald schon entschieden, den Sohn, gerade neun Monate alt, zur Großmutter zu geben. Nach Hause, in die Obhut der Oma. Kozani, Westmakedonien. Eine kleine Stadt in den Bergen, während des Zweiten Weltkriegs von der Wehrmacht besetzt. Roter Safran in der Gegend, anderthalb Autostunden nach Thessaloniki.
Dort ging er zur Schule, dort wuchs er heran.
Und kam erst 1968 zurück, sechs Jahre alt mittlerweile. Dann lernte er Deutsch. Und entdeckte den Fußball für sich. Weil sein Vater, der mittlerweile ein Restaurant betrieb, dort zusammen mit anderen Griechen eine eigene Liga gegründet hatte und gleich auch Präsident der eigenen Mannschaft geworden war.
Olympias Gerlingen, Heimspiele gegen das Heimweh.
Und da, sagt Topalidis, bin ich mitgelaufen. Immer im Trikot, immer mit einem Ball unter dem Arm.
Der Sohn des Präsidenten, der Rasenplatz als Kinderstube. Halb vier als Heimat, natürlich verliebte er sich. In dieses Mannschaftsgefühl, in die langen Nachmittage, neben den Kabinen und hinter den Toren, an denen nichts wichtiger schien als das nächste Spiel.
In diesen Ort auch, Fußball, an dem Männer weinten, vor Glück und vor Schmerz, und plötzlich zu singen begannen, aus vollem Halse. Ein Leben zwischen frisch gekalkten Linien, erste Versuche am Kopfballpendel. Der Geruch von Grashalm am Morgen.
Er fing dann bald selbst an, verbrachte seine Jugend bei der SpVgg 07 Ludwigsburg, beim Stuttgarter Sportclub. Ein Sechser, ein Arbeiter. Grätschen und Fleiß.
Ioannis, der Läufer. Eine Maschine, er schaffte im Mittelfeld. Und lebte weiterhin in zwei Ländern.
Ging nach Griechenland, machte seinen Abschluss am Gymnasium in Kozani.
Und kam wieder zurück. 18 Jahre alt.
Ging nach Griechenland, studierte Sport an der Universität in Thessaloniki.
Und kam wieder zurück. Ein Erwachsener jetzt.
Hin und her.
Längst Pendler, auch zwischen den Sprachen.
Der Deutschgrieche, sein europäischer Spagat. In beiden Ländern zu Hause, in keinem wirklich daheim.
Was immer blieb, war der Fußball.
Ioannis Topalidis, das hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren nicht geändert, liest genau zwei deutsche Zeitungen.
Den Montags-kicker.
Und den Donnerstags-kicker.
Das reicht ihm. Mehr braucht es doch gar nicht.
Ich bin fußballverrückt, sagt er, mein ganzes Leben schon.
Ohne das Spiel wäre er niemand.
Ohne das Spiel, das ginge halt nicht.
Wenn Fußball jemals verboten würde, das hat einer der Griechen damals gesagt, dann beginge der Topalidis Selbstmord. So erzählt es der Topalidis. Und lacht.
In Esslingen dann, Eintracht in der Landesliga, wurde er Spielertrainer, der eigene verlängerte Arm, kümmerte sich jetzt auch um Taktik, um Auf- und Einstellung, und damit, das bleibt ja nicht aus, um die Befindlichkeiten der Mitspieler, die Eigenheiten und Egoismen. So eine Fußballmannschaft, das weiß jeder, der mal Teil einer Kabine war, ist ein sensibler Organismus, eine vor Testosteron triefende Großfamilie, bei der im Grunde immer Weihnachten ist, an jedem Wochenende Bescherung, der Baum also ständig brennt. 23 Körper mit eigenen Köpfen. Das muss man wollen.
Und Topalidis wollte. Er liebte alles daran. Die Taktiktafel und das Training, die Kreide an den Händen, die Linien- und die Waldläufe. Und die Siege natürlich, wenn aus Theorien schließlich Tore wurden, aus Pfeilen Läufe und aus Strichen Pässe.
Dieses Gefühl, die Fäden in der Hand zu halten.
Da, sagt er, hat es klick gemacht. Da wusste ich, dass ich als Trainer arbeiten möchte.
So machte er seine Scheine, A-Lizenz, B-Lizenz, wurde Praktikant beim VfB, Meisterjahr unter Daum, und bewarb sich schließlich in Köln. An der Sporthochschule, um Fußballlehrer zu werden. 1994, während der WM in den USA.
Das, sagt er, war ein richtiges Studium.
Da musste er, um überhaupt dabei sein zu dürfen, eine Prüfung bestehen, dann lange warten. Bis das Glück im Briefkasten lag.
Als ich die Zusage bekommen habe, erinnert er sich jetzt, war das für mich, als hätte ich im Lotto gewonnen.
Er lacht. Ein Sechser, mit Zusatzzahl.
Den Brief hat er heute noch immer, sicher verwahrt.
Fußballlehrer, vielleicht das deutscheste Wort, das er kennt. Den Abschluss, Außenseiter zwischen Ex-Profis, schaffte er locker. Sammer cum laude.
Danach, sagt Topalidis, war für mich auch klar, dass ich etwas im Profifußball machen möchte. Aber ich habe auch schnell gemerkt, dass es nicht so einfach ist, dort Fuß zu fassen.
Der große Traum, Trainer ganz oben, blieb erst mal unerfüllt. Und Topalidis, immer schon gutes Auge, tingelte durch die Branche, lebte am Rande des Spiels, wurde Scout, ein Beobachter nur. Der Mann mit dem Notizbuch, einer der Namenlosen auf den Tribünen, Späher genannt. Ein Zuarbeiter im Hintergrund. Er konnte den Rasen riechen, er war wirklich nah dran. Und doch sehr weit weg.
Die Bundesliga wie hinter Plexiglas.
Scout sein, sagt er heute, das war ja nur die zweitbeste Lösung. Doch im Kopf hatte ich schon aufgegeben. Trainer, habe ich mir gesagt, das wird nichts mehr.
Ioannis Topalidis, als wäre ihm der Lottoschein, irgendwo auf dem langen Weg zwischen Stuttgart, Köln und Berlin, einfach aus der Hosentasche gefallen, das nie eingelöste Versprechen.
Und dann, sagt er jetzt, kam die Situation mit Rehhagel.
Das Schicksal, doch noch Glück im Spiel.
Im Spätsommer 2001 hat er die Freunde im Ohr. Ioannis, das wäre doch was! Da liest er die Schlagzeilen, in beiden Sprachen. Und versucht dann, Kontakt aufzunehmen. Beginnt, sich umzuhören. Bei den anderen Scouts, auf den Tribünen. Möchte wissen, ob jemand vielleicht einen Draht legen kann, möglichst direkt.
Zu Rehhagel, in Kaiserslautern.
Zu Otto, in Athen.
Die meisten weisen ihn ab, zucken nur immer wieder mit den Schultern. Dann aber trifft er einen, der die Nummer von einem hat, dem Rehhagel angeblich vertraut.
Ein Bekannter, der schon engere Kreis.
Eine Verbindung, er nähert sich an.
Ioannis Topalidis, er wählt diese Nummer.
Es ist ein kurzes Telefonat. Nein, sagt die Stimme am anderen Ende der Leitung, der Otto hat sich noch nicht entschieden. Aber, Herr Topalidis, schicken Sie mir doch mal eine Bewerbung. Dann schauen wir weiter.
Also steckt Ioannis Topalidis seinen Lebenslauf in einen Briefumschlag und bringt ihn zur Post. Der lange Einwurf. Wartet dann, mal wieder, auf das Glück. In jenen Tagen, in denen die Griechen bereits unruhig werden.
Zunächst jedoch hört er nichts, bleibt die erhoffte Antwort erst einmal aus.
Dann aber spielen Rehhagel und die Griechen in Helsinki. Das erste Pflichtspiel des neuen Trainers, WM-Qualifikation. Die berühmte Standortbestimmung, sie gerät zur Demütigung. Denn die Griechen, erst kopf- dann chancenlos, werden von den Finnen überrannt, vorgeführt. Am Ende steht ein 1:5. Das Ergebnis, so heißt es dann meist, auch in dieser Höhe verdient.
Rehhagel-Debakel zum Einstand, schreibt der kicker.
Otto Rehhagel, so liest es sich, ist bereits nach wenigen Wochen gescheitert.
Eine Fehlbesetzung. Und in den Tagen danach entlädt sich der angestaute Frust der Griechen, mischt sich ihre Enttäuschung über die Niederlage mit der allgemeinen Verwunderung über einen Trainer, der bisweilen unnahbar wirkt, selbstherrlich und entrückt. Ein König, der, obwohl ihm Verbandspräsident Vassilis Gagatsis zum Antritt eine Villa gemietet hatte, lieber von Deutschland aus regiert. Mit der Arroganz des Ausländers, der sich weigert, die Sprache seiner neuen Heimat zu lernen.
Die Griechen, sie lehnen ihn ab.
Der Meister als großes Missverständnis.
Otto Rehhagel, so ist er ein Herrscher ohne Staat. Und die ersten Journalisten rollen die Guillotine auf den Marktplatz. In den Kommentaren ist er bald nur noch Herr Rehhagel, der Deutsche. Ein Klischee. Fleißig, vielleicht. Pünktlich, ja klar. Aber ohne Herz. Rehhagel, so der Vorwurf, verstehe weder die Griechen noch ihren Fußball. Die Journalisten, sie wollen ihn nicht. Und hätte er schon einen Koffer in Athen gehabt, sie hätten ihm ganz sicher beim Packen geholfen.
Auf Wiedersehen, Herr Rehhagel!
Und auch in der Kabine kippt die Stimmung. Hatte Rehhagel bislang vor allem mit den Zweifeln der Öffentlichkeit zu kämpfen, geht ihm jetzt auch die Mannschaft verloren, verweigern die Spieler den von ihm geforderten Gehorsam. Und tragen ihren Unmut nach draußen, in die Notizblöcke der Reporter.
Der Trainer, so steht es wenige Wochen später im englischen Daily Express, sei wie ein Fremder. Zwischen ihm und den Spielern bislang keine Beziehung entstanden.
Die Sprachbarrieren, erklärt Rehhagel daraufhin in einem Interview mit dem kicker, sind ein großes Problem, das ich unterschätzt hatte. Wir suchen jetzt einen Dolmetscher, der auch ein bisschen fußballverrückt ist.
Und es ist dieser zweite Satz, der Ioannis Topalidis die Tür öffnet.
Wenig später klingelt sein Telefon. Und Otto ist dran.
Sie treffen sich in Berlin, im Hotel Kempinski. Und unterhalten sich zwei Stunden lang.
Die beiden Männer verstehen sich gleich. Sie sprechen dieselbe Sprache, sie sprechen Fußball. Rehhagel, der Bergarbeiterspross aus Altenessen. Und Ioannis Topalidis, der Gastarbeitersohn aus Stuttgart, sie sind Kinder der Bundesliga. Sie könnten die Spielzüge der Gründerjahre, die großen Partien, Dutzende Europapokal-Nächte mit Salzstreuern nachstellen, Flankenläufe an Tischkanten, sich gemeinsam in Siegen verlieren, sie schöpfen aus sechzig Jahren Vokabular. Und Topalidis gelingt es, Rehhagel von sich zu überzeugen.
Er ist, verrückt genug, der richtige Mann.
Er versteht die Griechen, kennt den Fußball und den Weg zum Olymp.
Er ist der Fremdenführer, den Rehhagel so dringend braucht.
Der Tenzing Norgay für seinen Edmund Hillary.
Und Rehhagel, mit dem Rücken zur Wand, bietet ihm an, gleich mitzukommen. Auswärts nach Manchester, letztes Spiel der WM-Qualifikation, Old Trafford im Oktober. Ein Neuanfang im Theater der Träume.
Herr Topalidis, ich möchte Sie dabeihaben.
Und Ioannis Topalidis sagt zu. Es ist die Chance seines Lebens, er wird sie nicht leichtfertig vergeben.
So sitzt er, damals 38 Jahre alt, am 6. Oktober 2001 bereits auf der Bank der Griechen, gleich neben Otto Rehhagel.
Sein neuer Stammplatz. Er wird ihn fast neun Jahre lang nicht wieder hergeben.
Ioannis Topalidis, plötzlich in der ersten Reihe.
Er ist jetzt tatsächlich mittendrin, wirklich dabei. Coachingzone, der Rasen nur einen Ausfallschritt entfernt. 66 000 Menschen im Stadion, dann werden die Hymnen gespielt.
Ioannis Topalidis, plötzlich auch ein Stück Fußballgeschichte.
Denn es wird ein Spiel, dessen Schlusspunkt die Jahre überdauern sollte. Das ganz große Drama, dieser eine Schuss Magie. Weil die Griechen, in der Qualifikation längst ohne Chance, an diesem Tag wie verwandelt aus der Kabine kommen und die eigentlich übermächtigen Engländer mit großem Kampf und ein paar feinen Überfällen an den Rand der Niederlage bringen, noch in der Nachspielzeit mit 2:1 führen, lange auch die Sensation in der Luft liegt.
Bis es noch einmal Freistoß gibt, 20 Meter zentral vor dem Tor. Und jeder im Stadion weiß, was jetzt passieren muss, unweigerlich.
David Beckham, die Haare kurz geschoren, die Nummer sieben auf dem Rücken, nimmt sich diesen Ball, legt ihn zurecht. Hier im Old Trafford, in seinem Wohnzimmer. Und tritt ihn schließlich, über die Mauer und über Nikopolidis hinweg, ins linke obere Eck. Dann bebt das Theater, dann explodieren die Träume. Ein Wahnsinn in Weiß. Es ist Englands Tor zur Weltmeisterschaft. Und Beckham jubelt vor der Kurve, die Erleichterung in beiden Fäusten.
Er hat seine Mannschaft in letzter Sekunde gerettet.
Das Lob aber bekommen die Griechen. Für ihre Courage, diesen Auftritt, mutig und frech. Der Außenseiter, er hat hier, im Schatten der Schlagzeilen, ein erstes Ausrufezeichen gesetzt.
Es ist ein kurzes Flackern, von der Welt kaum beachtet und bald schon wieder vergessen, aber eben auch der Beginn einer außergewöhnlichen Beziehung.
Otto Rehhagel und Ioannis Topalidis.
Die Zwei, wie sie der Autor Johannes Ehrmann Jahre später nennen wird. In Anlehnung an die britische Krimiserie der Siebzigerjahre, mit Tony Curtis und Roger Moore.
Die Zwei, ein ungleiches Duo.
Nach dem Spiel fliegen sie zurück nach Deutschland.
Rehhagel nach Essen, Topalidis nach Stuttgart.
Bisschen Heimat tanken. Im Abschied liegt ein Versprechen.
Herr Topalidis, sagt Otto Rehhagel an diesem Tag, ich werde mit dem Präsidenten sprechen, ich möchte Sie als Co-Trainer haben. Aber Sie müssen sich das gut überlegen, das kann hier alles sehr schnell vorbei sein.
Da, erinnert sich Topalidis jetzt, habe ich gesagt: Egal. Auch nur ein einziges Spiel mit der Nationalmannschaft reicht mir.
Ioannis Topalidis, wieder sechs Richtige. Lotto Rehhagel!
Es vergehen dann einige Wochen, ohne dass sie voneinander hören. Funkdisziplin, bis sich Otto kurz vor Weihnachten, wie angekündigt, meldet. Er habe mit dem Präsidenten gesprochen, erklärt er am Telefon, es sei alles geregelt, alles wie vereinbart.
Wenig später unterschreibt Ioannis Topalidis seinen Vertrag. Er ist jetzt offiziell Assistent, plötzlich Coach in der Heimat der Eltern. Ein, wie er sagt, unbeschreibliches Gefühl. Die große Ehre. Willkommen, Herr Topalidis!
Königstransfer, er ist jetzt Teil eines Teams.
Otto Rehhagel und Ioannis Topalidis, dann stürzen sie sich hinein. Gemeinsam, haben gleich alle Hände voll zu tun. Denn die Nationalmannschaft, erste Bestandsaufnahme, ist den Griechen nicht mehr viel wert. Eine Ruine nur noch, windschief in der Ebene. Das Fundament brüchig, die Wände von Schimmel befallen. Im Innern kaputt, über Jahrzehnte heruntergewohnt. Von den Urkräften des griechischen Fußballs zersetzt.
Da sind die Journalisten, die Kommentatoren der großen Sportzeitungen, in den Stiften vor allem eigene Farben, die vom Schreibtisch aus die Aufstellungen machen, dem Trainer den Kader diktieren, nicht nur zwischen den Zeilen. Und da sind die Präsidenten der großen Klubs, AEK, Panathinaikos und Olympiakos, die ihre Spieler nicht freigeben. Aus Angst, sie könnten dort draußen im Wettkampf unbrauchbar werden, für den heimischen Betrieb.
Sie sollten sich nicht verletzen, erzählt Topalidis, sich in den Zweikämpfen schonen.
Die Klubs, hier sind sie größer als das Land. Das Trikot der Nationalmannschaft, hier ist es weit weniger wert. Weshalb die Spieler eine Berufung, anders als in Deutschland etwa, nicht als Ehre begreifen, sondern viel eher als notwendiges Übel. Sie müssen halt hin. Die Hymne singen, 90 Minuten Pflichtaufgabe. Und wenn sie dann da sind, wirken sie lustlos, gehemmt. Mit den Gedanken schon wieder zu Hause.
Hinzu kommen die Intrigen im Verband, die gängige, kaum verhohlene Korruption. Zu viele Stimmen, die sich einmischen, immer mitreden wollen, Hinterzimmergenossen. Die Gier immer schon größer als das Spiel. So machen die Offiziellen, meist mit Klunkern behängte Provinzfürsten, milchige Magnaten, die Länderspielreisen zu Butterfahrten, Ausflüge mit dem Bumsbomber. Pauschalurlaub mit Entourage, Wein und Weib, genüsslich am Tisch der Spieler, feist am kalten Buffet.
Ganz am Anfang, erzählt Topalidis, haben noch alle zusammen in einem Hotel gewohnt. Da waren dann auch die Verbandsleute dabei. Und am Abend haben die immer zuerst gegessen. Dann erst durften wir.
Erst das Fressen, dann die Moral.
Erst die Macht, dann die Mannschaft.
Das, sagt er, haben wir dann alles geändert. Danach ist niemand mehr mit uns geflogen, danach waren wir allein im Hotel.
Und so beginnt, was Verbandspräsident Gagatsis später als kleine Revolution bezeichnen wird.
Rehhagel und Topalidis, mit dem Vorschlaghammer zwischen antiken Säulen. In wenigen Monaten nur restaurieren sie die griechische Nationalmannschaft, rennen gegen Wände, bis diese Wände endlich nachgeben, notwendige Trümmer. Errichten dann eigene Mauern.
Die Zwei, so gelingt es ihnen, die Mannschaft abzuschotten. Gegen alle Einflüsse von außen, das Flüstern auf den Fluren, das Brüllen der Presse. So sperren sie die Ablenkung aus, und auch die Kritik. Ein radikaler Bruch mit der Vergangenheit, der nur deshalb möglich ist, weil sich die beiden frei bewegen können, niemandem etwas schuldig sind.
Es war wichtig, sagt Topalidis, dass wir von außen kamen. Nur so konnten wir die alten Strukturen aufbrechen. In Griechenland, wenn du da eine Vorgeschichte hast, wenn die im Verband etwas gegen dich haben, dann wirst du nichts, dann hast du keine Chance. Aber ich war ein Unbekannter, ein Niemand. Ein unbeschriebenes Blatt. Die kannten mich nicht. Und Rehhagel hatte die nötige Autorität.
Die Zwei, nach und nach kappen sie die einstigen Seilschaften, zwei Außenseiter mit ganz scharfem Schwert, bis nur noch ein Strang übrig ist, an dem alle gemeinsam ziehen.
Und plötzlich geht es nur noch um Fußball, um die Mannschaft an sich.
Die Spieler, erzählt Topalidis, haben damals immer zu mir gesagt, Ioannis, wir wissen, dass ihr auf niemanden hört und dass ihr macht, was ihr für richtig haltet. Das respektieren wir sehr. Und die Spieler haben das respektiert, weil Rehhagel immer gemacht hat, wovon er überzeugt war.
Wagenburg, dieses wuchtige Wort.
Draußen im Land aber bleiben die Zweifel. Rehhagel, da sind sich die Griechen noch immer nicht sicher.
Dann, im Herbst 2002, beginnt die Qualifikation zur Europameisterschaft. Endrunde in Portugal, das noch immer große Ziel. Dafür wurde der Deutsche geholt. Jetzt muss er liefern, jetzt soll er zeigen, was seine Worte wirklich wert sind.
Zum Auftakt allerdings verliert er daheim gegen Spanien, und einen Monat später auch auswärts in der Ukraine.
Seine Mannschaft, ein Jahr zuvor noch Aug in Aug mit den Engländern, ein eigentlich würdiger Gegner, schießt in diesen Spielen kein einziges Tor.
Und in Athen toben die Tageszeitungen. Die Journalisten, auch persönlich beleidigt, schreiben wütende Abschiedsbriefe.
Auf Wiedersehen, du Supertrainer!
So steht es in der Fos, ein Beispiel nur.
Zu Hause, erinnert sich Topalidis, hat die Presse gleich Remmidemmi gemacht, da war hier schon wieder Alarm, weil die einen anderen Trainer wollten. Aber wir haben gewusst, dass wir eine gute Mannschaft haben.
So lassen sie sich nicht aus der Ruhe bringen, weder öffentlich noch in der Kabine. Für die ganz große Hysterie ist allerdings auch zu wenig Zeit. Denn vier Tage später geht es bereits gegen Armenien.
Ein Zwerg, schreibt die NZZ.
Ein Erfolg, erklärt Otto Rehhagel, ist unsere letzte Hoffnung.
Dann spricht der Präsident.
Es gibt kein Trainerthema, erklärt Vassilis Gagatsis den lauernden Journalisten noch vor dem Anpfiff, nicht einmal als Gedankenspiel. Die einzigen Verantwortlichen sind unsere Fußballer. In der Ukraine haben sie gespielt wie eine Stadtviertel-Mannschaft der vierten Liga.
Machtworte, sie sind die nötige Rückendeckung für Rehhagel. Aber auch ein Appell an die Ehre der Spieler.
Ein Weckruf, der seine Wirkung nicht verfehlt.