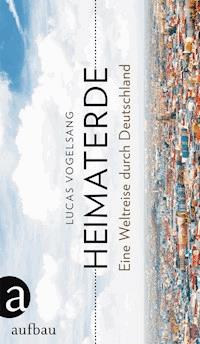9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Beckenbauer auf dem Rasen von Rom. Der Torfall von Madrid. Effes Mittelfinger. Der Fußball ist eine Bildermaschine, er produziert Legenden, Momentaufnahmen. Szenen, die vom Triumph und vom Scheitern erzählen, von Rivalität und Leidenschaft, von Aufstieg und Abgrund. Die ZEITLUPEN folgen diesen Spuren des Spiels und zeigen, wie es weiterging. Nach dem wichtigsten Tor, dem letzten Zweikampf, dem traurigen Abgang. In jedem Augenblick schon der Anfang einer neuen Geschichte. Der Fußball ist eine Bildermaschine, er produziert seit jeher Legenden, Momentaufnahmen. Unvergessene Szenen, die vom Triumph und vom Scheitern erzählen, von Rivalität und Leidenschaft, von Aufstieg und Abgrund. So entstehen Wahrheiten, die nicht nur auf dem Platz liegen. Und Geschichten, die nicht selten ins Abseits führen. Sie begleiten uns dann und liefern Stoff für immer neue Gespräche. In der Kurve, an den Stammtischen, im Fernsehen. Die ZEITLUPEN folgen diesen Spuren des Spiels, den Karrieren nach dem Abpfiff, dieser ewigen Nachspielzeit. Und zeigen, wie es weiterging. Nach dem wichtigsten Tor, dem letzten Zweikampf, dem traurigen Abgang. In jedem Augenblick schon der Anfang einer neuen Erzählung. »Die ZEITLUPEN sind ein pirlogleiches Spiel auf der Tastatur.« Micky Beisenherz »Ich liebe seine Schreibe. Lucas Vogelsang ist der FC Liverpool unter den Autoren.« Atze Schröder »Lucas Vogelsang schreibt, was ich denken möchte.« Henning Wehland
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Lucas Vogelsang
Zeitlupen
Denn der Fußball schreibt die besten Geschichten
Tropen Sachbuch
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe
Tropen
www.tropen.de
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover-Gestaltung und Illustration:
www.handsofgod.football
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-50497-2
E-Book: ISBN 978-3-608-12132-2
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
INHALT
Zeitlupe
Der Fußball und die Erinnerungen
Der Tritt
Eric Cantona und das Böse
Die letzte Flucht
Lutz Eigendorf und die Stasi
Aprilscherze
Reif, Jauch und der Torfall von Madrid
Zuckerhütchenspieler
Marcelinho, Hertha und der Karneval
Californication
Klinsmann und der deutsche Fußball
Schlachtenbummeln
Fußball und die Nähe zum Krieg
Deutsches Theater
Hoeneß, Daum und das Duell
Aus der Distanz
Matthäus, das Spiel und die Schuhe
Nachtschicht
Das Jahrhundertspiel und ich
Der schlimme Finger
Effenberg, der Tiger und die Sonne
Ostprobe
Der Franz, die Einheit und die Wahrheit
Grüße an die Oma
Müller, die Rekorde und das Radio
Die Mütter aller Siege
Die Bayern, das Trauma und der Triumph
Auf dem Rasen des Nachbarn
Hunde, Löwen und das Derby im Revier
Maßanzüge
Die Bayern, die Wiesn und die Watschn
Mehr als ein Spiel
Dynamo, Werder und die Kneipe
Um ein Haar
Daum, das Koks und die Gegenwart
Alter Schwede!
Zlatan, Gott und die Welt
The Fab One
George Best, das Leben und der Tod
Väter und Söhne
Maradona und der lange Abschied
Hintermannschaft
Zeitlupe
Denn das ist die wichtigste Sache am Fußball,dass es niemals nur um Fußball geht.
Terry Pratchett
Dann stand das Spiel plötzlich still, rollte der Ball nicht mehr. War alles anders als sonst. Nicht mehr Samstag, nicht mehr halb vier. Kein Anpfiff und auch kein Flutlicht am Abend. Kein Bier an der Roten Erde, keine Wurst an den Stadionterrassen. Die Wochenenden und Nachmittage nun gähnend leer, die Stadien nur weiße Elefanten. Also kein Tor in München, kein Tor in Berlin. Statt Pfiffen nur noch der Wind in der Kurve. Nach dem Frühstück gleich die Lottozahlen, der Wetterbericht.
Und im Radio, ohne Gesänge, lief wirklich Musik.
Nach einer Woche bereits, die Felder unbespielbar, schien Gras über die Sache zu wachsen.
Als hätte es das Spiel nie gegeben.
Dann aber begannen wir, uns zu erinnern. Im Gedächtnis wie in alten Kisten zu kramen, in vertrauten Gefühlen Zuflucht zu suchen. In den Bildern, die wir kannten. Den Szenen, die wir bei uns tragen wie Passbilder in der Brieftasche. Das innere Auge als Leinwand, auf der Festplatte nun wieder das volle Programm. Bundesliga Classics, Eurogoals.
Jeder auch sein eigenes Archiv.
Im Fernsehen liefen plötzlich die Spiele von damals, die großen Kämpfe von einst, standen wir plötzlich erneut im Finale. Waren wieder nur Sekunden zu spielen.
So schufen wir unsere eigenen Konferenzen, über die Jahrzehnte und über die Pokale hinweg. So hielten wir uns, die Fernbedienung in der Hand, an unsere eigenen Gesetze. So spulten wir noch einmal zurück. Wussten jedes Ergebnis, kannten die Tore bereits. Und waren doch wieder hellauf begeistert. Von der Gleichzeitigkeit des Moments, den Schnittbildern und Wiederholungen. In den Stadien Menschen, Jubel und Tränen. Echte Liebe wohl auch.
Die Vergangenheit auf allen Kanälen. Krimis, wo sonst nur Krimis laufen. Die Sportschau etwa zeigte Deutschland gegen England. Halbfinale in Wembley 1996, seltsam körnige Bilder. Erst Shearer, dann Kuntz. Erst der Zeigefinger zum Himmel, dann die Säge als Antwort.
Vertraute Gesten, tatsächlich alte Bekannte.
Und im Netz, auf ganz anderen Plätzen, liefen nochmal ganz andere Dramen. Dortmund und Juventus, zum Beispiel. Finale im Olympiastadion, 1997. Zweimal Karl-Heinz Riedle, den sie Air nannten, weil er so hoch springen konnte. Ein König, der die Luft beherrschte. Dann Lars Ricken, von Marcel Reif zum Kunstschuss gebrüllt.
Schließlich Leverkusen in Unterhaching, Fernduell mit den Bayern. In den Flaschen der Spieler schon heimlich Champagner, dann aber Ballack ins eigene Tor. Und an der Seitenlinie Christoph Daum, die Augen starr in den Abgrund gerichtet. Wieder mal um Haaresbreite an der Schale vorbei.
Diese Bilder, sie holten wieder alles hervor. Und hinterließen ein seltsam entrücktes Gefühl. Als hätten wir uns mit ihnen noch einmal selbst besuchen dürfen. Die eigene Jugend, die Anfänge von allem.
Denn diese Szenen nehmen uns an die Hand. Bis wir wieder dort stehen, auf Höhe des Sechzehners. Im Ohr das Raunen der Menge.
Kinderaugenblicke.
Ich bin selbst mit dem Fußball groß geworden, ein Sohn der 90er-Jahre. Mein erstes Bundesligaspiel habe ich in der Zusammenfassung gesehen. Auf einem klobigen Röhrenfernseher in der Laube meiner Eltern. Es war Samstag. Es lief ran, weil ran nun mal am Samstag lief. Nur wusste ich das damals noch nicht. Das Konzept aber, so viele Treffer in so kurzer Zeit, gefiel mir gleich gut. Da war richtig was los. Und vor der Kamera, Begeisterung in allen Stadien, standen die Männer des Wochenendes. Reinhold Beckmann, die Jeansjacke in Knallrot. Jörg Wontorra, das Sakko in Altrosa. Oder Lou Richter, von dem ich lange dachte, er wäre der Typ von den Prinzen. Sie waren Komplizen, Türöffner auch.
Sie hatten den Fußball in unser kleines Wohnzimmer gelassen. Sie waren die Dealer, sie hatten mir die Pille schmackhaft gemacht.
Bald darauf kaufte ich mein erstes Panini-Album, klebte Katemann, Dickhaut und Wück. Sticker wie Fahndungsbilder. Die Bayern trugen Opel, Karlsruhe hatte Ehrmann auf der Brust. Und Bochum, unvergessen, ging mit Faber hausieren. Die Bundesliga, damals auch eine große Lotterie. Ein tatsächlich knallbunter Zirkus. So geriet ich hinein. In dieses Spiel, das man nur mit großen Augen schauen konnte. Plötzlich auch am Abend, mit meinem Vater auf der Couch. Weil die Deutschen in Amerika spielten, müde Blicke über den großen Teich. Letchkov gegen Icke, 20 Zentimeter zu kurz.
Die erste große Niederlage.
Danach dann Klinsmann gegen Bordeaux, Zidane noch mit vollem Haar. Das war mein erster Titel, ich jubelte im Wohnzimmer. Hertha spielte da noch in der Zweiten Liga, wir sollten erst später zueinander finden. An einem Nachmittag gegen Waldhof Mannheim. Auf dem Maifeld, im Windschatten von Günther Jauch. In der Champions League dann. Ali Daei gegen Chelsea, Barcelona im Nebel. Aber das ist noch mal eine ganz andere Geschichte.
Erstmal flogen die Deutschen über den kleinen Teich, spielten dort unter den Augen der Queen. Und ich saß daheim und klebte Abziehbildchen aus Haselnussschnitten, fiebrige Finger. Klebte Ziege und Reuter und Freund. Gesichter, die mich von nun an begleiten sollten. Erst als Spieler und später als öffentliche Figuren. Ich lernte sie nach und nach kennen. Die Europameisterschaft war, wenn man so will, unsere erste gemeinsame Reise. Und das Finale gegen Tschechien, Bierhoff in der Verlängerung, der erste gemeinsame Sieg. So wurden es besondere Wochen. Auch, weil diese Spiele anders waren als die Spiele zuvor.
Größer, wichtiger. Staatsangelegenheiten.
Der Fußball, er war jetzt nicht mehr nur bei uns zu Hause, er war nun auch bei den Nachbarn zu Gast. Gleichzeitig in allen anderen Wohnzimmern. Meine Freunde und ich, wir saßen gemeinsam vor dem Fernseher, wir teilten diesen Moment. Und nach jedem Spiel liefen wir in den Hof gegenüber, stellten die besten Szenen dort nach. Und jeder kam mit, denn jeder wusste Bescheid. Wir brauchten keine Wörter, um zu erklären, was gerade erst war. Wir trugen die Tore noch in uns. Und schossen mit Dosen auf Tischtennisplatten. Wurden Klinsmann, Sammer und Kuntz. Nur einmal war ich trotz allem Kroate. Davor Suker, mit der Sohle über dem Ball, als hätte er ihn gestreichelt.
Mein Held aber blieb Andy Möller, weil er in Wembley den Gascoigne gemacht hatte, die Brust raus vor den englischen Fans. Der ziemlich trockene Moment einer sonst sehr feuchten Figur.
Dann kam Bierhoff, und traf zweimal gegen Kouba. Das entscheidende Tor für immer mit Gold überzogen. Und Jürgen Klinsmann durfte den Pokal in den Himmel halten, in seinem Rücken die Queen, lächelnd im türkisfarbenen Kostüm. Auch das ein Sommermärchen.
Und die Menschen fuhren mit ihren Autos über den Kurfürstendamm. Berlin, die wieder grenzenlose Freude. Ganz am Ende dieser Nacht, das weiß ich noch genau, hat mein Vater mit einer Gaspistole in die Luft geschossen. Vor Freude, im Übermut auch. Und aus der erwachsenen Überzeugung heraus, Platzpatronen geladen zu haben. Da allerdings hatte er sich reizenderweise geirrt. So bin ich dann glücklich, aber mit roten Augen eingeschlafen.
Die Europameisterschaft, der Titel und die Bilder aus England, sind jetzt 25 Jahre alt. Und meine Erinnerungen aus dieser Zeit längst zu Schlaglichtern geworden. Bekömmliche Häppchen, meist auf dem Silbertablett angerichtet.
So kann ich die Jahre seither allein an jenen Momenten entlang erzählen, die geblieben sind.
Meinen Freunden, den Kollegen und Altersgenossen, geht es mitunter ganz ähnlich. Wenn sie vom Fußball von damals sprechen, verstehen wir uns. Und leben in Highlights, in Andeutungen. Stichwortspiele. Dann ist Fußball eine eigene Sprache. Dann reicht eine Szene, um einen ganzen Film zu beginnen. Dann reicht ein Zitat für einen ganzen Roman.
Ricken, lupfen jetzt!
Wir melden uns vom Abgrund.
Mach ihn! Er macht ihn!
Weiter, immer weiter!
Andy Brehme gegen den Elfmetertöter Goycochea.
Dann ist in Hamburg noch immer nicht Schluss. Dann steht Peruzzi in München zu weit vor seinem Kasten. Dann macht Fjörtoft einen Übersteiger und Baumann vergibt gegen Golz. Dann steht Assauer wieder im Parkstadion, im Mund noch die tränennasse Zigarre. Hinter ihm ein untröstlicher Trommler. Und Jörg Berger, er ruhe in Frieden, tollt wie irre durch den Frankfurter Jubel. Ein Feuerwehrmann, der die Kurve in Brand gesteckt hat. Und Götze steht neben Löw, die Lippen des Bundestrainers ganz nah am Ohr, dann fliegt er hinein in die Flanke. Dann holt Deutschland den vierten Stern. Und am Ende läuft der Kaiser allein über den Rasen von Rom.
So legen sich die Erinnerungen übereinander, Geschichte in Schichten. So kommt noch einmal alles zurück. Und wir können die Momente vergleichen, die uns zu denen gemacht haben, die wir heute sind. Bekloppte, Anhänger, Schlachtenbummler. Erwachsene, die auch im Sommer noch Schal tragen, manche sogar Kutte dazu. Frauen, die sich unmögliche Farben ins Gesicht schminken. Männer, die in der Kneipe sitzen, selbst wenn draußen die Sonne noch scheint. In der Hoffnung, dass genau jetzt noch einmal etwas Großes passiert.
Denn die Szenen von damals, die schon gespielten Spiele, sie sind im besten Fall wie Musik. Sie bergen Gefühle. Ganz so, als hätten wir einen Teil von uns dort im Strafraum, im Jubel und im Schmerz, konserviert. Wir sind dann wieder so alt, so dumm oder auch so glücklich wie damals. Das Kopfkino, tatsächlich noch immer die geilste Konferenz der Welt. Weil sie uns gehört. Und weil sie niemals abgepfiffen wird. Es einfach immer weiter und dann auch gerne von vorne losgeht.
Unsere persönlichen Zeitlupen, jederzeit abrufbar.
Und damit auch die sowieso größte Unterhaltung.
Denn der Fußball, er schreibt noch immer die besten Geschichten.
Der Tritt
Die Möwen folgen dem Fischkutter,weil sie glauben, dass die Sardinenwieder ins Wasser geworfen werden.
Eric Cantona
Am 25. Januar 1995 verliert der König die Kontrolle. Es läuft die 48. Minute im Spiel zwischen Manchester United und Crystal Palace, als Eric Cantona kurz hinter der Mittellinie seinen Gegenspieler von den Beinen holt, aus Frustration. Und aus Rache. Weil er noch ein paar Rechnungen aus der ersten Hälfte zu begleichen hatte.
Cantona, auf dem Rücken die Nummer Sieben, wird unmittelbar vom Platz gestellt. Doch es vergehen noch einmal 50 Sekunden, ehe er tatsächlich Rot sieht. 50 Sekunden, angefüllt mit Gesten der Verachtung, Kopfschütteln, Abwinken. Cantona, längst außer sich, läuft langsam in Richtung Tribüne. Ein Abgang als große Show. Von den Rängen regnet es Beleidigungen. Das Stadion höhnt. Die Fernsehbilder wackeln. Cantona bebt. Kurz zeigt die Kamera seinen Trainer Alex Ferguson, dann den Schiedsrichter, in dessen Gesicht bereits eine Ahnung liegt.
Schließlich explodiert der Moment.
Cantona, plötzlich von niemandem zu halten, schon gar nicht von der nur kniehohen Werbebande, springt mit beiden Beinen voran ins Publikum und erwischt einen der Zuschauer, den damals 20-jährigen Matthew Simmons, auf Brusthöhe. Ein Irrsinnstackling, vor allem aber ein gezielter Angriff. Denn Simmons, so wird es später in der Zeitung stehen, soll dem Franzosen kurz zuvor seine ganz persönlichen Abschiedsworte zugerufen haben. Mit besten Grüßen an die Heimat und die Mutter. Majestätsbeleidigungen.
Eric Cantona jedenfalls bohrt diesem Simmons seine Stollen in den Brustkorb, bleibt dabei hängen, fällt, rappelt sich wieder auf und schickt gleich noch ein paar wilde Hiebe hinterher, ehe er von einem Ordner und seinem Torwart Peter Schmeichel eingefangen werden kann.
Dann endet das Video.
Mehr als ein Vierteljahrhundert ist seither vergangen, doch die Bilder aus dem Selhurst Park haben nichts von ihrer Wucht verloren. In der großen Sammlung der Skandale, der Exzesse und durchgebrannten Sicherungen, hängt Cantonas Tritt heute gleich neben den Portraits von Paul Gascoigne, Roy Keane oder Vinnie Jones, neben all den Inselbegabungen, die auf dem Platz genauso zu Hause waren wie hinterher im Pub.
Er hängt dort neben Craig Bellamy, der seinen Mannschaftskollegen John Arne Riise während einer Sauftour mit einem Golfschläger verprügelt hatte, weshalb ihm später der vielleicht schönste, weil britischste Spitznamen aller Zeiten verliehen wurde. The Nutter with the Putter. Auch das eine Auszeichnung. Bellamy, das kann man so sagen, hatte sich selbst zum Ritter geschlagen.
Und er hängt natürlich auch neben dem übergroßen Wandgemälde, das Zinedine Zidane 2006 in Berlin mit der Stirn gemalt hat. Der Kopfstoß, Wut auf Öl.
Es sind Szenen, die überdauert haben.
Denn Bilder wie diese machen etwas mit uns.
Wer sich die Fernsehübertragung von damals heute noch einmal anschaut, wird erst vom Unglauben übermannt. Und dann von einer gierigen Faszination, die sich anschleicht.
Die alte Hexe Schaulust.
Die Kommentare unter den Videos erzählen davon. Cantona, dieser gallische Hahn, den Kragen jederzeit aufgestellt wie ein Kamm, hat Hass gesät, hier aber erntet er Applaus. Ganz so, als habe er gerade im Moment des Totalausfalls den Sockel seines Denkmals gegossen.
Classic, schreibt einer. King Cantona, ein anderer.
Die Verehrung für den König, sie ist mit der Zeit eher gewachsen.
Wir sehen ihn, den Sprung, den Wahnsinn in seinen Augen. Wir sind fassungslos, aber wir können uns nicht von ihm lösen. Weil wir genau darauf warten, weil es sich gut anfühlt, wenn die Männer da unten nicht mehr Herr ihrer selbst sind, wenn der Doktor zum Mister wird. Nicht mehr Gentleman nur, plötzlich Boxer auch. Wenn es knallt und zischt und dampft. Faust auf Faust. Wenn die ansonsten auf Hochglanz polierte Schale des Sportlers plötzlich Risse bekommt und sich dahinter das Menschliche offenbart. Das Hässliche, das Kaputte.
Dieser Einblick, dieses öffentliche Seelenlimbo, kitzelt uns an einer Stelle, die wir sonst verleugnen. Dann wird der Gang ins Stadion zum Schattenboxen mit den niederen Instinkten. Dann durchdringt uns etwas Schönschauriges.
Dann glimmt etwas in uns, Adrenalinspiegelneuronen.
Denn auf den Rängen sind wir dumm wie Brot und Spiele.
Aber noch etwas anderes stimmt. Der Abgrund, machen wir uns nichts vor, ist der vielleicht einzige Ort, an dem eine Begegnung plötzlich möglich erscheint, weil die Kreisliga dort von der Champions League nur noch einen Faustschlag, einen Fehltritt entfernt ist. Schau mal, Bruder, die sind ja auch nicht anders als wir. Schlagen ihn lang, schlagen über die Stränge.
Auch diese Typen, millionenschwer und vom Fußballgott mit Talent gesegnet, müssen morgens um fünf mit dem Schweinehund vor die Tür.
Zidane, das sagte er hinterher selbst, wollte im Berliner Olympiastadion die Ehre seiner Familie verteidigen. Weil Materazzi seine Schwester beleidigt hatte.
Was tatsächlich so klang, als hätte er, Weltfußballer und Werbeträger immerhin, gerade in einem Weddinger Käfig um eine Fanta und ein bisschen Gras gespielt und nicht zehn Kilometer entfernt im Olympiastadion um die Weltmeisterschaft.
Im öffentlichen Kontrollverlust, zwischen Häme und Mitleid, entsteht deshalb so etwas wie Nähe. Die großen Gefühle für den kleinen Mann. Wir können sie nachempfinden. Wir waren schon immer eher Rocky als Maske.
Eher McEnroe als Sampras.
Natürlich leiden wir mit den Helden, klatschen bierselig im Konfettinebel, zählen weiße Westen und hängen an sauberen Fassaden. Doch hinter jedem ordentlich gefalteten Lächeln lauert doch immer die Sehnsucht nach der dunklen Seite. Wir zittern mit John McClane. Und überlegen trotzdem, wie es wäre, mit Hans Gruber, der alten Schweinebacke, einmal um die Hochhäuser zu ziehen. Einmal über das Ziel hinauszuschießen. Da sind wir moralisch gefangen zwischen Gut und Böse. 90 Minuten echte Gefühle.
Die echten Idole sind deshalb im besten Falle beides. Genie und Wahnsinn. Held und Schurke. In ihnen toben die Gegensätze und wir schauen ihnen gern dabei zu, stellen den Kragen auf und gockeln über den Ascheplatz, zahlen die rote Karte dann selbst. Kurzschlussoffensive.
Nun aber gibt es Profis, ehemalige Helden, die genau daran zerbrechen. Am Skandal. An der Wut, den Dämonen. Weil ihre Ausfälle irgendwann auf Schlagzeilenlänge zusammengestrichen werden. Zu Überschriften, die an den Namen haften bleiben. Ranzig und grell.
Pizzeria-Schlägerei, Dönerwurf, Negersaft.
Ihre Karrieren enden dann nicht selten im Dschungel. Zwischen Schlagerstars und Laiendarstellern, zwischen den Phantomen einer sehr deutschen Seifenoper. Wo sie, abgehalftert am Lagerfeuer, noch einmal eine ganz andere Schaulust bedienen, noch einmal ganz andere Prüfungen bestehen müssen.
Sie sind dann zu klein, um noch einmal aus dem Abgrund herauszuwachsen.
Andere aber sind schlichtweg zu groß, um wirklich Schaden zu nehmen.
So war es bei Zidane. So war es auch bei Cantona.
Denn der König, seien wir ehrlich, hätte danach eigentlich nie wieder Fußball spielen dürfen. Und die Journalisten, von ihm nicht selten zu Hofberichterstattern verzwergt, hätten ihn nur allzu gerne als Büßer gesehen. In einem Hemd ohne Kragen. Das Regelkorsett als Zwangsjacke.
Die Strafe als Knebel, das Maul endlich gestopft.
Ein Gericht verurteilte ihn am Ende zu 120 Sozialstunden. Der englische Fußballverband aber sperrte ihn lediglich bis September. Acht Monate nur.
Und Cantona kam zurück. Der Mythos hatte die Strafe überdauert.
Jahre später wurde er zum Premier-League-Spieler des Jahrhunderts gewählt. Und die Fans in Manchester sangen immer neue Lieder für ihren König.
2009 hat ihm der Regisseur Ken Loach einen eigenen Film gewidmet. Looking für Eric. Cantona, der sich selbst spielt, steht dort plötzlich im Raum, als wäre er aus seinem Poster gesprungen. Eine Erscheinung natürlich. Ein französischer Geist aus der Flasche, ein bezauberndes Genie. Und spricht im Laufe der Geschichte den vielleicht schönsten, weil treffendsten Satz seiner Karriere. Selbstironisch bis zur Ernsthaftigkeit, sein französischer Akzent schwer in den englischen Silben.
I am no man, sagt er also, I am Cantona.
Dann vergehen stille Sekunden, in denen seine Züge jede Härte verlieren.
Ein echtes Schauspiel.
Dann lacht er.
Im Sommer 2019 wurde Eric Cantona mit dem President’s Award der UEFA ausgezeichnet. Unter anderem auch, so hieß es offiziell, für seine beispielhafte persönliche Tugend.
Noch Fragen? Nein.
Aber noch einmal die große Bühne.
Cantona, der mittlerweile einen grauen Vollbart und dazu meist eine graue Schirmmütze trug, sah dort oben aus wie der Veteran seines eigenen Krieges. Und hielt eine ebenso kritische wie kryptische Rede zur Gegenwart. Über die Wissenschaft, die Zellteilung, das Alter, Verbrechen und Kriege. Vielleicht, so der Gedanke, machte er sich einen Spaß, führte er nun die Zuschauer vor. Wie damals 1995, auf der Pressekonferenz nach seinem Tritt, nach den Urteilen. Als er sich erklären sollte, als alle eine Entschuldigung erwarteten, er stattdessen aber von Möwen und Fischkuttern sprach und die anwesenden Journalisten mit einem einzigen Gleichnis aus dem Gleichgewicht brachte.
Eine Improvisation des Impulsiven.
Oder aber, auch eine Möglichkeit, er hatte nun doch den Verstand verloren.
Genie und Wahnsinn, auf der Bühne nah beieinander.
Eric Cantona, auf der Bühne ganz bei sich.
Unten im Publikum saßen derweil Cristiano Ronaldo und Lionel Messi und starrten fragend in den Raum. Ihnen ging es wie allen anderen an diesem Abend.
Sie waren fassungslos, sie verstanden ihn nicht.
Aber sie konnten sich nicht von ihm lösen.
Die letzte Flucht
Lutz war ein Junge, der dasLeben mitgenommen hat, dersehr unbedarft war. Ich habeihn immer wieder gewarnt.
Jörg Berger
In der Dunkelheit lauert etwas. Es ist kurz nach 23 Uhr in der Nacht des 5. März 1983, als ein schwarzer Alfa Romeo, Kennzeichen GF-EL 96, mit hoher Geschwindigkeit über die Forststraße in Braunschweig fährt. Der Asphalt ist nass vom Regen, die Bäume stehen dicht am Rand, am Steuer sitzt der Bundesligaprofi Lutz Eigendorf.
Er hat einen langen Tag hinter sich.
Am Nachmittag hatte er mit Eintracht Braunschweig zu Hause an der Hamburger Straße gegen den VfL Bochum verloren, den Abend dann in einer Kneipe verbracht.
Jetzt ist er auf dem Heimweg. Er wohnt nur wenige Kilometer entfernt.
An der nächsten Kurve aber verliert Eigendorf die Kontrolle über seinen Wagen, trägt ihn die Geschwindigkeit von der Fahrbahn, kracht er nahezu ungebremst in eine Ulme. Die Kabine des Alfa Romeo wird bis zur Beifahrerseite eingedrückt, Eigendorf erleidet schwere Brust- und Schädelverletzungen. Er hatte keine Chance, werden die Ermittler später sagen.
Vielleicht allerdings durfte er auch keine zweite bekommen.
In der Klinik, noch in den frühen Morgenstunden, werden 2,2 Promille Alkohol im Blut gemessen. Damit scheint die Sache klar, eine Tragödie schnell erzählt. Trunkenheit am Steuer, der Übermut eines jungen Mannes. Gerade einmal 26 Jahre alt.
Am nächsten Tag, 7. März 1983, stirbt Lutz Eigendorf.
Unmittelbar nach seinem Tod jedoch beginnt das Raunen, macht die Trauer gleich Platz für Gerüchte. War dieser Unfall tatsächlich nur ein Unglück, ein Ausrutscher des Schicksals? Oder war es doch eher Mord, eine gezielte, eine politische Aktion gegen den Bundesligaspieler Eigendorf. Den Verräter, wie sie ihn nannten. In ihren Akten und auf den Tonbändern. Jene Männer, deren weinrotes Trikot er seit der Jugend getragen hatte. War dieser Tod also eine Bestrafung, ein Akt der Rache womöglich für seine Flucht und all die Provokationen danach?
Das Vorspiel zu den Schlagzeilen jedenfalls, zu den Bildern mit Trauerflor, hatte nahezu auf den Tag genau vier Jahre zuvor begonnen.
Auf einer Auswärtsfahrt zum Klassenfeind.
Lutz Eigendorf, sie nannten ihn den Beckenbauer der DDR, hatte in Ost-Berlin für den BFC gespielt, jenen Verein, bei dem Erich Mielke auf der Tribüne saß und die Schiedsrichter von dort oben so lange im Auge behielt, bis ihm das Ergebnis gefiel. Abseits, das wussten die Leute in der DDR, war immer erst, wenn Mielke pfiff. Und Eigendorf galt nun mal als Lieblingsspieler des Stasi-Chefs, ein Vorzeige-Athlet, der schöne Posterboy der Republik.
Am 21. März 1979 allerdings war er nach einer Partie in Kaiserslautern und einem anschließenden Einkaufsbummel in Gießen erst seiner Mannschaft und dann der DDR abhandengekommen. Sie suchten ihn noch, die Mitspieler und die Spürhunde, die damals immer gleich mit im Bus saßen. Aber Eigendorf hatte sich abgesetzt und war mit einem Taxi zurück nach Kaiserslautern gefahren, wo er um politisches Asyl bat. Natürlich wurde er aufgenommen, der Geschäftsführer versteckte ihn in einem Haus im Pfälzer Wald, er wurde Jugendtrainer und debütierte, nach einem Jahr Sperre durch die UEFA, im Profikader des 1. FC Kaiserslautern.
Er spielte jetzt für andere Teufel.
Eigendorf hatte es in den Westen geschafft. Und für die Männer in Ost-Berlin war das, dieser erfolgreiche Seitenwechsel, natürlich die größtmögliche Schande, weil sie nicht nur einen ihrer Besten, sondern mit ihm auch ihr Gesicht verloren hatten.
Lutz Eigendorf war nicht der erste Republikflüchtling aus der DDR-Oberliga. Und er sollte bei Weitem nicht der Letzte sein. Nach ihm flohen, neben vielen anderen, auch Falko Götz und Dirk Schlegel, später sogar der WM-Held Jürgen Sparwasser und der Trainer Jörg Berger. Doch sein Abgang galt als besondere Angelegenheit. Er war die schallende Ohrfeige für Erich Mielke.
Der Stasi-Chef, so hieß es, erkannte in der Flucht seines einstigen Lieblings eine persönliche Kränkung. Eine Absage an die Idee seines Staates zudem. Einen Fehler im System, den es eigentlich nicht hätte geben dürfen. Eigendorf schien ihn mit jedem Sprint, jedem Pass zu verhöhnen.
Ein Ochs, den er als Esel durch die Arena führte. Unaushaltbar. Und die Häme des Publikums gab es als Untermalung natürlich gleich noch dazu. Spielte der BFC woanders, wieder auswärts beim Klassenfeind, schallte es zuverlässig von den Rängen.
Wo ist denn der Eigendorf?
Immer wieder.
Der Name auf fremden Trikots, Eigendorf auf fremden Plätzen, das alles war eine große, zu jeder Zeit sichtbare Vorführung. Auch deshalb ließ ihn die Stasi nicht aus den Augen. Lutz Eigendorf hatte sich im Westen eingerichtet, dort ein wirklich neues Leben begonnen. Und war ihr dennoch nicht entkommen. Im Gegenteil. Der lange Arm Mielkes reichte auch drüben bis hinein in die Nachbarschaft, in das unmittelbare Umfeld des Spielers. Die Mitarbeiter des Ministeriums verfolgten ihn, so sagte man gern, auf Schritt und Tritt. Sie waren da, rund um die Uhr. Bis zu 50 Personen hatte das MfS auf Eigendorf angesetzt. Schatten, die ihm gefolgt waren. Gummiohren, die an seinen Wänden klebten. Die Überwachung war nahezu lückenlos.
Selbst bei Eigendorfs Hochzeit, Oktober 1982, soll ein Spion im engsten Kreis gestanden haben. Wie Geier umkreisten sie den Fußballer. Kader und Kadaver.
Eigendorf, der zumindest einen Hauch gespürt haben musste, lebte bald in ständiger Panik vor dem MfS. Und ließ es sich dennoch nicht nehmen, Grüße nach drüben zu schicken. Immer wieder trat er im Fernsehen auf, übte Kritik an der alten Heimat und ermunterte andere Spieler öffentlich, ihm zu folgen. Im Westen warteten Wunder. Für Mielke und seine Männer war er damit selbst zum Klassenfeind geworden. Ein Kapitalistenliebchen. Auf Rosen gebettet, ein Dorn im Auge.
Am 21. Februar 1983 schließlich gab er dem ARD-Magazin Kontraste ein Interview, nur wenige Meter entfernt von der Berliner Mauer. Der antifaschistische Schutzwall diente als bewusst gewählte Kulisse. Lutz Eigendorf hatte eine Botschaft dabei, sie galt Ost-Berlin. Er trug ein weißes Hemd und eine gelbe Krawatte dazu. Mit der Grenze im Rücken, der Kamera ganz nah, wirkte er größer als sonst. Er war jetzt nicht mehr nur Fußballer, er stand dort als Unterhändler der eigenen Überzeugung. Seine Sätze, wohl gewählt, sollten auch eine Erklärung sein, für die Flucht vier Jahre zuvor.
Und so sprach er über die Gründe, den Westen. Über das Geld, das er als Berufsfußballer noch einmal verdienen wollte.
Aber ich glaube, sagte er dann, dass der Reiz, einmal in der Bundesliga zu spielen, wo doch an sich das Leistungsniveau wesentlich höher ist als in der DDR-Oberliga, doch sehr groß war. Und ich es einfach noch mal wissen wollte, mit 24, da Fuß zu fassen.
Es war ein kleiner Seitenhieb nur, ein Nachtreten vielleicht. Aber in den Amtsstuben des MfS wurden Eigendorfs Sätze als letztgültige Provokation verstanden. Ein Fanal. Es sollte Konsequenzen haben. Zwei Wochen später krachte der schwarze Alfa in die Ulme an der Forststraße.
Unfall oder Mord? Es ist die Frage, die geblieben ist.
Was genau in dieser Nacht des 5. März 1983 geschehen ist, konnte bis heute nicht vollständig rekonstruiert werden. Aber es gibt Anhaltspunkte und Theorien. Vermutungen, die sich gehalten haben.
In seinem Film Tod dem Verräter aus dem Jahre 2000 erzählt der Journalist Heribert Schwan die Geschichte dieser Nacht als gut durchdachtes und von langer Hand geplantes Mordkomplott der Staatssicherheit. Nach dem Mauerfall war Schwan ein Papier in die Hände gefallen, auf dem neben dem Namen Eigendorf auch die Wörter Gase, Gifte und Verblitzen handschriftlich vermerkt worden waren.
Verblitzen war eine Vokabel der Stasi, ein kühles Chiffre, das einen Vorgang beschreibt, bei dem ein entgegenkommendes Fahrzeug aus der Dunkelheit heraus mit Fernlicht geblendet werden sollte. Ziel war es, den Fahrer zu verwirren, damit er die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Das plötzliche Gleißen zwischen den Bäumen. Glaubt man Schwans Rekonstruktion, dann ist Lutz Eigendorf nach seinem Kneipenbesuch im Gegenlicht der Stasi von der Straße abgekommen. Der Historiker Andreas Holy stützt diese These, hat aber noch eine weitere Erklärung für den Kontrollverlust dieser Nacht, für die Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, für den absurd hohen Alkoholwert, den die Ärzte später in Eigendorfs Blut feststellen sollten.
Ich schätze, sagte er dem Magazin 11FREUNDE