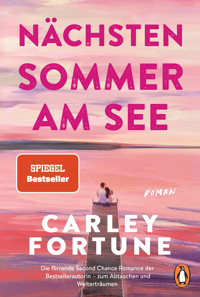
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein schicksalhafter Tag. Ein nicht eingelöstes Versprechen. Eine herzschmerzende Erinnerung an Lachen, Knistern, Hoffnung.
»Du und ich in einem Jahr, Fern Brookbanks. Versetz mich nicht.«
Romantische Blockhütten am Ufer, Tretboote auf dem glitzernden Wasser und Sonnenuntergänge am See: Fern kann immer noch nicht fassen, dass ihre verstorbene Mutter ihr das Ferienresort am kanadischen Smoke Lake vererbt hat. Ein Ort, der sie an die Sommer ihrer Kindheit und an ihre Jugendliebe erinnert. Und gleichzeitig an den größten Schmerz. Als hätte sie nicht damit nicht genug zu kämpfen, betritt plötzlich der Mann das Resort, den sie vergeblich versucht aus ihrer Erinnerung zu verbannen. Will Baxter, mit dem sie vor zehn Jahren einen einzigen Sommertag verbracht hat – den aufregendsten ihres Lebens. Ein Tag, der mit einem Versprechen endete, das er jedoch nie eingelöst hat. Fern kann nicht glauben, dass ausgerechnet er ihr helfen soll, das Resort finanziell zu retten. Und dass Will noch immer diese Wirkung auf sie hat, die ihr den Atem raubt. Mit einem Schlag sind all die intensiven Gefühle von damals wieder da – doch Will kommt ganze neun Jahre zu spät …
Sehnsucht, Sonnenschein und Nostalgie: Der Nr. 1-Bestseller und TikTok-Hit aus den USA!
Haben Sie Sehnsucht nach noch mehr romantischen Lesestunden an Kanadas Seen? Lesen Sie auch »Fünf Sommer mit dir«!
Spice-Level: 2 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Carley Fortune ist eine preisgekrönte kanadische Journalistin. Unzählige Leserinnen träumen sich mit ihren nostalgischen Liebesgeschichten an die schönsten Urlaubsorte Kanadas. Nach ihrem international erfolgreichen Debütroman Fünf Sommer mit dir über eine unvergessene Jugendliebe an einem traumhaften See stürmte Nächsten Sommer am See sofort auf Platz 1 in den USA und Kanada und wurde zu einem weltweiten TikTok-Hit. Der Roman wird aktuell für Netflix verfilmt. Carley Fortune lebt mit ihrer Familie in Toronto.
Begeisterte Stimmen über Nächsten Sommer am See:
»Eine atemberaubend schöne Geschichte, die mich von der ersten Seite an gefesselt hat!« Elena Armas
»Strahlend.«Emily Henry
»Diese Sommergeschichte drückt alle Knöpfe: voller Sehnsucht, verlorener Liebe und geliebter Tropes.« BuzzFeed
»Eineperfekte sommerliche Mischung aus sexy Romance und zweiter Chance.« Ashley Poston
»Eine süße Geschichte über zweite Chancen, und darüber, dass die Zukunft oft anders ist als erwartet.« Jodi Picoult
Außerdem von Carley Fortune lieferbar:
Fünf Sommer mit dir
www.penguin-verlag.de
Carley Fortune
Roman
Aus dem Englischen von Carolin Müller
Die Originalausgabe erschien 2023unter dem Titel Meet me at the Lakebei Berkley, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. usgeschlossen.
Copyright © 2023 der Originalausgabe by Carley Fortune
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: Favoritbüro nach einem Entwurf und unter Verwendung einer Coverillustration von Libby Lennie
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31033-2V003
www.penguin-verlag.de
Für Marco
Für diese erste Mix-CD und alle, die darauf folgten,
aber besonders fürs Runterdrehen der Lautstärke.
1
Jetzt
Ich schaffe es bis zur Rezeption, ohne dass mich jemand bemerkt. Der Empfangstresen ist aus einem eindrucksvollen großen Baumstamm gefertigt – rustikal, aber stilvoll, der Inbegriff von Moms Ästhetik –, und er ist nicht besetzt. Ich eile daran vorbei zum Büro, mache die Tür hinter mir zu und schließe sie ab.
Dieser Raum erinnert eher an eine Fischerhütte als an einen Arbeitsplatz. Wände aus Kiefernholz, zwei antike Schreibtische und ein kleines Fenster mit einem bereits etwas fadenscheinigen karierten Vorhang. Ich bezweifle, dass sich seit der Erbauung des Hauses im neunzehnten Jahrhundert viel verändert hat. Nichts weist darauf hin, wie viel Zeit Mom hier verbracht hat, abgesehen von einem Babyfoto von mir, an einen der Balken geheftet, und dem leichten Hauch von Clinique-Parfüm in der Luft.
Ich lasse mich auf einen der abgewetzten Lederstühle fallen und schalte den Tischventilator aus Plastik ein. Ganz klebrig bin ich sowieso schon, aber hier drinnen ist es noch mal besonders stickig, eine der wenigen Ecken des Hauses ohne Klimaanlage. Ich hebe die Ellbogen wie eine Vogelscheuche und wedle mir mit den Händen Luft zu. Schweißflecken unter den Armen sind jetzt das Letzte, was ich gebrauchen kann.
Während ich für ein wenig Abkühlung sorge, bevor ich in meine hohen Schuhe schlüpfe, starre ich auf einen Stapel unserer Broschüren. Brookbanks Resort – Ihre Auszeit in Muskoka erwartet Sie, verkündet eine fröhliche Schriftart über einem Foto vom Strand bei Sonnenuntergang, im Hintergrund die Lodge, wie ein herrenhausartiger Landsitz. Beinahe muss ich darüber lachen, denn eigentlich ist es das Brookbanks Resort, vor dem ich flüchten wollte, und nun sitze ich hier.
Vielleicht vergisst Jamie ja, dass ich mich zu dieser Sache bereit erklärt habe, und ich kann mich einfach wieder verkrümeln, in bequeme Hosen schlüpfen und das alles mit einem Eimer kalten Weißweins begießen.
Es rüttelt an der Türklinke.
Daraus wird wohl nichts.
»Fernie?«, ruft Jamie. »Warum hast du abgesperrt? Hast du was Unanständiges vor?«
»Ich brauche fünf Minuten«, erwidere ich gereizt.
»Aber du machst doch jetzt keinen Rückzieher, oder? Du hast es versprochen«, sagt er. Diese Erinnerung ist überflüssig. Es graut mir schon den ganzen Tag davor. Vielleicht auch mein ganzes Leben.
»Ich weiß, ich weiß. Ich mach nur noch ein bisschen Papierkram fertig.« Ich kneife die Augen zusammen angesichts dieser unbedachten Bemerkung. »Bin gleich so weit!«
»Was für Papierkram? Geht es um die Wäschebestellung? Dafür haben wir ein System!«
Meine Mutter hat für alles ein System angelegt, und Jamie will nicht, dass ich daran herumpfusche.
Er macht sich Sorgen. Es ist Hochsaison, aber viele der Gästeunterkünfte sind nicht belegt. Ich bin seit sechs Wochen zurück, und Jamie denkt, dass es bloß eine Frage der Zeit ist, bis ich frischen Wind in die Bude bringe. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß nicht einmal, ob ich bleiben werde.
»Du kannst mich nicht aus meinem eigenen Büro aussperren. Ich habe einen Schlüssel!«
Ich fluche leise. Natürlich hat er einen.
Es wäre peinlich, wenn er mich hier herauszerren müsste, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das tun würde. Seit meinem letzten Highschool-Jahr habe ich im Resort für keinen Aufruhr mehr gesorgt, und ich gedenke nicht, wieder damit anzufangen. Hier zu sein, fühlt sich für mich wie ein Rückschritt an, aber ich bin keine unbesonnene Siebzehnjährige.
Ich atme tief durch, stehe auf und streiche mein Kleid glatt. Es ist mir zu eng, aber die zerrissene Jeans, die ich sonst ständig trage, ist für den Speisesaal nicht angemessen. Als ich mich vorhin umgezogen habe, kam es mir so vor, als könnte ich Moms Stimme hören.
Ich weiß, du würdest am liebsten den ganzen Tag im Pyjama rumlaufen, aber wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen, Zuckererbschen.
Ich öffne die Tür.
Jamies strohblonde Locken sind kurz geschnitten und ordentlich gebändigt, aber er hat noch immer dasselbe Kindergesicht wie früher, als wir klein waren, und er hält Deo für eine freiwillige Option.
»Geht’s um die Wäschebestellung?«, fragt er.
»Überhaupt nicht«, sage ich. »Ihr habt ja ein System.«
Jamie blinzelt, unsicher, ob ich ihn aufziehen will. Seit drei Jahren ist er der Geschäftsführer des Resorts, eine Tatsache, die mir nach wie vor nicht in den Kopf gehen will. In gebügelten Hosen und mit Krawatte sieht er wie verkleidet aus, denn für mich wird er immer eine kleine Wasserratte in Badehose und Bandana bleiben.
Auch er weiß nicht mehr so recht, wie er mit mir umgehen soll – er schwankt zwischen dem Versuch, es mir, seiner neuen Chefin, recht zu machen, und dem Wunsch, mich davon abzuhalten, dass ich Unheil anrichte. Eigentlich sollte es ein universelles Gesetz geben, dass es Ex-Partnern verbietet, miteinander zu arbeiten.
»Früher warst du mal lustiger«, sage ich zu ihm, und er grinst mich an. Mit seinem breiten Lächeln und den himmelblauen Augen ist da plötzlich wieder der Jamie, der bekifft und in einem lila Kaftan, den er aus Mrs. Roses Ferienhaus geklaut hatte, das komplette Alanis-Morissette-Album Jagged Little Pill zum Besten gab.
Die Tatsache, dass Jamie es liebte, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, war eines der Dinge, die ich an ihm am meisten mochte – niemand beachtete mich, wenn Jamie dabei war. Er war ein guter Freund und zugleich ein gutes Ablenkungsmanöver.
»Du aber auch«, meint er und mustert mich mit zusammengekniffenen Augen. »Ist das ein Kleid von deiner Mutter?«
Ich nicke. »Es passt nicht richtig.« Ich habe es vorhin aus ihrem Schrank gefischt. Kanarienvogelgelb. Eines von mindestens zwei Dutzend farbenfrohen ärmellosen Hemdblusenkleidern. Ihre Abenduniform.
Einen Moment lang herrscht Schweigen, und das reicht, dass mich der Mut verlässt. »Hör zu, ich fühl mich nicht …«
Jamie schneidet mir das Wort ab. »Nein, nein, das tust du mir nicht an, Fernie. Du weichst den Hannovers schon die ganze Woche aus, und sie reisen morgen ab.«
Jamie zufolge kommen die Hannovers bereits seit sieben Jahren jeden Sommer ins Brookbanks Resort, geben Trinkgeld, als wollten sie damit irgendetwas beweisen, und werben jede Menge Gäste an. Der sorgenvollen Art und Weise nach zu urteilen, wie ich Jamie in seinen Computer habe starren sehen, benötigt das Resort weitaus dringender eine gute Mundpropaganda, als er durchblicken lässt. Unser Bilanzbuchhalter hat mir heute erneut eine Nachricht hinterlassen, dass ich ihn anrufen soll.
»Sie sind schon beim Dessert«, meint Jamie, »und ich habe ihnen gesagt, dass du gleich da sein wirst. Sie wollen dir persönlich ihr Beileid aussprechen.«
Ich kratze mir mit den Fingernägeln über den rechten Arm, bevor es mir bewusst wird. Warum fällt mir all das eigentlich so schwer? In meinem echten Leben manage ich drei Coffeeshops namens Filtr in Toronto. Darüber hinaus plane und überwache ich gerade die Eröffnung der vierten und größten Filiale, die im Herbst stattfinden soll. Es wird die erste mit einer eigenen Rösterei vor Ort sein. Eigentlich gehört es zu meinen selbstverständlichen Gewohnheiten, mit Gästen zu sprechen.
»Okay«, sage ich zu ihm. »Tut mir leid. Ich krieg das hin.«
Jamie atmet erleichtert aus. »Toll.« Er wirft mir einen entschuldigenden Blick zu und schiebt hinterher: »Und noch toller wäre es, wenn du auch an ein paar weiteren Tischen vorbeischauen und Hallo sagen würdest, wenn du schon mal dabei bist – du verstehst schon, wenn du die Tradition weiterführen würdest …«
Ich verstehe. Mom besuchte das Restaurant jeden Tag und erkundigte sich unermüdlich, ob diesem Gast die Regenbogenforelle auch schmeckte und jener gut geschlafen hatte. Es war irre, wie viele Details über die Gäste sie erinnerte, und die liebten sie dafür. Sie pflegte immer zu sagen, dass man sich erst ein Familienunternehmen nennen dürfe, wenn man dem Namen Brookbanks Resort auch ein Gesicht verlieh. Und drei Jahrzehnte lang war dieses Gesicht ihres gewesen. Das von Margaret Brookbanks.
Seit ich hier bin, hat Jamie mich schon mehrfach wenig subtil aufgefordert, den Speisesaal aufzusuchen und die Gäste zu begrüßen, aber bisher habe ich mich achselzuckend geweigert. Denn sobald ich mich dort zeige, ist es offiziell.
Mom ist weg.
Und ich bin hier.
Wieder zurück im Resort – dem allerletzten Ort, an dem ich enden wollte.
Jamie und ich gehen zusammen Richtung Rezeption. Sie ist noch immer nicht besetzt. Jamie bleibt zeitgleich mit mir stehen.
»Nicht schon wieder«, murmelt er genervt.
Die diensthabende Rezeptionistin hat erst vor ein paar Wochen hier angefangen und neigt dazu, sich in Luft aufzulösen. Mom hätte sie längst gefeuert.
»Vielleicht sollte einer von uns übernehmen, bis sie wieder auftaucht«, sage ich. »Nur für den Fall, dass jemand kommt.«
Jamie verdreht die Augen zur Decke und überlegt. Dann fällt sein Blick auf mich. »Netter Versuch, aber die Hannovers sind jetzt wichtiger.«
Wir gehen weiter zu den Flügeltüren, die ins Restaurant führen. Sie stehen offen, und das Klirren von Besteck und das Gemurmel fröhlicher Unterhaltungen dringt hinaus in die Lobby, zusammen mit dem Duft von frisch gebackenem Sauerteigbrot. Hinter dem Durchgang befinden sich hohe Balkendecken und Fenster, die den Blick in einem beeindruckenden Halbrund über den See gewähren. Ein Umbau, den meine Mutter vorgenommen hat, nachdem sie das Resort von meinen Großeltern übernommen hatte. Es fällt schwer, mir diesen Raum vorzustellen, ohne dass sie von einem Tisch zum anderen geht.
Ich atme leise durch, schiebe mir die Haare meines weißblonden Bobs hinter die Ohren und höre ihre Stimme in meinem Kopf.
Versteck dich nicht hinter deinen Haaren, Erbschen.
Als wir den Speisesaal gerade betreten wollen, kommt Arm in Arm ein Pärchen heraus. Die beiden sind etwa Mitte sechzig und fast komplett in beiges Leinen gekleidet.
»Mr. und Mrs. Hannover!«, ruft Jamie mit ausgebreiteten Armen. »Wir wollten gerade zu Ihnen. Darf ich Ihnen Fern Brookbanks vorstellen?«
Die Hannovers schenken mir ihr freundlichstes Lächeln, die mimische Entsprechung eines Schulterklopfens.
»Wir waren so bestürzt, als wir vom Hinscheiden Ihrer Mutter hörten«, sagt Mrs. Hannover.
Hinscheiden.
Ein seltsames Wort, um das, was passiert ist, zu beschreiben.
Eine dunkle Nacht. Plötzlich ein Reh vor der Windschutzscheibe. An Granit zerschmetternder Stahl. Über den Highway verstreute Eiswürfel.
Ich habe versucht, nicht über Moms letzte Augenblicke nachzudenken. Eigentlich habe ich versucht, gar nicht an sie zu denken. Das tägliche Sperrfeuer aus Trauer, Schock und Wut macht es mir manchmal schwer, morgens aus dem Bett zu kommen. Auch jetzt fühle ich mich wackelig, aber ich versuche, es mir nicht anmerken zu lassen. Der Unfall ist inzwischen weit über einen Monat her, und obwohl die Leute gerne ihr Beileid aussprechen wollen, können die meisten nur ein gewisses Maß an Leid ertragen.
»Es ist schwer, sich diesen Ort hier ohne Maggie vorzustellen«, sagt Mr. Hannover. »Sie hatte stets ein Lächeln im Gesicht. Wir haben immer so gern mit ihr geplaudert. Letzten Sommer haben wir sie sogar dazu überredet, mit uns anzustoßen, stimmt’s?« Seine Frau nickt engagiert, als würde ich ihnen nicht glauben. »Ich hab mal zu ihr gesagt, dass mir ganz schwindelig wird, wenn ich sie immer so rumsausen sehe. Himmel, hat sie da gelacht.«
Der Tod meiner Mutter und die Zukunft des Resorts sind zwei Themen, die mich im Moment überfordern, und ein weiterer Grund, warum ich das Restaurant bisher gemieden habe. Denn die Stammgäste würden zu beidem etwas zu sagen haben.
Ich bedanke mich höflich bei den Hannovers und komme auf ihren Urlaub zu sprechen – Tennis, das schöne Wetter, der neue Biberdamm. Der Small Talk fällt mir leicht. Ich bin zweiunddreißig – zu alt, um mich über die Gäste zu ärgern oder ihr Urteil zu fürchten. Sie ist diejenige, auf die ich wütend bin. Ich dachte, sie hätte akzeptiert, dass mein Leben in Toronto ist. Was hat sie sich dabei gedacht, mir das Resort zu hinterlassen? Was hat sie sich bloß dabei gedacht, einfach zu sterben?
»Unser herzliches Beileid«, bekräftigt Mrs. Hannover erneut. »Sie sehen ihr so ähnlich.«
»Stimmt«, bestätige ich. Ich bin ähnlich klein und habe die gleichen hellen Haare und grauen Augen.
»Dann wollen wir Sie nicht länger aufhalten. Sicher wollen Sie Ihren letzten Abend hier bei uns noch in Ruhe genießen. Vom Balkon Ihres Zimmers aus haben Sie einen großartigen Blick auf das Feuerwerk«, rettet Jamie mich, und ich werfe ihm ein dankbares Lächeln zu. Er zwinkert verstohlen zurück.
Schon als Jugendliche waren wir ein gutes Team, wenn wir zusammenarbeiteten. Wir hatten ein Codewort, wenn einer von uns vor einem nervigen oder überanspruchsvollen Gast gerettet werden musste: Wassermelone. Der betagte Witwer, der mir immer wieder beteuerte, wie sehr ich doch seiner ersten Liebe ähnelte: Wassermelone. Der Hobby-Ornithologe, der Jamie eine ausufernde Beschreibung aller von ihm in der Gegend beobachteten Arten gab: Wassermelone. Aber nachdem wir einen ganzen Sommer gemeinsam im Ausrüstungsschuppen arbeiteten und Kanus und Kajaks aus dem See schleppten, verstanden wir uns auch wortlos – von da an genügte ein leichtes Augenaufreißen oder Zucken der Lippe.
»War doch gar nicht so schlimm, oder?«, erkundigt sich Jamie, als die Hannovers in Richtung Aufzug verschwunden sind, aber ich antworte nicht.
Er weist mit dem Arm auf den Eingang zum Speisesaal. Viele der Besucher dort sind Gäste des Resorts, aber auch einige Einheimische. Bei meinem Glück entdeckt mich jemand, mit dem ich die Highschool besucht habe, sobald ich den Raum betrete. Das Blut rauscht in meinen Ohren wie ein Laster auf dem Freeway.
»Ich fürchte, ich kann das nicht«, sage ich. »Ich geh zurück ins Haus. Ich bin total erschöpft.«
Das ist nicht gelogen. Die Schlaflosigkeit hat mich überkommen, seit ich hierher zurückgekehrt bin. Jeden Morgen wache ich unausgeschlafen und etwas orientierungslos in meinem früheren Kinderzimmer auf. Ich blicke in das dichte Gewirr aus Ästen vor dem Fenster und rufe mir in Erinnerung, wo ich bin und warum ich hier bin.
Anfangs zog ich mir einfach das Kissen über den Kopf und schlief weiter. Erst gegen Mittag stand ich auf, wankte nach unten und füllte den restlichen Tag mit Kohlenhydraten und Folgen von The Good Wife. Doch dann fing Jamie an, mich anzurufen und mit Fragen zu löchern, und Whitney kam ohne Vorwarnung vorbei und hielt mir Vorträge darüber, wie viel Zeit ich im Pyjama verbrachte – die Art von liebevoller Strenge, die nur eine beste Freundin aufbringen kann –, also zog ich mich an. Ich verließ auch wieder das Haus, besuchte die Lodge, ging zum Schwimmen hinunter zum Privatsteg der Familie und trank meinen Morgenkaffee so, wie Mom es immer getan hatte. Ein paarmal bin ich sogar mit dem Kajak rausgefahren. Es ist ein gutes Gefühl, auf dem Wasser zu sein, als hätte ich einen Funken Kontrolle, auch wenn es nur darum geht, ein winziges Boot zu steuern.
Ich werde zwar immer noch von einer Prozession aus Trauer, Wut und Panik begrüßt, sobald ich die Augen aufschlage, aber mittlerweile zieht sie leise und nicht mehr wie eine scheppernde Marschkapelle vorbei.
Im Laufe der letzten paar Wochen hat Jamie mich geduldig über alles auf den Stand gebracht, was sich in den langen Jahren, seit ich zuletzt hier gearbeitet habe, verändert hat. Aber viel verrückter ist all das Zeug, das sich überhaupt nicht verändert hat. Das Sauerteigbrot. Die Gäste. Die Tatsache, dass er mich noch immer Fernie nennt.
Wir kannten uns lange, bevor wir zusammenkamen. Das Cottage der Pringles befindet sich nur ein paar Buchten weiter am See. Seine Großeltern kannten meine, und seine Eltern kommen noch heute immer freitags zu Fish and Chips ins Restaurant des Resorts. Jetzt, da sie in Rente sind, verbringen sie fast den ganzen Sommer in Muskoka und kehren erst im September in das hundert Kilometer westlich von Toronto gelegene Guelph zurück. Jamie lebt noch in einer Mietwohnung in der Stadt, aber er hat sich das leer stehende Grundstück neben dem seiner Eltern gekauft, um sich dort ein Haus zu bauen, in dem er das ganze Jahr über wohnen kann. Er liebt den See mehr als alles andere.
»Heute ist Canada Day«, sagt Jamie. »Da würden sich die Gäste und die Angestellten schon freuen, dich zu Gesicht zu bekommen. Jetzt beginnt der Sommer so richtig, und ich verlange ja gar nicht, dass du dich auf die Bühne stellst und vor dem Feuerwerk noch eine Rede hältst.« Er verkneift sich zu sagen: So wie es deine Mutter immer getan hat. »Aber Hallo sagen könntest du wenigstens.«
Ich schlucke schwer, und Jamie fasst mich an den Schultern und sieht mir fest in die Augen. »Du schaffst das. Jetzt bist du schon mal hier … und ordentlich angezogen. Außerdem warst du tausendmal da drinnen.« Er senkt verschwörerisch die Stimme. »Wir haben es dort sogar mal gemacht, weißt du noch? Nische drei.«
Ich schnaube. »Natürlich weißt du noch, in welcher Nische es war.«
»Ich könnte dir all die Orte, die wir entweiht haben, auf einer Karte einzeichnen. Allein im Ausrüstungsschuppen …«
»Stopp!« Ich lache jetzt, aber leicht überdreht. Hier bin ich, zusammen mit meinem Ex-Freund, und wir reden darüber, wo im Ferienresort meiner kürzlich verstorbenen Mutter wir Sex hatten. Ich fühle mich, als hätte mich das Universum an der Nase herumgeführt.
»Fernie, alles, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, dass es keine große Sache ist.«
Ich will Jamie gerade antworten, dass er falschliegt und es sehr wohl eine große Sache ist, aber da entdecke ich aus dem Augenwinkel eine Ausflucht. Ein auffallend hochgewachsener Mann schiebt seinen silbernen Rollkoffer auf den Empfangstisch zu, und der ist noch immer nicht besetzt.
Der Riese hat uns den Rücken zugewandt, aber man sieht, dass sein Anzug teuer war. Vermutlich maßgeschneidert. Der schwarze Stoff sitzt auf eine tadellose Weise an seinem Körper, die präzise Maße und reichlich Spielraum auf der Kreditkarte erfordert. Ich bezweifle, dass Stangenware lang genug für seine Arme wäre, und bei ihm sieht die Manschette perfekt aus. Genauso wie sein nach hinten gekämmtes Haar. Pechschwarz und glänzend und auf die gleiche sorgfältige Art gestylt, wie sein Jackett geschneidert ist. Ehrlich gesagt ist er overdressed. Das hier ist zwar ein wunderschönes Resort, eines der hübschesten im Osten von Muskoka, und das Personal ist stets adrett gekleidet, aber die Gäste ziehen zwanglose Kleidung in der Regel vor, besonders im Sommer.
»Ich kümmere mich um ihn«, sage ich zu Jamie. »Ich brauche wieder ein bisschen Übung beim Einchecken. Kommst du mit und schaust, ob ich alles richtigmache?«
Es gibt keine Diskussion. Wir können den eleganten Mann schließlich nicht einfach da stehen lassen.
Als ich hinter den Empfangstisch trete, entschuldige ich mich dafür, dass er warten musste.
»Willkommen im Brookbanks Resort«, sage ich und blinzle nur ganz kurz zu ihm hoch – sogar mit meinen hohen Absätzen überragt er mich um gut dreißig Zentimeter.
»Haben Sie gut hergefunden?«, erkundige ich mich höflich und drücke eine Taste, um den Computer aus dem Stand-by zu wecken. Der große Kerl hat immer noch kein Wort gesagt. Das letzte Stück der Straße hierher ist unbefestigt, nicht beleuchtet und weist ein paar üble Kurven auf. Manchmal empfinden Leute aus der Stadt die Anreise deshalb als beschwerlich, besonders wenn sie nach Sonnenuntergang hier eintreffen. Ich schätze, der Mann kommt aus Toronto, obwohl er auch aus Montreal stammen könnte. Nächste Woche findet hier in der Gegend ein Medizinkongress statt, und manche der Ärzte reisen früher an, um ein verlängertes Wochenende zu haben.
»Ja.« Er fährt sich mit der Hand über die Krawatte. Und sagt sonst nichts mehr.
»Gut.« Ich tippe mein Passwort ein. »Gehören Sie zu der Gruppe der Dermatologen?« Ich greife aufs Hauptmenü zu, und als er nichts erwidert, räuspere ich mich leise und versuche es erneut. »Haben Sie bei uns reserviert?«
»Habe ich.« Er spricht die Wörter langsam, als überprüfe er sie gleichzeitig auf Fehler.
Ich habe keine Ahnung, was sein Problem ist. Männer mit Anzügen wie seinem klingen normalerweise weitaus selbstsicherer. Aber dann schaue ich auf und blicke in ein sehr attraktives, markantes und ziemlich angespannt wirkendes Gesicht. Er ist ungefähr in meinem Alter, und er kommt mir seltsam bekannt vor. Ich bin mir sicher, dass ich dieses Gesicht schon einmal gesehen habe. Seine Nase erinnert mich an irgendetwas. Vielleicht ist er ein Schauspieler, obwohl Promis eher selten im Anzug und frisch rasiert hier auftauchen – zumindest war das früher so.
»Ihr Name bitte?«
Er hebt die Augenbrauen, als überrasche ihn meine Frage. Dann fällt mir auf, wie dunkel seine Augen sind, schwarz wie Krähenflügel, und mein Magen zieht sich zusammen. Er hält sich auffallend aufrecht, seine Körperhaltung ist einwandfrei. Mein Herz rast, hämmert bis in meine Fingerspitzen und meine Fußballen. Ich suche sofort nach der Narbe. Und dann entdecke ich sie: unterhalb seiner Lippe an der linken Seite des Kinns, kaum noch sichtbar, es sei denn, man weiß, wonach man Ausschau halten muss. Ich kann nicht glauben, dass ich es noch weiß.
Aber ich weiß es.
Ich weiß, dass seine Augen nicht wirklich schwarz sind – im Sonnenlicht sind sie espressobraun.
Ich weiß, wie er die Narbe bekommen hat.
Denn obwohl ich versucht habe, ihn zu vergessen, weiß ich genau, wer dieser Mann ist.
2
14. Juni, zehn Jahre zuvor
Wir hatten nur noch fünf Minuten, um zum Bahnhof zu kommen, und die Straßenbahn steckte im Verkehr fest. Whitney und ich schoben uns durch die dicht gedrängten Fahrgäste nach vorne und murmelten dabei halbherzige Entschuldigungen, bevor wir hinaus auf den Gehsteig stolperten und losrannten.
»Los, beeil dich, Whit«, schrie ich ihr über die Schulter zu.
Zu spät zu kommen, war keine Option. Es gab an diesem Tag genau einen Bus Richtung Norden, und auch wenn keine von uns es laut ausgesprochen hatte, mussten Whitney und ihr Riesenkoffer ihn unbedingt erwischen. Wir hatten drei Tage zusammen in meinem klitzekleinen Apartment verbracht, und es war durchaus möglich, dass unsere Freundschaft nicht noch einen vierten überleben würde.
Die Sonne stand tief am Himmel, blinzelte zwischen Gebäuden hindurch und glitzerte an Glastürmen, während wir die Dundas Street entlangrannten und die Sohlen unserer Turnschuhe auf den kaugummigesprenkelten Boden klatschten. Wenn man hochschaute, blendete einen die grelle Sonne, aber unten auf Bodenhöhe war Toronto in blaugraues Morgenlicht getaucht. Der Kontrast war schön. Die Art, wie sich das Licht in den Fenstern spiegelte, erinnerte mich an zu Hause, an schillernden Sonnenschein auf dem See.
Ich wäre gerne stehen geblieben und hätte es Whitney gezeigt. Aber wir hatten keine Sekunde zu verlieren, und selbst wenn wir Zeit gehabt hätten, hätte sie der glitzernden Skyline wohl nichts Magisches abgewinnen können. Ich hatte schon ihren ganzen Besuch über versucht, sie Toronto durch meine Augen sehen zu lassen, aber ohne Erfolg.
Wir erreichten den Busbahnhof eine Minute zu spät, aber neben dem Bus, der in der Parkbucht Nummer neun hielt, stand eine lange Schlange Reisender, von denen jeder auf seine Weise genervt dreinschaute. Der Fahrer war nirgends zu sehen.
»Gott sei Dank«, keuchte ich.
Whitney beugte sich vor und stützte sich schnaufend mit den Händen auf den Knien ab. Ein paar kastanienbraune Strähnen hatten sich aus ihrem Pferdeschwanz gelöst und klebten an ihren hochroten Wangen. »Ich. Hasse. Rennen.«
Als sie wieder Luft geschöpft hatte, prüften wir, ob wir auch die richtigen Abfahrtsinfos hatten, und stellten uns dann ans Ende der Schlange. Der Busbahnhof sah im Grunde wie eine schäbige Riesenwerkstatt aus – eine dunkle, feuchte Achselhöhle von Toronto. Die Luft roch nach Automaten-Sandwiches, Dieseldämpfen und Elend.
Ich checkte die Uhrzeit auf meinem Handy. Es war bereits nach zehn. Ich würde zu spät zu meiner Schicht im Café sein.
»Du musst nicht warten«, sagte Whitney. »Von hier aus komm ich schon klar.«
Whitney und ich waren beste Freundinnen seit der Grundschule. Sie hatte ein rundes Gesicht mit haselnussbraunen Rehaugen und eine winzige Kirschnase, die sie unter fast allen Umständen trügerisch unschuldig wirken ließ. Es war süß, dass Whitney versuchte, unerschrocken zu klingen, aber gleichzeitig hielt sie ihre Nylonhandtasche umklammert, als könne sie ihr bei weniger Wachsamkeit sofort entrissen werden.
Mit ihren zweiundzwanzig Jahren war Whitney noch nie allein in Toronto gewesen, nicht einmal für zehn Minuten, und auch wenn ich wusste, dass ihr nichts passieren würde, hatte ich nicht vor, sie in einer der schmuddeligsten Ecken der Stadt sich selbst zu überlassen.
»Schon okay. Ich will dir noch winken, wenn du losfährst«, sagte ich zu ihr.
»Denk dran«, meinte sie, »schon bald muss ich nicht mehr so einen weiten Weg hinter mich bringen, damit wir uns sehen können.«
Es war gar kein so weiter Weg – zweieinhalb äußerst malerische Stunden –, aber gut.
Ich setzte ein Lächeln auf. »Kann’s kaum erwarten.«
»Ich weiß, dass es dir hier gefällt.« Sie schielte argwöhnisch über die Schulter. »Aber manchmal versteh ich’s nicht ganz.«
Mir lag eine sarkastische Antwort auf der Zunge.
Wie selten Whitney mich während meines Studiums hier besucht hatte, war ein wunder Punkt bei mir. Ich war nicht sicher, ob es daran lag, dass unsere Freundschaft kein wirklich solides Fundament mehr hatte seit unserem Streit über mein »selbstzerstörerisches Verhalten« im Highschool-Abschlussjahr, oder daran, dass sie die Stadt einfach nicht besonders mochte. Bei jedem ihrer seltenen Besuche wurde deutlich, dass sie eigentlich lieber in Huntsville wäre. Sie schlug meine Einladungen zwar nicht kategorisch aus, aber sie schien auch nie sonderlich begeistert darüber. Das sah ihr eigentlich gar nicht ähnlich. Whitney war die ultimative Ja-und?-Person – eigentlich ergriff sie jede Gelegenheit für Eskapaden und Abenteuer beim Schopf.
»Ehrlich, mir würde es reichen, wenn wir die nächsten zwei Tage in deiner Wohnung abhängen und Brot essen würden«, hatte sie bei ihrer Ankunft diese Woche verkündet.
Offen gestanden nervte mich das. Meine Zeit in Toronto lief langsam ab, und es gab noch so viele Dinge, die ich machen wollte. Whitney hätte eigentlich meine Komplizin sein sollen. Stattdessen hatte es sich so angefühlt, als hätte ich sie nur mitgeschleift.
»Was gibt es da nicht zu verstehen?«, fragte ich und machte eine gespielt erhabene Geste, just in dem Moment, als ein Mann in der nächsten Parkbucht auf den Boden kotzte.
Whitney verzog angewidert das Gesicht und blickte auf ihr Handy. »Jamie hat geschrieben. Ich soll dir einen Kuss von ihm geben.« Ihre Nase kräuselte sich, als sie seine Nachricht vorlas. »Gib Fernie einen Abschiedskuss von mir. Mit Zunge ist erlaubt. Gerne. Schick ein Foto. Zwinkersmiley.«
Ich schüttelte den Kopf und musste mir ein Grinsen verkneifen. Jamie war wie ein menschlicher Labradoodle – ein unbekümmerter, vergnügungshungriger, wuscheliger Lockenkopf. Beim Klang seines Namens wurde mir etwas leichter ums Herz. »Das hat mein Freund geschrieben? Ich bin schockiert.«
»Er wünscht sich nichts mehr, als dass du zurückkommst. Das tun wir alle.«
Ich schluckte. Dann entdeckte ich zu meiner Erleichterung einen Mann, der in einer verräterischen marineblauen Uniform auf den Bus zugeschlendert kam.
»Lassen Sie sich nur Zeit!«, rief ihm einer der Passagiere höhnisch entgegen. »Wir sind ja noch überhaupt nicht spät dran.«
»Ich freu mich so drauf, wenn wir wieder an einem Ort wohnen«, fuhr Whitney fort.
Ich nickte und zwang mich zu den Worten: »Ich mich auch.«
Seit vier Jahren lebte ich nun fern von meiner besten Freundin und meinem Freund – ich sollte die Sekunden zählen, bis wir wieder vereint wären. Jamie hatte ich seit seinem Überraschungsbesuch am Valentinstag nicht mehr gesehen. Während der Wintermonate arbeitete er als Snowboardlehrer in Banff, aber seit dem langen Maiwochenende war er wieder im Resort. Ich hatte mein letztes Studienjahr bereits beendet – ich sollte eigentlich längst dort bei ihm sein. Ich hätte direkt nach meiner Abschlussprüfung im April meine Taschen packen sollen. Stattdessen hatte ich Mom dazu überredet, dass ich noch bis Ende Juni bleiben durfte, damit ich die Stadt unsicher machen konnte bis zur Saisonauftaktfeier im Resort, die Ende nächster Woche stattfinden würde. Ich hatte ihr Verständnis als Unternehmerin ausgenutzt und ihr weisgemacht, dass mein Chef Schwierigkeiten hätte, eine Barista zu finden, die mich ersetzen könnte.
Am Bus ging es nun voran, und der Fahrer fing an, Gepäckstücke in seine Klappe unten zu werfen. Während die Passagiere vorwärtsrückten und die Schlange sich langsam auflöste, umarmten Whitney und ich uns noch einmal lange.
»Hab dich lieb, Baby«, sagte sie.
Da ich in einem Dirty-Dancing-artigen Resort aufgewachsen war, hatte ich auch einen Dirty-Dancing-Spitznamen bekommen: Baby. Ich hasste es. Es passte noch nicht mal wirklich – schließlich war Baby ein Gast.
Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, zog ihr die Kapuze ihres Hoodies über den Kopf und schnürte sie fest zu. »Ich dich auch«, sagte ich zu ihr. Wenigstens das war keine Lüge.
Als Whitney einen Platz gefunden hatte, warf ich ihr noch eine Kusshand durchs Fenster zu und holte dann die Kopfhörer aus meinem Stoffbeutel. Ich drückte auf Play, und die Talking Heads übertönten den Busmotor und den tickenden Countdown in meinem Kopf, der mit jedem verstrichenen Augenblick lauter wurde.
Noch neun Tage, bis ich zurück nach Hause musste.
Meine Kopfhörer waren mein Therapeut und meine Tarnkappe. Das Two Sugars befand sich nur ein paar Blocks vom Busbahnhof entfernt – nicht weit genug, als dass die Musik meine Schuldgefühle hätte wegwaschen können oder mich das Resort und all die damit einhergehenden Verpflichtungen hätte vergessen lassen. Auch meine Vergangenheit wartete dort auf mich. Die Zeit, als die Huntsville-High-Gerüchteküche hauptsächlich durch Fern-Brookbanks-Klatsch befeuert worden war. Das war zwar schon Jahre her, aber ich wusste, dass die Leute dort in mir noch immer dieses Mädchen sahen. Die Fern, die völlig aus der Spur geraten war. Mit ein wenig Glück war im Café heute so viel los, dass mein Hirn nach dem zehnten gebrühten Espresso einfach auf Autopilot schalten würde.
Ich lief Richtung Osten, drängelte mich durch die Horden von Touristen auf dem Yonge Dundas Square. Ich mochte seine Geschmacklosigkeit – den Beton, die blinkende Reklame und die Doppeldeckerbusse für Stadtrundfahrten –, aber was mir am besten daran gefiel, war, dass überall Menschen waren und mich kein einziger davon beachtete. Jeden Tag überquerten etwa einhunderttausend Leute diese Kreuzung, und in diesem ganzen Trubel war ich ein absoluter Niemand.
Ich erzählte immer, dass ich aus Huntsville käme, aber das stimmte nicht ganz. Das Resort befand sich weit außerhalb an den felsigen Ufern des Smoke Lakes. Zum Studieren nach Toronto zu gehen, war für mich ein bisschen wie eine Mondlandung gewesen. Ich wünschte, ich könnte für immer die Weltraumforscherin spielen.
Ich drehte die Musik lauter und spürte bewusst die Sonne in meinem Nacken, als ich mit den Schultern erst nach vorne und dann zurück kreiste. Es wurden Rekordtemperaturen erwartet. Toronto erreichte im Juni seine Bestform. Die Außenterrassen und Parks quollen über vor zügelloser Sommer-Unbeschwertheit. Im Juni war ein heißer Tag noch ein Geschenk. Im August wäre er eine Bürde, und die ganze Stadt würde nach geschmortem Müll riechen.
Ich hatte mich passend zu der angekündigten Hitze angezogen und trug eine ausgefranste kurze Jeans und ein Trägeroberteil unter einer kurzärmeligen Bluse, die ich in einem Secondhandladen aufgestöbert hatte. Sie war fließend und hauchdünn und hatte ein zartes braunes Blumenmuster, das ich auf eine Neunzigerjahre-Art stylish fand – den gelblichen Fleck am Saum konnte man kaum sehen.
Vor dem Two Sugars stand eine Reihe von metallenen Zeitungskästen Wache, und ich schnappte mir eine Ausgabe von The Grid, der kostenlosen alternativen Wochenzeitschrift, die ich favorisierte, bevor ich an der Eingangstür zog. Sie war verschlossen. Irritiert rüttelte ich noch einmal an der Klinke und drückte dann die Nase an die Glasscheibe. Das Café war mein zweitliebster Ort auf der Welt, und er war menschenleer bis auf Luis. Sobald er mir öffnete, drang der Geruch von frischer Farbe in meine Nase.
»Warum haben wir geschlossen?«, fragte ich, nahm die Kopfhörer aus den Ohren und trat ein. Dann fiel mein Blick auf ein Schwarz-Weiß-Gemälde, das sich über eine komplette Wand erstreckte. »Was ist das?«
»Die Frage muss wohl eher lauten: Was ist das?« Luis zeigte auf meinen Kopf.
»Neue Frisur.«
Er schnaubte. »Das ist keine Frisur. Du hast deine kompletten Haare abgeschnitten.« Dann grinste er. »Gefällt mir.«
Ich zupfte an einer der raspelkurzen Strähnen – sie war kaum lang genug, dass man sie zwischen den Fingern halten konnte. Ich hatte meine Haare nach meiner letzten Schicht, bevor Whitney angekommen war, schneiden lassen. Wenn man bedachte, dass sie mir vorher bis über die Schultern gefallen waren, war es wirklich eine große Veränderung.
»Ich erinnere mich zwar nicht, dich um deine Meinung gebeten zu haben, aber danke«, sagte ich. »Also, was ist hier los?«
»Hast du das mit dem Wandgemälde gar nicht mitbekommen?« Luis verschränkte die Arme vor seiner beeindruckend breiten Brust. Andere Mitarbeiter des Two Sugars waren gekommen und gegangen, aber wir beide arbeiteten nun schon seit drei Jahren zusammen.
»Nö.«
»Tja, wir haben jetzt ein Wandgemälde. Oder zumindest fast.
Ich blickte mich um. Der Künstler war nirgends zu sehen. »Und wir beide spielen die Babysitter?«, riet ich.
»Einer von uns beiden. Ich war schon die letzten paar Tage hier.« Er zog einen kleinen Schlüsselring aus der Hosentasche. »Jetzt bist du dran.«
Ich starrte Luis an. Stundenlang mit einem Fremden zu verbringen, mit dem ich Small Talk machen musste – die Vorstellung war fast noch grausiger, als eine öffentliche Rede halten zu müssen. »Nein«, sagte ich.
»Do-hoch«, erwiderte Luis leiernd. »Ich fahre nach Toronto Island. Bin in ’ner halben Stunde mit Freunden an der Fähre verabredet.«
»Na gut«, brummte ich widerwillig und nahm den Schlüssel entgegen. Dann warf ich meine Sachen auf einen Tisch und trat näher an das Gemälde heran. »Und wo ist unser Michelangelo?«
»Er holt sich kurz was zu essen«, erklärte Luis. »Am frühen Nachmittag sollte er eigentlich mit allem fertig sein, dann kannst du dir freinehmen. Wir haben noch bis morgen geschlossen.«
Ein paar Stunden würde ich das hier schon überleben. Ich hatte einen Joint in meiner Tasche und vor, ihn nach Feierabend in der Gasse hinterm Café zu rauchen. Anschließend würde ich durch meine Stadt zurück zu meiner Wohnung in Little Italy schlendern.
»Gefällt es dir?«, erkundigte sich Luis.
Ich betrachtete das Wandgemälde eingehender. Es bestand aus einer spiegelkabinettartig verzerrten Skyline von Toronto – der CN Tower war winzig und wurde von einer Waschbärenpfote umklammert. Toronto erfuhr gerade einen regelrechten Hype, und diese Art von trendigem Stolz auf die Stadt war überall zu sehen: auf T-Shirts, Postern, sogar auf meinem Stoffbeutel, auf dem eine Karte von Little Italy abgebildet war.
»Ich weiß nicht«, sagte ich. »Es kommt mir … wenig originell vor.«
»Autsch«, hörte ich eine tiefe Stimme hinter uns.
Ich drehte mich langsam um.
Bekleidet mit einem weiten Blaumann, stand da ein Typ in meinem Alter mit einer Papiertüte voller Essen. Er war ungewöhnlich groß und hielt sich sehr aufrecht, was ihn noch größer erscheinen ließ. Das zerzauste schwarze Haar fiel ihm bis über die Ohren. Seine Nase war einen Tick zu lang, aber es stand ihm.
»Das ist unser Michelangelo«, sagte Luis.
Das Kinn und die Wangenknochen des Typen waren kantig, beinahe eckig. Ich wusste gar nicht, wo ich hinschauen sollte, da war so viel von ihm, und es war alles sehr … ansehnlich.
»Euer wenig origineller Michelangelo«, korrigierte der Typ. Ich senkte den Blick. Er war zu hübsch, um ihn direkt anzusehen. Seine hellbraunen Arbeitsstiefel hatten neonpinke Schnürsenkel.
»Aber normalerweise nennt man mich einfach Will.« Er streckte mir die Hand entgegen. »Will Baxter.«
Ich starrte erst auf seine große Hand und blickte ihm dann in die Augen. Sie waren so dunkel wie eine Ölpfütze.
»Und du bist?«, fragte Will nach einem Moment und ließ den Arm wieder sinken.
Ich warf Luis einen genervten Blick zu. Typen, die so heiß waren wie dieser hier, waren die Schlimmsten. Aufgeblasen, von sich selbst eingenommen und langweilig. Noch dazu war er groß. Heiß und groß bedeutete komplett unerträglich. Wahrscheinlich bestand die einzige Herausforderung in seinem Leben darin, passende Hosen zu finden. Luis machte eine kleine wegwerfende Geste, wie um zu sagen: Der Typ ist in Ordnung.
»Fern.«
Will zog fragend die Augenbrauen hoch.
»Brookbanks«, fügte ich hinzu und wollte mir aus reiner Gewohnheit die Haare hinter die Ohren stecken, nur dass da nichts mehr zum Stecken war.
»Tut mir leid zu hören, dass du meine Arbeit wenig originell findest, Fern Brookbanks«, sagte Will übertrieben fröhlich. »Ich fürchte nämlich, du musst mich noch den restlichen Tag ertragen.«
Ich lächelte ihn verkrampft an.
»Tja, Leute, ich werd dann mal«, verkündete Luis. »Und Will, keine Sorge, auch wenn der erste Eindruck etwas anderes vermuten lässt, beißt Fern nicht.«
»Hey!«, protestierte ich.
»Wir sehen uns am Montag.« Luis küsste mich auf die Wange und flüsterte mir ins Ohr: »Das ist ein super Typ. Sei nett.«
Ich schloss hinter Luis ab und spürte, dass Will mich dabei beobachtete.
»Was?«
»Sag mir, warum es dir nicht gefällt.«
Er holte einen Muffin aus der Papiertüte und zog das Pergamentpapier ab. Mein Magen knurrte. Ich hatte als besonderes Abschiedsfrühstück für Whitney zwar Moms Pancakes gemacht, aber das war bereits Stunden her. Will brach den Muffin in zwei Hälften und hielt mir eine davon hin.
»Danke«, sagte ich und stopfte sie in den Mund. Zitrone-Cranberry.
Wir drehten uns zur bemalten Wand um. Bis auf die rechte Ecke schien alles fertig.
»Der Waschbär ist gut«, meinte ich. Als er nichts darauf sagte, schielte ich zu ihm hoch. Aus der Nähe betrachtet, sah er noch besser aus. Seine Wimpern waren übertrieben geschwungen und so schwarz wie der See bei Mitternacht. Sie waren lang und fein, und der Kontrast zu seiner vollgeklecksten Arbeitskluft war seltsam aufregend. Ich betrachtete das Wandgemälde erneut. »Also, schlecht ist es jetzt auch wieder nicht.«
Sein Lachen kam aus dem Nichts, explodierte wie ein Feuerwerk. Es war der akustische Ausdruck reinen Vergnügens. »Sag mir, was du wirklich denkst.«
»Es ist einfach nicht das, was ich ausgesucht hätte. Es wirkt jetzt alles so anders hier drinnen als noch vor sechs Monaten.« Mein Chef hatte beschlossen, dass das Café ein wenig »Modernisierungsbedarf« hätte. Statt der verschrammten Kirschholzstühle gab es jetzt welche aus geformtem schwarzem Kunststoff. Die ehemals türkisen Wände waren weiß gestrichen worden. Und es gab auch keine Renoir-Poster mehr.
Ich machte den Fehler, erneut zu Will zu gucken. Die faszinierte Art und Weise, wie er mich ansah, verunsicherte mich.
»Also, kein großer Fan von Veränderung?«
»Mir hat es gefallen, wie es vorher war.« Ich zeigte auf eine Ecke neben dem Fenster. »Wir hatten da diesen alten Samtsessel und mehrere Nigella-Lawson-Kochbücher.« Zwar hatten wir nicht oft hineingeschaut, aber Nigella war unser Ding. »Dort drüben hing ein Holzperlenvorhang.« Ich zeigte zu dem Durchgang, der in die Küche führte.
An der Wand, die Will nun bemalte, hatte sich über der Milch- und Zuckerstation ein großes Korkbrett befunden, an das die Leute Flyer für Klavierunterricht, Strickgruppen, verschiede Gesuche und einfach alles Mögliche pinnen konnten. Letztes Jahr hatte sogar einer unserer Stammgäste seinem Freund einen Antrag gemacht, indem er ein Schild aufgehängt hatte, auf dem stand: Ich liebe dich, Sean. Willst du mich heiraten? Direkt darunter hatte er Streifen zum Abreißen eingeschnitten, auf denen dieselbe Antwort stand: Ja.
»Es war so gemütlich hier. Jetzt fühlt es sich wie ein komplett anderer Ort an«, erklärte ich. »Es ist so … nüchtern.«
»Ich weiß, was du meinst«, sagte Will und wischte sich ein paar Muffin-Krümel von den Brusttaschen seines Blaumanns. Am kleinen Finger trug er einen schlichten goldenen Siegelring. »Jedes Mal, wenn ich nach Toronto komme, hat es sich ein bisschen verändert. Manchmal mehr, manchmal weniger.«
»Du lebst nicht hier?«
»Nein, in Vancouver«, sagte er. »Aber ich bin hier aufgewachsen. Und ja, es entwickelt sich ständig weiter. Eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht.« Er strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Immer, wenn ich wieder herkomme, lerne ich die Stadt ganz neu kennen.«
»Romantisch«, sagte ich trocken. Aber seine Worte schossen wie ein Espresso in meinen Blutkreislauf.
3
Jetzt
Über den Empfangstresen hinweg starre ich Will an. Meine Hände schweben über der Computertastatur, und mein Mund ist ganz trocken. Er schaut mir direkt in die Augen. Seinen Namen hat er mir noch immer nicht genannt, und Jamies Kopf schnellt zwischen uns hin und her wie der eines Welpen, der sich nicht zwischen zwei Spielzeugen entscheiden kann.
Will und ich waren zweiundzwanzig, als wir uns das letzte Mal begegnet sind, und er sieht überhaupt nicht so aus, wie ich mir vorgestellt hätte, dass er einmal sein würde. Ich frage mich, ob er von mir das Gleiche denkt. Denn er muss wissen, wer ich bin. Er muss wissen, dass dieses Brookbanks Resort mein Brookbanks Resort ist.
»Wir brauchen bloß Ihren Namen, damit wir die Reservierung finden können«, sagt Jamie und schiebt mich aus dem Weg, während Will und ich uns weiter anstarren. Er kneift die Augen leicht zusammen. Er ist sich nicht sicher, ob ich ihn erkannt habe.
Aber natürlich habe ich das, auch wenn dieser Will Baxter ganz anders ist als der Will Baxter, den ich einmal gekannt habe.
Er besteht noch immer aus langen Linien und scharfen Kanten, wobei der Anzug mich verwirrt. Genauso wie sein Haar, das er sich aus dem Gesicht gekämmt und mit Styling-Produkten festzementiert hat. Er ist nach wie vor schlank, wirkt aber irgendwie muskulöser als früher. Es sind der Anzug, das Haar und sein Körperbau plus die zehn Jahre, seit ich ihn zuletzt gesehen habe.
Obwohl es unerwartet ist, die maßgeschneiderte Kleidung und der Zweihundert-Dollar-Haarschnitt stehen ihm. Er sieht gut aus.
»Will Baxter«, sagt er und schaut mir fest in die Augen, als er mir seine Kreditkarte und den Ausweis über den Tresen zuschiebt.
Ich habe nur einen Tag mit Will verbracht, und der hat mein Leben verändert. Früher dachte ich, er wäre vielleicht mein Seelenverwandter. Und dass er und ich unter sehr anderen Umständen heute zusammen sein könnten. Ich habe einmal alles Mögliche über Will gedacht.
Und ich habe viel zu viel Zeit meines Erwachsenenlebens damit verschwendet, mich zu fragen, was aus ihm geworden ist.
Vielleicht kann ich meine Kinnlade gerade noch davon abhalten, runter auf den burgunderroten Teppich zu fallen, aber meine Atmung bekomme ich nicht unter Kontrolle. Dieses verdammte Kleid von meiner Mutter ist so was von eng, ich kann deutlich sehen, wie sich mein Brustkorb hebt und senkt. Will bemerkt es auch. Sein Blick wandert für eine Sekunde nach unten, und als er ihn wieder hebt, holt er geräuschvoll Luft.
»Mr. Baxter, ich sehe, Sie haben eines der Ferienhäuschen gebucht«, sagt Jamie.
Ich nehme seine Worte kaum wahr.
Will anscheinend auch nicht, denn er antwortet nicht. Stattdessen senkt er den Kopf.
»Fern.« Wills Stimme ist tief, und mein Name kommt ihm schwer über die Lippen, als hätte er sich in flüssigem Teer verfangen.
Ich weiß nicht recht, was die richtige Reaktion darauf ist. Was die sicherste ist. So zu tun, als erinnerte ich mich nicht an ihn, würde mir den meisten Schutz bieten, aber ich bin keine besonders gute Schauspielerin. Ich war mir nie sicher, ob es verrückt ist, dass ich mich an die vierundzwanzig Stunden, die ich mit Will verbracht habe, so klar erinnern kann, oder ob es viel absurder wäre, wenn ich das nicht täte.
Ich zupfe an der Haut meines Unterarms, und Will verfolgt meine Bewegung mit dem Blick. Ich presse die Handflächen auf den Tresen, verärgert darüber, dass er diese Wirkung auf mich hat.
»Du bist hier.« Er sagt es, als würde er nicht die ironischsten Wörter aneinanderreihen.
Ich bin hier?, will ich zurückschreien. Möchte ihn fragen, wo zur Hölle er gewesen ist. Es war seine Idee, sich hier im Resort wiederzutreffen. Ich bin aufgetaucht. Er hat neun Jahre Verspätung.
Meine Lippen öffnen sich, dann schließe ich sie. Und mache sie wieder auf, aber es kommt nichts heraus.
»Bist du okay?«, flüstert Jamie dicht neben meinem Ohr, und ich schüttle den Kopf.
Wassermelone, forme ich mit den Lippen, in der Hoffnung, dass Jamie es noch weiß.
»Mr. Baxter«, sagt Jamie und reibt sich die Hände. »Ich fürchte, Mrs. Brookbanks hat heute Abend noch andere Verpflichtungen. Aber ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen beim Ankommen behilflich sein könnte.«
Ohne Will in die Augen zu schauen, nicke ich seiner Schulter zu und schiebe mich hinter dem Tresen hervor.
»Ich sehe, Sie sind in Haus zwanzig untergebracht«, sagt Jamie.
Mist. Mist. Mist. Mist.
Ich haste mit weiterhin gesenktem Kopf Richtung Haupteingang. Als ich hinausschlüpfe, höre ich Will noch meinen Namen rufen, dann renne ich los.
Vor Will Baxter davonzulaufen, ist kräfteraubend. Ich weiß das, weil ich das schon seit neun Jahren tue. Eigentlich hätte es mich weit von ihm wegführen sollen, durch eine Art Zaubernebel und Märchenwald ins Land des Vergessens. Ich floh vor dem Gefühl unserer ineinander verflochtenen Finger, vor dem Schmerz. Der fühlte sich anfangs so brennend und stark an wie ein Speer, der durchs Brustbein dringt. Mit der Zeit ist er zu einem dumpfen Stechen verblasst. Aber an diesem Abend gibt es kein Entkommen vor ihm.
Ich renne über die Steinplatten vor dem Haupthaus. Sobald ich den Weg erreicht habe, versinken meine hohen Absätze im Kies, und ich gerate ins Straucheln. Ich verlagere das Gewicht auf die Fußballen, aber ich komme nur schwer vorwärts. Meine Birkenstocks stehen noch im Büro. Fluchend ziehe ich die Schuhe aus und muss die Zähne zusammenbeißen angesichts der spitzen Steinchen unter meinen nackten Füßen. Ich habe zu lange in der Stadt gelebt. Früher sind Whitney und ich den ganzen Sommer lang barfuß hier auf der Anlage herumgelaufen.
Ich bin kaum zwei Meter weitergekommen, als ich eilige Schritte hinter mir vernehme.
»Fern. Warte.«
Aber ich warte nicht. Ich gehe schneller, stolpere und falle hin. Die Demütigung trifft mich heftiger als der stechende Schmerz an meinen Handflächen und Knien.
»Alles okay mit dir?«, erkundigt sich Will und beugt sich über mich.
Ich verfluche den Tag, an dem er geboren wurde. Ich verfluche die Menschen, die sich neun Monate zuvor in den Armen lagen. Ich verfluche so einiges, während ich da liege. Fest presse ich die Stirn gegen den Boden und vergrabe die Finger im Kies. Vielleicht kann ich mich irgendwie hier herauswühlen.
»Ich helf dir hoch, okay?«
Bevor ich Nein sagen kann und dass hier rein gar nichts okay ist, fasst mich Will an den Armen und zieht mich auf die Füße.
Ich zögere, wische Schmutz und Steinchen weg, und Will beugt sich hinunter, um meine Wunden zu begutachten. Sein Kopf ist bloß wenige Zentimeter von meinem entfernt – so nah, dass ich sein Parfüm riechen kann, Rauch und Leder und etwas Süßes, wie verbranntes Karamell. Ich konzentriere mich auf meine Beine.
»Das sieht übel aus«, sagt er und fährt mit dem Finger neben einer blutigen Stelle entlang, die bereits anzuschwellen beginnt. Ich bin so verblüfft, dass ich nur zusehen kann.
»Nicht so schlimm«, fauche ich. Als ich einen Blick auf ihn riskiere, sieht er mich durch seine dichten dunklen Wimpern hindurch an.
»Du bist es«, sagt er. Er wirkt nicht überrascht, mich zu sehen.
Ich stelle mich aufrecht hin, und auch Will richtet sich zu seiner vollen Größe auf.
Ich starre auf seine Krawatte. Er hat einmal behauptet, er würde so etwas niemals anziehen. Ich frage mich, gegen welche anderen Pläne er auch verstoßen hat.
»Bist du okay?«, fragt er. »Möchtest du dich hinsetzen?« Er zeigt auf eine Holzbank mit Blick auf den See, dessen gegenüberliegendes Ufer man in der Dunkelheit nicht erkennen kann. Die Luft riecht nach frisch gemähtem Gras, Petunien und Kiefern – die gepflegten Rasenflächen und Gärten rund um die Lodge treffen nicht weit von hier auf die wilderen Ufer des Sees. Mein Blick wandert zum Steg, wo ein paar hiesige Feuerwehrleute alles für das abendliche Feuerwerk aufbauen, und ich schlucke.
Ich schüttle den Kopf, vor meinen Augen dreht sich alles. Es gibt tausend Dinge, die ich Will sagen wollte, aber irgendwie bekomme ich keines davon zu fassen.
Will reibt sich den Nacken. »Du erinnerst dich doch an mich, oder?« Seine Worte kommen heraus, als balancierten sie vorsichtig über ein Drahtseil. Sieben zaghafte Schritte.
Ob ich mich an ihn erinnere? Die Frage ist so absurd, dass es schon fast lustig ist. Meine Mutter hat mir das Leben gerettet, aber es war Will, der mir dabei geholfen hat, es auch zu meinem Leben zu machen.
Will hebt meine Schuhe vom Boden auf und kommt mit zurückhaltender Miene einen Schritt näher, um sie mir zu reichen. Die Bewegung lässt mich zusammenzucken. Überall um uns herum sind Gäste, sie sitzen mit Decken auf dem Rasen, haben sich auf Liegestühlen am Strand ausgestreckt und warten darauf, dass das Feuerwerk beginnt, aber das ist mir egal.
»Oh, ich erinnere mich an dich«, sage ich. Das Licht der Gartenlaternen umschmeichelt seine hohen Wangenknochen, und ein Bild von ihm aus jener Nacht, wie der Kerzenschein über sein Gesicht flackert, taucht in meinem Kopf auf. »Aber was mich interessieren würde, ist, was du hier machst?«
Mein Tonfall lässt ihn blinzeln. Er hält mir noch immer meine Schuhe hin.
»In meinem Resort«, füge ich hinzu und reiße die Schuhe an mich. »Hast du dich im Datum geirrt?«
»Nein, ich …«
»Jetzt erzähl mir nicht, dass das irgendein Zufall ist«, unterbreche ich ihn.
»Weißt du es nicht?« Er klingt durcheinander. »Ich bin hier, um zu helfen«, sagt er mit gesenkter Stimme.
»Wovon redest du?«
»Hat dir deine Mutter nichts gesagt? Sie hat mich als Unternehmensberater angeheuert.«
Mein Hals biegt sich zurück wie der Spannriemen einer Steinschleuder. »Meine Mutter? Woher kennst du meine Mutter?«, zische ich und kneife die Augen zusammen. Einen Moment lang habe ich vergessen, dass sie nicht mehr hier ist.
»Ich habe sie letzten Sommer hier kennengelernt«, sagt Will. »Ich dachte, sie hätte es dir möglicherweise erzählt. Ich dachte, das ist vielleicht der Grund, warum du hier bist. Sie hat mich um Hilfe gebeten, was die strategische Planung und Ideen für …«
Ich schwenke meine Schuhe, um ihm Einhalt zu gebieten. Ich bin überfordert. Es will mir nicht in den Kopf, dass meine Mutter einen Berater angeheuert haben soll, ganz zu schweigen von der noch absurderen Tatsache, dass diese Person ausgerechnet Will ist. Will, der hier ist. Will, der schon letzten Sommer hier war. Will, der meine Mutter gekannt hat. Will, der davon ausgegangen ist, dass ich von seinem Kommen weiß. Will, der mich trotzdem nie kontaktiert hat. Das ist alles zu viel für mich.
Ich atme tief durch, damit ich die wichtigste Tatsache aussprechen kann.
»Will«, sage ich, und sein Name fühlt sich auf meiner Zunge merkwürdig an. »Meine Mutter ist tot.«
»Was? Nein. Ich habe doch neulich erst mit ihr gesprochen … Das ist noch gar nicht so lange her«, murmelt er, mehr zu sich selbst.
»Es war ein Autounfall. Im Mai.« Ich zähle die Fakten auf, als würde ich ein Pflaster abreißen, fein säuberlich und indem ich ihrer Bedeutung möglichst wenig Aufmerksamkeit schenke. Ich erzähle, wie die Eismaschine des Restaurants mitten während der Abendessenszeit den Geist aufgab und die Barkeeper mit einem Spender in einem der Gästezimmer auskommen mussten. Als sich dann noch jemand über den ständigen Lärm beschwerte, beschloss meine Mutter kurzerhand, selbst in die Stadt zu fahren, um einen Kofferraum voller Eis zu holen. Es war dunkel, und ich bezweifle, dass sie das Reh überhaupt gesehen hat, bevor es durch ihre Windschutzscheibe gekracht ist.
Es macht mich irrational wütend, dass sie darauf bestanden hat, Aufgaben selbst zu erledigen, die sie leicht jemand anderem hätte übertragen können. Am Ende hat ihr unermüdlicher Einsatz sie das Leben gekostet.
Will fährt sich mit der Hand übers Gesicht. Er ist eine Spur blasser geworden.
»Bist du okay? Natürlich bist du das nicht«, sagt er und beantwortet damit seine eigene Frage. »Du hast wirklich nicht gewusst, dass ich komme. Du bist hier, weil du deine Mutter verloren hast.«
Ich strecke die Hände aus, die Handflächen nach oben – eine Geste der Bestürzung, keine Effekthascherei. »Mir gehört diese Anlage jetzt. Sie hat sie mir vermacht.«
Will starrt mich an, und ich schaue weg. Das wochenlange nächtliche Wachliegen und stundenlange Herumwälzen holen mich plötzlich ein, die Erschöpfung, die mir tief in den Knochen steckt, drängt an die Oberfläche.
»Fern«, sagt er ruhig, sanft. Er dreht den Ring an seinem kleinen Finger. Das Ringdrehen habe ich ganz vergessen. »Es tut mir so leid.«
Die Beileidsbekundung rammt sich mir in die Brust wie das stumpfe Ende einer Axt. Es ist nicht das, was ihm leidtun sollte. Meine Unterlippe zittert.
Er fasst mich am Arm, und ich schüttle ihn ab. »Nicht.«
»Fernie?«, ruft Jamie oben von der Treppe aus. »Alles in Ordnung?«
»Ja, alles gut«, sage ich und trete zur Seite, um einer Gruppe Platz zu machen, die Richtung Lodge unterwegs ist.
Jamie wünscht den Gästen einen schönen Abend und singt ein Loblied auf die Krabbenküchlein, bevor er sich, zwei Stufen auf einmal nehmend, zu uns gesellt. Er ist nicht so groß wie Will, aber Jamie war schon immer sehr in Harmonie mit seinem Körper. Er bewegt sich selbstbewusst wie ein Riese.
»Sie haben Ihren Schlüssel liegen lassen, Mr. Baxter«, sagt er mit zusammengekniffenen Augen und reicht ihn Will. »Und Ihr Koffer steht noch am Empfang, aber ich lasse ihn in Ihre Unterkunft bringen.«
Will macht sich größer, als er die Schlüsselkarte entgegennimmt. »Das weiß ich sehr zu schätzen.«
»Sie beide kennen sich also?«, erkundigt sich Jamie und schaut von einem zum anderen.
»Nein«, sage ich im selben Moment, in dem Will »Ja« antwortet.
Jamies Blick fällt nach unten auf meine zerkratzen Beine. »Wir haben im Büro einen Erste-Hilfe-Kasten. Lass mich das kurz verarzten.«
»Nicht nötig«, sage ich. »Wirklich, Jamie, alles gut.«
Ich bemerke genau den Moment, in dem Will den Namen erfasst. Er blinzelt zweimal, und ein schockierter Ausdruck huscht über sein Gesicht wie eine hereinbrechende Flut.
Jamie geht vor mir in die Hocke und begutachtet die Verletzung. Mein Blick schnellt zu Will. Ein Reflex. Aber er beobachtet Jamie, die Hände an den Seiten geballt.
»Bist du sicher, dass du okay bist, Fernie?«, hakt Jamie nach und sieht prüfend zu mir auf. »Das sieht nämlich gar nicht gut aus.«
Ich stehe zwischen Jamie Pringle und Will Baxter, barfuß und mit aufgeschlagenen Knien, kaum zwei Monate nach dem Tod meiner Mutter. »M-hm«, sage ich mit Nachdruck zu ihm.
»Nehm ich dir nicht ab. Du kommst jetzt mit mir mit«, verkündet Jamie, der sich wieder erhoben hat. »Du kannst mir nichts vormachen, Fernie«, sagt er leise in mein Ohr, aber ich bin mir sicher, dass Will es hören kann.
Es gibt keinen Grund, mich schuldig zu fühlen, aber ich tue es trotzdem. Und es nervt mich, dass es so ist.
Will räuspert sich. »Dann lass ich euch beide mal«, sagt er. »Es tut mir leid, Fern.« Er wirft mir einen langen Blick zu. Ich habe das Gefühl, dass er noch mehr sagen will, aber dann dreht er sich um und geht den Weg entlang davon.
Mit Zischen und einem lauten Knall explodiert über uns der erste Feuerwerkskörper und erleuchtet die Baumkronen. Aber ich blicke nicht hoch. Ich starre Will hinterher, der von mir weggeht, wie er es vor zehn Jahren getan hat.
Du und ich in einem Jahr, Fern Brookbanks. Versetz mich nicht.
Das war das Letzte, was er zu mir gesagt hat.
4
14. Juni, zehn Jahre zuvor
Die meisten Jungs hatten keine gute Haltung, sie lümmelten in Türrahmen herum oder hingen über Cafeteria-Tischen. Jamie benutzte mich oft als Pfosten zum Anlehnen, den Ellbogen auf meine Schulter gestützt. Will war da ganz anders.
Er skizzierte die Tragfläche eines Flugzeugs, das über der Skyline seines Wandgemäldes schwebte, während ich so tat, als läse ich im Stadtmagazin The Grid. Auf dem Tisch vor mir lag mein Notizbuch mit der Liste der Dinge, die ich noch machen, sehen, essen und trinken wollte, bevor ich in etwas mehr als einer Woche nach Hause fahren würde. Zwischen Unikursen, lernen und meinen Arbeitsschichten hatte ich die Zeit in Kanadas größter Stadt nicht optimal genutzt. Ich hatte gehofft, in der Ausgabe von dieser Woche ein paar erschwingliche Ideen zu finden, die ich meiner Liste noch hinzufügen könnte, aber stattdessen starrte ich fasziniert auf die lange Linie von Wills Rücken und den entschlossenen Griff seiner Hand um den Pinsel, mit dem er malte. Am meisten aber beeindruckte mich seine aufrechte Haltung.
»Ich kann spüren, wie du mich beurteilst«, sagte Will. »Sehr laut.«
Er blickte mich mit hochgezogenem Mundwinkel über die Schulter hinweg an, wobei ihm die Haare über die Augen fielen. »Wie wär’s, wenn du ein bisschen Musik anmachst, um es zu übertönen?«
Er war also nicht nur heiß, sondern auch witzig. Ich funkelte ihn wütend an, aber Wills Lächeln wurde noch breiter. Ich hatte noch nie ein so schönes Lächeln gesehen wie seins.
»Grinst du immer so viel?«, fragte ich.
»Bist du immer so freundlich?«
»Schon.«
Er lachte leise, und ich spürte den Klang, warm und süß, in meinem Bauch. »Dann nehme ich es dir nicht übel.« Er zeigte mit dem Kinn zu meinem iPod auf dem Tisch. »Was ist jetzt mit Musik?«
»Klar.« Er hatte meinen Schwachpunkt in Rekordzeit gefunden. Ich wischte die Druckerschwärze des Zeitungspapiers von meinen Fingern an meinen Shorts ab und scrollte mit abgesplitterten blauen Nägeln durch meine Alben, auf der Suche nach etwas, was ihm gefallen könnte. »Ich habe das neue Album von Vampire Weekend. Kennst du das schon?«
»Hast du das gehört, als du hier angekommen bist? Ich habe dich vorhin draußen auf der Straße gesehen.«
Ich räusperte mich überrascht. »Äh, nein. Das war eine Playlist von Peter.«
»Dein Freund?«
Ich schnaubte. »Peter ist der beste Freund meiner Mutter. Playlists sind unser Ding.«
Das war noch untertrieben. Peter und ich kommunizierten über Musik. Mom nannte es unsere Geheimsprache. Sie sagte auch, dass Peter nicht viele Leute in sein Leben ließe – das hatten wir beide gemeinsam. So wie sie es ausdrückte (und sie liebte es, diese Geschichte zu erzählen), hatte Mom sich schon lange vor meiner Geburt den Weg in sein Leben gebahnt.
Er wusste nicht, was er von meinem ganzen Gerede halten sollte, und er wusste nicht, wie er mich dazu bringen konnte, auch mal die Luft anzuhalten, und nach seinem ersten Winter bei uns im Resort wurde er mich einfach nicht mehr los. Er war also praktisch gezwungen, sich mit mir anzufreunden.





























