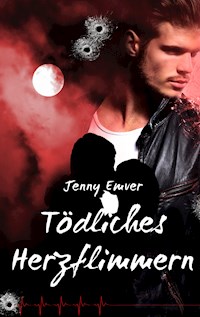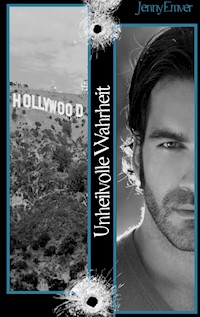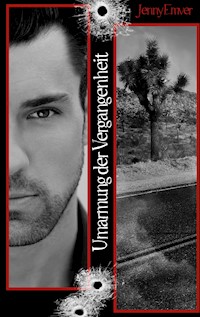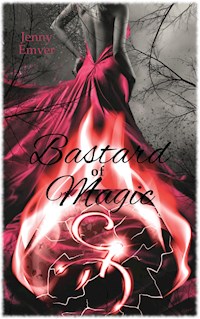Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: K28
- Sprache: Deutsch
WER IST SEIN NÄCHSTES OPFER? Der Kriminalkommissar Maurice Schwarz ermittelt in einer Mordserie, in der die Opfer mit einer Bastelschere gequält und schließlich getötet werden. Bei Johanna Richter wird nachts eingebrochen. Der Täter verschwindet jedoch unverrichteter Dinge wieder. Hilfesuchend wendet sie sich an Maurice Schwarz. Beide verbindet eine gemeinsame Vergangenheit und alte Gefühle flammen auf, nicht ahnend, dass der Mörder bereits sein nächstes Opfer im Visier hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Jerome, (ihr wisst wer gemeint ist) Mädels, ihr seid der Knaller und nur euch verdanke ich es, dass die Geschichte von Maurice & Johanna überhaupt erzählt wurde.
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
KAPITEL DREIZEHN
KAPITEL VIERZEHN
KAPITEL FÜNFZEHN
EPILOG
PROLOG
Seit 57 Stunden und 32 Minuten galt sie nicht mehr unter den Lebenden. Seit 57 Stunden und 33 Minuten stand er vollkommen neben sich. Oder es brachte sein wahres Wesen zum Vorschein – wer konnte das schon so genau sagen?
Für ihn gab es keine Vorzeichen, als er in das winzige, schmuddelige Badezimmer trat. Ohne Vorwarnung traf ihn der Anblick der leblosen Gestalt in der Badewanne. Vor 57 Stunden und 34 Minuten konnte er kaum noch gerade stehen, geschweige denn, einen klaren Gedanken fassen. Doch von einer Sekunde auf die andere war er vollkommen nüchtern. Der Anblick der toten Frau zog ihm den Boden unter den Füßen weg, den er eigentlich schon längst verloren zu haben glaubte.
Der Oktoberwind pfiff ihm um die Ohren und ließ die Blätter im Baum über ihm rascheln. Auf der Straße war niemand unterwegs. Vermutlich hatten sich alle vor dem ungemütlichen Wetter geflüchtet. In der Nähe konnte er ein Spielstraßenschild ausmachen. Die Nachbarn der Bewohner wurden durch hohe Hecken abgeschirmt. Zur Straßenseite stand ein mannshoher Zaun, der gleichzeitig die Sicht auf das Grundstück verhinderte. Betreten konnte man das Anwesen bloß über zwei unterschiedlich breite Tore. Eins für Fußgänger, das andere für den Familienwagen.
Er ballte die Hände zu Fäusten und sah zu dem großen Haus, in dem sämtliche Lichter brannten. Es war noch nicht spät, erst kurz vor sieben und der Mann war allein.
Perfekter hätte der Zeitpunkt nicht sein können.
Ein Auto näherte sich und sein Herz schlug schneller.
Würde es etwa …?
Nein.
Der Wagen hielt an einer anderen Einfahrt und eine Frau stieg aus. Sie sah nicht in seine Richtung und eilte auf eine Haustür zu, die sich in unmittelbarer Nähe zu ihm befand. Das Auto fuhr weiter, die Scheinwerfer blendeten ihn kurz, und bog in eine andere Straße ein.
Schon seit ein paar Tagen beobachtete er die Leute, die hier lebten, deshalb wusste er, dass Frau und Kind außer Haus waren. Nur wann sie zurückkehren würden, konnte er nicht sagen. Vielleicht war es klug, seinen Plan auf der Stelle durchzuführen.
Ihn durchzuckte unbändige Wut, gemischt von Trauer, die er nur im Zaum halten konnte, wenn er sich ausmalte, wie er sich rächen würde. In den ersten Stunden waren seine Gefühle außer Kontrolle geraten und er schlug alles kurz und klein, was nicht an der Wand oder der Decke befestigt war.
Irgendwann entkam er der Raserei und die Trauer nahm ihn in Beschlag. Diese weilte nicht lange und er begann einen Schuldigen zu suchen. Seine Liste wurde länger und länger. Er kannte alle Namen, immerhin sprach er mit ihnen von Angesicht zu Angesicht. Also machte er eine Liste mit sämtlichen Personen, die an ihrem Tod schuld waren.
Wieder flackerte das Bild der toten Frau vor seinem geistigen Auge auf und in seiner Brust setzte ein schmerzhaftes Ziehen ein. Niemals glaubte er daran, sie zu verlieren. Sie war sein Lebensinhalt, auch wenn viele dachten, der Alkohol würde an erster Stelle stehen. All das waren Lügen. Lügen von Leuten, die es nicht besser wussten. Er wusste nicht, wie er ohne sie weiterleben sollte.
Allerdings wusste er auch nicht, dass sie überhaupt einen Föhn im Badezimmer besaßen. Dann hätte er die Anzeichen vielleicht doch bemerkt. Wasser, ein Föhn und seine Frau waren keine gute Kombination, wie er jetzt wusste. Hätte er gewusst, dass ein Föhn existierte, und wäre er nicht so im Suff gewesen … womöglich würde seine Frau noch leben. Seine geliebte Mina.
An ihrem Tod waren nur die Ausgeburten der Hölle schuld und an allem voran war der Teufel. Er kniff die Augen zusammen, ballte seine Hände wieder zu Fäusten und schritt aus dem Schatten des Baumes. Der Zaun um das Grundstück konnte ihm kein Hindernis bieten. In seinem Hirn setzte sich vor wenigen Stunden eine Entschlossenheit fest, die ihm den nötigen Schubs über die Klippe gab. Diesen brauchte er, um seine Tat umsetzen zu können. Rasch war er über die Einzäunung geklettert. Niemand sah oder hörte ihn. In seiner Pullovertasche tastete er nach den beiden einzigen Gegenständen, die er außer seiner Kleidung bei sich trug.
Mehr benötigte er nicht.
Die Wut und der Hass, die in seinem Inneren wüteten, machten ihn zwar entschlossen, aber nicht blind. Zumindest für dieses hier plante er alles durch, welche Tat danach folgen würde, würde er dann entscheiden.
Alles schön nacheinander. Stück für Stück würde er Gerechtigkeit einfordern. Das Gesetz würde ihm nicht helfen. Diese Leute waren das Gesetz. Gegen sie würde er keine Chance bekommen, obwohl sie ein wertvolles Leben beendeten. Leise schlich er um das Haus herum, in der Hoffnung, er würde eine offene Tür oder ein Fenster finden.
Bingo.
Vorsichtig spähte er in das Zimmer, welches über und über mit Büchern bestückt war. In der Mitte befand sich ein massiver Schreibtisch und an diesem saß ein Mann. Auf der Nase trug er eine Brille, wodurch seine Augen noch riesiger wirkten.
Diese Augen …
Vor dem Mann lag ein dickes Buch, indem er anscheinend las. Fest entschlossen trat er durch die angelehnte Tür. Von seiner Bewegung aufgeschreckt sah der Arzt auf. Überraschung flackerte über das faltige Gesicht, gefolgt von Misstrauen.
»Was machen Sie denn hier?«, fragte er und erhob sich von seinem weißen Schreibtischstuhl.
»Ich will Gerechtigkeit.« Die Stimme klang vor unterdrückter Wut fast wie ein Knurren und dann stürzte er sich auf den Arzt.
EINS
Johanna Richter verließ gut gelaunt das Gebäude des Jugendamts in Neukölln. Nachdem es lange nicht so aussah, als würde sie vermitteln können, erzielte sie in einem ihrer Fälle doch noch das erwünschte Ergebnis und die Parteien würden sich nun doch einigen.
Ein minderjähriges Paar erwartete in Kürze ein Baby. Eine Sache, die Johanna bereits öfter erlebte und wie in vielen Fällen, war es auch in diesem so, dass nicht die Teenager zerstritten zu ihr kamen und Hilfe suchten. Es waren die Eltern, die mit den Entschlüssen ihrer Sprösslinge zu hadern hatten. Sofia und Ben waren sich in allem einig, sie wollten ihr Baby bekommen und gemeinsam aufziehen. Im Sommer machte Ben seinen Abschluss und bemühte sich bereits um einen Ausbildungsplatz bei einer Bank, um für seine kleine Familie zu sorgen. Über Wochen begleitete Johanna die Familien und heute fanden sie eine Lösung, die für alle zufriedenstellend war.
Besser konnte dieser Tag nicht enden. Die ganze Woche verlief bisher äußerst positiv. Sie befreite sogar einen kleinen Jungen aus den Fängen seines brutalen Vaters. Manchmal fühlte sie sich wie eine Heldin, die die Welt ein Stück besser machte. Zumindest die Welt von einigen Kindern. Genau deshalb entschied sie sich nach dem Schulabschluss für diesen Werdegang.
»Hallo Johanna.« Sie drehte sich um, als sie die Stimme ihres Kollegen Michael vernahm.
Ein Lächeln huschte über ihre Lippen. »Hallo Michael.«
»Machst du schon Feierabend?«, fragte er und musterte sie gründlich durch seine Brille. Michael war bereits Anfang sechzig und würde nächsten Sommer in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen. Mit seiner Frau zusammen wollte er in den Schwarzwald ziehen, wo sie kurz davor waren ein kleines Haus zu kaufen.
»Ja. Ich habe einen Fall abgeschlossen und läute den Feierabend mit dem herrlichen Herbstwetter früher ein.«
»Das solltest du wirklich tun. Es gibt genügend Tage, an denen du nicht vor Mitternacht nach Hause kommst.« Während er sprach, bemerkte Johanna deutlich, wie Michael von dieser Arbeit geprägt wurde. Dennoch bewunderte sie diesen Mann. Wenn sie Vorbilder in diesem Job benennen musste, wäre einer von ihnen Michael.
»Das tue ich. Ich lasse es mir gleich mit einem Buch und einem guten Kaffee auf meiner Terrasse gutgehen.«
Michael wünschte ihr einen schönen Nachmittag und ging die kurze Treppe hinauf, die in das Gebäude führte. Während Johanna auf ihren kleinen Wagen zuging, bildete sich in ihrem Magen ein seltsames Gefühl. Über ihren Rücken rieselten kalte Schauer und sie glaubte, beobachtet zu werden. Unauffällig drehte sie sich um und schaute hinter sich auf den Gehweg. Dieser war mit Menschen überfüllt, die ihr keine Aufmerksamkeit schenkten. Sie erblickte niemanden, der sie gezielt anstarrte.
Du irrst dich!, schimpfte ihre innere Stimme und sie versuchte, auf diese zu hören. Doch das schlechte Gefühl blieb, selbst als sie in ihrem kleinen blauen VW saß und aus Gewohnheit die Zentralverriegelung betätigte, konnte sie das Gefühl nicht abschütteln.
Während der Fahrt schaute sie immer wieder in ihren Rückspiegel, in der Annahme dort müsse sie ein verdächtiges Auto erblicken. Natürlich tat sie das nicht. Jedes Mal fuhr ein anderes Fahrzeug hinter ihr, und wenn ihr doch mal eines eine längere Zeit folgte, bog es schließlich ab oder wechselte die Spur.
Da ist niemand. Keiner beobachtet dich!, flüsterte ihre innere Stimme wieder und sie atmete tief durch.
Knapp fünfundzwanzig Minuten später bog sie in die Raabestraße im Prenzlauer Berg ein, in der ihre hübsche Wohnung im Erdgeschoss lag. Sie teilte sich die Etage mit Elisabeth Specht, einer alten Dame. Der Mietpreis war enorm, aber Johanna verliebte sich auf Anhieb in den Schnitt und zahlte ihn deshalb gerne. Zur Wohnung gehörten ein paar Parkplätze an der Straße. Glücklicherweise hatten einige ihrer Nachbarn keine Autos und sie fand meistens direkt einen Platz vor der Haustür.
Zu den Anwohnern, die keinen Wagen besaßen, zählte auch Elisabeth Specht. Sie war mit ihren siebenundachtzig Jahren zwar noch flott zu Fuß, wollte aber kein Auto mehr fahren. Hin und wieder tat Johanna ihr einen Gefallen und fuhr mit ihr zum Supermarkt, wofür ihr Elisabeth sehr dankbar war. Insgeheim betrachtete sie die Frau als eine Art Großmutter, die sie selbst nicht mehr hatte. Manchmal trafen sich die beiden auch zu Kaffee und Kuchen und unterhielten sich stundenlang. Irgendwann hatte sich Johanna ihr anvertraut und von ihrer Vergangenheit berichtet, die sie sonst für sich behielt. Ansonsten wussten nur ihre Familie, ihre Arbeitskollegin und ihre engste Freundin Bescheid.
Johanna stellte den Motor aus und öffnete die Tür, um auszusteigen. Sobald sie die Autotür zuschlug, konnte sie wieder Blicke auf sich spüren und sah sich ruhelos um. Seit wann war sie so paranoid? So kannte sie sich nicht. Trotz der Dinge in ihrer Vergangenheit hatte sie sich nie etwas eingebildet. Schnell eilte sie zur Haustür, zog schon im Gehen den Schlüssel aus der Tasche ihres blauen Trenchcoat und steckte ihn schließlich ins Schloss. Eilig drückte sie die Tür hinter sich zu und spurtete zu ihrer Wohnungstür. Kaum hatte sie auch diese aufgeschlossen, huschte sie hinein und ließ die Tür ins Schloss und ihre Handtasche zu Boden fallen. Plötzlich kam ihr ein logischer Gedanke, der ihre abrupte Paranoia erklären würde.
War sie vielleicht überarbeitet?
Genau, das musste es sein! Schon seit Monaten nahm sie sich vor, Urlaub einzureichen, doch immer wieder waren Fälle dazwischengekommen. Johanna mochte kein frei nehmen, in dem Wissen, dass ein Kind ihre Hilfe benötigte. Aber wenn ihr Bewusstsein diese Signale sendete, sollte sie eventuell doch einmal ihre Bedürfnisse an erster Stelle setzen und sich den wohlverdienten Urlaub nehmen.
Wegfahren, abschalten und zur Ruhe kommen. Der Gedanke klang mehr als verlockend.
Gleich morgen würde sie in ihrem Terminkalender nachsehen und dann ein paar freie Tage festlegen. Sobald sie diesen Entschluss gefasst hatte, merkte sie, wie ihre Schultern leichter wurden, und sie anfing, sich zu entspannen. Der Knoten in ihrem Magen löste sich und sie konnte freier atmen.
Wie sie es gegenüber Michael erwähnte, kochte sich Johanna einen Kaffee, schnappte sich ihre aktuelle Lektüre und setzte sich in einer Decke gehüllt auf ihre Terrasse. Draußen herrschte ein wundervoller Oktobertag und mit knapp fünfzehn Grad in der Sonne war er auch recht warm. Dort verbrachte sie die nächsten Stunden und kehrte erst wieder ins Innere ihrer Wohnung zurück, als der Roman keine neuen Seiten mehr hergab. Ihr gelang es, die merkwürdigen Gedanken vom Nachmittag vollständig auszublenden. Am Abend gönnte sie sich ein Glas Wein in der Badewanne und ließ damit den Tag ausklingen.
Perfekter hätte dieser Tag nicht enden können.
Johanna schreckte aus dem Schlaf und vernahm das Geräusch von brechendem Glas. Das Bersten hallte ihr bis ins Mark wider. Sofort begann ihr Herz zu rasen und ihr liefen kalte Schauer über den Rücken. Mit aufgerissenen Augen registrierte sie, dass es halb drei in der Nacht war. Angestrengt lauschte sie nach weiteren Bewegungen in ihrer Wohnung. Aber sie hörte neben ihrem donnernden Herzschlag und ihren harschen Atemzügen nur den Wind, der draußen toste.
Starr saß sie in ihrem Bett und versuchte im halbdunklen Zimmer etwas anderes, als ihre Möbel auszumachen. Es war eine klare Nacht, sodass das Mondlicht ihre Wohnung ein bisschen erhellte. Die Schatten der Büsche vor ihrem Fenster tanzten an der gegenüberliegenden Wand. Nachdem einige Momente verstrichen waren, ohne das irgendetwas geschah, wollte sie aus dem Bett steigen und nachsehen, was sie aus dem Schlaf riss.
Plötzlich betrat eine in komplett schwarz gekleidete Gestalt das Zimmer und Johanna zuckte erschrocken zurück. Angstschweiß bildete sich in ihrem Nacken und ihr Mund öffnete sich zu einem stummen Schrei. Ihr Gehirn setzte vor Furcht aus. Sie presste sich an das Kopfgestell ihres Bettes und versuchte, sich unsichtbar zu machen. Die Person trat einen weiteren Schritt in das Zimmer und sah sie dabei direkt an.
Johanna spürte den Blick mehr, als das sie ihn wirklich sah. Immerhin befand sich die Gestalt im Schatten und sie konnte weder Gesicht noch Mimik erkennen, obwohl er bloß eine schwarze Mütze trug. Der Ausdruck, mit dem die Person sie musterte, ließ ihr Herz so sehr rasen, dass es schmerzte, und der Schweiß ließ ihre Klamotten an der Haut kleben. Zudem zitterte ihr Körper so stark, dass ihre Zähne aufeinander schlugen. Es musste ihr Instinkt sein, der ihr sagte, dass der Blick der Person hasserfüllt war. Anders konnte sie sich das Detail nicht erklären, welches in ihrem Geist herumspukte.
Egal, was die Gestalt wollte, sie würde nicht kampflos aufgeben. Entschlossen reckte sie das Kinn und ihr Hirn nahm seinen Dienst wieder auf. Ruckartig schnellte ihre Hand zur Nachttischlampe und sie blinzelte von der plötzlichen Helligkeit. Doch bevor sie das Gesicht der Gestalt sehen konnte, wirbelte diese herum und verschwand im Flur. Erstarrt wartete sie, dass der Einbrecher zurückkehrte. Sie hatte keinen Zweifel mehr daran, dass es sich um einen Mann handelte. Ihr Herzschlag donnerte weiterhin viel zu schnell und ihre Atmung glich beinahe einem Keuchen.
Polizei!
Blitzartig tauchte der Gedanke in ihrem Hirn auf. Panisch griff sie nach ihrem Handy auf dem Nachttisch und wählte mit zitternden Fingern den Notruf. Schon nach dem ersten Freizeichen wurde ihr Anruf von einer Frauenstimme entgegengenommen.
»Polizei Berlin, Ihr Anliegen bitte.«
»Bei mir wurde eingebrochen!«, flüsterte Johanna hektisch und versuchte mühsam, sich zu beruhigen.
»Wer sind Sie und wo sind Sie?«
Dunkel erinnerte sie sich an die W-Fragen aus dem Erste-Hilfe-Kurs, doch vor Aufregung konnte sie keine von denen sofort beantworten. Auf das gezielte Nachfragen der Frau wusste sie jedoch die Antworten.
»Mein Name ist Johanna Richter«, murmelte sie, aus Angst, der Einbrecher könnte sie hören und sich entschließen zurückzukommen. Vielleicht befand er sich ja auch noch in ihrer Wohnung? Dann nannte sie ebenso leise ihre Adresse und lauschte der nächsten Frage, die sie nur mit großer Anstrengung über ihren rasenden Herzschlag hinweg verstand. Ihre Hand zitterte so sehr, dass sie nur schwer das Handy am Ohr halten konnte. In kurzen Sätzen schilderte sie der Frau am anderen Ende das Geschehene und diese versprach, dass ein Streifenwagen unterwegs sei und es nur noch wenige Minuten dauern würde.
»Ist der Einbrecher noch im Haus?«
Ihre Stimme zitterte genauso, wie ihr Körper. »Ich weiß es nicht.«
»Können Sie sich irgendwo verstecken?«
Johanna dachte nach und verneinte. Es gab in ihrer Wohnung weder einen Keller, noch irgendeine Nische, in der sie sich hätte verbergen können. Der offene Schnitt war der Hauptgrund, warum sie sich für diese Wohnung entschieden hatte. Selbst ihr Kleiderschrank bot keinen Platz, da dieser vollgestopft mit Klamotten war.
»Sie können jetzt auflegen, Frau Richter, der Streifenwagen ist bei Ihnen.«
Johanna atmete laut auf, doch auch die Information der netten Frau konnte ihren Körper nicht dazu bewegen, sich zu entspannen. Trotz dessen erhob sie sich mit zitternden Gliedern aus ihrem Bett und schlich vorsichtig zur Haustür. Erst als sie die Tür öffnete und das Blaulicht sah, beendete sie das Telefonat.
Vor ihr standen zwei Polizisten, die vom Alter vollkommen unterschiedlich waren. Der eine wirkte, als würde er demnächst in Pension gehen und der andere, als würde er frisch von der Polizeiakademie kommen. Beide sahen jedoch wachsam und hellwach aus. Schnell stellten sie sich ihr vor, sobald sie die Namen hörte, vergaß sie diese auch schon wieder.
»Bleiben Sie hier draußen bei meinem Kollegen«, sagte der ältere Polizist und betrat mit erhobener Waffe ihren kurzen Flur. Während er ihr Zuhause nach dem Einbrecher absuchte, schwieg der andere Gesetzeshüter und musterte sie. Die Kälte kroch Johanna unter die Haut. Ihr Körper steckte bloß in einem schwarzen Top und einer langen, grauen Pyjamahose, die nichts gegen die Außentemperatur ausrichtete. Gänsehaut bildete sich auf ihrem Leib und der Angstschweiß ließ sie zusätzlich frösteln. Jetzt wünschte sie sich, sie hätte an ihren Morgenmantel gedacht.
»Die Wohnung ist leer«, teilte der ältere Polizist ihnen mit, nachdem er zurück in den Flur getreten war, und steckte seine Waffe weg. »Sie können hereinkommen.« Erleichtert betrat Johanna ihre Wohnung, auch wenn sie in diese für den Moment am liebsten gar nicht zurückgekehrt wäre. Dennoch war sie froh darüber, dass der Einbrecher verschwunden war.
»Erzählen Sie, was geschehen ist«, forderte der ältere Polizist sie auf.
Johanna kam der Aufforderung nach und schilderte noch einmal, was passiert war. Gleichzeitig untersuchte der jüngere Polizist ihre Haustür. Dann verschwand er im Wohnzimmer und kehrte nach wenigen Minuten zurück. »Es gibt keine Spuren, die auf einen Einbruch hindeuten.«
In Johannas Ohren rauschte es, ihr Herzschlag nahm wieder an Tempo zu und sie spürte, wie ihre Beine nachzugeben drohten. Dieser Mann stellte ihre Aussage in Zweifel.
»Frau Richter gibt an, eine männliche Gestalt in ihrem Schlafzimmer gesehen zu haben und die kaputte Glasvase im Wohnzimmer könnte ein Beweis dafür sein«, entgegnete sein Kollege.
»Sie behauptet, eine Gestalt gesehen zu haben, die ganz in Schwarz gekleidet war. Es gibt keinen Beweis für die Anwesenheit einer weiteren Person in dieser Wohnung. Eine kaputte Vase ist noch lange kein Indiz für einen Einbruch. Wahrscheinlich ist sie durch die offene Terrassentür und den starken Wind umgefallen.«
»Meine Terrassentür war nicht offen.«
Augenblicklich erntete sie einen finsteren Blick. »Wollen Sie mich für dumm verkaufen?«
Kommt darauf an, wie teuer es ist, ihre innere Stimme lachte.
Das musste eindeutig die Aufregung der letzten Stunde sein! Seit drei Jahren vermisste sie ihren Sarkasmus. Er kehrte definitiv zur falschen Zeit zurück. »Ich habe meine Terrassentür vor dem Schlafengehen geschlossen!«, erwiderte sie energisch, verschränkte die Arme vor der Brust und konterte den Blick des jungen Polizisten.
»Und warum steht sie dann weit offen?«, wollte der Polizist wissen und wies mit seiner Hand Richtung Wohnzimmer, aus dem in diesem Moment ein kräftiger Windstoß kam. Er führte sie ins Wohnzimmer.
»Weil der Einbrecher dort hinausgerannt ist?«, stellte Johanna als Gegenfrage und weigerte sich, zu glauben, dass die Polizisten recht haben könnten.
Die Gardine wehte im seichten Wind und ließ Johanna schaudern. Sie hatte diese Tür definitiv geschlossen, bevor sie zu Bett gegangen war! Das wusste sie, weil der Wind sie sonst nicht hätte schlafen lassen. Sogar das Fenster im Schlafzimmer hatte sie zugemacht, da der Sturm sie vom Schlafen abhielt. Wenn sie die Terrassentür nicht geschlossen hätte, hätte es in der gesamten Wohnung gezogen und durch dieses Geräusch wäre Johanna niemals zur Ruhe gekommen.
Der jüngere Polizist musterte sie. »Und wie soll er dann hineingekommen sein? Es gibt keine Einbruchspuren! Und irgendwelche Spuren gibt es immer. Die Türen sind vollkommen unversehrt.«
Angespannt strich sich Johanna den kalten Schweiß von der Stirn und überlegte, was sie tun sollte. Anscheinend glaubten ihr die Polizisten nicht! So viel zum Thema Helfer in der Not.
»Hören Sie, wir werden es als falschen Alarm angeben.«
»Vielleicht hat Ihnen Ihre Fantasie wirklich einen Streich gespielt«, merkte der ältere Polizist an und deutete in die Richtung ihrer überfüllten Bücherregale.
Johanna wollte irgendetwas erwidern. Doch kein einziges Wort verließ ihren Mund. Sie beobachtete verzweifelt, wie die beiden Gesetzeshüter aus ihrer Wohnung gingen. Hinter ihnen fiel die Haustür leise ins Schloss.
In der restlichen Nacht machte Johanna kein Auge mehr zu. Stattdessen saß sie mit einer Tasse Tee in ihrem Wohnzimmer und starrte an die Wand. Immer wieder huschten ihre Augen zu der zerbrochenen Vase am Boden. Die Scherben schienen sie zu verhöhnen. Ihre Gedanken rasten und wollten nicht zur Ruhe kommen und ihre Gefühle bildeten einen Strudel, sodass sie keines genau benennen konnte. Wenigstens hörte ihr Körper auf zu zittern und ihr Herzschlag beruhigte sich so weit, dass ihre Brust nicht länger schmerzte. Noch nie war sich Johanna hilfloser vorgekommen, als in diesem Augenblick. Kurz spielte sie mit dem Gedanken, ihre Schwester anzurufen, verwarf diesen aber schnell wieder.
Jacqueline würde sich nur unnötig aufregen und vermutlich noch ihre Mutter informieren und das war etwas, was Johanna um jeden Preis vermeiden wollte.
Jessica Winter behandelte sie sowieso schon wie ein verletztes Tier. Alle zwei Tage telefonierten sie miteinander und mindestens zweimal die Woche musste sich Johanna bei ihrer Mutter blicken lassen. Obwohl Johanna im Januar neunundzwanzig wurde, bemutterte Jessica sie, wo sie nur konnte. Es war nicht so, dass Johanna nicht wusste, was sie antrieb. Doch solange sie Johanna wie ein angeschossenes Tier behandelte, solange konnte sie nicht aufhören, sich wie eins zu fühlen.
Nein, sie musste hier alleine durch. Sie war stark und würde das überstehen!
Früher hätte er niemals gedacht, dass er einen Menschen töten würde. Ganz entgegen seiner Erwartung tat es ihm nicht leid. Es fiel ihm auch nicht schwer. In seinem Inneren existierten nur noch diese Wut und dieser Schmerz, der nicht vergehen wollte. Nachdem er den Arzt um die Ecke brachte, empfand er für einen kurzen Zeitraum so etwas wie Seelenfrieden. Dementsprechend verließ er fast ausgeglichen das Grundstück. Zurück in seiner Wohnung löste sich die innere Ruhe schnell und er knallte mit voller Wucht zurück in die Realität.
Mina war immer noch fort. Tot. Sie würde nicht zu ihm zurückkommen.
Seine Umgebung glich nach wie vor einem Trümmerhaufen und erinnerte ihn daran, wie er in seinem Schmerz alles klein schlug. Ermattet ließ er sich auf das Sofa fallen, welches als Einziges einigermaßen heil geblieben war. Um ihn herum herrschte neben den Trümmern auch ein heilloses Durcheinander aus Müll. Pizzakartons, Essensreste, leere Flaschen, Verpackungen von chinesischem Essen und unzählige Zigarettenstummel.
Kein Alkohol.
Seit diesem Tag rührte er keinen Schluck mehr an.
Im Suff konnte er keinen klaren Gedanken fassen und schon gar nicht beobachten.
Zwei ganze Tage schenkte er bereits dieser Frau seine Aufmerksamkeit. Sie tat nichts anderes als Arbeiten und wenn sie nicht in ihrem schicken Büro saß, war sie immer in Gesellschaft verschiedener Leute. Wollte er sie erwischen, musste er schnell sein und die nächste Gelegenheit nutzen.
Dieses Mal konnte er sich nicht erlauben, vor dem Gebäude zu stehen und seinen stumpfen Gedanken zu lauschen. Oder einen Rückzieher zu machen.
Er würde handeln.
Ihn überkam wieder diese innere Ruhe, die er verspürte, sobald er über seine nächste Tat nachdachte. Genüsslich steckte er sich eine Zigarette zwischen die Lippen und zündete sie an. Heute Nacht würde sein Leben wieder einen Sinn haben.
Johanna trat vor die Türen des Jugendamts und rieb sich erschöpft die Augen. Auch wenn heute Sonntag war, war sie ins Büro gefahren, um einen Bericht fertig zu schreiben. Seit ihrem Entschluss sich nicht unterkriegen zu lassen, waren mehr als zweiundsiebzig Stunden vergangen, in denen sie nur wenig Schlaf fand.
Noch am Samstag besorgte sie sich in einem Baumarkt Sicherheitsgriffe für die Fenster und Terrassentür. Sie baute sie sogar eigenhändig an. Zudem kaufte sie sich zwei Ketten, die sie an der Haustür anbrachte und sie regelmäßig vorlegte. Eine Alarmanlage wurde ihr von dem Sohn eines älteren Ehepaares aus ihrer Nachbarschaft empfohlen und angeschlossen. Dann drehte sie zusätzlich den Schlüssel zweimal im Schloss ihrer Haustür herum.
All das gab ihr nur einen kleinen Teil der Sicherheit zurück, die sie vor dem Einbruch verspürte. Ihre Gedanken wanderten zu ihrer Schwester, die sie damals beim Einzug fragte, ob sie nicht doch lieber eine Wohnung im ersten oder zweiten Stock mieten wollte. Sofort verwarf Johanna den Gedanken an Jacqueline. Nach ihrer Scheidung sehnte sich Johanna nach einem Neuanfang und erfüllte sich diesen mit der traumhaften Altbauwohnung.
Die Wohnung wurde durch einen viereckigen Flur betreten. Von dort gingen fünf Türen ab. Auf der linken Seite waren ein kleiner Abstellraum und das Badezimmer, welches mit einer Duschwanne ausgestattet war. Zudem gab es noch Stellfläche für zwei kleine Schränke. Am Ende des Flurs betrat man das Schlafzimmer, in dem das Bett, ihr großer Kleiderschrank und zwei Nachtschränke standen. Rechts waren das Wohnzimmer und die Küche. In der Wand befand sich eine weitere Tür, die die beiden Räume miteinander verband. Durch das Wohnzimmer gelangte man auf die geräumige Terrasse. Im Wohnzimmer konnte sie ihre beiden voll bestückten Bücherregale unterbringen und neben dem Sofa auch einen alten Schaukelstuhl stellen. Die Küche war klein und brachte kaum einen Pluspunkt bei ihrer Mutter ein. Trotz dessen liebte Johanna ihre Wohnung sehr.
Die Scheidung mit ihrer Jugendliebe Andre war hässlich gewesen. Dabei hatten sie sich immer großartig verstanden. Zunächst waren sie beste Freunde und verliebten sich dann mit fünfzehn ineinander. Alles teilten sie miteinander. Den ersten Kuss. Das erste Date. Den ersten Sex. Johanna bereute nicht, den Heiratsantrag an ihrem zwanzigsten Geburtstag angenommen zu haben. Erst als sie das gemeinsame Kind vor knapp zwei Jahren verlor, war die Ehe in die Brüche gegangen. Immer öfter blieb Andre abends länger fort und ließ sie mit ihrer Trauer allein.
»Johanna?« Sie hörte ihren Namen, blinzelte und stellte fest, dass sie noch immer vor den Türen des Jugendamts stand. Wieder erklang ihr Name und sie drehte sich in die Richtung, aus der die Stimme kam. Vor ihr stand Leah Wagner aus ihrer Abschlussklasse.
»Hallo Leah«, grüßte Johanna perplex zurück. Mit dieser Begegnung hatte sie gewiss nicht gerechnet.
»Wie lange ist das her?«, fragte sie und strahlte noch genauso, wie vor elf Jahren. Ihr schwarzes Haar trug sie nun kürzer und ihre grünen Augen besaßen noch den gleichen starken Ausdruck. Damals freundeten sie sich an, nachdem Leah mitten im Schuljahr nach Berlin zog und in ihre Klasse kam.
»Ich weiß nicht, vielleicht fünf Jahre?«
»Sind es nicht sogar sechs?«, trällerte Leah und lächelte. »Wir müssen uns unbedingt mal auf einen Kaffee treffen und ausführlich quatschen! Weißt du, wen ich vor ein paar Wochen in einer Bar getroffen habe? Nein, natürlich nicht, woher sollst du das wissen. Aber das errätst du nie! Es war Maurice. Maurice aus unsere Abiklasse. Er ist jetzt Kommissar im K28! Irre oder? Und er ist noch genauso heiß wie damals, wenn nicht gar heißer.«
Johanna schüttelte angesichts des Wortschwalls den Kopf, anscheinend hatte sich Leah in all den Jahren nicht verändert und war ihrer überschwänglichen Art treu geblieben. Früher mochte sie das sehr an ihr, doch jetzt machte es ihr bewusst, wie sehr sie sich selbst aus den Angeln verlor. Besonders in den letzten beiden Jahren.
»Ich muss jetzt los, mein Freund wartet. Aber ich rufe dich an, okay? Hast du noch dieselbe Nummer von damals?«
»Ja. Okay, bis dann«, gelang es Johanna noch zu sagen, ehe Lilly beinahe davonrannte und sie allein auf der Treppe zurückließ.
In der Nacht lag Johanna wach und lauschte jedem Geräusch. Selbst wenn es sich nur um ein vorbeifahrendes Auto handelte, schlug ihr Herz automatisch schneller. So konnte es nicht weitergehen. Es war die dritte Nacht infolge, in der sie kaum Schlaf fand. Irgendwelche Schlafmittel zu nehmen, traute sie sich jedoch nicht, aus Angst, der Einbrecher käme zurück, tat ihr weiß Gott was an und sie würde es nicht mitbekommen. Seufzend schaltete sie das Licht auf ihrem Nachtschrank an und beugte sich über den Rand des Betts. Unter dem Bettgestell lugte die Ecke eines Kartons hervor. Dort bewahrte sie Erinnerungen ihrer Jugendzeit auf. Um sich abzulenken, öffnete Johanna diesen und zog das Jahrbuch von vor elf Jahren heraus.
Sie kannte das Buch in- und auswendig. Als sie an den einzelnen Porträtfotos angekommen war, blätterte sie langsamer. Bilder von Andre, Larissa, Leah und anderen Schulfreunden tauchten auf und wurden überblättert, bis Johanna innehielt und ein gewisses Porträt anstarrte. Erst als Leah ihn heute Nachmittag erwähnte, dachte sie wieder an ihn.
All die Jahre gelang es ihr, die Gedanken an ihn einzudämmen, dachte nur selten, aber mit rasendem Herzschlag an ihn. Doch jetzt war es, als wäre ein Schalter umgelegt und alle Erinnerungen kamen zurück. Dunkelbraune Locken, ein fantastisches Lächeln und grünbraune Augen strahlten zu ihr hinauf. Ihr Puls geriet ins Stocken. Ob dieses Lächeln immer noch die gleiche Wirkung auf sie hatte, wie vor elf Jahren?
Maurice Schwarz, ihre erste und einzige Liebelei.
ZWEI
Das Funkgerät knackte neben Maurice Schwarz, ehe es die Worte ausspuckte. »Leitstelle an K28. Fahrt sofort in die Elßholzstraße. Es wurde ein 42 mit 110 gemeldet.«
Seufzend griff Maurice nach dem Funkgerät und hielt es sich vor den Mund. »Schwarz und König von K28 haben verstanden und machen sich auf den Weg.« Er ließ den Knopf an der Seite los und die Hand sinken.
Neben ihm runzelte sein Kollege und Freund Alexander König die Stirn. »Das ist der zweite Mord in weniger als zwei Wochen.«
»Das ist mir bewusst«, antwortete Maurice und nahm das mobile Blaulicht, um es durchs offene Fenster auf das Wagendach zu docken. Die Autofahrer auf den Berliner Straßen wichen dem rasch heranfahrenden Fahrzeug aus. Sicherlich gab es viele Einsätze, zu denen die Kommissare gerufen wurden, aber nicht bei allen war von Anfang an klar, dass es sich um Mord handelte.
Die Fahrt bis zum Gerichtsgebäude dauerte nicht lange, da es zwei Uhr morgens war, und sie nicht weit vom Tatort entfernt waren. Erst vor einer Stunde schlossen sie eine Einbruchserie ab, indem sie den Straftäter auf frischer Tat ertappten. Ihre Kollegen hatten den Einbrecher bereits ins K28 gebracht und sie waren ebenfalls auf den Weg dorthin gewesen.
Das Blaulicht tauchte Maurice´ Gesicht immer wieder in den Schatten, als er aus dem Auto stieg und auf die Absperrung zuging. Alexander ging neben ihm und beugte sich gleichzeitig unter dem Polizeiband durch.
»Was haben wir?«, fragte Alexander eine junge Streifenpolizistin, der bei seinem Anblick kurz der Mund offenstand. Mit seinen vierundvierzig Jahren sah Alexander auch noch verdammt gut aus. Selbst um zwei Uhr morgens. Sein Gesicht war vom Leben gezeichnet und Maurice wusste auch, dass sein Körper einige Narben aufwies, aber seine Ausstrahlung und sein Lächeln brachten die Frauen reihenweise um den Verstand.
Die junge Streifenpolizistin riss sich sichtbar zusammen und ratterte die Informationen herunter. »Richterin Tanner wurde ermordet. Sie wurde vor einer halben Stunde vom Wachdienst in ihrem Büro aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bisher keine Spur vom Täter. Das Büro liegt im rechten Obergeschoss, das dritte Büro auf der rechten Seite.«
Maurice schloss kurz die Augen, denn er kannte Richterin Tanner. Alexander bedankte sich und sie machten sich gemeinsam auf den Weg in das Büro der ermordeten Frau.
»Richterin Tanner war sehr beliebt. Sie war dafür bekannt, immer fair zu urteilen und keine Vorurteile zu haben«, sagte Maurice und rieb mit seiner Hand über den Dreitagebart.
Die Richterin war jahrelang für das Familiengericht tätig. Er selbst war mit ihr ebenfalls einmal vor Gericht gewesen. Damals war es um seinen gewalttätigen Vater gegangen. Sie sprach seiner Mutter das alleinige Sorgerecht zu und entzog seinem Erzeuger das Umgangsrecht. In den dreiundzwanzig Jahren hörte er nicht auf, die Richterin für ihre Entscheidungen zu schätzen. Wenn etwas über sie in der Zeitung stand, las er es mit Interesse und wenn sie sich über den Weg gelaufen waren, grüßten sie immer einander. Auch nach all den Jahren erkannte Richterin Tanner Maurice noch und war ehrlich an seinem Wohlergehen interessiert gewesen.
»Ich verstehe nicht, wieso sie sterben musste. Sie war eine sehr faire Frau«, brummte Alexander, als sie die Treppen zum Obergeschoss nahmen.
Überall brannte Licht und an jeder Ecke stand ein Streifenpolizist, der wachsam seine Umgebung im Auge behielt. Es war unmöglich jemanden in diesem Gebäude zu ermorden. Es gab die besten Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen. Doch jetzt war das Unmögliche möglich geworden.
Nacheinander betraten die Kommissare das Büro und wurden auf der Stelle mit dem Anblick der Leiche konfrontiert. Hinter dem Schreibtisch saß Barbara Tanner, die Augen waren schreckgeweitet. Die Mascaraspuren verrieten Maurice, dass sie geweint hatte. An ihren Mundwinkeln verliefen parallel Blutspuren.
Weiteres Blut befand sich auf der Höhe ihres Herzens.
An der rechten Wand stand ein hüfthoher und langer Schrank. Links waren zwei große Fenster, die mit den Gardinen schlampig zugezogen wurden. Die Spusi war ebenfalls vor Ort und dokumentierte alles mit der Kamera.
»Hallo ihr zwei«, begrüßte sie die Gerichtsmedizinerin Dr. Kaltenbach. »Die Leichenstarre ist noch nicht komplett ausgeprägt. Sie ist also noch nicht lange tot. Knapp zwei Stunden, eher weniger.«
»Und wie ist sie gestorben?«, fragte Maurice, der den Blick nicht von Barbara Tanner nehmen konnte. Alexander zog sich Einmalhandschuhe an und machte es sich zur Aufgabe, den Raum zu untersuchen. Er stand neben dem Regal mit den Akten und öffnete gerade eine kleine Schatztruhe.
»Es war definitiv der Stich ins Herz. Wäre der Stich nicht gewesen, wäre sie am Blutverlust gestorben.« Während Dr. Kaltenbach sprach, öffnete sie den Mund der Richterin und offenbarte den Grund für die Blutspuren im Gesicht. Der Täter oder die Täterin schnitt ihr die Zunge heraus. Maurice sah zu seinem Kollegen und schluckte schwer. Auch wenn er schon vieles gesehen hatte, rumorte sein Magen trotzdem verdächtig. Alexander schien diese Information ebenfalls nicht kalt zu lassen.
»Die Zunge wurde mit dieser Schere …« Dr. Kaltenbach sah die beiden Männer an, zögerte und hielt schließlich eine normale Bastelschere für Kinder mit roten Griffen hoch. »Versucht abzuschneiden. Das Wort trifft es nicht ganz. Derjenige musste öfter ansetzen und hat viele Versuche gebraucht. Es sieht ganz so aus, als hätte er nicht viel Erfahrung mit der Abtrennung von Körperteilen. Ihm war wohl nicht bewusst, dass es mit einer Bastelschere ziemlich mühsam werden würde, und hat schließlich etwas Schärferes verwendet. Die Wundränder im Mund sind unterschiedlich.«
Maurice warf Alexander einen bedeutungsschweren Blick zu. Die Kinderschere war ihnen nicht unbekannt. Erst am vorigen Donnerstag wurde eine männliche Leiche gefunden, bei der die gleiche Schere benutzt wurde. Hatten sie es mit einem Serienmörder zu tun? Alexander erwiderte seinen Blick und nickte.
Ulrike Kaltenbach war im Urlaub gewesen, weshalb sie nichts davon wusste. Die beiden Kommissare wechselten einen weiteren Blick und nickten anschließend. Sie würden das Detail der Bastelschere erst einmal für sich behalten.
»Hat … hat sie noch gelebt?«, hinterfragte Alexander und blickte von der gewöhnlichen, blutverschmierten Schere zu Dr. Kaltenbach und wieder zurück.
»Nach der Blutung zu urteilen, ja.«
»Oh Gott«, flüsterte ein Streifenpolizist, der gerade zur Tür hereingekommen war. Die beiden Kommissare und die Gerichtsmedizinerin konnten ihm da nur zustimmen. »Wer tut denn so etwas?«
»Hat sie sich nicht gewehrt?«, hinterfragte Maurice gleichzeitig und beäugte die Richterin. Sie besaß eine stämmige Figur und hätte sie Widerstand geleistet, wäre ihr die Zunge garantiert nicht abgeschnitten worden. Zumindest nahm Maurice das an.
»Jemand, der höchstwahrscheinlich eine gewisse Wut verspürte. Die Schnittränder sind abgehackt, was dafürsprechen könnte oder einfach für die Tatsache, dass es mit einer Bastelschere ziemlich schwer ist, die Zunge abzutrennen. Dennoch bin ich mir recht sicher, dass die Person eine beachtliche Wut in sich trägt. Die Frau hat einige Blutergüsse am Körper, die vor ihrem Tod eingetreten sind. Mehr kann ich erst nach der Obduktion sagen.«
Keiner der Männer war sich sicher, ob er noch mehr Informationen haben wollte.
Er mochte die Farbe Rot. Fasziniert starrte er die Blutspritzer auf seinen Händen an. Sie waren durch seine Tat dort hingelangt. Erinnerungen an den fassungslosen Ausdruck im Gesicht der Richterin durchzuckten ihn. Beinahe ungläubig sah sie ihn an, während er die Tür hinter sich schloss. Genau fünfzehn Stunden beobachtete er das Gerichtsgebäude und wurde dann tatsächlich für seine Geduld belohnt. All die Stunden konnte er das Kommen und Gehen der Personen sehen, obwohl Sonntag war. Richterin Tanner verließ es an diesem Tag nicht ein einziges Mal.
Nachdem er die kommenden und gehenden Leute zählte, konnte er sagen, wie viele Leute sich zu den späten Stunden noch im Gebäude aufhielten. Die Reinigungskräfte gingen schon vor zwei Stunden nach Hause. Dann war nur noch das Sicherheitspersonal da. Ihm war bewusst, dass sein Plan riskant war und doch wollte er es wagen. Sein Herz begann schneller zu pochen und sendete gleichzeitig einen Schmerz aus, den er bald nicht mehr kontrollieren konnte.
Über die Straße konnte er ohne Probleme gehen, zu dieser Stunde war der Asphalt eher spärlich befahren. Hastig zog er sich seine Kapuze über den Kopf. Von seinen früheren Besuchen wusste er, dass dieses Gebäude nur so von Überwachung strotzte. Schnellen Schrittes ließ er die wenigen Stufen hinter sich und zog die eine Hälfte der schweren Flügeltür auf. Nichts geschah, er sah in keine Mündung einer Waffe und er konnte auch keine Schritte vernehmen. Leise schlich er in die Empfangshalle und strebte die linke Treppe an, das Büro von Richterin Tanner befand sich im ersten Stock. Er erinnerte sich an das Gefühl, welches ihn durchströmte, sobald er durch die Tür zu ihrem Büro trat. Gerade jetzt beflügelte es ihn und gab ihm das Gefühl fliegen zu können. Der Schmerz wich diesem Empfinden und er genoss die Erinnerung an die quälenden Laute, die die Richterin von sich gab. Ganz entgegen seiner Erwartung bettelte sie nicht. Mit wachsamen Augen sah sie sein Näherkommen und blieb arrogant in ihrem Stuhl sitzen. Vermutlich rechnete sie nicht damit, dass ihr Gefahr drohte.
»Was wollen Sie?«, fragte sie, was ihn dazu veranlasste, sie mit schief gelegtem Kopf zu mustern. Wieso besaß diese Frau so viel Macht, ein wundervolles Leben zu beenden? Diese Bilder flimmerten durch seinen Kopf und katapultierten ihn fünf Stunden zurück.
»Sie wissen es bereits«, antwortete er leise, die Stimme vor unterdrückter Wut gepresst. Langsam ging er auf sie zu, die Hand in seiner Pullovertasche, in der seine Werkzeuge steckten. »Halten Sie bloß still!«, zischte er und zog eine Rolle Klebeband hervor. »Ich weiß, wo sich Ihre Tochter befindet, und ich werde genau das Gleiche oder Schlimmeres mit ihr anstellen, wenn Sie auch nur irgendetwas versuchen, wie den Sicherheitsdienst zu informieren!«
In ihrem Gesicht konnte er das blanke Entsetzen erkennen und er wusste sofort, dass er mit seinen Worten einen Nerv getroffen hatte. Die Bedrohung eines geliebten Menschen zog immer. Noch bevor er sich seinen Plan zurechtlegte, recherchierte er ausgiebig über seine Zielpersonen.
Einige Handbewegungen waren nötig, um ihre Handgelenke effektiv an den Armlehnen zu befestigen. Das Gleiche geschah auch mit ihren Schienbeinen, nur dass sie aneinandergebunden wurden. Natürlich täuschte er sie nur, niemals würde er einer Unschuldigen etwas antun. Das entsprach nicht seinem Typ. Zumindest war er davon immer ausgegangen. Bis vor einer Woche hatte er auch nie daran gedacht, einen Menschen kaltblütig das Leben zu nehmen. Für einen Moment hielt er inne, schüttelte den Kopf und konzentrierte sich wieder auf sein Vorhaben. Ihm war es prinzipiell egal, wen er für seine Vergeltung tötete. Er würde sie um jeden Preis einfordern.
Genüsslich strich er den Namen von seiner Liste und bedachte den Nächsten darauf. Nein, diese würde er sich bis zum Schluss aufheben. Zunächst würde er sich um den Mann kümmern, der diese Richterin auf alles aufmerksam machte.
Frustriert schloss Maurice die Akte vor sich auf dem Schreibtisch. Nach nur vier Stunden Schlaf war er wieder auf den Beinen gewesen und war geduscht wie gehabt im Kommissariat erschienen. Inzwischen war es halb zwölf und sein Magen knurrte. Er war ohne Frühstück aus dem Haus gestürmt und trank zwischenzeitlich drei Tassen Kaffee. Das war nichts, was sein Körper nicht kannte. Keine Nahrung zu bekommen, das war etwas, womit sein Kreislauf nicht umgehen konnte. Gerade als er sich den vierten Kaffee holen wollte, öffnete sich die Tür zum Büro und Alexander erschien.
»Ich komme aus der Gerichtsmedizin. Ulrike bestätigt die Angaben von letzter Nacht. Tödlich war die Stichwunde und hat Richterin Tanners Herz sauber durchbohrt. Zuvor hat sie die Hölle durchlebt. Aber das haben wir ja gestern Abend schon feststellen müssen. Bei näherer Untersuchung kann Ulrike nun eindeutig bestätigen, dass die Zunge zunächst mit der Bastelschere malträtiert und dann vermutlich mit einem Fleischmesser entfernt wurde. Ganz genau kann sie sich nicht festlegen, nur das die Wundränder ziemlich glatt waren. Interessant und neu dagegen ist, dass Ulrike eine klebrige Substanz an den Handgelenken der Richterin gefunden hat. Die Substanz wurde von der Spusi ebenfalls an den Stuhllehnen und den Hosenbeinen entdeckt. Alle Proben sind im Labor. Ich vermute, es war irgendeine Art von Klebeband. Als ich ihr das sagte, hat sie mich nur missbilligend angesehen und mit der Zunge geschnalzt. Du kennst sie ja, sie will keine Hypothesen ohne handfeste Beweise aufstellen. Aber es bestätigt deinen Verdacht, dass sie gefesselt war. Ansonsten hätte sie sich gewehrt. So wie wir sie kannten, hätte sie nicht still dagesessen und auf ihren Tod gewartet.«
»Aber warum nimmt er das Klebeband mit und lässt die Bastelschere zurück? Das verstehe ich nicht.« Maurice rieb sich mit Daumen und Zeigefinger die Augen.
Alexander zuckte mit den Schultern. »Das kann ich dir auch nicht beantworten. Vielleicht waren irgendwelche Spuren darauf, die wir nicht finden sollten.«
Darauf erwiderte Maurice nichts, sondern dachte nach. Abrupt kam ihm ein logischer Gedanke. »Womöglich ist die Bastelschere seine Signatur? Wir sollen wissen, dass nur er für die Morde verantwortlich ist«, sagte Maurice.
Sein Kollege sah ihn stumm an und antwortete nicht.
»Was ist? Nicht nur du guckst Criminal Minds.«
Maurice lehnte sich in seinem Stuhl zurück und betrachtete die Stellwand. An dieser waren alle Fotos und Informationen beider Tatorte. Der Mörder oder die Mörderin verspürte eine riesige Wut. Für diese Annahme sprachen deutlich die abgehakten Ränder der Wunden und das zunächst keine andere Waffe verwendet wurde, um diese Art von Verletzungen zuzufügen. Es schien, als wollte er oder sie das Opfer um jeden Preis quälen. Auch beim Kinderarzt erwähnte der Gerichtsmediziner diese wahrscheinliche Wut in seinem Bericht. Beide Kommissare waren sich einig, dass es sich um ein und denselben Täter handelte.
Er starrte auf das Foto, welches das Gesicht des Kinderarztes zeigte. »Bei Dr. Phillip wurden keine Klebebandspuren gefunden.« Die Leiche wurde am Donnerstagabend mit ausgestochenen Augen entdeckt. Er war qualvoll verblutet, nachdem ihm noch mehrmals in den Bauch gestochen wurde. Dabei gab es keine Spuren und keine Hinweise auf den Täter. Kein Motiv. Der Kinderarzt war beliebt gewesen, sowohl privat als auch in seinem Beruf. Egal, wo Alexander und Maurice recherchiert hatten, sie hatten nur positives über den Mann im mittleren Alter gehört. Im Arbeitszimmer des Kinderarztes gab es Spuren eines Kampfes. Der Schreibtischstuhl lag auf dem Boden, doch offensichtlich hatte der Mörder rasch die Oberhand gewonnen.