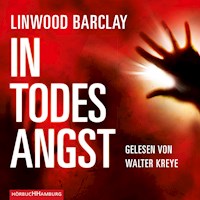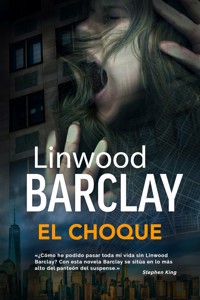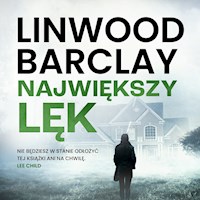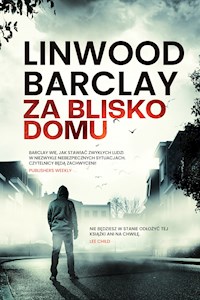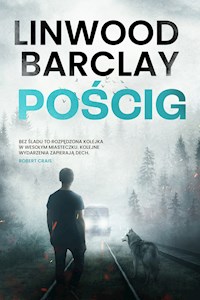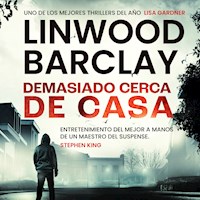Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Tod einer Doppelgängerin - "Ein Killer von einem Thriller." New York Times Cal Weaver, ein Privatdetektiv, fährt in einer regnerischen Nacht nach Hause. Auf einem Parkplatz klopft eine junge, nervös wirkende Frau an die Windschutzscheibe und bittet ihn, sie mitzunehmen. Cal hat Bedenken, fährt den Teenager aber zu einer Bar. Ein großer Fehler - denn am nächsten Morgen ist die Anhalterin verschwunden, ihre Freundin wird tot aufgefunden. Und der Verdacht fällt auf Cal ... "Spannung, die keinen Moment nachlässt." TV Movie
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 30 min
Sprecher:Frank Arnold
Ähnliche
Linwood Barclay
Nachts kommt der Tod
Thriller
Aus dem Englischen von Silvia Visintini
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Für Neetha
»Kannst du schwimmen?«
»Sie sind verrückt, Mann! Lassen Sie mich los!«
»Obwohl … auch wenn du’s kannst, seh ich schwarz für dich. Wir sind so nahe bei den Wasserfällen, da ist die Strömung unglaublich stark. Da reißt’s dich runter, bevor du bis drei zählen kannst. Und es geht sehr tief runter.«
»Lassen Sie mich los!«
»Vielleicht erwischst du davor noch einen von den Felsen und kannst dich dranklammern. Aber wenn du dagegenknallst, bist du höchstwahrscheinlich erledigt. Wenn du in einem Fass stecken würdest, wie diese Wahnsinnigen, die sich da schon mal runtergestürzt haben, hättest du vielleicht eine Chance von einem Prozent, optimistisch gerechnet.«
»Wenn ich’s Ihnen doch sage, Mister, ich schwöre bei Gott, ich war’s nicht.«
»Ich glaub dir nicht. Aber wenn du ehrlich bist, wenn du zugibst, was du getan hast, dann schmeiß ich dich nicht runter.«
»Ich war’s nicht! Ich schwöre!«
»Wenn du’s nicht warst, wer war’s dann?«
»Ich weiß es doch nicht! Wenn ich einen Namen wüsste, ich würd ihn sagen. Bitte, bitte, ich flehe Sie an, Mann.«
»Weißt du, was ich glaube? Wenn du da runterstürzt, das fühlt sich an wie fliegen.«
Eins
Wenn ein Mann mittleren Alters eine Jugendliche mitnimmt, die vor einer Bar steht und den Daumen rausstreckt, dann ist er nicht ganz bei Trost. Und auch das Mädel ist eigentlich nicht mehr zu retten. Doch im Augenblick reden wir von meiner Dummheit, nicht von ihrer.
Sie stand am Straßenrand, das blonde Haar hing ihr in klatschnassen Strähnen ins Gesicht, der Neonschein der Coors-Reklame im Fenster von Patchett’s Bar tauchte sie in ein gespenstisches Licht. Die Schultern hatte sie hochgezogen, als könne sie damit den Sprühregen abwehren, sich irgendwie warm und trocken halten.
Wie alt sie wohl sein mochte? Alt genug, um Auto fahren und vielleicht sogar wählen zu dürfen, aber um Alkohol zu trinken wahrscheinlich noch zu jung. Wenigstens hier in Griffon im Staat New York. Auf der anderen Seite der Lewiston Queenston Bridge vielleicht nicht. Drüben in Kanada durfte man schon mit neunzehn trinken, nicht erst mit einundzwanzig. Was aber nicht hieß, dass sie im Patchett’s nicht ein paar Bierchen gezischt haben konnte. Ausweise wurden da nicht besonders gründlich kontrolliert. Das war allgemein bekannt. Wenn auf deinem Ausweis ein Foto von Nicole Kidman prangt, du aber eher wie Penelope Cruz aussiehst, dann reicht ihnen das völlig. »Hock dich hin, was willst du trinken?«, das war das Motto bei Patchett’s.
Mit ihrer überdimensionalen roten Handtasche auf der Schulter stand sie da und streckte den Daumen raus. Und sie sah zu mir herüber, als ich langsam auf das Stoppschild an der Ecke zurollte.
Vergiss es, dachte ich. Einen männlichen Anhalter mitzunehmen ist schon nicht besonders schlau, aber eine jugendliche Anhalterin? Das ist dümmer, als die Polizei erlaubt. Ein Typ Anfang vierzig, der in einer finsteren, regnerischen Nacht ein Mädchen zu sich in den Wagen steigen lässt, das noch nicht mal halb so alt ist wie er selbst – die reine Idiotie. Also Augen stur geradeaus. Ich wollte gerade wieder Gas geben, da hörte ich ein Klopfen am Beifahrerfenster.
Ich sah hinüber. Da stand sie. Sie hatte sich vorgebeugt, sah mich an. Ich schüttelte den Kopf, aber sie klopfte weiter.
Ich ließ das Fenster gerade so weit herunter, dass ich ihre Augen und die obere Hälfte ihrer Nase sehen konnte. »Tut mir leid«, sagte ich. »Ich kann –«
»Nur zu mir nach Hause«, sagte sie. »Ist gar nicht weit. In dem Pick-up da drüben sitzt so ein Typ, der ist mir nicht geheuer, glotzt mich schon die ganze Zeit an und …« Sie machte große Augen. »Scheiße, sind Sie nicht der Vater von Scott Weaver?«
Und dann war plötzlich alles anders.
»Ja«, sagte ich. Der war ich gewesen.
»Dacht ich mir’s doch. Sie kennen mich wahrscheinlich gar nicht, aber ich hab Sie schon öfter gesehen. Wenn Sie Scott von der Schule abgeholt haben und so. Hören Sie, es tut mir leid, jetzt regnet’s Ihnen auch noch in den Wagen. Ich find schon jemand …«
Wie hätte ich eine von Scotts Freundinnen da im Regen stehen lassen können?
»Steig ein«, sagte ich.
»Sind Sie sicher?«
»Ja.« Ich schwieg einen Moment, gab mir eine Sekunde Zeit, da wieder rauszukommen. Dann: »Schon in Ordnung.«
»Mensch, danke!«, sagte sie, öffnete die Tür und stieg ein. Sie jonglierte mit ihrem Handy, streifte sich die Tasche von der Schulter und stellte sie neben ihre Füße. Das Innenlicht ging an und gleich wieder aus. »Gott, ich bin völlig durchgeweicht. Tut mir leid wegen Ihrem Sitz.«
Sie war nass. Ich weiß nicht, wie lange sie da schon gestanden hatte, aber lange genug, dass ihr das Wasser in kleinen Rinnsalen von den Haaren auf Jacke und Jeans lief. Ihre Oberschenkel waren nass, gut möglich, dass ein vorbeifahrendes Auto sie vollgespritzt hatte.
»Mach dir deswegen keine Sorgen«, sagte ich, während sie sich anschnallte. Ich war noch nicht wieder angefahren, wartete, dass sie mir sagte, wo sie hinwollte. »Soll ich geradeaus fahren, abbiegen, oder was?«
»Bin ich doof.« Sie lachte nervös, dann schüttelte sie den Kopf und verspritzte Wassertropfen wie ein Spaniel, der aus einem See kommt. »Woher sollen Sie wissen, wo ich wohne? Einfach geradeaus.«
Ich sah nach links und rechts, dann fuhr ich über die Kreuzung.
»Du warst also eine Freundin von Scott?«, fragte ich.
Sie nickte, lächelte. Dann verzog sie das Gesicht. »Ja, er war ein lieber Kerl.«
»Wie heißt du?«
»Claire.«
»Claire?« Ich zog den Namen in die Länge, eine Aufforderung an sie, mir ihren Nachnamen zu nennen. Vielleicht war sie mir bei meinen Online-Recherchen schon untergekommen. Ihr Gesicht hatte ich eigentlich noch nicht richtig gesehen.
»Genau«, sagte sie. »Wie Schoko E. Claire.« Wieder das nervöse Lachen. Sie nahm das Handy von der linken in die rechte Hand, legte dann die leere Linke auf das linke Knie. Auf dem Handrücken, direkt unter den Knöcheln, hatte sie einen ziemlich bösen Kratzer, der vielleicht drei Zentimeter lang und ganz frisch war, aber nicht blutete.
»Hast du dir weh getan, Claire?«, fragte ich sie mit einem Nicken in Richtung ihrer Hand.
Sie sah auf sie hinunter. »O Scheiße, hab ich gar nicht bemerkt. Da ist so ein Idiot im Patchett’s rumgetorkelt, hat mich fast über den Haufen gerannt, da muss ich mir die Hand an einer Tischkante aufgerissen haben. Brennt ein bisschen.« Sie hob die Hand ans Gesicht und blies auf die Wunde. »Ich werd’s überleben«, sagte sie.
»Du siehst aber nicht aus, als ob du schon alt genug wärst, um da reinzudürfen.« Ich warf ihr einen vorwurfsvollen und zugleich süffisanten Blick zu.
Sie bemerkte den Blick und verdrehte die Augen. »Schon klar.«
Einen Kilometer lang schwiegen wir beide. Soweit ich im Licht des Armaturenbretts sehen konnte, lag das Handy auf ihrem rechten Oberschenkel und ihre Hand darüber. Sie beugte sich vor, um in den Außenspiegel an der Beifahrertür zu sehen.
»Der Typ da sitzt schon fast auf Ihrer Stoßstange«, sagte sie.
Grelles Scheinwerferlicht traf auf meinen Rückspiegel. Das Fahrzeug hinter uns war ein Geländewagen oder ein Pick-up, die Scheinwerfer waren jedenfalls so hoch montiert, dass sie mir ins Heckfenster strahlten. Ich stieg kurz auf die Bremse, damit das Bremslicht aufleuchtete, und der Fahrer vergrößerte den Abstand. Claire sah weiterhin in den Außenspiegel. Der Drängler schien sie sehr zu interessieren.
»Alles in Ordnung, Claire?«, fragte ich.
»Hmm? Ja, alles bestens, ja.«
»Du wirkst ein bisschen nervös.«
Sie schüttelte den Kopf ein wenig zu aggressiv.
»Bist du sicher?«, fragte ich sie. Ich drehte mich zu ihr, und unsere Blicke kreuzten sich.
»Ganz sicher«, sagte sie.
Sie war keine besonders gute Lügnerin.
Wir fuhren auf der Danbury Road, einer vierspurigen Straße mit einer fünften Spur für Linksabbieger. Sie war links und rechts von Fast-Food-Lokalen, einem Heimwerkermarkt, diversen Discountern und einer Reihe anderer Läden gesäumt, deren Omnipräsenz in jeder größeren Stadt es einem schwermachte, Tucson von Tallahassee zu unterscheiden.
»Woher kanntest du Scott?«, fragte ich.
Claire zuckte die Achseln. »So halt, von der Schule. Wir sind jetzt nicht so oft zusammen abgehangen oder so, aber ich kannte ihn. Hat mich echt traurig gemacht, was mit ihm passiert ist.«
Ich schwieg.
»Ich meine, alle Jugendlichen bauen mal Scheiße. Aber was wirklich Schlimmes passiert den meisten dabei nicht.«
»Stimmt«, sagte ich.
»Wann war das noch mal?«, fragte sie. »Weil, es kommt mir irgendwie so vor, als wär’s erst ein paar Wochen her.«
»Morgen sind’s zwei Monate«, sagte ich. »Am 25. August.«
»Mensch«, sagte sie. »Aber, klar, jetzt, wo Sie’s sagen, wir hatten ja Ferien. Weil normalerweise würde die ganze Schule über so was reden, aber in diesem Fall halt nicht. Als die Schule wieder anfing, dachte irgendwie niemand mehr daran.« Sie hielt sich die linke Hand vor den Mund und sah mich entschuldigend an. »So hab ich das nicht gemeint.«
»Schon gut.«
Es gab so vieles, was ich sie fragen wollte. Doch ich kannte sie ja noch keine fünf Minuten, und meine Fragen waren zu direkt gewesen, und ich wollte nicht rüberkommen wie jemand vom Heimatschutzministerium. Seit dem Vorfall benutzte ich die Liste von Scotts Facebook-Freunden als eine Art Wegweiser, und bestimmt war mir auch der Name dieses Mädchens schon untergekommen, aber im Augenblick wusste ich nicht, wo ich sie hintun sollte. Allerdings wusste ich auch, dass eine Facebook-»Freundschaft« nicht unbedingt viel zu bedeuten hatte. Scott hatte eine Menge Leute zu seinen Freunden hinzugefügt, die er nicht mal kannte, darunter auch einige bekannte Künstler, die Graphic Novels machten, und weitere C-Promis, die ihre Facebook-Seiten noch eigenhändig pflegten.
Rausfinden, wer dieses Mädchen war, konnte ich immer noch. Vielleicht würde sie mir ein andermal ein paar Fragen zu Scott beantworten. Sie buchstäblich nicht im Regen stehen zu lassen trug mir möglicherweise ein paar Pluspunkte für einen späteren Zeitpunkt ein. Vielleicht wusste sie ja etwas, das ihr unwichtig schien, mir aber weiterhelfen konnte.
Als hätte sie meine Gedanken gelesen, sagte sie: »Man redet über Sie.«
»Häh?«
»Ja … also, die Leute in der Schule.«
»Über mich?«
»Ein bisschen. Sie wussten schon vorher, was Sie machen. Beruflich, meine ich. Und sie wissen, was Sie in letzter Zeit tun.«
Da brauchte ich mich wohl nicht zu wundern.
»Ich weiß nichts, hat also gar keinen Sinn, mir Fragen zu stellen«, fügte sie hinzu.
Ich wandte meinen Blick einen Moment von der regennassen Straße und sah sie an, sagte aber nichts.
Ein Mundwinkel verzog sich nach oben. »Ich hab gemerkt, dass Sie das überlegt haben.« Sie schien über etwas nachzudenken, dann sagte sie: »Das soll aber kein Vorwurf sein wegen dem, was Sie machen. Mein Dad würde wahrscheinlich dasselbe tun. Wenn’s drauf ankommt, kann er ganz schön verbissen und kleinkariert sein.« Sie drehte sich so, dass sie mich ansehen konnte. »Ich finde, es ist falsch, ein Urteil über jemanden zu fällen, bevor man alles über ihn weiß, Sie nicht? Ich meine, man muss erst verstehen, dass er vielleicht Erfahrungen gemacht hat, die ihn die Welt in einem anderen Licht sehen lassen. Meine Großmutter zum Beispiel, sie lebt nicht mehr, aber sie hat immer nur gespart und gespart, bis zu ihrem Tod, neunzig ist sie geworden, weil sie damals die Weltwirtschaftskrise miterlebt hat. Ich hatte noch nie davon gehört, aber dann habe ich mich schlaugemacht. Sie wissen wahrscheinlich, was die Weltwirtschaftskrise war?«
»Ich weiß, was die Weltwirtschaftskrise war. Aber ob du’s glaubst oder nicht, miterlebt habe ich sie nicht.«
»Egal«, sagte Claire, »wir dachten immer, Grandma wäre knausrig, aber in Wirklichkeit wollte sie nur auf alles vorbereitet sein. Für den Fall, dass das wieder passiert. Könnten Sie kurz mal bei Iggy’s reinfahren?«
»Was?«
»Da vorn.« Sie zeigte durch die Windschutzscheibe.
Ich kannte das Lokal. Was ich nicht kapierte, war, warum sie mich dorthin lotsen wollte. Iggy’s war so eine Art Wahrzeichen von Griffon, das hatte ich von den Einheimischen erfahren. Seit über fünfzig Jahren bekam man dort Eis und Burger, und Iggy’s konnte sich auch noch behaupten, nachdem McDonald’s einen Kilometer weiter seine goldenen Bögen aufgespannt hatte. Selbst ausgewiesene Big-Mac-Apostel pilgerten hierher, um sich Iggy’s unnachahmliche, von Hand geschnittene und mit Meersalz gewürzte Pommes sowie die Milchshakes mit richtigem Speiseeis schmecken zu lassen.
Ich hatte mich darauf eingelassen, dieses Mädchen nach Hause zu fahren, aber ein Abstecher zu Iggy’s Drive-in war doch ein bisschen viel verlangt.
Ehe ich Einwände erheben konnte, sagte sie: »Also, nicht zum Essen. Mir ist nur plötzlich ganz komisch im Magen. Manchmal wird mir von Bier schlecht, wissen Sie, und es ist ja schon schlimm genug, dass ich Ihnen den Wagen nass mache. Ich will nicht auch noch reinkotzen.«
Ich setzte den Blinker und fuhr auf das Restaurant zu, in dessen Scheiben sich das Licht meiner Scheinwerfer spiegelte und mich blendete. Iggy’s war nicht so durchorganisiert und geleckt wie MacDonald’s oder ein Burger King – die Menütafeln bestanden noch immer aus gerilltem weißem Kunststoff mit schwarzen Steckbuchstaben –, bot jedoch genügend Platz zum Sitzen, und selbst zu dieser vorgerückten Stunde saßen noch Gäste da. Ein ungepflegter Mann mit einem überdimensionalen Rucksack trank Kaffee. Allem Anschein nach ein Obdachloser, der sich vor dem Regen hierhergeflüchtet hatte. Ein paar Tische weiter teilte eine Frau eine Portion Pommes unter zwei Mädchen in rosa Schlafanzügen auf, von denen keines älter als fünf sein konnte. Was die wohl zu erzählen hätten? Mir fiel eine Geschichte von einem gewalttätigen Vater ein, der einen über den Durst getrunken hatte. Sie waren hergekommen, um abzuwarten, dass der Vater in sein Säuferkoma fiel und sie sich wieder nach Hause wagen konnten.
Noch ehe ich anhielt, hatte Claire sich den Riemen ihrer Handtasche ums Handgelenk gewickelt und ihre Sachen zusammengerafft, als plane sie eine Flucht.
»Alles in Ordnung bei dir?«, fragte ich und stellte den Schalthebel auf Parken. »Ich meine, abgesehen von deiner Übelkeit?«
»Ja – ja, sicher.« Sie lachte auf und öffnete die Tür. Ich registrierte die Scheinwerfer eines Wagens, der hinter mir auf den Parkplatz gefahren war. »Bin gleich wieder da«, sagte sie, sprang aus dem Auto und schlug die Tür zu. Zum Schutz vor dem Regen hielt sie sich die Tasche über den Kopf. Sie rannte auf den Eingang des Restaurants zu und gleich weiter in den hinteren Teil, wo sich die Toiletten befanden.
Inzwischen hatte der Wagen in einiger Entfernung von meinem geparkt. Ich sah hinüber. Es war ein schwarzer Pick-up, dessen Scheiben so stark getönt waren, dass ich nicht erkennen konnte, wer am Steuer saß.
Mein Blick wanderte zum Restaurant zurück. Hier saß ich nun, mitten in der Nacht, und wartete darauf, dass ein Mädchen, das ich kaum kannte – eine Minderjährige noch dazu –, sich den Alkohol , den sie noch gar nicht hätte trinken dürfen, aus dem Leib kotzte. Mir war völlig klar, dass ich mich erst gar nicht in diese Situation hätte hineinmanövrieren dürfen. Aber nachdem sie diesen Typ in dem Pick-up erwähnt hatte, der sich so für sie interessierte …
Pick-up?
Ich sah noch mal zu dem schwarzen Wagen hinüber, der auch dunkelblau oder grau sein konnte – bei dem Regen war das schwer zu sagen. Falls jemand ausgestiegen und zu Iggy’s reingegangen war, dann hatte ich es jedenfalls nicht bemerkt.
Bevor Claire zu mir in den Wagen gestiegen war, hätte ich ihr klipp und klar sagen sollen, sie solle ihre Eltern anrufen. Die sollten sie abholen.
Aber dann hatte sie Scott erwähnt.
Ich holte mein Handy heraus und sah nach, ob ich E-Mails bekommen hatte. Hatte ich nicht, aber während dieser Übung waren immerhin zehn Sekunden vergangen. Mit einer Programmtaste des Autoradios rief ich einen Sender aus Buffalo auf, der mich nicht mit Werbung nervte. Allerdings bekam ich von dem, was da gesprochen wurde, nicht viel mit.
Das Mädchen war jetzt schon fünf Minuten auf der Toilette. Wie lange braucht ein Mensch, um sich zu übergeben? Man geht rein, tut, was zu tun ist, spritzt sich ein bisschen Wasser ins Gesicht und kommt wieder raus.
Vielleicht ging es Claire schlechter, als ihr klar gewesen war. Möglicherweise hatte sie sich eingeferkelt und brauchte länger, um sich zu restaurieren.
Toll.
Ich hatte meine Hand auf dem Zündschlüssel, wollte ihn drehen. Du könntest einfach losfahren. Sie hatte ein Handy. Sie konnte jemand anderen anrufen und sich abholen lassen. Ich konnte nach Hause fahren. Ich war nicht verantwortlich für dieses Mädchen.
Leider stimmte das nicht. In dem Moment, als ich mich darauf eingelassen hatte, sie mitzunehmen, hatte ich in gewisser Weise auch die Verantwortung für sie übernommen.
Ich sah wieder zu dem Pick-up hinüber. Er stand einfach da.
Wieder ließ ich meinen Blick durch das Restaurant schweifen. Da waren der Obdachlose und die Frau mit den beiden Mädchen. In der Nische am Fenster saßen jetzt noch ein Junge und ein Mädchen um die achtzehn und teilten sich ein Coke und eine Portion Hähnchensticks. An der Theke gab ein Mann seine Bestellung auf. Er stand mit dem Rücken zu mir, hatte pechschwarzes Haar und trug eine braune Lederjacke.
Sieben Minuten.
Ich machte mir Gedanken, wie es wohl aussähe, wenn jetzt Claires Eltern auf der Suche nach ihr hier hereinschneiten und feststellten, dass ich auf ihre Tochter wartete? Ich, Cal Weaver, der Privatschnüffler der Stadt. Würden sie mir glauben, dass ich sie nur nach Hause bringen wollte? Dass ich mich bereit erklärt hatte, sie mitzunehmen, weil sie meinen Sohn gekannt hatte? Dass es lautere Absichten waren, die mich leiteten?
An ihrer Stelle würde ich mir kein Wort glauben. Und so ganz lauter waren meine Absichten auch nicht gewesen. Ich hatte überlegt, ob ich versuchen sollte, ihr ein paar Informationen über Scott zu entlocken, auch wenn ich mich rasch dagegen entschieden hatte.
Es war nicht die Hoffnung, etwas von ihr zu erfahren, die mich jetzt hier festhielt. Ich brachte es einfach nicht über mich, ein junges Mädchen nachts in dieser Gegend im Stich zu lassen. Und erst recht nicht, ohne ihr vorher Bescheid zu sagen.
Ich beschloss, ins Lokal zu gehen, um sie zu suchen und mich zu vergewissern, dass es ihr gutging. Dann würde ich ihr sagen, sie müsse sich jetzt selbst darum kümmern, wie sie von hier nach Hause kam. Ich würde ihr Geld fürs Taxi geben, wenn es niemanden gab, den sie anrufen konnte. Ich stieg aus, ging ins Restaurant, sah auch auf den Plätzen nach, die ich von draußen nicht hatte einsehen können, nur für den Fall, dass Claire sich kurz hingesetzt haben sollte. Als ich sie an keinem der Tische entdeckte, ging ich nach hinten zu den Toiletten. Sie waren nur ein paar Schritte von einer weiteren Glastür entfernt, die nach draußen führte.
Vor der Tür mit der Aufschrift DAMEN wappnete ich mich kurz, dann drückte ich sie einen Spaltbreit auf.
»Claire? Geht’s dir gut, Claire?«
Keine Antwort.
»Ich bin’s. Mr. Weaver.«
Nichts. Nicht von Claire und auch von sonst niemandem. Also stieß ich die Tür etwas weiter auf und warf einen prüfenden Blick in den Waschraum. Zwei Waschbecken, ein an der Wand montierter Händetrockner, drei Kabinen. Die Türen waren in einem stumpfen Hellbraun gestrichen, und von ihren Angeln blätterte der Rost. Alle drei waren geschlossen. In dem knapp fünfzig Zentimeter breiten Spalt zwischen Türunterkante und Fußboden waren keine Füße zu sehen.
Ich machte zwei Schritte vorwärts, streckte einen Arm aus und berührte vorsichtig die Tür der ersten Kabine. Sie war nicht versperrt und schwang träge auf. Keine Ahnung, was ich mir eigentlich erwartete. Schon ehe ich die Tür aufgestoßen hatte, war mir klar, dass niemand da drin war. Und dann schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: Was, wenn jemand drin gewesen wäre? Egal, ob Claire oder sonst wer?
Die Damentoilette war bestimmt nicht der richtige Ort für mich.
Rasch ging ich wieder hinaus, zurück ins Restaurant. Ich hielt weiterhin Ausschau nach Claire. Obdachloser, Frau mit Kindern –
Der Mann in der braunen Lederjacke, der vorhin an der Theke gestanden hatte, war nicht mehr da.
»Mist«, sagte ich.
Als ich wieder den Parkplatz betrat, fiel mir als Erstes auf, dass der schwarze Pick-up verschwunden war. Gleich darauf sah ich ihn. Er wartete in der Ausfahrt zur Danbury Street darauf, sich in den fließenden Verkehr einordnen zu können. Bei diesen getönten Scheiben war es unmöglich zu erkennen, ob jemand auf dem Beifahrersitz saß.
Jetzt tat sich eine Lücke auf, und der Pick-up schoss los, dass der Motor aufheulte und die Hinterreifen auf dem nassen Asphalt durchdrehten. Er fuhr nach Süden, Richtung Niagara Falls.
War das womöglich der Wagen, von dem Claire gesprochen hatte, als ich sie vor Patchett’s hatte einsteigen lassen? Wenn ja, war er uns gefolgt? War der Fahrer der Mann in der Lederjacke? Hatte er sich Claire geschnappt und war mit ihr davongefahren? Oder war sie zu der Einsicht gelangt, dass er doch nicht so furchteinflößend war, wie sie ursprünglich gedacht hatte, und gewährte jetzt ihm die Gunst, sie nach Hause fahren zu dürfen?
Mist, verdammter.
Mein Herz hämmerte. Ich hatte Claire verloren. Eigentlich hatte ich sie ja gar nicht haben wollen, aber jetzt schob ich Panik, weil ich nicht wusste, wo sie abgeblieben war. Was sollte ich tun? Ich überlegte fieberhaft. Dem Pick-up folgen? Die Polizei verständigen? Vergessen, dass das Ganze überhaupt geschehen war?
Dem Pick-up folgen.
Das schien mir am logischsten. Ihm nachfahren, ihn einholen, versuchen, einen Blick hineinzuwerfen, mich vergewissern, dass Claire –
Da war sie.
In meinem Wagen. Auf dem Beifahrersitz. Den Gurt hatte sie bereits angelegt. Das blonde Haar hing ihr ins Gesicht.
Sie wartete auf mich.
Ich atmete ein paarmal durch, ging zum Wagen, stieg ein, schlug die Tür zu. »Wo zum Teufel warst du?«, fragte ich, als ich mich auf den Sitz fallen ließ. Das Innenlicht leuchtete kurz auf und erlosch. »Du warst so lang da drin, dass ich mir schon Sorgen gemacht habe.«
Sie wandte sich von mir ab und starrte aus dem Seitenfenster. »Bin wahrscheinlich zur Seitentür rausgekommen, als Sie vorne reingingen.« Ihre Stimme klang jetzt mehr wie ein Brummeln, jedenfalls rauher als vorher. Die Bröckchen, die sie gehustet hatte, waren ihrer Kehle offenbar nicht bekommen.
»Du hast mir vielleicht einen Schrecken eingejagt«, sagte ich. Doch was hatte es für einen Sinn, mit ihr zu schimpfen? Sie war schließlich nicht mein Kind, und in ein paar Minuten würde ich sie zu Hause abliefern.
Ich setzte zurück, fuhr hinaus auf die Danbury Street und dann weiter in Richtung Süden.
Meine Beifahrerin lehnte sich weiterhin an ihre Tür, als bemühe sie sich, den größtmöglichen Abstand zwischen uns zu halten. Ich konnte mir ihren plötzlichen Argwohn nicht erklären. Warum jetzt erst und nicht schon vor unserem Stopp bei Iggy’s? Warum sollte sie jetzt auf einmal Angst vor mir haben? Weil ich ihr ins Restaurant hinterhergerannt war? Hatte ich damit irgendeine Grenze überschritten?
Und noch etwas irritierte mich. Nichts, was mit mir zu tun hatte. Etwas, das ich gesehen hatte, als ich in den Wagen gestiegen war. In den paar Sekunden, die das Licht an war.
Und das mir jetzt erst richtig bewusst wurde.
Ihre Kleider.
Die waren trocken. Ihre Jeans waren nicht dunkel vor Feuchtigkeit. Ich konnte schlecht hinüberlangen und ihr die Hand aufs Knie legen, um zu prüfen, ob die Hose nass war, aber ich war mir ziemlich sicher, dass sie es nicht war. Hatte sie die Hose im Waschraum ausgezogen und unter den Händetrockner gehalten? Wohl kaum. Diese Dinger schafften es gerade so, einem das Wasser von den Händen zu pusten. Aber Jeansstoff zu trocknen? Ausgeschlossen.
Da war aber noch etwas. Und es befremdete mich noch mehr als die trockenen Klamotten. Vielleicht hatte ich in Wirklichkeit gar nicht gesehen, was ich zu sehen geglaubt hatte. Das Licht hatte schließlich nur kurz aufgeleuchtet.
Ich musste es noch mal einschalten, um mich zu vergewissern.
Ich tastete an der Lenksäule nach dem Schalter für das Deckenlicht. »Verzeihung«, sagte ich. »Hab grade überlegt, was ich mit meiner Sonnenbrille gemacht habe.« Mit der Rechten kramte ich in der kleinen Ablage vorne an der Mittelkonsole herum. »Ah, da ist sie ja.«
Dann schaltete ich das Licht wieder aus. Ich hatte gesehen, was ich sehen wollte.
Ihre linke Hand. Sie war unverletzt.
Kein Kratzer.
Zwei
Ich hatte die kleine Wunde auf Claires Hand gesehen, die aufgerissene Haut, die winzigen Blutströpfchen direkt unter der Oberfläche, die jeden Moment austreten konnten. Diese Verletzung hatte sie sich erst wenige Minuten, bevor sie zu mir ins Auto gestiegen war, zugezogen.
Wenn Claire nicht eine von den X-Men mit ihrer unglaublichen Regenerationsfähigkeit war, dann war das Mädchen, das jetzt neben mir saß, nicht dasselbe, das neben mir gesessen hatte, als wir bei Iggy’s eingetroffen waren.
Wir fuhren die Danbury Street entlang, und das Ganze kam mir irgendwie surreal vor, als sei ich in eine Folge von Twilight Zone geraten. Aber das hier war keine dieser Unwahrscheinlichen Geschichten, das war real, und es musste eine rationale Erklärung dafür geben.
Ich bemühte mich, eine zu finden.
Die Kleidung dieses Mädchens war ziemlich identisch mit der von Claire. Blaue Jeans und eine kurze dunkelblaue Jacke. Auch das lange blonde Haar hatten sie gemeinsam. Doch bei genauerem Hinsehen stellte ich fest, dass das Haar meiner Beifahrerin, ebenso wie ihre Jeans, nicht annähernd so nass war wie das von Claire. Und auch sonst stimmte damit etwas nicht. Es sah aus, als säße ihr ganzer Kopf irgendwie schief. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich eine Perücke vor der Nase hatte.
Ich brach das Schweigen. »Muss ich irgendwo abbiegen oder so?«
Das Mädchen nickte, zeigte mit dem Finger. »Bis zur zweiten Ampel, dann links.«
»Alles klar.« Nach einer Pause fragte ich sie. »Geht’s dir wieder besser?«
Ein Nicken.
»Du warst so lange weg, dass ich mir schon Sorgen gemacht habe. Hätte ja sein können, dass du doch nicht so fit bist, wie du dachtest.«
»Mir geht’s gut«, sagte sie leise.
Plötzlich blendete mich etwas im Rückspiegel, obwohl es Nacht war. Wieder hoch angesetzte Scheinwerfer.
»Du hast mir vorhin gerade erzählt, wie du meinen Sohn kennengelernt hast.«
»Hmmm?«
»Ich habe mich nur gefragt, wo das passiert ist. Wo er dich mit Eis bekleckert hat.«
»Oh«, machte sie und blickte jetzt nicht mehr aus dem Fenster, sondern nach rechts unten, aber immer noch so, dass ihr Gesicht seitlich von der Perücke verdeckt wurde. »Ach ja, da im Galleria-Einkaufszentrum, wo die ganzen Restaurants sind. Das war lustig. Ich bin ihm buchstäblich in die Arme gelaufen. Er hatte ein Eis in der Hand, und der oberste Teil ist ihm von der Waffel gerutscht und auf meinem Oberteil gelandet.«
»Na so was«, sagte ich. Wir standen an der Ampel, bei der ich links abfahren sollte. Der Wagen, der vorhin hinter uns war, stand jetzt neben uns, auf der Spur, die geradeaus führte. Es war ein Geländewagen, kein Pick-up wie der, den ich auf dem Parkplatz von Iggy’s gesehen hatte.
Bevor es grün wurde, sagte ich ruhig zu ihr. »Wie lange willst du das noch weitermachen?«
»Häh?« Beinahe hätte sie mir das Gesicht zugewandt.
»Dieses Theater. Wie lange willst du noch so tun, als wüsste ich nicht, dass du nicht Claire bist?«
Jetzt sah sie mich an, antwortete aber nicht. Ich spürte sofort, dass sie Angst hatte.
»Netter Versuch«, sagte ich. »Das Haar, die Klamotten, alles recht überzeugend. Aber Claire hatte einen Kratzer an der linken Hand. Den hatte sie sich gerade erst bei Patchett’s eingefangen.«
»Der Kratzer spielt keine Rolle«, sagte das Mädchen leise. »Es sollte nur aus der Ferne funktionieren. Für die Nähe war es nie gedacht.«
»Wovon redest du?«
Sie biss sich auf die Unterlippe. »Tun Sie einfach so, als ob Sie glauben, ich bin Claire, ja? Benehmen Sie sich ganz normal.«
»Warum? Glaubst du, wir werden beobachtet?« Ich hob eine Hand, eine Geste, die die Welt um uns herum einschloss. »Dass uns jemand per Satellit überwacht?«
»Da war vorhin ein Pick-up. Das war er vielleicht. Könnte aber auch jemand anderes gewesen sein.«
Ich verstand, warum sie glaubte, sie käme damit durch. Zu ihren Füßen stand auch eine überdimensionale Handtasche. Sie musste also mit einer ähnlichen roten Tasche wie Claire zum Wagen gegangen sein. Vielleicht war es sogar dieselbe.
Ich hatte Claire nicht wirklich gut in Augenschein nehmen können, doch soweit ich das beurteilen konnte, sahen die beiden Mädchen sich recht ähnlich. Sie hatten so ziemlich denselben porzellanartigen Teint. Das Gesicht meiner jetzigen Beifahrerin war vielleicht eine Spur ovaler und ihre Nase ein bisschen länger als Claires. Aber von Größe und Körperbau her waren sie ungefähr gleich. Dünn, knapp eins siebzig. Aus der Ferne konnte man in einer dunklen, regnerischen Nacht die eine ohne weiteres für die andere halten, insbesondere mit der Perücke, der ähnlichen Kleidung, einer fast identischen Tasche. Hätten sie sich als Schwestern ausgegeben, ich hätte es ihnen abgenommen. Also fragte ich nach.
»Seid ihr Schwestern?«
»Was? Nein.«
»Ihr seht aber so aus«, sagte ich. »An deiner Frisur müsstest du allerdings noch arbeiten. Die will nicht so richtig.«
»Was?«
»Die Perücke. Sie sitzt schief.« Sie machte sich daran zu schaffen. »Jetzt ist es besser. Das kommt Claires Haaren schon sehr, sehr nahe. Wirklich nicht schlecht.«
»Die hat sie aus einem Halloween-Laden in Buffalo«, sagte das Mädchen. »Bitte fahren Sie mich einfach zu Claires Haus, so wie Sie’s vorhatten. Es ist nicht weit.«
»Ich möchte nur verstehen, was hier gespielt wird. Du musst auf der Toilette auf sie gewartet haben. Sie geht rein, du kommst raus, in ziemlich ähnlichen Klamotten. Du bist zur Seitentür rausgegangen, als ich vorne reinkam. Ich habe in der Damentoilette nachgesehen.« Sie sah mich erschrocken an. »Hat Claire sich da versteckt, bis wir zwei weggefahren sind?« Ich stellte mir vor, wie sie auf dem Toilettenbecken stand, damit man ihre Füße in dem Spalt unter der Tür nicht sah. Ich hätte nicht nur die erste, sondern auch die zweite und dritte Kabine kontrollieren sollen.
»Schon möglich«, sagte meine Beifahrerin mürrisch.
»Die Idee war also, dass der Typ, der Claire verfolgt hat, sich an dich hängt? Und Claire jetzt tun und lassen kann, was sie will, ohne dass ihr Verfolger irgendwas davon mitkriegt.«
»Wow«, sagte sie. »Sie sind ja genial.«
»Zoff mit dem Freund?«, fragte ich.
»Häh?«
»Jemand stellt Claire nach? Sie will ihn abschütteln und sich mit dem Neuen treffen?«
Das Mädchen schnaubte leise. »Ja, klar, genau darum geht’s.«
»Aber du hast gesagt, es könnte auch jemand anderes sein. Gibt es mehr als einen, der hinter ihr her ist?«
»Hab ich das gesagt? Kann mich nicht erinnern.«
»Wie heißt du?«
»Spielt keine Rolle.«
»Na gut, keine Namen. Wenn’s nicht um den Freund geht, worum denn dann?«
»Hören Sie, machen Sie sich keine Gedanken. Das Ganze geht mich nichts an, und Sie geht es erst recht nichts an.«
»Steckt Claire in Schwierigkeiten?«
»Hören Sie, Mister – Mr. Weaver, oder? Claire hat gesagt, Sie sind der Vater von Scott.«
Ich nickte. »Du kanntest Scott also auch?«
»Klar. Jeder kannte Scott. Irgendwie.«
»Kanntest du ihn gut?«
»Ein bisschen. Also hören Sie, ich weiß überhaupt nichts. Klar? Lassen Sie mich einfach aussteigen. Egal, wo. Hier. Vergessen Sie, was passiert ist. Es geht Sie nichts an.«
Ich beobachtete die Scheibenwischer, die sich rhythmisch hin und her bewegten. »Und ob es mich was angeht. Du und Claire, ihr habt mich da hineingezogen.«
»War aber keine Absicht, klar?«
»Sollte jemand anderes Claire vor Patchett’s abholen? Der ist dann aber nicht aufgetaucht, und deshalb hat Claire sich von mir mitnehmen lassen? Wer hat sie bei Iggy’s abgeholt?«
»Halten Sie an.«
»Ach, komm. Ich kann dich doch nicht hier rauslassen. Mitten in der Pampa.«
Sie löste den Gurt und langte nach dem Türgriff. Wir fuhren ungefähr fünfzig. Ich rechnete nicht damit, dass sie die Tür wirklich öffnen würde, doch genau das tat sie. Nur ein paar Zentimeter, aber genug, um einen gewaltigen Luftzug zu erzeugen.
»Herrgott!«, schrie ich und versuchte, über sie hinweg den Türgriff zu erreichen. Es gelang mir nicht. »Mach zu!«, brüllte ich sie an. Sie gehorchte. »Bist du übergeschnappt, oder was?«
»Ich will aussteigen!«, schrie sie, dass mir die Ohren gellten. »Jetzt ist es sowieso egal! Claire hat’s geschafft, abzuhauen.«
»Abzuhauen? Wovor?«
»Halten Sie an und lassen Sie mich aussteigen! Das ist Menschenraub!«
Ich bremste und fuhr an den Straßenrand. Wir befanden uns in einer Gegend, in der Wohngebiet auf Gewerbegebiet stieß. Alte Häuser standen Seite an Seite mit Möbelbeizereien und Elektroläden. Direkt vor uns war eine Kreuzung, über der eine Ampel hing, die träge von Gelb zu Rot zu Grün wechselte und dann wieder von vorne anfing.
»Hör mal, ich kann dich hinfahren, wohin du möchtest«, sagte ich. »Du brauchst nicht auszusteigen. Es schüttet. Jetzt …«
Sie stieß die Tür auf, schwang ihre Beine aus dem Wagen und stürzte davon. Im letzten Moment packte sie ihre Tasche. Sie stolperte, berührte mit einem Knie das Gras, riss sich die Perücke vom Kopf und schleuderte sie in ein Gebüsch. Ihr eigenes Haar war auch blond, aber nur schulterlang, etwa um die Hälfte kürzer als das von Claire.
Von meinem Sitz aus konnte ich die Beifahrertür nicht erreichen, also stieg ich aus. Ich ließ den Motor laufen, ging um den Wagen herum und schlug die Tür zu.
»Bleib stehen!«, rief ich. »Komm schon! Keine Fragen mehr! Ich bring dich nach Hause!«
Sie blickte zurück, nur eine Sekunde, und hob eine Hand. Es sah aus, als halte sie ein Handy. Als wolle sie mir signalisieren, ich solle mir keine Sorgen machen, sie würde jemanden anrufen, der sie abholen konnte.
Ihre Füße patschten durch die Pfützen. An der Kreuzung bog sie rechts ab. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite gab es eine Fernseherreparaturwerkstatt, die den Eindruck machte, als sei sie schon seit Jahren geschlossen.
Ein unbehagliches Gefühl beschlich mich, als sie meinen Blicken entschwand. Regen lief mir in die Augen, tropfte mir in die Ohren.
Ich versuchte mir einzureden, dass sie recht hatte. Es ging mich nichts an. Es war nicht mein Problem.
Ich stieg wieder in den Wagen und wendete.
Fuhr an einem schwarzen Pick-up vorbei, der mit ausgeschalteten Lichtern auf der anderen Straßenseite parkte. Ich hatte ihn schon vorhin da stehen sehen, es aber wieder vergessen, als ich eine Vollbremsung hinlegen musste, um zu verhindern, dass das Mädchen aus dem fahrenden Wagen sprang.
Ich fuhr weiter. Doch der verdammte Pick-up ließ mir keine Ruhe. Nach weniger als einem Kilometer fuhr ich an den Straßenrand und sah in den Rückspiegel. Ich wendete erneut. Eine Minute später war ich wieder da, wo ich den Pick-up gesehen hatte.
Er war weg.
Ich ließ den Wagen an der Ampel ausrollen, sah nach vorne, nach links und nach rechts. Keine Spur von dem Pick-up. Und auch nicht von dem Mädchen.
Also wendete ich ein drittes Mal und machte mich auf den Heimweg.
Drei
Früher hätte ich, wenn ich nach so einem absurden Vorfall nach Hause gekommen wäre, als Erstes gesagt: »Du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist.«
Aber das war früher, und jetzt ist jetzt.
Es war schon fast halb elf, als ich heimkam. Um diese Zeit war Donna meistens schon im Bett, aber früher wäre sie heruntergekommen, wenn sie die Haustür auf- und wieder zugehen gehört hätte.
Zumindest hätte sie heruntergerufen: »Hey!«
Und ich hätte zurückgerufen: »Hey!«
Aber jetzt gab es kein »Hey!«. Nicht von ihr und nicht von mir.
Ich ließ meine Jacke auf die Bank neben der Haustür fallen und ging langsam in die Küche. Ich hatte, wie sooft, nichts zu Abend gegessen, doch in den letzten zwei Monaten hatte ich auch kaum Appetit gehabt. Meinen Gürtel musste ich jetzt zwei Löcher enger schnallen, damit mir die Hosen nicht hinunterrutschten. Und bei den seltenen Gelegenheiten, zu denen ich eine Krawatte trug, passten zwei Finger zwischen meinen Hals und den zugeknöpften Hemdkragen.
Um sechs hatte ich zuletzt etwas gegessen. Eine Tüte Kartoffelchips. Da saß ich im Auto und beobachtete die Hintertür eines Metzgerladens in Tonawanda. Der Inhaber verdächtigte einen seiner Mitarbeiter des Diebstahls. Von Ware, nicht Geld. Rinderbraten und T-Bone-Steaks waren immer viel schneller ausverkauft als erwartet, und der Mann war zu dem Schluss gekommen, dass ihn jemand übers Ohr haute, entweder sein Lieferant oder jemand direkt vor seiner Nase.
Ich fragte ihn, ob er seinen Angestellten irgendwann die Aufsicht über den Laden überließ. Während dieser Zeit parkte ich in einer Seitenstraße, von der aus ich den Hintereingang gut im Auge behalten konnte, und beobachtete das Kommen und Gehen dort.
Musste nicht lange warten.
Am späten Nachmittag, es fing schon an zu dämmern, da fuhr die Frau eines der Angestellten am Hintereingang vor und schickte vermutlich eine SMS. Sekunden später ging die Tür auf, und ihr Mann lief zu ihrem Fenster, eine fest zugebundene Mülltüte in der Hand. Sie nahm die Tüte, warf sie auf den Beifahrersitz und raste los, als hätte sie gerade einen Spirituosenladen ausgeraubt.
Ich machte ein paar Fotos mit dem Teleobjektiv, dann folgte ich ihr nach Hause. Beobachtete, wie sie den Beutel ins Haus trug. Noch besser wäre es gewesen, wenn ich mich an ein Fenster hätte schleichen und sie dabei fotografieren können, wie sie einen Braten in den Ofen schiebt. Aber auch bei meiner Arbeit gibt es Grenzen. Manchmal bleibt einem in meiner Branche nichts anderes übrig, als zum Voyeur zu werden, aber hier schien es mir nicht notwendig. Ich brauchte schließlich keinen Beweis, dass sie mit dem Abendessen fremdging.
Gut, ich war weder dem Malteser Falken noch verschwundenem Plutonium auf der Spur. In der wahren Welt hat ein Privatdetektiv es mit gestohlenen Lebensmitteln oder Baumaterial oder Benzin oder Autos oder Kleinlastern zu tun. Vor einiger Zeit hatte ich das Geheimnis der geraubten Zedernsetzlinge gelüftet, die jedes Mal verschwanden, wenn der Besitzer sie wieder neu gepflanzt hatte.
Wer bestohlen wird, möchte nicht nur sein Zeug wiederhaben – er möchte auch wissen, wer’s ihm gestohlen hat. Die Polizei hat zu viel Arbeit und zu wenig Personal, um bei solchen Delikten zu ermitteln. Ein zufälliger Diebstahl, irgendeine einmalige Sache, das ist auch für mich eine harte Nuss, aber wenn es ein Muster gibt, wenn jemand das Opfer einer Serie von richtig nervigen Attacken wird, dann kann ich ihm mit einiger Wahrscheinlichkeit helfen. Denn ich habe Zeit, mich auf die Lauer zu legen, bis der Mistkerl wieder zuschlägt.
Dazu braucht man nicht das Hirn eines Nobelpreisträgers, sondern Sitzfleisch und die Fähigkeit, wach zu bleiben.
Mit der Suche nach Menschen ist es nicht viel anders. Ehemänner und Ehefrauen, Söhne und Töchter verschwinden genauso oft wie Steaks und Steinplatten oder Treibstoff und Trucks. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass Dinge oft schmerzlicher vermisst werden als Menschen. Wird einem Mann der Truck geklaut, will er ihn wiederhaben, gar keine Frage. Der notorisch untreue, gewalttätige, versoffene Ehemann jedoch, der eines Abends den Heimweg nicht mehr findet, gilt einer Frau vielleicht als Zeichen, dass es das Schicksal doch gut mit ihr meint.
Mit uns hatte das Schicksal es in letzter Zeit nicht sehr gut gemeint.
Ich holte mir ein Bier aus dem Kühlschrank, ging ins Wohnzimmer und ließ mich wie ein nasser Sack in einen Ledersessel fallen. Auf dem Couchtisch entdeckte ich ein paar aus einem Zeichenblock herausgerissene Blätter. Es waren lauter Porträts von Scott. Ein Profil, ein Dreiviertelprofil und noch ein drittes, eine Frontalansicht, wie ein Passfoto. Neben den Skizzen lagen mehrere gespitzte Kohlestifte in verschiedenen Härten. Außerdem stand da noch ein Behälter, etwa so groß wie eine Dose Rasierschaum für unterwegs. Es war der Fixierspray, den Donna benutzte, um zu verhindern, dass die Kohle verschmierte, sobald sie mit einer Zeichnung so weit gekommen war, wie es ihr möglich war – fertig wurde sie nie damit, weil es immer irgendetwas gab, das für sie nicht stimmte. Zeichnungen, die ihrer Meinung nach unserem Sohn nicht gerecht wurden, warf Donna nicht weg, sondern hob sie auf, um daraus das, was sie für gelungen hielt, in späteren Versuchen verwenden zu können. In der Luft hing ein chemischer Geruch, der einem den Atem nehmen konnte, ein Indiz, dass sie den Spray erst vor kurzem benutzt hatte.
Das war Donnas Bewältigungsstrategie. Bilder von unserem Sohn zu zeichnen, manche aus dem Gedächtnis, manche nach Fotos. Überall im Haus stieß ich auf sie. Hier, im Wohnzimmer, in der Küche, neben ihrem Bett, in ihrem Wagen. Ein paar Tage lang klebte eines im Bad auf dem Spiegel, das sie sich beim Schminken immer wieder ansah. Ich fand, dass sie Scott darauf fast perfekt getroffen hatte, und offenbar war auch sie dieser Meinung. Doch schließlich nahm sie es ab und steckte es zu den anderen, die vor ihrer Kritik nicht bestehen konnten.
»Ich fand das wirklich gelungen«, sagte ich.
»Die Ohren waren falsch«, sagte sie.
In diesen Tagen konnte das bereits als ein längeres Gespräch durchgehen.
Diese fixe Idee, das perfekte Abbild unseres Jungen zu schaffen, war bestimmt nicht gut für Donna. Oder mich. Vermutlich hätte ich das anders gesehen, wenn sie sich stattdessen an den Computer gesetzt und ihre Trauer durch das Schreiben von Gedichten und Erinnerungen verarbeitet hätte. Sich auf diese Weise mit dem auseinanderzusetzen, was geschehen war, wäre unauffälliger gewesen, hätte mich nicht mit hineingezogen, es sei denn, sie hätte mir ihre Sachen zum Lesen gegeben. Aber an den Skizzen kam ich nicht vorbei. Sie lagen da. Für sie mochten sie eine therapeutische Wirkung haben, für mich waren sie eine ständige Erinnerung an das, was wir verloren hatten. Und an unser Versagen. Dass so viele der Zeichnungen unvollendet – und unvollkommen – waren, machte nur umso deutlicher, in welcher Bedrängnis Scott sich befunden hatte.
Selbstverständlich war auch Donna nicht besonders glücklich darüber, wie ich mit meinem Kummer umging.
Unter einer Zeichnung von Scott, auf der ein Auge nicht fertig war, fand ich die Fernbedienung. Ich schaltete den Flachbildschirm ein, reduzierte die Lautstärke und parkte den Daumen auf der Programmtaste. Was für einen Haufen Kanäle es mittlerweile gab. Mit nichts als Essen oder Golf oder Wiederholungen uralter Unterhaltungsserien. Was erwartete uns noch? Der »Mensch ärgere dich nicht«-Kanal? In weniger als fünf Minuten klickte ich mich durch zweihundert Sender und fing dann wieder von vorne an.
Es fiel mir immer schwerer, meine Gedanken zu sammeln. Meine eigene Diagnose für meinen Zustand lautete: PT-ADS. Posttraumatisches Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren, weil ich eigentlich immer nur an eines dachte. Meinem Beruf konnte ich gerade noch nachgehen, doch es war immer da, dieses Hintergrundrauschen.
Zu guter Letzt blieb ich bei den Nachrichten von einem der Sender aus Buffalo.
Drei Menschen waren vor einem Spirituosenladen in Kenmore ausgeraubt worden. Ein Mann aus West Seneca hatte seinen Pitbull auf eine Frau gehetzt, die anschließend mit dreißig Stichen genäht werden musste. Der Hundebesitzer sagte der Polizei gegenüber, die Frau habe ihn »komisch angesehen«. In Cheetowaga hatte ein Mann auf einem Fahrrad im Vorüberfahren dreimal auf ein Haus geschossen und dabei einen Mann in die Schulter getroffen, der auf seinem Sofa saß und sich eine alte Folge von Alle lieben Raymond ansah. Zwei Männer mussten ins Erie County Medical Center eingeliefert werden, weil auf sie geschossen worden war, als sie eine Bar verließen. Eine Genossenschaftsbank in der Main Street war von einem Mann überfallen worden, der dem Kassierer einen Zettel in die Hand gedrückt hatte, auf dem stand, er habe eine Waffe, obwohl keine zu sehen gewesen war. Und als ob das noch nicht genug wäre, suchte die Polizei von Buffalo nach drei Jugendlichen, die hinter einem Haus in der LaSalle Avenue auf einen Vierzehnjährigen eingestochen, ihn anschließend mit Benzin übergossen und ein brennendes Streichholz auf ihn geworfen hatten. Der Junge war schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, doch seine Überlebenschancen wurden als äußerst gering eingeschätzt.
Und das waren nur die Meldungen des heutigen Tages.
Ich schaltete den Fernseher ab und überflog die Buffalo News von heute, die in dem Rattan-Zeitungsständer neben dem Sessel steckte und offensichtlich von Donna bereits durchgeblättert worden war. Auf der Seite, die über umliegende kleinere Städte berichtete, befasste sich ein Artikel mit der Frage, ob unsere Polizei beim Griffon Jazz Festival im August überreagiert hatte. Damals hatte eine Handvoll junger Schläger von außerhalb die Veranstaltung gestört und Erfrischungen aus dem Bierzelt geklaut. Angeblich wurden sie dabei von einigen Polizisten aus Griffon überwältigt, jedoch nicht des Diebstahls beschuldigt und in Gewahrsam genommen, sondern in zwei Wagen verfrachtet und außerhalb der Stadt einer Behandlung unterzogen, bei der sie einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Zähnen verlustig gingen.
Der Bürgermeister, ein Mann namens Bert Sanders, hatte es zu seiner Hauptaufgabe gemacht, Polizeiexzesse einzudämmen, bekam dafür aber nicht viel Unterstützung, weder vom Rest des Stadtrats noch von den braven Bürgern der Stadt. Diesen Herrschaften war es nämlich herzlich egal, wie viele Zähne Störenfriede von außerhalb einbüßten, Hauptsache, in ihrer Stadt ging es nicht zu wie in Buffalo.
Von Buffalo brauchte man nicht einmal eine Stunde nach Griffon, einer Stadt mit ungefähr achttausend Einwohnern, deren Zahl sich auf das Drei- bis Vierfache aufblähte, wenn im Sommer die Touristen kamen, um ihre Boote zu Wasser zu lassen, im Niagara River zu angeln, die verschiedenen Wochenend-Festivals, wie ebenjene Jazz-Veranstaltung, zu besuchen oder in den kleinen Kuriositätenläden im Zentrum einzukaufen, die sich gegen Großhandelsketten wie Costco und Walmart und Target im Westen des Staates New York behaupten mussten, die ihnen die Kundschaft abspenstig machten.
Wir hatten jetzt Ende Oktober, Griffon war also wieder in seinen gewohnten Dornröschenschlaf gefallen. Über Kriminalität mussten wir uns keine Gedanken machen. Haustüren wurden abgesperrt – wir waren ja nicht blöd –, aber es gab keine Gegend in der Stadt, in die man sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht hätte wagen dürfen. Schaufenster wurden nach Geschäftsschluss nicht mit Rollbalken verbarrikadiert. Es gab keine Hubschrauber, die uns um drei Uhr nachts mit Suchscheinwerfern den Schlaf raubten. Trotzdem blieb ein gewisses Unbehagen wegen der Nähe zu Buffalo, wo die Rate der Gewaltverbrechen grob geschätzt dreimal so hoch war wie der nationale Durchschnitt und die Stadt deshalb regelmäßig einen Platz unter den Top 20 der gefährlichsten Städte Amerikas belegte. Es herrschte eine unterschwellige Angst, dass jederzeit wilde Horden aus dem Süden wie marodierende Zombies bei uns einfallen und unserem mehr oder weniger beschaulichen Dasein ein Ende setzen könnten.
Und aus diesem kühlen Grunde ließen die Bürger von Griffon ihrer Polizei gerne eine gewisse Ellbogenfreiheit. Der Vorsitzende des Unternehmerverbandes forderte alle Einwohner auf, ihre Solidarität mit der örtlichen Polizei zu bekunden. Die Geschäfte im Zentrum der Stadt wurden gedrängt, Unterschriftenlisten auszulegen. Jeder, der sich dort eintrug, könnte dann nicht nur mit dem guten Gefühl nach Hause gehen, ein kleines Zeichen der Dankbarkeit für den Einsatz der Polizisten gesetzt zu haben, sondern sich damit auch fünf Prozent Rabatt auf seinen Einkauf sichern. Auf den Listen prangte die stolze Überschrift: JA ZU EINEM SICHEREN GRIFFON! JA ZU UNSERER POLIZEI!
Nicht, dass in Griffon eitel Sonnenschein herrschte. Auch wir hatten unsere Probleme. Griffon war keine Insel der Seligen.
Es gab keine Inseln der Seligkeit mehr.
Ich betrachtete ein Foto, das mir gegenüber im Bücherregal stand. Donna und ich, Scott in der Mitte. Da war er dreizehn gewesen. Kurz bevor er in die Highschool gekommen war.
Vor dem Sturm.
Er lächelte, war aber sorgsam bemüht, seine Zähne dabei nicht zu zeigen. Erst zwei Wochen davor hatte er eine Zahnspange bekommen, und er genierte sich. Gefangen in den Armen seiner Eltern, wirkte er verlegen, vielleicht sogar peinlich berührt. Andererseits, in diesem Alter war einem doch so ziemlich alles peinlich, oder? Eltern, Schule, Mädchen. Das Bedürfnis, dazuzugehören, wie die anderen zu sein, war eine viel stärkere Triebkraft als das Verlangen, in der Mathearbeit eine Eins zu kriegen.
Er hatte immer nach einem Weg gesucht, zu sein wie die anderen, doch es gelang ihm nicht, sich entsprechend zu verbiegen.
Er war ein Exzentriker, auf seinem iPod hätte man wohl eher Beethoven als Bieber gefunden. Ihm gefiel so gut wie alles, was gemeinhin als klassisch bezeichnet wurde. Musik, Filme, sogar Autos. Der vorhin erwähnte Malteser Falke hing als Poster bei ihm an der Wand, und in seinem Bücherregal stand das Modell eines 57er Chevrolet Bel Air. Bei den Klassikern der Literatur zog er allerdings eine säuberliche Trennlinie. Während er sämtliche Graphic-Novel-Klassiker, von Black Hole über Walzer mit Bashir und Die Rückkehr des Dunklen Ritters bis hin zu Maus und Die Wächter, sein Eigen nannte, machte er um 400-Seiten-Romane einen großen Bogen. Die Ärzte meinten, das sei möglicherweise auf eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung zurückzuführen – zweifellos eine beeindruckende klinische Diagnose. So richtig überzeugt war ich von dieser blumigen Umschreibung jedoch nicht.
Abgesehen von den Graphic Novels hatte er kaum gemeinsame Interessen mit Jugendlichen seines Alters. Die Buffalo Bills – die in dieser Gegend geradezu Kultstatus besaßen – ließen ihn kalt. Und er hätte sich eher die Augen ausgestochen, als sich die Irrungen und Wirrungen der Tieftoilettentaucher von Jersey Shore, unterbeschäftigter Hausfrauen, zwangsgestörter Messies oder sonstige Serien anzusehen, denen seine Altersgenossen verfallen waren. Die mit den vier weltfremden jungen Wissenschaftlern bereiteten ihm allerdings großes Vergnügen, vielleicht sogar einen gewissen Trost. Sie gaben ihm Hoffnung, dass man uncool und doch cool sein konnte. Sosehr ihm daran lag, Freunde zu gewinnen, so wenig war er geneigt, deswegen Interesse an Dingen zu heucheln, für die er nichts übrighatte.
Doch dann, vorletzten Sommer, fand in Griffon wieder einmal ein Konzert statt. Diesmal traten auch mehrere alternative Bands auf, und Scott freundete sich mit zwei Jungs an, die, genau wie er selbst, für Massenkultur nur Verachtung übrighatten. Diese neuen Freunde, die aus der Gegend von Cleveland kamen und hier nur Urlaub machten, waren der Ansicht, es sei einfacher, sich über seine Umwelt lustig zu machen, wenn man sich die Hucke vollsoff oder -kiffte. Da waren sie wohl nicht die Ersten.
Scott hatte bestimmt schon früher Gelegenheit gehabt, mit Alkohol und Drogen zu experimentieren – Eltern, die glauben, da, wo ihre Sprösslinge leben, kommen sie an solche Rauschmittel nicht heran, glauben wahrscheinlich auch an den Weihnachtsmann –, aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte er uns nie Anlass zu der Vermutung gegeben, dass er es auch tat. Damals war es ihm noch wichtig gewesen, seinen Eltern keinen Kummer zu bereiten. Doch aus diesem Alter war er langsam heraus. Freunde zu haben zählte mehr, als Papa und Mama glücklich zu machen.
Durchaus keine ungewöhnliche Entwicklung.
Wir bemerkten gewisse Veränderungen in seinem Verhalten. Nichts Weltbewegendes. Ein bisschen mehr Geheimniskrämerei, aber welcher Teenager versucht nicht, seine Privatsphäre zu verteidigen? Allmählich jedoch wurde unser Vertrauen auf immer härtere Proben gestellt. Wir gaben ihm Geld und schickten ihn in die Drogerie, und er kam mit gerade mal der Hälfte der Dinge zurück, die er hätte besorgen sollen, dafür ohne Restgeld. Immer öfter vergaß und versäumte er etwas. Seine Noten wurden schlechter. Er behauptete, er hätte nichts auf, doch dann schrieben uns Lehrer, dass er seine Hausaufgaben nicht machte. Oder gleich gar nicht zum Unterricht erschien. Dinge, die ihm einmal lieb und wert gewesen waren – ehrlich zu uns zu sein, Wort zu halten, zur vereinbarten Zeit zu Hause zu sein –, hatten anscheinend keine Bedeutung mehr für ihn.
Ich kam gar nicht auf die Idee, sein verändertes Verhalten mit Alkohol und Gras in Verbindung zu bringen. Es gab nicht den Moment, in dem mir dämmerte, dass diese Drogen unserem Sohn den Verstand getrübt, ihn gegen uns aufgebracht hatten. Ich schob es auf sein Alter. Darauf, dass er dazugehören wollte. Scott hatte sich mit Jungs verbrüdert, für die Saufen und Kiffen das Normalste von der Welt war. Und als die beiden Ende des Sommers nach Ohio zurückfuhren, war es auch für unseren Sohn das Normalste von der Welt geworden.
Wir beteten, dass das Ganze nur eine Entwicklungsphase war. Jugendliche probieren eben alles Mögliche aus. Wer trank nicht mal einen über den Durst, rauchte nicht den einen oder anderen Joint zu viel? Trotzdem redeten wir darüber – und nicht nur einmal –, wie wir uns verhalten sollten. Wie wir eine kluge Entscheidung treffen konnten. Mein Gott, was für ein Schwachsinn. Einen Tritt in den Hintern zur rechten Zeit und Stubenarrest, bis er zwanzig war, das hätte der Junge gebraucht.
Und das hätte er wohl auch bekommen, wären wir klug genug gewesen zu erkennen, dass er bald auf härtere Sachen umsteigen würde.
Denn es war weder Bier noch Hasch, was sie bei der Autopsie in seinem Blut fanden.
Donna und ich, wir redeten und redeten, wie ihm am besten zu helfen sei. Mit einer Therapie. Der Teilnahme an einem Entwöhnungsprogramm. Viele Nächte schlugen wir uns vor dem Computer um die Ohren, recherchierten im Internet, lasen die Geschichten anderer Eltern, entdeckten, dass wir nicht allein waren. Ein großer Trost war uns das nicht. Wir wussten immer noch nicht, wie wir die Sache angehen sollten. Wir griffen zu den üblichen Mitteln, mit wechselnder Intensität, aber gleichbleibendem Misserfolg. Wir schrien rum. Verhängten Hausarrest. Versuchten es mit emotionaler Erpressung. Mit Aussicht auf Belohnung im Falle einer Besserung. »Wenn du die Mathearbeit schaffst, kriegst du einen neuen iPod.« Appellierten an sein Gewissen. Ich sagte ihm, sein Verhalten brächte seine Mutter noch ins Grab. Donna sagte ihm, sein Verhalten brächte seinen Vater noch ins Grab.
Aber irgendwie müssen wir – ich jedenfalls, das weiß ich – auch daran geglaubt haben, dass das Ganze doch nicht so schlimm war. Schon schlimm, aber nicht hoffnungslos. Millionen Teenager gerieten vorübergehend ins Schleudern und kriegten dann doch die Kurve. Ich habe mich in meiner Jugend zwar nicht oft zugedröhnt, aber der wöchentliche Vollrausch war doch ein Ziel, das ich beharrlich anstrebte. Irgendwie hab ich’s überlebt.
Wir logen uns in die eigene Tasche.
Wir waren dumm.
Wir hätten mehr tun sollen, und wir hätten es früher tun sollen. Diese Einsicht nagte an mir. Tag für Tag. Und ich wusste, sie nagte auch an Donna. Jeder von uns machte sich Vorwürfe, und manchmal machten wir einander Vorwürfe.
Warum hast du nichts getan?
Ich? Warum hast du denn nichts getan?
Im Grunde meines Herzens glaubte ich, dass ich mir mehr Vorwürfe machen musste. Scott war ein Junge. Ich war sein Vater. Hätte ich nicht irgendwie zu ihm durchdringen müssen? Hätte ich nicht einen Zugang zu ihm finden müssen, der Donna verwehrt blieb? Hätte ich mit meiner Erfahrung aus meinem früheren Beruf nicht in der Lage sein müssen, ihm Vernunft beizubringen?
Fast zwei Stunden verbrachte ich damit, Zeitung zu lesen, ohne was davon aufzunehmen. In die Glotze zu schauen, ohne mitzubekommen, was da lief. Mein Bier auszutrinken und in die Küche zu gehen, um mir ein neues zu holen. Und dann wieder von vorne anzufangen. Bis dahin würde Donna hoffentlich wirklich eingeschlafen sein und nicht nur so tun müssen, als ob.
Als ich nach oben ging, war nur noch das Licht im Bad an. Selbst wenn ich früher hochgekommen wäre, hätte Donna die Augen zugehabt, aber wirklich geschlafen hätte sie nicht. Man lebt nicht zwanzig Jahre mit jemandem, ohne unterscheiden zu können, ob er schlief oder nur so tat. Aber im Grunde war es egal. Ich würde sie sowieso nie darauf ansprechen. Das war jetzt das Spiel, das wir spielten: Ich tu so, als ob ich schlafe, damit du kein schlechtes Gewissen haben musst, weil du nicht mit mir redest.
Ich zog mich im Bad aus, putzte mir die Zähne, machte das Licht aus und schlüpfte leise neben ihr unter die Decke, mit dem Rücken zu ihr. Wie lange das wohl so weitergehen würde? Und wie würde es enden? Gab es irgendetwas, das uns helfen konnte, diesen toten Punkt zu überwinden?
Ich liebte sie noch immer. So wie am ersten Tag.
Doch wir redeten nicht miteinander. Wir fanden die richtigen Worte nicht. Es gab nichts zu sagen, denn es gab nur eins, an das wir beide dachten, und es tat zu weh, darüber zu reden.
Ich stellte mir vor, wie ich den ersten Schritt machte. Mich umdrehte, näher an sie heranrutschte, meinen Arm um sie legte. Ohne etwas zu sagen, zumindest am Anfang nicht. Sie einfach nur zu halten und die Wärme ihres Körpers zu spüren. Ihr Haar in meinem Gesicht.
Stellte es mir so intensiv vor, dass es mir schon vorkam, als täte ich es wirklich.
Ich lag lange wach. Starrte an die Decke. Oder auf den Digitalwecker auf dem Nachttisch. Ein Uhr morgens. Zwei Uhr morgens.
Es war nicht nur unsere Schuld.
Nicht alles.
Auch Scott hatte Schuld. Klar, er war ein Teenager, aber er war alt genug. Er hätte es besser wissen müssen.
Und es gab noch jemanden. Nicht die Typen aus Cleveland. Nicht die jungen Leute aus Griffon, die Scott vielleicht Marihuana und Alkohol verkauft hatten.
Ich wollte den Kerl finden, der ihm das 3,4-Methylendioxymethylamphetamin gegeben hat. Das Zeug, das auf der ganzen Welt als Ecstasy bekannt ist.
Das, was im toxikologischen Bericht stand.
Das Gift, das Scott offensichtlich glauben gemacht hatte, er könne fliegen.
Ich würde ihn aufspüren, den Typen, der diese letzte, tödliche Dosis besorgt hatte.
Wir alle haben jede Menge falsch gemacht, aber für mich war es dieser Verbrecher, der die Katastrophe heraufbeschworen hatte.
Vier
Morgens kommt die Frau mit einem Tablett herein.
»Hey«, sagt sie zu dem Mann, der noch im Bett liegt.
Er stützt sich auf einen Ellbogen, begutachtet das Frühstück, das ihm die Frau auf den Nachttisch stellt.
»Rührei«, sagt er und beäugt den Teller beinahe argwöhnisch.
»So, wie du’s gern hast«, sagt sie. »Gut durch. Iss, bevor’s kalt wird.«
Er schiebt die Beine unter der Decke hervor und setzt sich auf die Bettkante. Er trägt einen ausgewaschenen weißen Flanellschlafanzug mit dünnen blauen Streifen. Die Knie sind fast durchgescheuert.
»Wie hast du geschlafen?«, fragt die Frau.
»Ganz gut«, sagt er, nimmt die Serviette und breitet sie sich über die Knie. »Ich hab dich gar nicht aufstehen gehört.«
»Ich bin gegen sechs aufgestanden, aber ich bin auf Zehenspitzen in der Küche herumgegangen, damit ich dich nicht wecke. Hast du dein Hobby aufgegeben?«
»Was? Was meinst du damit?«
»Wo ist denn dein kleines Buch? Normalerweise liegt es doch da.« Sie zeigt auf den Nachttisch.
»Ich schreib rein, wenn du draußen bist«, sagt er, stellt sich den Teller auf seinen Schoß und kostet von den Eiern. »Schmeckt gut.« Die Frau schweigt. »Willst du dich hersetzen?«
»Nein. Ich muss zur Arbeit.«
Er beißt in eine Scheibe Speck, dass es kracht. »Soll ich dir helfen?«
»Helfen? Wobei?«
»Bei der Arbeit. Ich könnte mitkommen und dir helfen.« Er kaut den Speck, schluckt ihn hinunter.
»Du bist durcheinander«, sagt sie. »Du gehst doch nicht zur Arbeit.«
»Früher schon«, sagt er.
»Genieß lieber dein Frühstück.«
»Ich könnte dir helfen, wirklich. Du weißt doch, Buchhaltung ist meine Stärke. Mir entgeht nichts.«
Die Frau seufzt. Wie oft sie dieses Gespräch wohl schon geführt hat? »Nein«, sagt sie.
Die Miene des Mannes verdüstert sich. »Ich möchte, dass es wieder so ist wie früher.«
»Wer will das nicht?«, sagt die Frau. »Ich möchte auch gern wieder einundzwanzig sein. Aber es gibt Wünsche, die gehen eben nicht in Erfüllung.«
Er bläst in seinen Kaffee, trinkt einen Schluck. »Wie ist es heute draußen?«
»Schön, glaub ich. Heute Nacht hat’s geregnet.«
»Ich würde gerne rausgehen, auch wenn’s regnet«, sagt der Mann.
Ihr reicht es. »Iss dein Frühstück. Ich hole nachher das Tablett.«
Fünf
Ich hatte mich mit Fritz Brott, dem Inhaber der Metzgerei Brott’s Brats, in seinem Laden in Tonawanda verabredet. Wir setzten uns in sein Büro im hinteren Teil der Metzgerei, um uns ungestört unterhalten zu können.