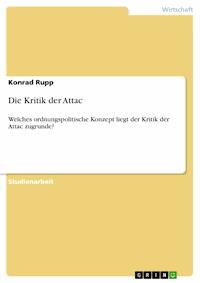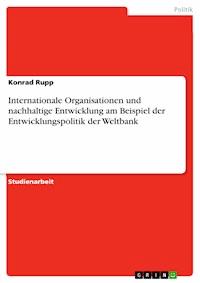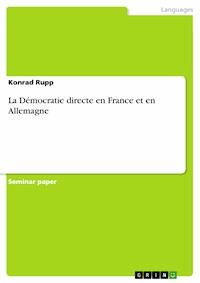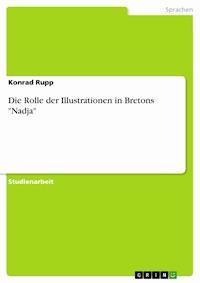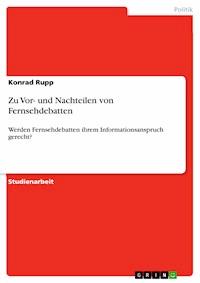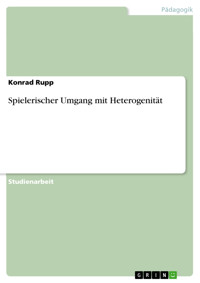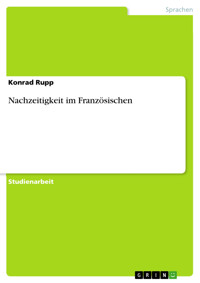
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Französische Philologie - Linguistik, Note: 2,3, Universität Stuttgart (Linguistik/Romanistik), Veranstaltung: Vergleichende Grammatik des Französischen und des Italienischen, Sprache: Deutsch, Abstract: In vielen Sprachen, wie zum Beispiel im Französischen, Italienischen oder auch im Deutschen, fällt auf, dass es im Vergleich zu den Vergangenheitstempora nur wenige Zeiten gibt, um Nachzeitigkeit auszudrücken. Da also die Verwendung des Futurs mehr oder weniger eindeutig scheint, gibt es auch wenig Forschungsliteratur darüber. Bei näherer Betrachtung wird jedoch schnell klar, dass mehr als nur die „reinen“ Zukunftstempora untersucht werden müssen, um Aussagen darüber treffen zu können, welche Möglichkeiten die Sprecher einer Sprache haben, um Zukünftiges auszudrücken. In besonderem Maße muss natürlich, bei Ermangelung formal festgelegter grammatischer Ausdrucksmöglichkeiten, der Fokus auf die Untersuchung der gesprochenen Sprache gelegt werden. Im Folgenden soll zunächst die diachrone Entwicklung der Futurtempora im Französischen dargestellt werden. Woraus haben sie sich entwickelt, wie lief diese Entwicklung ab? Dann wird auf Einzelheiten der Semantik und der Morphologie eingegangen werden. Abschließend erfolgt in synchroner Betrachtung ein Vergleich der Ausdrucks- und Verwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Tempora im Französischen. Welche Möglichkeiten gibt es, Nachzeitigkeit auszudrücken? Welche morphologischen, aber besonders, welche semantischen Unterschiede gibt es zwischen diesen Möglichkeiten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
2. Futur simple
2.1. Entstehung
2.2. Morphologie
2.3. Semantik
3. Futur périphrastique
3.1. Entstehung
3.2. Morphologie
3.3. Semantik
4. Présent futural
5. Vergleichende Betrachtung
6. Zusammenfassung und Ausblick
7. Literaturverzeichnis
Einleitung
In vielen Sprachen, wie zum Beispiel im Französischen, Italienischen oder auch im Deutschen, fällt auf, dass es im Vergleich zu den Vergangenheitstempora nur wenige Zeiten gibt, um Nachzeitigkeit auszudrücken. Da also die Verwendung des Futurs mehr oder weniger eindeutig scheint, gibt es auch wenig Forschungsliteratur darüber.[1]
Bei näherer Betrachtung wird jedoch schnell klar, dass mehr als nur die „reinen“ Zukunftstempora untersucht werden müssen, um Aussagen darüber treffen zu können, welche Möglichkeiten die Sprecher[2] einer Sprache haben, um Zukünftiges auszudrücken. In besonderem Maße muss natürlich, bei Ermangelung formal festgelegter grammatischer Ausdrucksmöglichkeiten, der Fokus auf die Untersuchung der gesprochenen Sprache gelegt werden. Hierbei sei kurz darauf hingewiesen, dass eine adäquate Untersuchung erst seit wenigen Jahrzehnten – seit der Erfindung der Tonbandaufnahme – möglich ist.[3]
Im Gegensatz dazu sind grammatikalisierte Formen des Futurs schon länger zu untersuchen. Trotzdem findet sich relativ wenig Literatur, die sich der Semantik der Futurtempora widmet. Abgesehen von quantitativen Analysen sind sehr wenige Werke erschienen, die die Besonderheiten und Unterschiede der Ausdrucksformen der Nachzeitigkeit ausreichend untersuchen. Vor allem die Betrachtung des Kontextes, in welchem das eine oder andere Tempus verwendet wird, ist nur unzureichend untersucht.[4]
Im Folgenden soll zunächst die diachrone Entwicklung der Futurtempora im Französischen dargestellt werden. Woraus haben sie sich entwickelt, wie lief diese Entwicklung ab? Dann wird auf Einzelheiten der Semantik und der Morphologie eingegangen werden. Abschließend erfolgt in synchroner Betrachtung ein Vergleich der Ausdrucks- und Verwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Tempora im Französischen. Welche Möglichkeiten gibt es, Nachzeitigkeit auszudrücken? Welche morphologischen, aber besonders, welche semantischen Unterschiede gibt es zwischen diesen Möglichkeiten ?
Leider kann im Rahmen dieser Seminararbeit nicht auf die modalen Ausdrucksmöglichkeiten der Zukunftstempora eingegangen werden, ebenso wenig wie auf eine quantitative Analyse. Des Weiteren muss der Kontext der Futurformen weitgehend unberücksichtigt bleiben.
2. Futur simple
2.1. Entstehung
Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass sich das Futur simple nicht – wie man annehmen könnte – aus dem lateinischen futurum simplex entwickelte, sondern aus einer lateinischen Verbalperiphrase. Es soll sich aus dem Verb im Infinitiv + habere entwickelt haben.[5] Gänzlich sicher ist sich die Forschung bei dieser Annahme allerdings nicht. Zwar wird inzwischen eine morphologische Erweiterung des synthetischen lateinischen Futurs zu den heutigen Formen ausgeschlossen, doch zum Beispiel das rumänische Futur, das wohl aus der Periphrase von Infinitiv + volere entstanden ist, wirft die Frage auf, ob dies nicht auch der Fall in den anderen romanischen Sprachen sei.[6]
Warum aber entwickelte sich überhaupt eine periphrastische Form aus dem synthetischen futurum simplex? Coseriu nennt zwei häufig thematisierte Gründe. Der erste mögliche Grund ist eher morphologischer Natur. Schon im klassischen Latein waren die Futurformen eine Art Schwachstelle, da sie „in den 4 Konjugationsklassen nach zwei verschiedenen Verfahren gebildet“[7] wurden und darüber hinaus „in der 1. Person Sing. mit dem Konjunktiv Präsens der 3. und 4. Konjugation“[8] zusammenfielen. Diese Unvollkommenheit wurde durch lautliche Veränderungen im Vulgärlatein, durch den Quantitätenkollaps und die daraus resultierenden Homophonien noch verstärkt. Demzufolge war also das Bedürfnis der Sprecher, sprachökonomisch sinnvoll zu handeln, der Grund für den Wandel von synthetischen zu periphrastischen Futurformen. [9]
Die zweite mögliche Erklärung nennt Coseriu „semantisch“[10]. Hierbei steht als Grund für den Wandel zu periphrastischen Futurformen das Bedürfnis, modale und affektische Werte des Futurs zu übermitteln – Werte, die nicht mit den synthetischen Formen zu transportieren waren. So sollte zum Beispiel die Motivation der zukünftigen Handlungen durch die Futurform ausgedrückt werden. Es war also wichtig, debeo, habeound volo + Verb unterscheiden zu können.[11] Anders ausgedrückt, stehen also „die kognitiven Kategorien
VERPFLICHTUNG und ZUKUNFT […] in Kontiguität zueinander“[12], weshalb sich der Bedeutungswandel vollzieht.Eine andere Interpretation dieses Bedürfnisses findet sich bei Vossler. Er geht davon aus, dass das einfache Volk den Sinn des Futurs nicht versteht, sich nicht einer subjektiven Sichtweise erwehren kann. Das heißt, der Sprecher situiert sich immer selbst zum Zukünftigen und somit wird dieses moduliert in die „Bereiche der Furcht und Hoffnung, des Wunsches und der Unsicherheit“[13]. Hierin sieht Vossler eine Abschwächung der Kategorie des Futurs.[14]