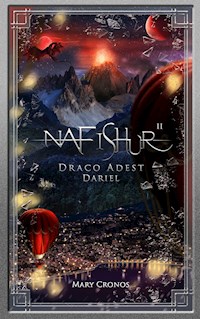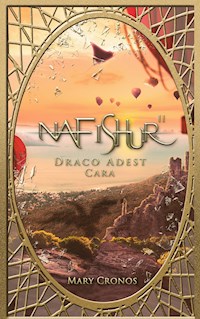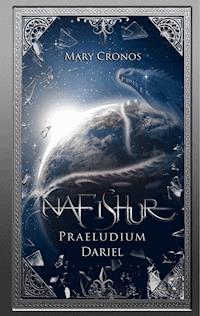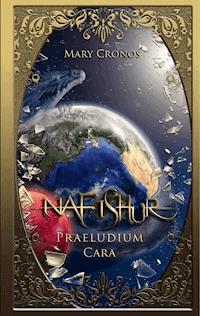
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Cara Clow wächst behütet und fröhlich am westlichen Stadtrand von Paris auf. Ihre Eltern lieben sie über alles und auch ihr kleiner Bruder vergöttert sie. Doch an ihrem achtzehnten Geburtstag soll sich alles ändern. Ein Überfall im Park, einige wenige Minuten, und alles ist vorüber. Sie ist allein. In dieser Nacht schwört sie sich, alles zu tun, was nötig ist, um ihre Familie zurückzubekommen. Was sie letztlich bekommt, ist eine neue Familie. Eine, wie sie verrückter nicht sein könnte und doch das normalste von all dem, was ihr in den kommenden Jahren widerfahren soll. Der erste Band der Reihe Nafishur ist das "Vorspiel" (Praeludium) zu einem Fantasy-Abenteuer, das Dariel, Cara und Ginga in eine Parallelwelt unserer eigenen führt: nach Nafishur. Erlebe die Geschichte aus Caras Sicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Da der Roman auch ohne diese Zeilen schon lang genug ist, möchte ich mich an dieser Stelle kurzfassen. Nur auf drei Kleinigkeiten sei hingewiesen:
Zum einen handelt es sich bei Nafishur um eine Geschichte, die aus zwei Perspektiven erzählt wird. Egal für welche Version du dich entscheidest: Auch mit einem Buch wirst du ein rundes Bild haben. Aber erst wer beide Geschichten kennt, wird Nafishur richtig kennenlernen und das eine oder andere Geheimnis etwas früher lüften. Wie bei einem gewissen Videospiel mit stets zwei Editionen habt ihr nun die Wahl mit einem Band zu leben, beide zu kaufen, zu tauschen oder in rege Diskussionen mit den Lesern der anderen Hälfte zu treten.
Zum Zweiten lade ich all meine Leser ein, die schwarz-weißen Pixelgrafiken, die sogenannten QR-Codes auszuprobieren. Dazu ist lediglich ein Smartphone nötig. Es gibt unzählige kostenlose Apps, die diese Codes durch simples Abfotografieren lesen können. Warum das ganze interessant sein könnte? Weil hinter jedem Code ein Link auf meine Website steckt; genaugenommen ein Link zu einer verborgenen Seite innerhalb meiner Website. Dort finden sich dann zusätzliche Informationen, Grafiken, Illustrationen, Grundrisse, Lagepläne, ungekürzte Versionen der Kapitel oder Kommentare von mir zu bestimmten Szenen. Das Beste: Die Inhalte der Links bleiben nicht beim Alten. Immer wieder gibt es Neues zu entdecken! Also probiert es aus!
Zu guter Letzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich zu bedanken. Die Liste derer, die meinen Dank verdienen ist lang: Chrissy und Keks, Miriam und Steph, Aicha und Jacqueline, Anja und auch Anika, Anna, Clari und Simone. Und vor allem meinen lieben Eltern.
Warum ich gerade diesen Menschen so unendlich dankbar für ihre Unterstützung bin? Das wäre der Stoff für einen weiteren Roman. Wer dennoch mehr wissen möchte, kann direkt den Trick mit dem QR-Code im Buch trainieren:
Und ich möchte mich bei all meinen Lesern bedanken und freue mich, euch nun die Hardcover-Version von Nafishur Praeludium anbieten zu können.
Und nun: Viel Spaß in Paris und gute Reise! Wir sehen uns in Nafishur!
Gewidmet
Annerose ›Mama‹ Schucklies
Ewige Quelle von Kraft und Liebe
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Wie viele Geheimnisse kann ein Mensch allein tragen? Mit jedem Geheimnis kommen auch immer Gefahr, Misstrauen und Angst. Ich wollte keine Angst mehr haben. Nicht um sie. Kein Äon an Ewigkeit war wertvoll genug, um sie gegen eine einzige Sekunde in ihrer Gegenwart zu tauschen. Ich war mir sicher: Er würde das verstehen und mir helfen. Er würde mich bei meiner Flucht unterstützen und mir Mut machen. In ihm war nichts Schlechtes, nur das pure Gute, keine Dunkelheit, nur Licht.
Nun wartete ich auf sein Kommen, auf seine Fragen und seinen gutmütigen Blick. Ich wartete darauf, ihm – meinem besten Freund und Vertrauten – sagen zu müssen, dass ich ihn verlassen würde. Unzählige Male ging ich meine Erklärungen und Begründungen im Kopf durch. Sie schienen mir plötzlich nicht mehr gut genug. War doch der einzig wahre Grund meine Liebe zu ihr.
Ich wollte Worte finden, die ihm zeigten, wie wichtig auch er mir war und dass ich ihn vermissen würde. Ich wollte, dass er erkannte, dass es dennoch keinen anderen Weg gab, als mich vergessen zu lassen. Ich durfte mich an nichts mehr erinnern. Ich musste zu einem normalen Menschen werden. Wie konnte ich sonst sichergehen, sein Geheimnis zu wahren – was auch immer geschehen würde? Wie sollte ich ihn und diese Welt sonst schützen? Wie …
Plötzlich verschwamm alles vor meinen Augen. Sein Arbeitszimmer. Der große, alte Schreibtisch vor mir. Die etwas verstaubte, stickige Luft … alles löste sich regelrecht auf. Meine gesamte Wahrnehmung schrumpfte auf eine einzige zusammen: Eine feste, warme Hand auf meiner Schulter. Dann fühlte ich, wie ich leichter wurde. Nach und nach glaubte ich zu schweben und dann zu fliegen, immer und immer höher zu steigen. War er das? Hatte er meine Gedanken erahnt? Oder gehört? Wie konnte man Gedanken hören? Wer war da überhaupt bei mir? Und wo war ich?
Frieden.
Ich spürte Frieden und Licht.
Ich bin frei.
Aber frei wovon?
»Bist du bereit?«
»Warum sollte ich nicht bereit sein?«
Trotzig sah mir meine Freundin Ginga entgegen. Ihre Arme hatte sie vor der Brust verschränkt, die Lippen waren fest aufeinandergepresst. Man sah ihr deutlich an, dass sie sich gerade an einen anderen Ort wünschte. Sie hatte mich in den vergangenen drei Jahren noch nie hierher begleitet.
Wir standen auf der schattigen, kleinen Holzterrasse eines der wenigen Einfamilienhäuser von Paris. Die alten Dielen knarrten leise unter uns. Es war Mai und die Sonne stand am späten Nachmittag noch immer viel zu hoch am Himmel. Ich war froh, dass wir nun hier im Schatten waren. Mit hochgezogener Braue spähte ich über die Sonnenbrille hinweg zu meiner Begleiterin. Sie stand direkt neben mir. Ihr rotes, unbändiges Haar schien selbst hier im Halbdunkel zu leuchten. Ihre grünen, stets wachsamen Augen blieben hinter ihrer Sonnenbrille verborgen. Auch sie war sicher erleichtert, dem unbarmherzigen Licht der Sonne nicht mehr ausgesetzt zu sein, aber ihr war diese Erleichterung momentan nicht anzusehen.
»Sie wird mir schon nicht den Kopf abbeißen«, fügte sie leise mit ihrem niedlichen Akzent hinzu. Ich wusste immer noch nicht genau, woher sie eigentlich stammte, aber es hatte zum Glück nicht lange gedauert, ihr Französisch beizubringen – bis auf ein paar kleinere Macken.
»Abreißen«, erwiderte ich also.
»Was? Ach, ist doch dasselbe!« Sie schnitt eine Grimasse, atmete tief durch und sah mich dann wieder mit einem ziemlich selbstbewussten Lächeln an. »Und wenn sie Glück hat, beruht das auf Gegenseitigkeit.«
»Ginga! DU wolltest unbedingt mitkommen! Jetzt reiß dich zusammen!«, zischte ich ihr nahezu lautlos zu und drückte auf den kleinen, bronzenen Klingelknopf um diese Unterhaltung zu beenden. Eine kurze, hübsche Melodie hallte durch das Haus.
»Ja klar wollte ich das! Ich lass dich doch nicht ausgerechnet heute alleine.« Ihre Antwort war ebenfalls nur ein Flüstern. Wir hatten beide die leisen, etwas trägen Schritte auf der anderen Seite der Tür vernommen. Dann hörten wir ein leises Klicken und die Tür schwang auf.
»Cara, mein Engel! Da bist du ja!« In der Tür lehnte eine kleine, zierliche Dame, die trotz ihres Alters nichts von ihrer Würde und Eleganz verloren hatte. Das weiße Haar trug sie zu einer komplexen Flechtfrisur geknüpft und aus ihrem von der Zeit gezeichneten, blassen Gesicht strahlten mir zwei silbergraue Augen entgegen. Sie hatten ein lebendiges Strahlen wie man es in einem so alten Gesicht niemals erwartet hätte. Ihre ganze Gestalt wirkte freundlich und warmherzig und unendlich vertraut. Wie sagte man so schön? Unsere Herzen waren miteinander verbunden.
Nicht umsonst nannte ich sie Großmutter und sie mich ihre Enkelin. ›Blut ist nicht alles, was zählt‹, pflegte sie immer zu sagen. Und letztlich war sie die einzige ›Verwandte‹, die ich noch hatte. Die einzige, die mich länger kannte als ich mich selbst. Und gerade heute ließ ich mich gern in ihre Arme ziehen.
»Mamé! Wie schön, dass es dir besser geht!«
Ihr Haar roch wie eine bunte Frühlingswiese in der Provence. Ich ließ meine Wahl-Großmutter nicht los und genoss den Duft und all die Erinnerungen, die mit ihm verbunden waren. Es waren lebendige und glückliche Erinnerungen an eine Kindheit, die viel zu früh einer bitteren Realität gewichen waren.
»Alles Liebe zum Geburtstag mein Engel! Und wie ich sehe, hast du noch eine Freundin mitgebracht! Kommt doch bitte rein, ihr zwei. Besuch von so hübschen, jungen Damen ist mir immer willkommen. Das weckt in mir neue Lebensgeister!«
Widerwillig lösten wir uns voneinander. Doch sie hielt weiter meine Hand, drückte sie leicht und bedachte mich mit einem Blick, der gleichermaßen Liebe und Ermutigung ausdrückte. Ich nahm rasch meine Sonnenbrille ab, um ihr nicht das Gefühl zu geben, in einen Spiegel zu schauen. »Mamé, das ist Ginga. Ginga, das ist Victoria. Meine … Großmutter.«
Beide lächelten sich an und ohne ein weiteres Wort zu verlieren betraten wir das Haus. Bildete ich mir die veränderte Stimmung nur ein? Ginga war doch sonst nicht so still … und Mamé nicht so kühl …
Doch bevor ich mir länger darüber Gedanken machen konnte, holten mich die Erinnerungen dieses Hauses ein. Das warme Licht, das von einem alten Kronleuchter ausging, verlieh dem Raum eine angenehme, wohlige Atmosphäre. Die Wände waren mit einer etwas altmodischen, verblichenen Tapete bezogen und hingen voller Bilder. All diese Erinnerungsfetzen ließen den kleinen Flur wie ein Museum wirken. Sie verrieten die Passion meiner Mamé für Fotografie und sie erzählten die Geschichte einer glücklichen Familie.
Es tat weh und es tat zugleich gut, all diese Bilder zu sehen. Einige davon hingen auch bei mir Zuhause, aber lange nicht so viele. Es war wie ein Ritual. Immer, wenn ich hier zu Besuch war, schritt ich alle Bilder ab, als wäre vielleicht ein neues hinzugekommen. Ich blieb vor jedem stehen und sah es einen Moment lang schweigend an. Die stolzen Eltern mit ihren Kindern, glücklich spielende Geschwister, Einschulungen, Gruppenbilder. Bei dem von einem glücklichen Brautpaar blieb ich auch an diesem Tag wieder am längsten stehen. Die Braut hatte ebenso langes, schwarzes Haar wie ich. Es bildete einen starken Kontrast zu dem weißen Brautkleid, der blassen Haut und den roten, lächelnden Lippen. Wie Schneewittchen ... Sie war ein Abbild meines älteren Ichs. Nur hübscher. Der Bräutigam daneben, der auf dem Bild gerade die Hand seiner Braut küsste, sah nicht minder selig aus. Er hatte dieses verliebte Leuchten in seinen Augen und seine Lippen zeichnete ein verschmitztes Lächeln. Seine haselnussbraunen Augen fanden sich auch in meinem Gesicht wieder. Als ich spürte, wie sich mein Blick durch Tränen verschleierte, löste ich ihn schweren Herzens von meinen Eltern. Ich blinzelte einige Male, dann sah ich wieder den Flur vor mir. Und den prüfenden Blick meiner Mamé auf Ginga. Oder bildete ich mir den ein?
Ich atmete tief durch. Heute war mein Geburtstag. Und egal was sich heute sonst noch jährte, diese beiden Menschen hier wollten mit mir feiern. Also sollte ich mich auch dementsprechend benehmen. Ich kramte mein Lächeln hervor und setzte es wieder auf. Meine Hände strichen ein letztes Mal über die Kommode aus Teakholz, die ebenfalls eine Vielzahl von Fotos beherbergte – alle in hübschen, wenn auch kitschigen, silbernen Rahmen … Ich war noch am Leben. Egal wie. Egal warum. Das war doch ein Wunder oder? Und vielleicht sogar ein Grund zum Feiern – oder?
Auch Mamé hatte wieder zu ihrem Lächeln zurückgefunden. Sie führte uns ins Wohnzimmer. Es war dank der bodentiefen Fenster lichtdurchflutet und der größte Raum in dem kleinen Haus. Es roch nach lauter Köstlichkeiten. Ich war froh, dass sie mir noch immer schmecken würden – trotz meines … Zustandes. Das Licht hingegen war auch für mich ziemlich unangenehm. Ich konnte die alte Einrichtung des Zimmers im ersten Moment kaum richtig erkennen und wollte nicht wissen, wie sehr Ginga die Sonne in diesem Moment verfluchte. Sie würde schlecht die ganze Zeit ihre Sonnenbrille auflassen können. Ich drehte mich bedauernd zu ihr um. Die über den schwarzen Gläsern zusammengezogenen Brauen sprachen Bände.
Licht und Kuchen.
Beides keine Gründe, um Freudensprünge zu machen.
»Nehmt doch Platz, ihr Lieben. Was möchtet ihr trinken?«
»Mach uns doch einen deiner besonderen Tees! Den hab ich schon ewig nicht mehr getrunken.« Gingas ehrliche Antwort auf diese Frage konnte ich mir lebhaft vorstellen und so antwortete ich lieber schnell für uns beide, um ihr gar nicht erst einen Aufhänger zu geben.
»Aber gerne.« Mit einem gütigen Lächeln verschwand sie in Richtung Küche. Ich wartete noch einen Augenblick, bis ich mich meiner Freundin zuwandte.
»Ginga! Nimm die Sonnenbrille ab! Ich weiß, das ist unangenehm, aber sie aufzulassen ist unhöflich.« Ich flüsterte so leise wie möglich. Ginga würde sowieso keine Probleme haben, mich zu verstehen. Sie hatte nicht gerade das, was man als Durchschnittsgehör bezeichnen konnte.
»Können wir ihr nicht sagen, dass ich eine Aller-Dings habe?«
»Eine Was? Eine Allergie? Ach komm schon Ginga. Wir bleiben ja nicht ewig. So schlimm wird das schon nicht sein. Für mich ist es auch hell.«
»HELL?!« Ich konnte ihren Blick durch die Sonnenbrille hindurch spüren. »Das Sonnenlicht hier drinnen ist schlimmer, als wenn du direkt in diese modernen LE-Dings, diese Leuchtdinger gucken würdest! Ach, was sag ich … in einen Laserstrahl! Und das ist noch zu wenig. Glaub mir einfach. ›Hell‹ trifft es nicht ansatzweise!«
Ich seufzte leise. Sie übertrieb maßlos. Unser Zuhause war momentan sicher auch nicht viel dunkler. Und der Weg hierher konnte doch auch nicht besser gewesen sein und sie hatte ihn überstanden … Dennoch stand ich auf und ging zu den Fenstern, um die Vorhänge etwas zuzuziehen. Mit jedem weiteren dunkelblauen Vorhang, den ich zwischen uns und das Tageslicht zog, verlor das Zimmer an Freundlichkeit. Aber zumindest entspannte sich Ginga nun etwas und zugegebenermaßen tat auch mir das Zwielicht gut.
»Besser?«
»Besser.«
»Dann nimm jetzt endlich die Brille ab!«
Wir setzten uns gerade, als Mamé mit einem altmodischen, silbernen Teeservice zurückkam. Ich konnte nur hoffen, dass die Tassen nicht so silbern waren wie sie aussahen. Sonst würde dieser Besuch noch schwieriger werden.
»Oh! Ist es euch zu hell hier drin gewesen?«
»Wir haben beide ziemliche Kopfschmerzen. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir sie zulassen.«
»Aber natürlich, Kind.« Die Tassen klirrten leise auf ihren Untertellern, während meine Großmutter sie abstellte. Der Tee füllte den ganzen Raum mit einem angenehm aromatischen Duft. Als Mamé bei Gingas Platz ankam, nahm diese gerade ihre Sonnenbrille ab. Ich war froh, dass sie vernünftig war. Ich konnte erkennen, wie sie die Augen immer wieder zudrückte und blinzelte. »Ein Schluck Tee wird Wunder wirken. Trinkt nur!«
»Merci«, murmelte sie ohne aufzublicken.
Ich war erstaunt, dass Ginga sich sogar höflich bedankte. Das war beinah mehr, als ich erwartet hatte. Lächelnd streckte ich meine Hand nach dem Tee aus, zögerte dann aber einen Moment. Ich musterte mein verzerrtes Spiegelbild in der Tasse und versuchte abzuschätzen, wie hoch wohl der Silberanteil in der verzierten Tasse war. Dann nahm ich meinen Mut zusammen, verwarf meinen Argwohn und griff zu. Das augenblickliche Brennen in meiner Hand war die Belohnung. Wie Säure! Ich verkniff mir einen Aufschrei und stellte das Folterinstrument so schnell wie möglich wieder ab. Zum Glück war Mamé noch damit beschäftigt, sich selbst einzugießen. Ich wollte Ginga gerade eine Warnung zukommen lassen, als es auch schon zu spät war. Sie ließ fluchend die Tasse fallen. Der heiße Tee ergoss sich halb über sie, halb über den Tisch. Im Reflex sprang sie auf. Das leise Fauchen war unüberhörbar gewesen.
Was dann geschah, überstieg meine kühnsten Erwartungen. Mamé schrie auf, lief zu mir, riss mich vom Stuhl – ich hatte keine Ahnung, woher sie diese Kraft und Schnelligkeit nahm – und brachte sich selbst zwischen meine Freundin und mich. Wusste sie, was Ginga war? Wollte sie mich vor ihr beschützen? Ihre grauen Augen waren vor Entsetzen geweitet.
Ginga hingegen fing sich wieder etwas – auch wenn sie sichtlich erstaunt über das Verhalten meiner Großmutter war. Sie hatte ganz offensichtlich keine Lust auf ein Drama. Ihre roten Locken wippten leicht auf und ab, als sie den Kopf schräg legte und an meiner Großmutter vorbei zu mir sah. Eine Braue fragend erhoben. Ich wusste, dass sie wissen wollte, was hier los war und was ich zu unternehmen gedachte. Genau diese Fragen konnte ich aber nicht beantworten. Vielmehr stellte ich sie mir selbst.
Ich öffnete gerade den Mund, um zumindest irgendetwas zu erwidern, als meine Großmutter auch schon zu sprechen oder vielmehr zu fluchen begann. Aber ich verstand nicht ein Wort. Ginga hingegen verstand sehr wohl – was erklärte, weshalb mir diese Sprache dennoch bekannt vorkam. Es war die, die ich von Ginga immer gehört hatte, bevor sie Französisch gelernt hatte. Ihr verdutztes Gesicht wäre eigentlich urkomisch gewesen – ohne meine wütende Großmutter ihr gegenüber. Wegen Letzterer blieb es allerdings nicht lange bei dem verdutzten Gesicht. In Windeseile feuerte Ginga hart zurück. Die Mimik und Gestik der beiden war mehr als deutlich. Ich wollte gar nicht wissen, was all die Worte bedeuteten, die sie sich gegenseitig an den Kopf warfen.
Fassungslos beobachtete ich einige Minuten lang, wie sich die beiden wichtigsten Menschen in meinem Leben gegenseitig aufs schärfste attackierten. Dann sah ich, wie Gingas Augen drohten, ihre Farbe zu wechseln. Sollten sie schwarz werden, musste ich damit rechnen, dass sie meine Großmutter kurz darauf nicht nur mit Worten angriff. Ich sprang zwischen die Beiden und schrie so laut ich konnte.
»HÖRT SOFORT AUF!!! ALLE BEIDE!!!«
Ich hatte nicht damit gerechnet, aber mein Ausbruch half. Tatsächlich unterbrachen beide ihre Tiraden und funkelten sich nur noch giftig an. Sie wirkten wie Raubkatzen, die sich gegenseitig belauerten um die Schwäche der jeweils anderen zuerst zu entdecken. Dass Ginga sich so aufführen konnte, wusste ich. Aber Mamé Victoria?! Sie war fast 80 und sonst die Güte in Person! Und ob ich es nun wahrhaben wollte oder nicht, sie war es gewesen, die diesen Streit begonnen hatte.
»Was um HIMMELSWILLEN ist in euch gefahren?! Kennt ihr euch irgendwoher? Was ist das für eine Sprache? Was verbergt Ihr?!«
Als Antwort erhielt ich für gefühlte Stunden nur ein ausgedehntes Schweigen. Ein Schweigen, in dem mich meine Großmutter immer wieder mehr oder weniger unauffällig hinter sich ziehen wollte.
»Ginga! Mamé!« Ich schüttelte meine Großmutter ab und sah gequält zwischen beiden hin und her. Ich hatte schon lange keine Freude mehr an meinem Geburtstag – nicht seit damals – aber so hatte ich ihn mir nicht vorgestellt.
»Mir reicht’s. Pardon, Cara. Aber sowas muss ich mir nicht sagen lassen.« Ginga flüsterte nur. Sie konnte mich nicht einmal mehr ansehen. Ich blinzelte und in diesem Augenblick war sie verschwunden. Ich starrte für eine gefühlte Ewigkeit auf die leere Stelle, auf der bis eben noch meine etwas sonderbare Freundin gestanden hatte. Sie mochte ihre Macken haben, aber die hatte ich ja auch. In den vergangenen gut drei Jahren hatte ich sie wirklich lieb gewonnen. Sie war immer für mich da gewesen. Bei jedem Alptraum und an jedem schlechten Tag, immer hatte sie mein Lächeln zurückgebracht.
»Ginga … nicht …« Meine Worte waren so leise, dass sie gut und gerne auch Gedanken gewesen sein konnten.
»Naja. Sie hatte wohl Wichtigeres zu tun.« Meine Großmutter strich über ihr hübsches Sommerkleid und seufzte leise; dann überprüfte sie den Sitz ihrer Frisur und widmete sich anschließend der Schadensbegrenzung an ihrem Esstisch. Es schien so, als hätte sie vollkommen verdrängt, was gerade passiert war … oder dass ich all das gesehen und gehört hatte … oder auch überhaupt, dass ich noch hier war. Aber zumindest auf Letzteres schien sie sich dann doch noch zu besinnen. Sie wandte sich mir zu und hatte bereits wieder ihr gütiges Lächeln im Gesicht. Jetzt fragte ich mich, wie echt es zuvor gewesen war. Wo sie es doch jetzt so problemlos aus- und angeknipst hatte. »Möchtest du noch einen Schluck von dem Tee Liebes?«
Ich schüttelte ungläubig den Kopf.
»Na gut. Ich bring das rasch in die Küche. Ich bin gleich wieder bei dir.«
Glaubte sie ernsthaft, ich würde es dabei belassen?! War das der berühmte Altersstarrsinn? O, ich konnte auch sehr starrsinnig sein, wenn ich etwas wissen wollte. Mindestens eine der beiden würde mir erzählen, was da eben passiert war.
»Mamé! Bitte! Du kannst doch nicht einfach so tun, als sei das eben nicht geschehen!« Ich spürte, wie Tränen in mir hochstiegen – zusammen mit Wut und Trauer. Ich lief ihr in die Küche nach. Sie räumte emsig und offenbar hoch konzentriert das Geschirr weg. »Ihr habt in der Sprache gesprochen, die Ginga sprach, als sie herkam! Du hast extra das Silberservice benutzt. Gib es doch zu! Woher kennt ihr euch?!«
»Wir kennen uns nicht, Kind. Was sagst du da?« Das war alles. Die anderen Fragen ignorierte sie weiterhin. Während meine Augen ihrem geschäftigen Treiben in der Küche folgten, arbeitete mein Kopf an weiteren Fragen, die sie vielleicht beantworten würde.
»Worüber habt ihr gesprochen? Warum wolltest du mich vor ihr schützen?«
Wieder keine Reaktion. Es war, als hörte sie mich gar nicht. Ich nickte resigniert und ließ dann den Kopf sinken. Ich würde heute wohl nichts mehr von ihr hören … Vielleicht, wenn sie erst einmal darüber nachgedacht hatte, wenn sie erfahren hatte, dass Ginga nicht böse war. Offenbar schien sie das ja zu glauben.
Wenn du wüsstest, dass ich ihr gar nicht mal so unähnlich bin …
»Also gut. Wenn du es nicht für nötig hältst, mir die Wahrheit zu sagen. Ich werde jetzt Ginga suchen. Ich kann es mir nicht leisten, die beiden letzten Vertrauten in meinem Leben zu verlieren. Vielleicht sieht wenigstens sie das genauso.«
Ich drehte mich um und ging auf den Ausgang zu. Es fiel mir unendlich schwer, mich nicht umzudrehen. Die Tränen konnte ich bei aller Selbstbeherrschung nicht mehr zurückhalten. Noch bevor ich die Haustür aufzog, setzte ich meine Sonnenbrille auf. Ich schob sie mir nah vor die Augen. Meine Tränen brauchte niemand zu sehen.
»Oh Liebes … manche Dinge sollten unausgesprochen bleiben …«, hörte ich sie leise murmeln. Dann schloss sich die Tür zwischen uns.
Ihre Stimme hatte resigniert und erschreckend müde geklungen. Was, wenn das das letzte Mal war, dass du mit ihr gesprochen hast? Für den Bruchteil einer Sekunde jagte der Gedanke durch meinen Kopf, doch dann gewann der Stolz. Wie hätte ich das Haus jetzt noch einmal betreten können? Nach allem, was geschehen war. Nach allem was gesagt – oder auch nicht gesagt worden war.
Ich trat aus dem Schatten der Terrasse. Die Sonne stand inzwischen tiefer, aber es war noch immer verflucht hell. Die schwarzen Gläser der Sonnenbrille konnten meine Tränen gut verstecken, aber sie hielten das Licht nicht vollkommen ab. Für einen Menschen war ihr Schutz sicher ausreichend, aber das war ich nun mal nicht mehr. Ich schloss meine Augen und durchquerte den Garten blind. Selbst mit einem schlechteren Gehör hätte ich den Weg gefunden. Wie oft war ich ihn in den vergangenen 23 Jahren gegangen – beinah täglich … Nur der Park trennte mein Zuhause von Mamés Häuschen.
Der Kies knirschte leise unter meinen Sohlen und der Duft von Rosen und Lavendel stieg mir in die Nase. Dann ertasteten meine Hände das kleine, verrostete Gartentor. Es ging selbst mir nur bis zur Taille und ich war klein. Sein Gestänge war von der Sommersonne ganz warm. Wenn mir Ginga erzählt hat, was hier los ist, dann komme ich wieder, dann sehe ich nach ihr. Mit einem leisen Quietschen gab das Tor nach und entließ mich auf eine kleine Straße. Dankbar sah ich nach oben, wo nun ein dichtes Blätterdach das meiste Licht abhielt. Der Bois de Boulogne, in dem das kleine Haus von Mamé gut versteckt stand, war zum Glück dicht bewaldet. Er war ein riesiger Park am westlichen Rand von Paris, der nicht den besten Ruf hatte – zumindest nicht vom Abend bis zum Morgen. Aber das kam mir gerade recht.
Einen letzten Blick zurück auf das kleine Haus erlaubte ich mir – zusammen mit einem tiefen Seufzer –, dann rannte ich los. Der Wind tat gut. Er kühlte mein durch die Tränen und die Sonne erhitztes Gesicht. Die Bäume und Sträucher, die Seen und wenigen Gebäude auf meinem Weg flogen an mir vorbei. Ginga würde sich über mein ›Schildkrötentempo‹ lustig machen, aber dennoch war ich zumindest schneller als normale Menschen.
Dann kamen mehr Häuser in Sicht und das Grün wich Grau. Der Park endete und sofort reihte sich wieder Hauseingang an Hauseingang. Als ich die ersten Mehrfamilienhäuser erreichte, drosselte ich mein Tempo. Die hohen Gebäude um mich herum hatten eine ähnliche Wirkung wie die alten, hohen Bäume: Schatten. Aber andererseits bildeten diese kalten, grauen Riesen erdrückende Mauern. Paris war so über und über dicht bebaut. Ich war wirklich stolz auf unsere kleine Villa. Laut Papa hatten meine Urgroßeltern sie wohl nach dem Vorbild der Villa Majorelle erbauen lassen und ignorierten dabei, so wie deren Schöpfer, die restliche Architektur ringsum. Schon von weitem hob sie sich vom Rest der Straße ab mit ihren schönen hohen Fenstern, dem Erker und all den gusseisernen Verzierungen. Sie sah beinah aus wie ein Hexenhaus aus einem Märchen. Für einen Moment blieb ich vor dem Gartentor stehen. Ob Ginga wirklich nach Hause gelaufen war? Vielleicht war sie ja auch an einem ganz anderen Ort; vielleicht in einem Park oder einem Club um sich abzureagieren; vielleicht lief sie einfach nur durch die Gegend …
Wenn sie aber hier war, dann würde ich sie nicht fortlassen, bis ich eine Antwort hatte. Noch immer tobten die unverständlichen Worte von eben durch meinen Kopf. Was war nur plötzlich in meine Großmutter gefahren?! Sie schien Ginga doch erst zu mögen und dann … Ich schüttelte energisch den Kopf. Tagträumerei brachte mich nicht weiter. Ich musste Ginga finden. Und ich brauchte einen Schluck von meinem Tee – dann würde auch das Licht nicht mehr so blenden. Und ich brauchte Ginga. Ich schob das Tor auf, lief rasch auf die Villa zu und die drei Stufen die Terrasse hinauf. Ich hielt gerade so vor der schweren Eichenholztür. Aus meiner Jeans angelte ich meinen Schlüsselbund. Er beherbergte nicht viele Schlüssel und nur einer schloss die Tür auf, die wirklich in mein Reich führte. Er war älter als die anderen – sicher wie die Villa an die hundert Jahre alt –, doch sein Gold schimmerte noch immer wie am ersten Tag.
Als ich mit ihm das Schloss öffnete, hallte das Klacken der Mechanik durch das halbe Haus. Ich mochte dieses Geräusch. Es bedeutete immer wieder, dass ich Zuhause war, dass ich sicher war.
Im Haus lehnte ich mich gegen die Tür, zog die lästige Sonnenbrille von der Nase und genoss für einen Moment einfach nur das Gefühl, angekommen zu sein. Dieser Ort würde immer diese Bedeutung für mich haben. Ich konnte mir nicht vorstellen auch nur in einem anderen Haus in der gleichen Straße zu wohnen. Diese Villa hatte mindestens genauso viele Geheimnisse wie ich. Es grenzte an ein Wunder, dass sie im Krieg nicht einen Kratzer davongetragen hatte; sie besaß unzählige Verstecke und meiner Meinung nach ein gewisses Eigenleben …
Genug Erinnerungen gewälzt! Ginga! Ich blinzelte und sah mich um.
»Ginga?! Bist du hier!?« Ich rief lauter als nötig, aber es kam keine Antwort.
Ich lief den Flur entlang ins Haus hinein und wollte gerade erneut ansetzen, als ein schwarzer Schatten auf mich zu huschte. Einen kurzen Augenblick später schnurrte Aby in meinen Armen. Sie war der mit Abstand merkwürdigste Stubentiger von Paris – und wahrscheinlich nicht nur da.
›Da bist du ja wieder! Ginga ist nicht da. Ihr habt mich so lang allein gelassen!‹ Die Worte, die direkt in meinem Kopf zu klingen schienen, hatten einen empörten und beinah beleidigten Unterton.
»Tut mir leid Aby. Aber wenn Ginga nicht hier ist, werde ich dich wohl oder übel noch einmal allein lassen müssen.«
›Was!? Warum das denn!?‹ Diesmal waren ihre unausgesprochenen Worte von einem leisen, aber sehr energischen Fauchen begleitet. Offenbar wogen ihre eigenen Bedürfnisse schwerer als Gingas Abwesenheit. ›Du bist gerade erst Heim gekommen!‹
»Aby!« Ich war mit ihr ins Wohnzimmer gelaufen. Nun landete sie auf einem der Sofas in der Mitte des Raumes. »Benimm dich einmal wie eine normale Katze und hör auf zu diskutieren! Ich würde auch lieber zuhause bleiben.«
Schweigend sah sie mit ihren leuchtend grünen Augen zu mir auf. Ein wenig hatte ihr Blick Ähnlichkeit mit dem von Ginga. Ihre Schwanzspitze zuckte unruhig. Ihr lag sicher eine gepfefferte Antwort auf der Zunge, aber irgendwas hielt sie davon ab, mich mit weiteren Protesten zu bedenken. Vielleicht war mir meine Sorge anzusehen. Vielleicht erinnerte sie sich daran, dass heute mein Geburtstag war – ich hatte es selbst bereits vergessen. In jedem Fall war ich froh, die Diskussion beendet zu haben.
Die Frage war nur, wo ich Ginga suchen sollte. Sie arbeitete – je nach Lust und Laune – in einem Dutzend verschiedener Clubs. Sie liebte es, angetrunkene Männer auszusaugen, wenn sie sich ablenken wollte; sie könnte mit anderen Worten überall in Paris sein. Es war ein Freitagabend. Sie würde an jeder Ecke jemanden finden, in den sie ihre Fänge versenken konnte.
Bei dem Gedanken daran begann mein Kiefer zu schmerzen. Automatisch schlug ich den Weg zur Küche ein. Dort angekommen durchsuchte ich die Regale und Hängeschränke nach einer großen Tasse und nach meinem Tee. Seit ungefähr vier Jahren war er mein ständiger Begleiter. Damals hatte ich sein Rezept und ein paar Dosen mit seiner Mischung in einem der Verstecke dieser Villa gefunden. Ich hatte keine Ahnung warum, aber er half mir, meinen Blutdurst zu stillen. Blutdurst. Ja. Denn ich war Vampir – so wie Ginga. Oder zumindest zum Teil so wie sie. Irgendwas war bei mir anders. Ihr half auch mein Tee nicht. Ich jedoch brauchte dank ihm nur alle paar Wochen richtig Blut trinken. Und jetzt brauchte ich dringend einen Schluck Tee. Oder Blut, schoss es mir durch den Kopf. Ohne würde ich Ginga vielleicht gar nicht erst anhören. Wenn wir nicht regelmäßig tranken, wurden wir schrecklich launisch und mein letzter Schluck lag schon eine Weile zurück.
Ich beobachtete, wie der Tee das Wasser in der Tasse langsam rötlich färbte. Er zog Schlieren und Kreise – wie Rauch in der Luft. Ich hatte nie Menschen verletzen wollen. Doch seit meinem achtzehnten Geburtstag hatte ich keine andere Wahl mehr. Die erste Zeit war grausam und gefährlich gewesen. Lange hatte ich nicht gewusst, was mit mir geschehen war, warum ich als Einzige überlebt zu haben schien. Die Ärzte nannten es ein Wunder. Dennoch behielten sie mich lange im Krankenhaus. Der einzige Grund: Ich aß kaum noch und einige Blutwerte waren die einer Toten. Wie hätten sie oder ich auch wissen sollen, dass ich nun eine andere Nahrungsquelle brauchte? Ich fand es in den Monaten heraus, die ich in der Reha auf dem Land verbrachte. Meine Eltern hatten mir ein nicht geringes Erbe hinterlassen und so legte man mir nahe, nicht gleich nach dem Krankenhaus in die Villa zurückzukehren. Es war mir damals recht. Ich hatte Angst vor meinem Zuhause. Ich hatte Angst vor den Erinnerungen. Heute konnte ich mit den meisten von ihnen umgehen. Es war gut, sie zu haben. In ihnen blieb meine Familie lebendig.
Mére … Pére … Frére …
Ich schloss die Augen und genoss den warmen Dampf in meinem Gesicht und den Duft, der mir in die Nase stieg. Ich kannte die merkwürdigen Namen der Kräuter nicht, die in der Rezeptur enthalten waren. So oft ich es auch versucht hatte herauszufinden, die vollständigen Bestandteile des Tees blieben mir verborgen … Bald wären meine Vorräte aufgebraucht. Ich fragte mich, was dann geschehen würde.
Die Monate der ›Kur‹ waren die schlimmsten meines Lebens gewesen – und sicher auch die schlimmsten im Leben einiger anderer Menschen, die sich zu dieser Zeit mit mir in der Klinik aufgehalten hatten.
Ich hatte nie Menschen verletzen wollen. Wirklich nicht. Aber zu jener Zeit war ich nicht mehr Herrin meiner Sinne. Anfangs waren da Träume, aus denen ich blutverschmiert hochschreckte. Dann erlebte ich die Überfälle immer mehr mit. Es dauerte lange, bis ich begriff, dass das merkwürdige Verschwinden von Patienten und Mitarbeitern auf mein Konto ging und dass keiner von ihnen je wiederkommen würde. Bis heute wusste ich nicht, wie viele Menschen meinem Blutrausch zum Opfer gefallen waren. So oder so – es waren zu viel gewesen.
Ich verlor mich schon wieder in Gedanken und Selbstmitleid. Auch ein Zeichen des Blutdurstes. Zumindest bei mir. Bei Ginga wirkte es eher gegenteilig. Sie machte nicht sich selbst nieder, sondern andere. Schnell setzte ich die Tasse an meine Lippen und trank den Tee mit zwei großen Schlucken aus.
Besser.
Viel besser.
Also gut. Und nun hieß es: Ginga suchen. Hoffentlich ließ ich mich nicht noch öfter von meinen Gedanken ablenken. An meinem Geburtstag war ich besonders anfällig … Also zwang ich meinen aufmüpfigen Geist, über Ginga nachzudenken. Ich ging die ganzen Clubs durch und dann fiel mein Blick auf ein Bild von uns. Es hing in der Küche über der Tür. Wir standen Arm in Arm vor dem Eiffelturm. Es war Winter und Ginga hatte sich noch immer nicht an den Schnee gewöhnt. Dementsprechend sah sie nicht in die Kamera, sondern starrte fasziniert ein paar Schneeflocken auf ihren Handschuhen an. Hätte sie damals aufgesehen, wäre das Bild wahrscheinlich nie zustande gekommen. ›Diese Dinger sind Teufelszeugs‹, rief sie immer, wenn sie eine Kamera aus der Nähe sah. Ich musste unwillkürlich lächeln. Am Eiffelturm hatten wir uns kennengelernt und ein paar unserer verrücktesten und schönsten gemeinsamen Erinnerungen waren hier verankert.
»Der Eiffelturm … Aber natürlich!« Erst flüsterte ich nur, dann kam meine Erkenntnis einem Freudenschrei gleich. Aby kam sofort zu mir geflitzt. Ich sah sie an, als hätte ich ein Heilmittel für Lepra entdeckt. »Der Eiffelturm! Das muss einfach die Lösung sein!«
›Bedeutet das, du musst nicht los?‹ In ihren Augen lag jede Menge Hoffnung.
»Natürlich muss ich das! Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo ich suchen muss.« Ich hockte mich hin und drückte Aby. »Pass gut auf das Haus auf. Ich beeile mich auch. Okay?« Sie schnurrte nur leise zur Antwort.
Ich schnappte mir die Schlüssel, zog schwungvoll die Haustür hinter mir zu und rannte los. Ginga … bitte sei wenigstens du jetzt ehrlich zu mir und erzähl mir, was los war … Ich rannte und rannte. Dann sah ich ihn endlich vor mir. Automatisch wurden meine Schritte langsamer. Es war inzwischen früher Abend und die Sonne strahlte den Eisenkoloss golden und rot an. Seine eigene Beleuchtung ließ ihn noch mehr erstrahlen. Wunderschön … Als ich die Seine überquert hatte, blieb ich stehen. Eiffelturm schön und gut… aber wo würde ich jetzt Ginga finden? Sie konnte überall sein. Vielleicht war sie an einem der Füße hochgeklettert. Früher hatte sie mir hier beigebracht, wie viel mehr Kraft und Geschicklichkeit unsere Art besaß. Oder sie saß auf einer der zahlreichen Bänke um den Turm herum. Ich versuchte mich zu erinnern, wo ich sie damals gefunden hatte. Damals vor dreieinhalb Jahren. Es war Winter gewesen und ich auch damals sehr durstig …
Zitternd lief ich durch die Straßen von Paris. Die winterliche Kälte machte mir nichts aus, aber der Durst. Um mich herum konnte ich regelrecht die schlagenden Herzen der Menschen spüren. Ich musste sehr gegen mich selbst kämpfen, um nicht schließlich direkt vor dem Eiffelturm über irgendwelche Touristen herzufallen.
Ich kauerte mich auf einer Parkbank zusammen. Eigentlich wollte ich nach Hause, aber dafür müsste ich mich durch die gut gefüllten Straßen schlängeln. Ich hatte es gerade so bis hierhergeschafft. Jeder weitere Meter wäre ein Risiko gewesen. Die Bank, auf der ich saß, stand unter einer kaputten Laterne und es war bereits Abend.
Die Menschen mochten zwar das abendliche Paris, aber sie mieden dunkle Ecken … Ich hatte einen langen Mantel mit Kapuze an und mir letztere tief ins Gesicht gezogen. Vielleicht war ich Passanten unheimlich. Sie taten gut daran, mich zu meiden.
Schweigend beobachtete ich die lautlos fallenden Schneeflocken.
Wie beruhigend …
Plötzlich hörte ich hinter mir kurz nacheinander einen dumpfen Schlag, ein erschrockenes Keuchen und letztlich ein Rascheln. Ich hatte niemanden kommen hören. Aber hinter mir lag hoher Schnee. Jeder würde da knirschende Geräusche machen! Langsam drehte ich mich um. Ich war mir nicht sicher, ob ich wissen wollte, was da zu sehen war. Seit dem Überfall war ich nicht mehr für ›Überraschungen‹ wie diese gemacht gewesen. Aber die Neugier und wohl auch der Wunsch zu wissen, ob mir Gefahr drohte, waren stärker als alles, was mich zurückhielt.
Vor mir – oder vielmehr hinter mir – lag eine reichlich verwirrte Frau mitten im Schnee. Ihr feuerrotes Haar hing ihr wirr ins blasse Gesicht und sie versuchen hektisch, sich vom Schnee zu befreien.
»Fri! Fri!« Ihre Stimme klang selbst mit den deutlichen Spuren von Panik noch schön. Sie murmelte ununterbrochen irgendetwas vor sich hin. Aber ich verstand kein Wort. Dann bemerkte sie mich und starrte mich mit ihren weit aufgerissenen, leuchtend grünen Augen an. Sie sah aus wie eine Amazone aus einem alten Film. Wild und wunderschön. Ich konnte sie nur mit offenem Mund anstarren, während sie mich mit irgendwelchen Worten ankeifte, die ich nicht verstand. Das war keine Sprache, die ich je gehört hätte … Ich schüttelte nur hilflos den Kopf.
»Ich kann dich nicht verstehen … Pardon … Tu nes parles pas français?«
Immerhin hatte ich sie offenbar vom Schnee abgelenkt. Sie hatte nicht viel an und es musste wahnsinnig kalt sein, aber sie schien sich beruhigt zu haben. Nun fixierte sie mich nur noch. Ihr Blick fühlte sich an, als würde sie mich mit allen Sinnen abtasten. Ein kalter Schauer lief meinen Rücken hinab. Ich spürte plötzlich Angst. Diese merkwürdige Fremde war anders.
Den Bruchteil einer Sekunde später lag ich mit ihr ihm Schnee und sie hielt mir den Mund zu. Obwohl meine Sinne so viel schärfer waren – warum auch immer – hatte ich ihre Bewegungen nicht kommen sehen. Mein Herz raste und meine geweiteten Augen füllten sich mit Tränen. Nein! Nein! Nein! Ich war doch die, die überlebt hatte! Nein! Mama hatte mich doch nicht mit ihrem Leben beschützt, damit ich nun doch sterben sollte! Nein!
Ich starrte verzweifelt die Fremde über mir an. Ihre leuchtend grünen Augen wurden plötzlich schwarz. Sie bleckte die Zähne und prompt verlängerten sich zwei von ihnen. Mon Dieu! Non! Sie war wie die Männer, die uns damals überfallen hatten! Sie war genauso! Gehörte sie zu ihnen? Hatte sie mich gesucht?
Mit einem wilden Knurren schlug sie die Zähne in meinen Hals und mein Schrei wurde zu einem lächerlich dumpfen Geräusch durch ihre Hand auf meinem Mund. Doch der Schrei befreite etwas anderes in mir. Etwas, das ich seit Stunden, Tagen und Wochen zu unterdrücken versuchte. Plötzlich kam auch aus meiner Kehle ein Knurren, mein Blick wurde klarer und für ein paar Sekunden schmerzte mein Kiefer mehr als mein Hals. Ich nahm alle Kraft zusammen und stieß sie von mir. Und tatsächlich! Es funktionierte! Diesmal hatte ich genug Kraft.
Diesmal würde ich nicht verlieren!
Noch während meine merkwürdige Angreiferin gegen einen Baum prallte, war ich aufgesprungen. Dann standen wir uns wieder gegenüber. Beide mit einem Fauchen im Hals und Wut im Bauch. Doch dann geschah etwas, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Meine Gegnerin gab ihre aggressive Haltung auf. Sie starrte mich an und während ihr fragender Gesichtsausdruck blieb, verschwanden ihre Fänge und ihre Augen nahmen wieder ihr schönes Grün an.
»Vampir«, flüsterte sie abwesend. Das wiederum ließ auch mich wieder zu mir kommen. Das war das erste Wort aus ihrem Mund, das ich verstand. Sie kam langsam und mit erhobenen Händen auf mich zu. Beinah als wolle sie mir zeigen, dass sie nicht vorhatte, mich wieder anzugreifen. Ich musterte sie argwöhnisch, aber irgendetwas sagte mir, dass sie mir wirklich nichts tun würde. Ganz langsam und vorsichtig legte sie ihre kalten Hände an meine Wangen. Durch all die Aufregung waren sie sicher gerötet und heiß. Sie legte den Kopf schräg, als würde sie lauschen und schüttelte ihn dann ungläubig. Sie zeigte auf meine Augen und meine Lippen und murmelte wieder »Vampir«, dann legte sie wieder eine Hand an meine Wange, lauschte und schüttelte den Kopf. Ich schien sie komplett aus dem Konzept zu bringen. Da waren wir schon zwei. Ich begriff auch nicht, was ich war.
Ich hatte irgendwann verstanden, dass mein Körper Blut wollte, dass meine Eckzähne spitz wurden, wenn ich durstig war und dass meine Sinne schärfer waren als vorher. Und natürlich kannte ich all die ach so beliebten Vampir-Geschichten. Aber weder glitzerte ich in der Sonne noch brauchte ich Angst haben, in Rauch aufzugehen. Ich wusste genauso wenig, was ich war, wie die Fremde vor mir.
Sie sah mich immer noch grübelnd an. Dann ließ sie verlegen die Hand fallen und nuschelte etwas, das ich nicht verstand. Dem Tonfall nach konnte es eigentlich nur eine Entschuldigung gewesen sein. Sie musterte besorgt die Wunde an meinem Hals. Ich nickte leicht.
»Pardon« Das war doch das Wort, das sie jetzt sagen wollte oder?
Sie sah mich fragend an, dann hellte sich ihre Miene auf. »Ah! Pardon!« Sie zeigte auf mich und dann auf sich. »Ginga!«
***
Ich lächelte bei der Erinnerung. Ich hatte Wochen gebraucht, um ihr zu erklären, dass ich nicht ›Pardon‹ hieß, sondern Cara. Meine Beine hatten mich inzwischen wie von selbst zu der Bank getragen, auf der ich damals gesessen hatte. Doch sie war leer … Ich seufzte leise.
»Wir konnten damals wirklich froh sein, dass sich an diesem Abend niemand für zwei fauchende Frauen in einer unbeleuchteten Ecke interessierte.« Ich wollte nicht wissen, was passiert gewesen wäre, wenn wir in diesem unbeherrschten Moment einen Menschen direkt vor uns gesehen hätten …
»Und ich hatte Glück, dass mich dieses seltsame Mischwesen mit nach Hause genommen hat, anstatt mich hier draußen erfrieren zu lassen …« Als könnte ein Vampir erfrieren … Typisch Ginga und ihre Dramatik …
Moment! Was? Ich wirbelte herum und da stand sie. Ihre Haare leuchteten durch die Abendsonne wie echte, lodernde Flammen. Sie biss sich verlegen auf die Unterlippe und sah mich schuldbewusst an.
»Ginga!!!« Für den Moment war jeder Streit vergessen. Da war nur die Freude, sie endlich gefunden zu haben. Ich fiel ihr in die Arme und war froh. Dann ließ ich sie langsam wieder los und sah sie an.
Ginga senkte den Kopf und nuschelte etwas Unverständliches. Ich schmunzelte und sagte leise »Pardon«. Sie sah mich mit einem etwas zerknirschten Lächeln an, zeigte auf sich und sagte »Ginga«.
***
Als wir endlich wieder an der Villa ankamen, begrüßte mich Aby schon nicht mehr ganz so freudig wie vorhin. Wahrscheinlich ahnte sie, dass ihre Streicheleinheiten noch warten mussten. Sie musterte uns nur aus sicherer Entfernung und schwieg.
Wir ließen uns beide je auf ein Sofa fallen. Zwischen uns stand der kleine Couchtisch. Er stellte mit seiner Obstschale und den Kerzen die ›neutrale Zone‹ zwischen uns dar. Aby hatte es sich vor dem Kamin gemütlich gemacht. Von da aus konnte sie unser Unterhaltung beobachten wie der Schiedsrichter ein Tennismatch.
»Also?« Ich sah Ginga fragend an, doch sie wich meinem Blick aus.
»Also was?«, murmelte sie.
Ich verdrehte die Augen. »Stell dich nicht so an. Du weißt genau, was ich meine.«
»Was willst du denn von mir hören? Sieh mal … tut mir leid … wirklich. Aber du weißt auch nicht, was deine ›Großmutter‹«, sie zeichnete zwei Gänsefüßchen in die Luft, »mir so alles an die Stirn geworfen hat.«
»Und genau das ist das Problem! Ich will es wissen! Aber niemand spricht mit mir! Mamé hat sogar so getan, als hätte es den Streit nie gegeben …«
»Und warum fühlst du dann nicht lieber ihr auf den Kiefer?«
»Ich hab’s ja versucht … aber sie hat nichts gesagt …« Außer, dass manches lieber unausgesprochen bleiben sollte …
»Ach so! Und bei ihr ist das okay, aber mein Schweigen verurteilst du!«
»Das ist was anderes! Wir beide wohnen hier seit über drei Jahren zusammen! Wir sind beinah wie Schwestern!«
»Und sie besuchst du mehrmals die Woche und sie ist wie deine Großmutter für dich! Wo ist das was anderes?!«
»Ginga!«
»Cara!«
Ich seufzte frustriert. Wir hatten uns doch bereits vertragen. Warum stritten wir denn jetzt schon wieder? Und warum konnte sie mir nicht einfach sagen, was die beiden vorhin so aufgeregt hatte?
Ich hatte immer respektiert, dass sie mir nicht alles aus ihrer Vergangenheit erzählte – oder genauer gesagt gar nichts. Aber in dem Wissen, dass selbst Mamé mehr wusste als ich, gefiel mir diese Tatsache nicht mehr. Ich wollte doch nur wissen, was zwischen meinen einzigen Vertrauten geschehen war. Eine davon saß mir jetzt gegenüber, doch ihr Blick war starr auf einen Blumentopf neben dem Sofa gerichtet. Dann sah sie mich plötzlich an.
»Ich will einfach nicht darüber reden, okay?! Ich weiß ja nicht, was in deine ›Mamé‹ gefahren ist, aber ich wollte einfach nur ein neues Leben! Ich hab die Fratzen satt!« Sie stand auf. »Ich muss nochmal hier raus. An die Luft. Rauch ablassen!«
»Non Ginga! Lauf nicht wieder weg!«
»Was denn? Willst du mich auch einsperren?!« aufgebracht rannte sie in den Flur. Ich folgte ihr.
»Ich–«
»Ich lass mich nicht mehr einsperren! Nie wieder! Und ich lass mich auch nie wieder so aus dem Haus jagen, wie deine ach so liebe ›Mamé‹ das getan hat!« Jetzt schrie sie schon fast.
»Ginga! Non!«
Zu spät. Die kleinen Gläser, die in Kopfhöhe in die Haustür eingelassen waren, klirrten, als meine Freundin die Tür hinter sich ›zufallen‹ ließ. Waren das Tränen gewesen, die in ihren Augen geglitzert hatten?
»Man, Ginga!« Ich hätte schreien können! Ich wollte meinem Ärger irgendwie Luft machen. »Ich will dir doch nur HELFEN!« Ich holte mit meinem Arm aus, als würde ich irgendwas nach meiner bereits durch Abwesenheit glänzenden Freundin werfen.
Plötzlich schrie ich auf und fand mich auf dem Fußboden wieder. Ungläubig starrte ich auf meine zitternde Hand und dann wieder auf den Türrahmen und die nicht mehr als solche zu identifizierende Tapete rechts daneben. Mein Herz schlug wie ein überhitzter Kompressor.
›WAS IST PASSIERT?! CARA?! ALLES OKAY?!‹
Aby schlitterte über das Parkett zu mir und saß dann direkt zwischen meinen Beinen. Mit Mühe formte ich eine Hand so, dass ich auf den großen Brandfleck neben der Haustür zeigte. Aby drehte sich fragend zur Tür um und fauchte dann erschrocken. Sie sah mich geschockt an und ihre Schwanzspitze zuckte vor Aufregung.
›W-wo kommt das her? War das Ginga? Wurdest du angegriffen?! Bist du verletzt?‹
Ihr Blick huschte über meinen Körper, aber ich war mir sicher, dass sie nicht mal einen Rußfleck an mir finden konnte. Ich schüttelte leicht den Kopf. Noch immer versuchte mein Verstand zu fassen, was gerade passiert war.
›Dein Mund öffnet und schließt sich, aber ich höre nichts! Und das Chaos in deinem Kopf ergibt keinen Sinn! Rede!‹
»Ich … das … der …« Ich blinzelte und starrte dann wieder ungläubig auf meine rechte Hand. »Ich … hab grad einen ... Feuerball gegen die Tür geschleudert.« Ich konnte es selbst kaum glauben.
›Haha, sehr witzig. Ehrlich, was ist passiert.‹
Ich sah Aby an oder eher durch sie hindurch und wiederholte – diesmal etwas flüssiger und überzeugter: »Ich hab gerade einen Feuerball gegen die Tür geschleudert.«
Aby starrte mich ein paar Sekunden lang schweigend an. Offenbar schien sie abzuwägen, ob ich sie veralberte, dreist anlog oder den Verstand verloren hatte. Ich ahnte, dass sie der Option, dass ich die Wahrheit gesagt hatte, keinen Platz einräumte. »Wirklich!«
Ich hielt meine Hand zwischen uns mit der Handfläche nach oben, als würde ich ein Teelicht halten. Das musste doch nochmal klappen! Konzentration!
Ungläubig aber doch neugierig beobachtete Aby meine Hand. Sie machte sogar ein paar Schritte rückwärts. Für vollkommen abwegig hielt sie meine Worte wohl doch nicht.
Allerdings geschah nichts. Meine Hand produzierte keinen Feuerball oder auch nur eine kleine Flamme – sie wurde nicht mal heiß. Wobei sie sich eben auch nicht heiß angefühlt hatte.
»Ich glaube, ich bin wirklich anders als Ginga …«, murmelte ich. »Ich muss reden …« Mit diesen Worten ließ ich meine arme, verwirrte Katze ein weiteres Mal an diesem Tag allein zurück.
***
Hier ruhen Theresa und Constantin Clow.
Geliebte und vermisste Eltern.
Unvergessen und unersetzlich.
Das Licht der Straßenlaternen reflektierte in den silbernen Lettern auf der Marmorplatte. Sie strahlten meinen empfindlichen Augen beinah entgegen. Ich kam immer hierher, wenn ich nachdenken musste oder mich allein fühlte … oder an Geburtstagen.
»Happy Birthday, Cara.« Heute traf alles zu.
Was für ein Tag, was für eine Nacht …
Ein schwacher Luftzug wehte über das Grab. Schwach, aber stark genug um mir den Duft von frischen Blumen und trockener Erde entgegenzuwehen. Rosen. Mama hatte Rosen geliebt. Sie hatte immer gesagt, dass Rosen jeder Frau ein gutes Vorbild wären: Vielfältig in Farbe, Größe und Form, wunderschön und mit berauschendem Duft – aber bei aller Schönheit doch auch in der Lage, sich zu wehren und zu schützen.
Die Rosen heute waren weiß. Sie leuchteten regelrecht auf dem sonst so dunklen Grab. Ich rückte sie in der Vase noch einmal zurecht und betrachtete mein Werk. Heute Morgen bei Sonnenaufgang hatte mein Geburtstag hier begonnen. Es war nur folgerichtig, dass er auch hier endete.
Bei meinem ersten Besuch vor inzwischen beinah 24 Stunden hatte ich die Rosen mitgebracht – zur Feier des ›Ehrentages‹. Es war eine Tradition in unserer Familie und der Tod – oder ›Untod‹ – war kein Grund, damit zu brechen: Ich war in der Dunkelheit gekommen. Es muss ungefähr Mitternacht gewesen sein. Wir kamen immer um Mitternacht zusammen, um uns dann bei den ersten Sonnenstrahlen zu gratulieren. Jeder Geburtstag begann für mich so – seit 23 Jahren. Seit fünf Jahren feierte ich meinen Geburtstag eben dafür morgens auf einem Friedhof.
Allein.
Allein mit einem kalten Stein.
Ich war doch so froh, Ginga und Mamé zu haben. Nicht mehr völlig allein zu sein. Und jetzt? Jetzt fühlte ich mich wieder so allein wie heute vor fünf Jahren … Traurig ließ ich den Kopf sinken und starrte auf meine Hände.
»Am Eiffelturm hast du mich gefunden. Nun war ich dran. Aber für mich war es einfacher …« Mit diesen Worten kniete sich Ginga neben mich und gemeinsam starrten wir eine Weile auf den Grabstein. Ich schwieg. Ich war noch immer wütend, aber am Grab meiner Eltern wollte ich nicht schreien oder fluchen. Nach ein paar Minuten setzte Ginga erneut an zu sprechen. Ich konnte spüren, wie schwer ihr das fiel. Aber in diesem Moment wollte ich, dass es ihr schwerfiel. »Schöne Blumen«, murmelte meine Freundin.
Mein Schweigen quälte sie. Jedes Thema war ihr recht, solange ich nur wieder mit ihr sprach und sie dafür nach Möglichkeit nichts sagen oder tun musste, das sie nicht wollte. Eigentlich wollte ich sie noch etwas zappeln lassen, doch dann hielt ich die Stille selbst nicht mehr aus. Da war zu viel, das ausgesprochen werden musste, um die Stille zu genießen. Zu viel, das über uns schwebte und jederzeit über uns hereinbrechen konnte.
»Ach Ginga …« Ich seufzte leise. »Ich will doch einfach nur verstehen, was da in euch gefahren ist.«
»Was in deine Großmutter gefahren ist, kann ich dir nicht sagen und ich will auch nur ungern wiederholen, was sie zu mir gesagt hat. Sagen wir einfach, ihre Tirade handelte von meiner Wesensart, meiner Heimat, vielen schändlichen Eigenschaften und Taten, die auf das Konto meiner ›Verwandten‹ gehen würden, und der Tatsache, dass ich unerwünscht sei.«
Sie fuhr sich mit einer Hand durch ihr Haar. Bildete ich mir das leichte Zittern in ihrer Hand nur ein oder hatten sie die Worte von Mamé wirklich so mitgenommen? Sie musterte den Grabstein vor uns und sah mich dann an.
»Weißt du … ich glaube, wir haben beide Dinge in unserer Vergangenheit erlebt, die besser unausgesprochen bleiben … Ich kann dir gern von dem erzählen, was es in meiner Welt gibt und was es nicht gibt … aber bitte lass meine Geschichte ruhen, so wie ich deine ruhen lasse. Okay?«
Ihre Welt?
Ich hatte von Anfang an gewusst, dass sie anders war, und je mehr ich sie kennenlernte, desto deutlicher wurde das. Die fremde Sprache, die nicht mal das Internet kannte; die Stärke und ein paar besondere Fähigkeiten, die ich bis heute bei keinem anderen Vampir gesehen hatte. Aber was meinte sie mit ›meine Welt‹?
»Natürlich …«, erwiderte ich leise. Ich zog meine Knie dicht an meinen Oberkörper und legte meine Arme um sie. Mein Blick war stur auf meine Turnschuhe gerichtet. Natürlich … auch ich hatte Geheimnisse … Ginga hatte inzwischen viel erahnt und manches erfahren – wegen unserer Sprachbarriere hatten wir gelernt, über jede Geste und jede Veränderung der Stimmung zu kommunizieren; aber wirklich gesprochen hatten wir auch über meine Vergangenheit nicht. Sie wusste, dass meine Eltern tot und mein Bruder Tammo verschwunden war und dass ich seit jener Nacht am Ende meines achtzehnten Geburtstags die Fähigkeit zu altern verloren hatte. Ich schien so etwas wie ein Vampir geworden zu sein. So wie Ginga. Aber irgendwas war anders an mir. Das hatten wir schnell gemerkt. Dass ich allerdings auch Feuerbälle schleudern konnte, das war uns bisher nicht bewusst.
»Sag mal, wie bist du eigentlich hier reingekommen? Nachts ist der Friedhof doch geschlossen.« Ginga entspannte sich etwas und versuchte ganz offensichtlich, mich aus meiner Grübelei zu reißen. Und zugegeben: Es gelang ihr. Ich musste leise lachen – völlig unangemessen angesichts des Ortes, an dem wir uns befanden.
»Ich komme meist nachts hier her. Ich will allein sein mit meinen Eltern, will mit ihnen reden können … und wenn ständig jemand mit einer Gießkanne hinter mir herumläuft, dann kann ich das nicht.« Ich sah auf und musterte die hohen Mauern rings um den Friedhof. »Gut, dass du mir mal beigebracht hast, was ein Vampir–«
»Oder Halb-Vampir!«
»Oder Halb-Vampir so alles kann.« Ja, Halb-Vampir traf es vielleicht am ehesten. Grinsend stieß ich mit meiner Schulter gegen ihre. Wir seufzten beide gleichzeitig und ließen unsere Köpfe gegeneinanderstoßen. So saßen wir für Sekunden, Minuten oder vielleicht Stunden gemeinsam vor dem Grabstein. Schweigend. Und es tat gut. Diesmal war alles Wichtige ausgesprochen. Die Stille tat gut.
»Cara?«
»Hm?«
»Tut mir leid, dass ich immer wieder abgehauen bin. Morgen erzähl ich dir über Nafishur, was auch immer du wissen willst okay? U-Und ich mach’s wieder gut! Versprochen!« Nafishur … Sie lehnte sich etwas weg von mir und sah mich an. »Ich gelobe Besserung und deine Eltern sind Zeugen. Lass uns so tun, als würde …«, sie sah auf ihre Uhr, irgend so ein Designerteil, »… als würde erst in einer halben Stunde dein Geburtstag anfangen, okay? Lass mich dich überraschen! Gib mir eine zweite Chance!«
Gingas Blick in der vergangenen Nacht war herzerweichend gewesen. Ich sah sie noch immer vor mir. Natürlich hatte ich ja gesagt. Auch wenn ich ihre Idee, meinen Geburtstag heute nochmal zu feiern, etwas gewöhnungsbedürftig fand. Noch gewöhnungsbedürftiger fand ich den Gedanken, dass sie mich mit etwas überraschen wollte. Ich hatte mich noch nicht entschieden, ob ich neugierig sein oder Angst haben sollte.
In diesem Moment aber war ich einfach nur froh, dass wir uns vertragen hatten. Sie würde mir mehr über ihre Heimat erzählen und ich würde nicht mehr nach ihrer Vergangenheit fragen. Das war ein guter Deal. Was das wohl für eine Heimat war? Eine ›Welt‹ hatte sie sie genannt? Wirklich? Oder war das nur ein weiterer Vokabelpatzer? Und wie hatte sie diese ›Welt‹ genannt? Nafi-Irgendwas. Noch nie gehört. Ich lehnte mich etwas zurück und genoss diesen friedlichen Augenblick. Ginga war unterwegs um, wie sie sagte, meine ›glamouröse Überraschung‹ vorzubereiten und Aby war im Garten oder der Nachbarschaft unterwegs. Ich hingegen saß in meiner kleinen Küche und trank Tee – meinen Tee. Ich schwenkte ihn leicht in seiner Tasse. Sie gehörte in das Lieblingsservice von Mama. Auf diese Weise war ich ihr gern im Alltag nah. Der Tee war noch heiß und sein Duft erfüllte den ganzen Raum. Das alte Radio lieferte mir die passende Hintergrundmusik für die Szene. Momentan erfüllte irgendeine reichlich blecherne Version einer Bachkantate den Raum. Ein Wunder, dass das Radio überhaupt noch lief – nachdem sich Ginga gegen den Angriff dieser letzten verbliebenen Technik im Haus mit einem Fausthieb verteidigt hatte … Dank des relativ dicken Vorhangs und des seit Sonnenaufgang wolkigen Himmels herrschte im Raum ein angenehmes Zwielicht. Es war ein guter Start, der auf einen guten Tag hoffen ließ – ohne Streit und Zickereien.
Ich goss mir noch zwei oder drei Mal nach, bevor ich aufstand und die Küche verließ. Ein ruhiger Morgen wie dieser war selten. Meist kam Ginga heim von Nächten in Clubs, in denen sie entweder gearbeitet oder gefeiert – oder beides – hatte. Sie war dann noch völlig aufgedreht und leistete mir morgens Gesellschaft bis ich losmusste. Ich hatte zwei Nebenjobs. Einer gefiel mir besonders gut: Aushilfe in einem kleinen Buchladen im Zentrum. Ich liebte Bücher über alles und was gab es Schöneres, als bei der Arbeit von dem, was man liebte, umgeben zu sein? Meinen zweiten Job hatte ich etwas später wenige Metrostationen weiter ergattert. Ich half in einem hübschen, kleinen Café aus. Dort gab es meiner Meinung nach die besten Gebäcke und mein Chef steckte mir oft das zu, was am Abend übrig geblieben war.
Ginga verstand nicht, weshalb ich in zwei Jobs tagsüber schuften wollte, anstatt in einer einzigen Nacht in einem Club an der Bar das Doppelte meines Monatseinkommens zu verdienen. Aber zum einen hatte ich nicht diese leuchtenden, hypnotisierenden Augen, mit denen man solche Trinkgelder aus Männern herauskitzelte, zum anderen war ich kein großer Fan von Clubs. Laut, stickig, viele Menschen, die meinen Hunger aufwecken könnten. Nein danke.
Unabhängig voneinander hatten mir beide Chefs gestern und heute frei gegeben. Sie wollten, dass ich ›ordentlich feierte‹ und dann ausschlafen konnte. Ausschlafen … Eigentlich sollte ich all das genießen und natürlich war das entspannte Frühstück auch ganz schön. Aber andererseits war mir inzwischen langweilig. Durch Ginga war ich es so gewöhnt, dass ständig irgendeine Form von Trubel um mich herum war, dass ich das Haus ohne diesen Trubel als irgendwie leer und tot empfand.
Ich schlenderte durch die Zimmer, bis ich ganz oben unterm Dach in meinem ankam. Es war noch angenehm schattig, aber das würde anders werden, sobald die Sonne sich wieder einen Weg durch die Wolken kämpfte. Ich mochte mein Zimmer sehr. Früher war das hier der Dachboden gewesen und ich hatte mir mit meinem kleinen Bruder Tammo ein Zimmer geteilt, aber als ich älter wurde, bauten sie eben diesen Dachboden für mich zu einem schönen, großen Zimmer aus. Bis auf einen kleinen Flur an der Treppe war im Grunde die gesamte Dachetage mein Reich. Durch diesen kleinen Flur hatte mein Zimmer die Form eines kurzen L. Am hinteren Ende des Zimmers stand unter der Dachschräge mein Bett. Direkt darüber befand sich ein Kippfenster. Ich liebte es, abends bei klarer Sicht vom Bett aus die Sterne zu beobachten. Ein echtes Highlight. Über Gingas Bett neben meinem – ein Ausziehsofa – befand sich kein Fenster. Aber nun steuerte ich auf mein zweites persönliches Highlight zu: Den kleinen Balkon. Meine Eltern hatten das obere Ende des Erkers für mich zu einem kleinen ›Ausguck‹ umgebaut. Papa hatte immer lachend gesagt ›Damit Eure Hoheit zum Volk winken kann‹. Ich musste noch immer lachen, wenn ich an seine Worte dachte. Direkt daneben stand ein Bücherregal. Es war den Schrägen im Zimmer angepasst und diente als Raumteiler. Hier verwahrte ich meine Lieblingsbücher.
Ich mochte Fantasy-Geschichten. Der Gedanke an andere Welten und phantastische Wesen war schön. Vampir-Romane besaß ich allerdings nicht mehr. In diesem Genre reichte mir mein eigenes Leben vollkommen aus.
Als ich gerade in Gedanken versunken nach einem Buch suchte, das ich lesen könnte, bis Ginga wieder da war, polterte es plötzlich über mir auf dem Dach. Im nächsten Moment stand ich auf dem Balkon und versuchte zu erkennen, wer da solchen Krach verursachte. Entweder waren es irgendwelche Vögel oder … – ich sah nach oben und entdeckte eine schwarze Schwanzspitze – ›oder‹ also. Aby hatte mal wieder zu hoch hinausgewollt.
»Aby!«
›C-Cara? Was machst du denn hier oben?‹
»Die Frage sollte ich wohl besser dir stellen!«
Ohne weitere Debatten kletterte ich nach einem kurzen Blick in die Nachbarschaft auf das Dach und angelte nach dem schwarzen Fellknäul, das hinter dem Schornstein des Kamins kauerte. Eine Minute später befanden wir uns wieder beide wohlbehalten in meinem Zimmer.
»Wie oft hab ich dir schon gesagt, dass du aufhören sollst, auf das Dach zu klettern! Die Dachziegel sind rutschig! Bei der Höhe helfen dir auch deine sieben Leben nicht weiter!« Ich wusste, dass diese Ansprache sinnlos war, aber ich hielt sie ihr dennoch jedes Mal seit ich