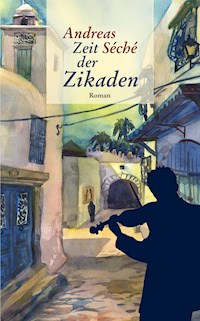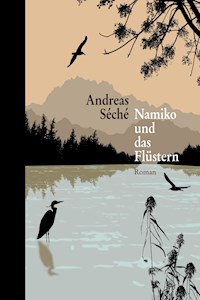
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der deutsche Reporter in den Gärten von Kyoto die geheimnisvolle Namiko kennenlernt, ist er sofort von ihr fasziniert: Die Studentin fährt gern Traktor, braucht zum Lesen kein Buch und entführt ihn mitten in der Nacht in den »Garten der Mondseufzer«. Und Namiko flüstert. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Gesten, Blicken und Berührungen. Je näher sie sich kommen, desto intensiver spürt er die große Magie der leisen Töne: in den alten Gärten von Kyoto, in der Natur – und in der Liebe. Schnell entwickelt sich zwischen den beiden eine tiefe Zuneigung. Doch der Tag seiner Heimreise nach Deutschland rückt immer näher. Und mit ihm eine folgenreiche Entscheidung.
»Mit viel Raffinesse werden die Selbstfindung eines Menschen und der Weg zu einem erfüllten Leben geschildert.« (Financial Times)
»Andreas Séché hat eine poetische Liebesgeschichte der besonderen Art geschrieben. Seine philosophischen Exkurse erinnern dabei an die besten Romane von Paulo Coelho.« (Nürnberger Nachrichten)
»180 Seiten große Lesefreude.« (Südwest Presse)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Andreas Séché
Namiko und das Flüstern
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Epilog
Anmerkungen
Leseprobe »Zeit der Zikaden«
Autor
Impressum tolino
Impressum tolino
Wir müssen nicht weiter gehen.
Aber tiefer.
Prolog
Manchmal schaue ich zum Mond auf und sehe mich selbst. Oft stehe ich dabei im Garten, direkt neben dem Nadelbaum, und während ich in den Himmel starre, drehe ich langsam einen Kiefernzapfen zwischen meinen Fingern. In letzter Zeit mag ich pathetische Gesten.
Irgendwie habe ich immer gewusst, dass die Zeit kommen würde, in der ich still den Mond anblicke und an meine Entscheidung denke und an das, was geschehen ist. Natürlich bin ich traurig, aber ich bin auch glücklich. Vielleicht ist das ohnehin dasselbe, wer kann das schon sagen.
Wenn ich den Blick wieder senke, schauen meine Augen durch das Fenster in den hell erleuchteten Raum hinein, und wenn ich mich konzentriere, sehe ich dort zwei verschwommene Gestalten auf dem Sofa sitzen, Rotwein trinken und lachend den Kopf nach hinten werfen.
Wir sehen uns, flüstere ich dann und blicke auf den Kiefernzapfen.
1
Immer wenn ich eine Flöte höre, muss ich an Namiko denken.
Namiko liebte die Flöte und die Töne, die aus ihr herausströmten, sie mit Haut und Haar erfassten und ihre Seele forttrugen in Welten, zu denen mir der Zutritt verwehrt war. Wenn Namiko eine Flöte hörte, schien sie wie in einen Bann gezogen. Meistens waren es die langsamen, tiefen Töne der japanischen Shakuhachi, deren Zauber sie trunken machte und dem auch ich mich nicht entziehen konnte. Aber um wie viel tiefer konnte die Musik in ihr Inneres vordringen als in meines.
Überhaupt liebte Namiko die sanften Töne. Das leise Atmen des ersten Oktoberwinds, das gedämpfte Geschwätz der Bäche von Kyoto, das Knistern des Schnees auf dem Moos, den fernen Klang buddhistischer Tempelglocken und natürlich das Flüstern.
Manchmal lag sie einfach neben mir im Gras, und dann spürte ich bereits, dass sie gleich wieder zu flüstern beginnen würde. Flüstern, sagte Namiko immer, das sei betonen, indem man gerade nicht betone. Wenn man die Stimme zurücknehme, verlagere sich das Gewicht von der Form des Gesagten auf seinen Inhalt und verleihe dem, was man ausdrücken wolle, den unaufdringlichen Hauch des Bedeutungsvollen.
»Flüstern«, flüsterte sie mir einmal ins Ohr, »ist Intimität mit der Stimme.«
Solche Sachen konnte nur Namiko sagen.
Wenn ich heute, nach all den Jahren, zurückblicke, dann überkommt mich jenes seltsame Gefühl, das Glück und Wehmut in sich vereint. An dem Tag, als unsere Wege sich zum ersten Mal kreuzten, hatte ich ja keine Ahnung, wie machtvoll das Schicksal gerade im Begriff war, in meine Zukunft einzugreifen. Das war in Kyoto damals. Namiko trat in mein Leben mit der stummen Herausforderung eines Rätsels, das endlich gelöst werden wollte. Wären wir uns damals nicht begegnet, manches wäre anders verlaufen in meinem Leben. Vieles hätte ich verpasst, weil es durch meine Wahrnehmung hindurchgesickert wäre wie Wasser durch ein Sieb. Dank Namiko weiß ich, dass für mich das wichtigste Geschenk der Liebe in der Nähe liegt und nicht im Freiraum. Wäre Namiko nicht gewesen, ich hätte vielleicht niemals die sanften Töne des Lebens wispern hören. Plötzlich war ich auf der Reise durch mein eigenes Leben bewegungslos verharrt und hatte überrascht die Luft angehalten, und da war es dann gewesen, das Atmen einer ganzen Stadt, ihrer Architektur, ihrer flüsternden Gärten, ihrer Rätsel und Schriftzeichen. Und auch in der Natur war ich mit einem Mal von einem wohltuenden Raunen durchdrungen, denn das Flüstern der Welt ist allgegenwärtig.
Ich war damals neunundzwanzig, arbeitete als Redakteur für eine deutsche Zeitschrift und war nach Kyoto gekommen, um einen Artikel über japanische Gärten zu schreiben. Mein Plan bestand darin, mir einige Gartenanlagen anzusehen, im alten Geisha-Viertel Gion meine Wahrnehmung ein bisschen spazieren zu führen und nach einer Woche wieder nach Hause zu fliegen. Aber was sind schon Pläne? Man macht sie, und wenn man einfallslos genug ist, hält man sich daran. Tatsächlich sind Pläne eine groteske Angelegenheit: Wenn jemand sie schmiedet, scheint er erfinderisch, aber eigentlich zeugt es von mehr Ideenreichtum, sich nicht an sie zu halten. Denn Pläne sind nichts weiter als Entwürfe, die eine trügerische Sicherheit verleihen und zur Ausrede werden, wenn man nicht auf die Spontaneität des Augenblicks reagieren möchte.
Seit einer halben Stunde schlenderte ich durch den Garten des Silbernen Pavillons und versuchte, mit eigenen Augen wiederzuerkennen, was ich zuvor in Büchern über die Gartenkunst Japans gelesen hatte. Da verirrte sich mein Blick und fiel auf eine Frau. Sie lehnte an einem Kirschbaum und hatte ihr weißes Männerhemd hochgerafft, damit sie die Hände in die Hosentaschen stecken konnte. Das glatte, schwarze Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden, und während sie auf dem Bügel ihrer Sonnenbrille herumkaute, sprang die Neugier aus ihren Augen. Sie musste mich zuerst entdeckt haben. Als ich sie erfasste, ruhte ihr Blick bereits in meinem.
Mein erstes Gefühl war Verblüffung. Fast war mir, als seien wir hier miteinander verabredet gewesen und beide erleichtert, uns endlich zu sehen. Ihr Blick trug einen vorwitzigen Forschungsdrang zu mir herüber, blätterte hemmungslos mein Äußeres auseinander und drohte in meine Innenwelt zu spähen. Meine Empfindungen verwischten. Ich schaute zur Seite und versuchte, meine Gedanken für ein paar säuberlich gepflanzte und geschnittene Büsche zu interessieren. Doch tief in mir war in diesem kurzen Augenblick etwas geweckt worden, das für Pflanzen nur wenig übrig zu haben schien, also hielt ich der Versuchung nur kurz stand und blickte wieder zum Kirschbaum hinüber. Die Frau stand nicht mehr dort, und ich sah sie auf eine nahe gelegene Bambusgruppe zugehen, ohne dass sie sich noch einmal umdrehte.
Dann war sie weg.
2
Vier Tage später schwang unsere Begegnung noch immer leise in mir nach. Ich hatte mir vorgenommen, mich von theoretischen Abhandlungen über japanische Gärten zu lösen und stattdessen lieber selbst darin zu baden. Also saß ich im Zengarten, und um mich herum keimte die Stille. Die Landschaft hatte sich stumm vor mir aufgebaut und wartete nun darauf, gewürdigt und, wenn das von einem Europäer nicht zu viel verlangt ist, auch verstanden zu werden. Denn die Zengärten der alten Kaiser- und ehemaligen japanischen Hauptstadt Kyoto sind keine diktatorischen Kunstwerke: Sensibel haben Mönche Ordnung in das Kiesfeld gerecht, aber niemand schreibt vor, was der Staunende damit anfangen soll. Vielleicht möchte er sich an ein Reisfeld erinnern, vielleicht an eine Wüste, und vielleicht fühlt er sich auch eingeladen, sich in übermütigen Metaphern zu verlieren, während eine Eidechse durch seine Wahrnehmung huscht. Gartenbaulich hingegen ist hier nichts dem Zufall überlassen. Jeder Baum, jeder Busch und jeder Stein wird von Menschenhand geplant, gesetzt und gehegt. Und doch hat der Garten nichts von dem Reißbrettflair eines, sagen wir, französischen Gartens, in dem man manchmal fürchtet, über die Einstichlöcher des Zirkels zu stolpern, mit dem einst die Planer die Konturen auf dem Millimeterpapier scharf zogen. Japanische Gärtner sind wohl näher am Herzschlag der Natur. Mit einem Sinn für das Filigrane und für Nuancen haben die Japaner, wie ich irgendwo gelesen hatte, zahllose Wörter für Regengeräusche und für das Aufschlagen von Regen auf unterschiedlichen Oberflächen erfunden; so lässt sich ein Garten zur Welt bringen, als habe die Erde selbst ihn geboren.
Im Zengarten hüllte mich die Harmonie ein. Ich versuchte, danach zu greifen, wandelte ein wenig umher und überquerte eine kleine geschwungene Holzbrücke, die geduldig über einem Bach ausharrte. Den benachbarten See beseelten Zierkarpfen, die sich streicheln ließen und von denen manche so wertvoll waren wie ein Auto. Die vier Elemente des Zengartens sind Stein, Wasser, Baum – und Moos, das grüne Meer des Festlandes, das über die Steine schwappt und die Baumrinden emporklettert. Ich bemühte mich, nicht auf das Moos zu treten, denn das wird in Japan nicht naserümpfend als Unkraut abgetan. Moos, das hält nicht nur die Feuchtigkeit gefangen, Moos bedeutet auch Alter, und dem Alter und der Vergangenheit bringen viele Japaner etwas wahrlich Seltenes entgegen: Verehrung. Auch ich sollte den Wert des Gewesenen bald vollkommen neu schätzen lernen, aber davon ahnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Und nicht nur vor dem Moos, überhaupt vor der Natur pflegen viele Japaner eine gesunde Ehrfurcht, kein Wunder bei all den Erdbeben und Taifunen, die das Land immer wieder durchwühlen. Und der in Japan verbreitete Shintoismus, der kami no michi, der »Weg der Götter«, bietet eine verschwenderische Auswahl an Naturgöttern und Geistern, den kami. Weil sie überall stecken, in jedem Stein, Baum, Fluss, eben in allen Dingen, wird Japan gelegentlich das »Land der acht Millionen kami« genannt. Dieses Idyll meinen die Japaner, wenn sie Kyoto nihon no furusato nennen, sozusagen die Geburtsstätte Japans.
Vor einer säuberlich zurechtgestutzten Kiefer endete mein gedankenversunkenes Dahinschlendern. Ich blätterte in meinem Reiseführer und fand in einem Kapitel über Gartenkunst, dass Kiefern Langlebigkeit symbolisieren. Plötzlich hörte ich eine Stimme hinter mir.
»Konnichiwa.«
Überrascht blickte ich von meinem Buch auf und drehte mich um. Vor mir stand die Frau mit dem Männerhemd. Diesmal trug sie ein rot-weiß kariertes. Sie hatte es locker über eine weiße Jeanshose hängen und ihre Haare wieder zu einem Pferdeschwanz gerafft, der von einem einfachen weißen Band gehalten wurde. Dass Konnichiwa guten Tag bedeutete, hatte ich in den paar Tagen meines Aufenthaltes zum Glück gelernt.
»Konnichiwa«, stammelte ich also zurück, und ich spürte, dass ich rot wurde. Was nun? Mehr Japanisch konnte ich nicht, und gerade wollte ich aus den Tiefen meines Gedächtnisses mein Schulenglisch hervorkramen, als die Frau mir mit einem sanften Lächeln zu Hilfe kam. »Wenn Sie kein Japanisch können, sollten wir vielleicht in Ihrer Sprache weiterreden«, schlug sie vor.
»Sie sprechen Deutsch!«, brachte ich heraus und gab mir für diese einfältige Feststellung innerlich selbst eine Ohrfeige.
»Von einer Germanistikstudentin sollte man das wohl erwarten können«, lachte sie. »Was sagt Ihr Buch über die wartende Geliebte?«
»Hm?«, fragte ich und blickte verdutzt auf meinen Reiseführer.
»Die wartende Geliebte. Diese Kiefer da!« Sie deutete auf den Baum, vor dem wir gerade standen, und lächelte mich nachsichtig an. »Das japanische Wort für ›Kiefer‹ klingt genauso wie das für ›warten‹. Was, wenn der Baum eine Frau darstellt, die sehnsüchtig auf ihren Geliebten wartet?«
»Was, wenn ich einen Mann darstelle, der sehnsüchtig auf Ihren Namen wartet?«, fragte ich. Offenbar hatte ich mich wieder halbwegs gefangen.
»Namiko«, lachte sie und streckte mir sehr unjapanisch die Hand entgegen. Ich nannte ihr meinen Namen.
»Ich bin überrascht. Jetzt treffe ich Sie schon zum zweiten Mal in einem Garten, und Sie verstehen seine Sprache nicht?«
»Nun –«
»Dieser Garten hier, er erzählt Ihnen Geschichten. Sie befinden sich quasi in einem Pflanzen gewordenen Märchen. Das Wort für ›Kiefer‹ ist matsu, und matsu bedeutet auch ›warten‹.«
»Ich spreche leider kein Japanisch, ich kann bloß Konnichiwa«, lächelte ich.
»Da gibt es nur eins –«
»Jemanden wie Sie fragen«, schlug ich vor.
»Japanisch lernen«, schmunzelte sie zurück.
»Bis es so weit ist, übersetzen Sie mir, was so ein Garten sagt?«
Ich fragte das nicht aus beruflichem Interesse. In diesem Moment konnte ich mich nicht einmal daran erinnern, überhaupt je einen Beruf gehabt zu haben. Ich sah nur Namiko und wollte sie mit Fragen wie dieser daran hindern, wieder wegzugehen.
Aber da war noch mehr. Da war das Gefühl, die Geschichte mit der wartenden Geliebten und all den anderen als Pflanzen getarnten Gestalten um mich herum könnte irgendwie wichtig sein.
Wir schlenderten zusammen weiter und verließen den kleinen Garten, um nach einem Café Ausschau zu halten.
»Woher wussten Sie, dass ich aus Deutschland bin?«, fragte ich unterwegs.
»Wir sind uns ja schon im Garten des Silbernen Pavillons begegnet. Darum hab ich heute etwas genauer hingesehen und das da entdeckt«, sagte sie und deutete lächelnd auf den deutschsprachigen Reiseführer in meiner Hand. »Ich musste Sie einfach ansprechen, denn dass man sich gleich zweimal in einem Garten begegnet, kommt wohl nicht so häufig vor. Obwohl ich selbst ziemlich oft in den Gärten bin.«
»Wozu?«
»Zum Lesen.«
»Ohne Buch?«, fragte ich und blickte suchend an ihr herab.
»Dafür brauche ich kein Buch«, sagte sie.
Wir schwiegen eine Weile.
Schließlich betraten wir ein Café, wo Namiko sich einen Cappuccino bestellte, in den sie fünf Löffel Zucker kippte. Ich ließ mir einen Kaffee kommen und saugte ihn schwarz aus der Tasse, obwohl ich ihn sonst mit Milch trinke. Aber irgendwie wollte ich auf Namiko abgehärtet wirken. Männer sind manchmal so.
»Find ich schön, dass unter der Rinde einer Kiefer mehr steckt als nur Holz«, sagte ich und rollte beim Trinken die Zunge ein, um die Geschmacksknospen vor dem Schlimmsten zu verschonen.
»Manchmal führe ich Touristen aus Europa herum und versuche, die Sprache der Gärten zu übersetzen.«
»Zum Beispiel, indem Sie die wartende Geliebte enttarnen?«
»Ist das nicht ein unglaublich starkes Bild? So eine Kiefer steht da, Jahr für Jahr, unerschütterlich. Ich finde, das lässt eine Menge Vertrauen erkennen in denjenigen, den sie erwartet. Sie bleibt. Schlägt Wurzeln. Wartet, wartet, wartet. Wenn man übrigens die Schriftzeichen für ›Zeit‹ und ›warten‹ nebeneinander setzt, bilden sie zusammen das Wort ›Hoffnung‹. Ich denke, die Hoffnung auf die gemeinsame Zukunft schöpft die Wartende aus der gemeinsam erlebten Vergangenheit. Deshalb kann sie so lange ausharren. Sie weiß, dass er irgendwann kommen wird, bei all dem, was sie verbindet. Ein großartiger Vertrauensbeweis, finden Sie nicht?«
»Obwohl sie schon so lange ohne ihn ist, müssen die beiden sich weiterhin sehr nahe sein.«
»Ja«, flüsterte Namiko, und das war das erste Mal, dass ich sie flüstern hörte, »das müssen sie.« Gedankenverloren sah sie mich an. »Kiefern in japanischen Gärten symbolisieren auch Beständigkeit.«
»Beständigkeit?«
»Wegen der Farbe der Nadeln. Kiefern sind immergrün.«
»Das ist – wirklich schön.«
Namiko blickte mich schweigend an und fuhr sich nachdenklich mit dem Zeigefinger über den Nasenrücken. Dann holte sie einen Stift hervor und begann auf eine Serviette zu kritzeln. »Magst du dir morgen einen geheimnisvollen Garten ansehen?«, fragte sie schließlich und war damit unkompliziert zum Du übergegangen.
Ich nickte. Während sie mir den Treffpunkt erklärte, schrieb sie weiter auf der Serviette. Dann stand sie auf.
»Ich muss los. Ich freu mich auf morgen. Hier«, sagte sie, drückte mir die Serviette in die Hand und ging. Auf dem Papier stand ein rätselhafter Text:
Der Zenmeister Sekkyo fragte seinen Mönch: »Kannst du die Leere fassen?« Der Mönch bildete mit seinen Händen ein leeres Gefäß. »Du hast ja gar nichts drin«, sagte Sekkyo unzufrieden.
»Zeig mir einen besseren Weg«, forderte der Mönch den Meister auf. Da packte Sekkyo die Nase des anderen und zog kräftig daran. »Au«, rief der Mönch. »Du tust mir weh!«
»Das«, sagte Sekkyo, »ist der Weg, die Leere zu fassen.«
Ich verstand kein Wort.
3
Mit dem Taxi fuhr ich zurück ins Hotel. An der Rezeption erkundigte ich mich, ob es möglich wäre, meinen Aufenthalt zu verlängern. Der freundlich lächelnde Mann hinter dem Schalter tippte etwas in seinen Computer und nickte. Also schickte ich ein Fax an die Redaktion in Hamburg und bat darum, an meine Recherchen in Japan noch drei Wochen Urlaub anhängen zu dürfen. Dann setzte ich mich in die Lobby, blickte durch die Glasfront nach draußen und dachte an Namikos Geschenk. Was hatte der Text auf der Serviette zu bedeuten? Erwachsene Männer, die sich an der Nase ziehen! Und was hat das mit dem Fassen der Leere zu tun? Was sollte das überhaupt: die Leere fassen? Wie auch immer ich den kurzen Dialog in meinen Gedanken hin und her wendete, er ergab einfach keinen Sinn. Er sträubte sich. Ich beschloss, mich später damit zu beschäftigen, schließlich gingen mir gerade viel wichtigere Dinge durch den Kopf.
Vielleicht war diese Frau verrückt. Jedenfalls las sie gerne ohne Buch, kippte löffelweise Zucker in ihren Cappuccino, philosophierte über Bäume und kritzelte bizarre Texte auf Servietten – das war nicht eben das, was ich von einem typischen Großstadtmenschen erwartet hätte. Anständige Großstadtmenschen laufen zielstrebig wie Pfeile über Zebrastreifen, schauen niemandem in die Augen, denken einmal wöchentlich an Selbstmord und halten ihre Neurosen instand. In einem Baum sehen sie einen Baum und nicht eine wartende Geliebte.
Normalerweise.
Ich hatte Feuer gefangen. Nicht nur, was Namiko selbst betraf. Eine geheime Welt hatte ihr Eingangstor einen Spaltbreit geöffnet und mich kurz hineinspähen lassen. Eine Welt, die mitten in der normalen Welt zu existieren schien, am selben Ort und zur selben Zeit. Ich hatte die Chance, diese versteckte Welt zu betreten.
Und Namiko hatte den Schlüssel.
Etwas Magnetisches streckte sein Kraftfeld nach mir aus und zog meine Gedanken in eine neue Richtung. Und so, wie ich beim ersten Anblick von Namiko überzeugt war, wir hätten einander schon erwartet, schien auch das, was sich da hinter der Fassade des Alltäglichen versteckt hielt, schon immer für mich da gewesen zu sein. Für einen kurzen Moment glaubte ich, der Sessel unter mir habe sich in einen mit weichem Moos bewachsenen Fels verwandelt und ein leises, unbestimmtes Wispern streife mich.
Auf der Straße vor der Glasfront fuhr ein Sattelschlepper vorbei. Ein Mann im dunkelgrauen Anzug machte sich an einem jener Getränkeautomaten zu schaffen, die man in Japan an jeder Straßenecke findet. Ein Mädchen saß auf der Kante eines Blumenkübels und wiegte ein Baby im Arm. Der Feierabend war da, und man hätte meinen können, überall sei der Asphalt aufgeplatzt und die Menge krieche direkt daraus hervor. Schwärme abgespannter Menschen bewegten sich hinter der Scheibe wie stumme Fische in einem Aquarium. Ein Taxi hielt vor dem Hoteleingang und entließ zwei Frauen, die lachend in die Lobby traten und durch die geöffnete Tür den Tumult der Straße mitbrachten.
Die Außenwelt sickerte herein.
Während ich im Eingangsbereich des Hotels saß und durch die Glasfront nach draußen auf die keuchende Wirklichkeit Kyotos blickte, beschloss ich herauszufinden, was da im Verborgenen lag. Meine freien Tage sollten kein Urlaub in Japan werden. Eher eine Reise in jene rätselhafte Welt, deren Anwesenheit ich bereits spürte, noch bevor ich in sie eingetaucht war.
Etwas wartete auf mich.
4
Heute, wo der Überblick möglich ist, weiß ich, dass die Faszination, die Namiko von unserer ersten Begegnung an auf mich ausübte, auch mit einer früheren Liebe zu tun hatte, die gar keine war und die sich deshalb wenige Monate vor meiner Reise nach Japan in Nichts aufgelöst hatte.
Sie hieß Eva und ließ sich genauso leicht zu delikaten Fehltritten verleiten wie ihre apfelpflückende Vorgängerin. Als ich mich von ihr löste, hatte die Beziehung ihr Haltbarkeitsdatum eigentlich schon lange überschritten, und folglich war vieles faul; aber das Entscheidende war, dass ich Evas Litaneien über die Wichtigkeit von Freiräumen nicht mehr ertragen konnte. Wann immer sie wieder einmal eigene Wege beschritt, an denen sie mich nicht teilnehmen ließ, schmückte sie ihre Ansprachen mit Thesen wie denen, dass Abstand das Wichtigste sei in einer Beziehung, dass ein Liebespaar ohne die nötige Distanz nicht atmen und darum nicht überleben könne und dass jeder Mensch seine Geheimnisse brauche. Ihre Verteidigungsreden fluteten in mich hinein wie Wasser in eine Pfanne mit heißem Fett.
Vielleicht war ich wirklich langweilig. Ich hatte keine Geheimnisse. Wenn ich ohne sie weggehen wollte, wusste sie, warum, mit wem und wohin, ohne dass sie mich danach hätte fragen müssen. Wenn ich wiederkam, erzählte ich ihr, wie es gewesen war. Wenn Eva alleine weg war, erzählte sie anschließend im Grunde nichts. Sie war dann sehr aufgekratzt, blickte gedankenverloren ins Nichts, und wenn ich sie fragte, wie es gewesen sei, wurde sie aggressiv. Mit Aggression schafft man Distanz, jedes in die Enge getriebene Tier weiß das.
Eva nutzte Aggressionen, um Fragen nicht beantworten, seltsame Situationen nicht klären und mich an ihrem Leben nicht teilhaben lassen zu müssen. Einmal lag ein Geschenkband mit roten Herzchen in ihrem Bett. Als ich sie danach fragte, wurde sie wütend und warf mir vor, ihr nicht zu vertrauen. In dem Moment dachte ich, es sei wohl tatsächlich an der Zeit, ihr nicht mehr zu vertrauen. »Mir hat jemand was geschenkt«, sagte sie schließlich, als könne es für ein Geschenkband eine andere Erklärung geben.
»Und was?«
»Ein Parfum.«
»Und wer hat es dir geschenkt?«
»Kennst du nicht.«
Mit jeder einzelnen Antwort wuchs in mir der Verdacht, dass Eva etwas zu verbergen hatte. Ich stellte mir damals oft vor, ich wäre mit einer Frau zusammen, die solche Fragen ganz einfach beantwortet hätte, und dann würden wir uns lachend in den Armen liegen, weil ich etwas missverstanden hatte und die Wahrheit ganz banal aussah. Aber so war es nicht mit Eva. Evas Lieblingssatz war: »Ich muss mich ja nicht rechtfertigen.« Natürlich musste Eva sich nicht rechtfertigen. Die Frage ist ja auch eher, ob man sich rechtfertigen möchte.
Auch meine eigene Rolle in diesem merkwürdigen Spiel missfiel mir immer mehr. Wie um das Gleichgewicht zu halten, war auf meiner Seite der Wippe auch ich immer weiter nach außen gekrochen, was uns nicht nur noch mehr voneinander und vom Mittelpunkt der Balance entfernte, sondern auch meinen Wunsch der Teilhabe an Evas Leben in ein Bedürfnis nach Kontrolle verwandelte. Ich erinnere mich, dass mich in den letzten Wochen der Sex mit ihr abgestoßen hatte. Ich fand ihre Küsse ekelerregend. Sie küsste so, wie man gegen das Schmelzen von Vanilleeis anleckt. Ich lag neben ihr und hoffte, dass sie mich nicht anfassen würde, dass sie keinen Sex in die Wege leiten würde, denn es war immer ein »in die Wege leiten«. Sex wuchs nicht, Sex wurde beschlossen und vollzogen.
Ich hatte das vor der Beziehung mit Eva nie erlebt, dass Sexualität sich auf das Zusammendübeln zweier mit Fleisch umhüllter Skelette reduzieren ließ. Eva fand das so in Ordnung. Ich fand das erbärmlich. Irgendwo auf dem Weg durch unsere Beziehung musste mir die rosarote Brille heruntergefallen sein. Ich sah einfach viel zu klar, was ich an Eva hatte: nichts.
Ich warf Eva aus meiner Wohnung, aus meinem Fotoalbum, aus meinem Herzen und aus meinem Leben, und es schmerzte nicht. Weh tat nur, dass es nicht wehtat, denn das war ein Zeichen dafür, dass ich Lebenszeit verschwendet hatte. Ich finde, man hat ein Recht darauf, dass ein Abschied wehtut. Denn die Fähigkeit, aus Liebe zu leiden, setzt die Fähigkeit zur Liebe voraus. Auch wenn sie sich im Schmerz viel stärker äußert als im Glück. Wenn eine Beziehung in die Brüche geht, dann hat man einfach einen Anspruch darauf, sich den ganzen Tag unter seiner Bettdecke verkriechen zu wollen und in Selbstmitleid zu versinken. Man sollte sich schlecht genug fühlen, um täglich einen Freund anzurufen und ihm wieder und wieder dasselbe vorzujammern. Und wenn er ein wirklich guter Freund ist, wird er mit dem Zuhören nicht aufhören, wenn er es nicht mehr hören kann, sondern wird warten, bis man selbst seine eigene Litanei nicht mehr erträgt. Dass eine Beziehung die Sache wert war, merken wir an dieser betäubenden Ich-Entleerung, nachdem in unserem Inneren noch jemand anders Platz gefunden hatte und diese besondere Art von Erfüllung mit einem Mal entfällt. Wenn wir das Tragische inszenieren wollen, neigen wir vielleicht dazu, diese Ich-Entleerung mit Alkohol wieder aufzufüllen. Aber was immer wir tun, Trauer sollte nach einer Trennung verdammt noch mal aufkommen.
Bei Eva war da nichts. Ich hatte nie die Gelegenheit gehabt, sie zu durchdringen, und ich war auch nicht durchdrungen von ihr. Sie bestand auf ihren Freiräumen, die sie zum Luftholen brauchte. Wahrscheinlich wollte sie sicher gehen, dass sie mich nicht einatmete.
Also schickte ich Eva in die Wüste. Dort hatte sie allen Platz der Welt zum Atmen.
5
»Konbanwa«, lächelte Namiko. »Das bedeutet ›Guten Abend‹.«
»Konbanwa, Namiko-san«, versuchte ich.
Namiko hockte auf dem Sims eines Springbrunnens und ließ zwei Kieselsteine in ihrer Hand kreisen. Sie trug ein schlichtes rotes Kleid, weiße Schuhe, einen kleinen braunen Rucksack über der Schulter und einen weißen Reif im Haar. Mit dem Bus war ich eine Weile unterwegs gewesen, denn der Treffpunkt lag am Stadtrand. Offenbar ein Wohngebiet, wie mir auf dem Weg von der Busstation zum Springbrunnen aufgefallen war.
Namiko sprang auf und warf die Steine ins Wasser. »Der Garten ist gleich hier«, sagte sie und marschierte los.
»Mitten im Wohngebiet gibt es einen öffentlichen Garten?«, fragte ich und folgte ihr.
»Wer sagt, dass er öffentlich ist?«
»Nicht?«
»Nein.«
»Wem gehört er?«
»Frag lieber, wie wir hineinkommen.«
»Wie kommen wir hinein?«
»Über diese Mauer hier!« Namiko war stehen geblieben und deutete auf eine weiße Mauer vor uns. Ein paar Bäume standen dahinter und reckten ihre Kronen über die Wand, als seien sie Schaulustige hinter einer Polizeiabsperrung.
»Namiko?«
»Ja?«
»Wir – ich meine, wir brechen nicht da ein, oder?«
»Nein, wir klettern einfach über diese kleine Mauer und schauen uns den Garten an«, sagte sie und zog sich hoch. Mit einem Rascheln verschwand sie. »Komm«, hörte ich ihre leise Stimme von drüben. Ich zog mich über die Mauer und ließ mich auf die andere Seite fallen. Plötzlich fühlte ich mich wie ein Entdecker, der Neuland betritt.
»Hier entlang«, flüsterte Namiko und trat durch ein paar Büsche.
Die Sonne stahl sich bereits davon und tauchte uns in ein diffuses goldenes Licht. Ich folgte Namiko zu einem kleinen Weg aus flachen Steinen, deren unregelmäßig geformte Kanten auf harmonische Weise ineinander griffen, ohne in eintönige Symmetrie zu verfallen.
- Ende der Buchvorschau -
Impressum
Texte © Copyright by Andreas Séché, Ulmenweg 8, 41379 Brüggen, [email protected]
Bildmaterialien © Copyright by Covergestaltung: Andreas Séché, unter Verwendung eines Bildes von Balint Radu, Fotolia. Die Abbildungen der asiatischen Schriftzeichen im Buch wurden weiß unterlegt, damit sie auch auf schwarzem Hintergrund (»Nachtmodus«) gut zu lesen sind.
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 978-3-7393-6390-5