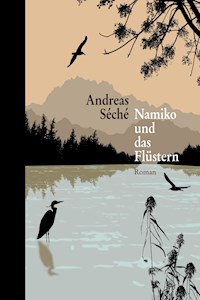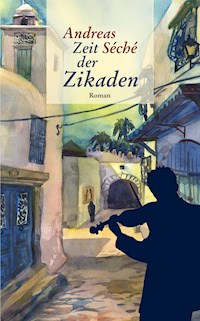
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Syrakesh, ein malerischer Inselstaat im Pazifischen Ozean. Eines Morgens wird am Strand eine zerstörte Violine angeschwemmt. Viele Meilen entfernt findet ein alter Schäfer einen völlig entkräfteten Mann in der glutheißen Wüste und nimmt ihn bei sich auf. Es ist Selim, der Straßengeiger, der die besondere Gabe hat, mit seinem Violinspiel tief in die Herzen der Menschen vorzudringen. Sein eigenes Herz hat er der zarten Miriam geschenkt. Doch dann riss das Schicksal die beiden Liebenden auseinander, und im Kampf um ihr gemeinsames Glück entfesselte der Straßengeiger Ereignisse, die bald das ganze Inselparadies erfassen sollten …
Stück für Stück erzählt Selim seine unglaubliche Geschichte. Erst spät begreift der alte Schäfer, dass auch er ein Teil davon ist.
Eine poetische Liebesgeschichte über die Macht der Leidenschaft.
»Märchenhaft, mitreißend, gefühlvoll – ein kleines Meisterwerk« (vital)
»Verzaubert seine Leser. Schöner lassen sich Literatur und Musik wohl kaum kombinieren« (Nürnberger Zeitung)
»Wunderbar poetische Sprache« (ekz-Bibliotheksservice)
»Grandios poetisches Erzählwerk. Fesselt von der ersten Seite an« (Nürnberger Nachrichten)
»Wortgewaltig und dennoch poetisch« (Aachener Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Andreas Séché
Zeit der Zikaden
»Ich werde deinen Garten zerstören und dich in die Wüste jagen«, sagte der böse Dschinn.
»Die Pflanzen magst du vernichten können«, antwortete Amina. »Aber den Garten trage ich in mir, und wenn ich ihn in den Sand weine, wird er dort wieder aus dem Boden hervorbrechen.«
Legenden von Syrakesh
Ouvertüre
Adagio
Was reglos scheint, hebt vielleicht die Welt aus den Angeln. Was mit viel Getöse rumort, rührt womöglich nur Altbekanntes um und bewegt doch nichts. Vermutlich waren die tobsüchtigen Wellen, die den Ozean in der Nacht durchwühlt haben, nichts weiter als gut kaschierter Stillstand. Und nun, wo das Meer friedlich und schweigsam in der Behaglichkeit eines schlaftrunkenen Morgens döst und sich nach menschlichem Ermessen nichts rührt, bereitet die Tide den nächsten Wandel vor. Denn keine Kraft der Welt vermag die Gezeiten des Lebens zu unterdrücken.
Mit jener sanftmütigen Trägheit, die sich nur gigantische Schöpfungen wie der Ozean, Wale oder der Mond gestatten können, gibt sich die blaue Wasseroberfläche mit einem kaum merklichen Schaukeln zufrieden. Vielleicht weil das größte aller Meere sich an diesem Tag seinem Namen besonders verbunden fühlt, denn Ferdinand Magellan hat es den Pazifischen, den friedlichen Ozean getauft.
Am Strand beugen sich ein paar Palmen über weißen Sand, als sei dieser geschundene Inselstaat in den letzten Jahren nicht die Hölle, sondern das Paradies gewesen. Möwen schweben über dem Wasser und kreischen in die Seeluft hinein, was immer ihnen in den Sinn kommt, denn sie gehören zu den wenigen Geschöpfen des Landes, denen die Möglichkeit unverhohlenen Gemeckers nie genommen worden war. Ansonsten schweigt der junge Tag, aber sein Atmen ist in einer leichten Brise spürbar, die landeinwärts streicht.
Etwas schwimmt auf den Strand von Syrakesh zu. Nicht geradewegs, sondern in einem geduldigen Vor und wieder Zurück, auf den schwungvollen Umwegen eines Ozeanwalzers. Zur heimlichen Musik kleiner Wellen naht es heran, zögernd, als müsse es erst noch auskundschaften, ob die Luft rein sei und es an Land geschwemmt werden wolle. Umspült von Wasser reckt es ab und zu seinen Hals in die Höhe wie ein Schiffbrüchiger kurz vor dem Ertrinken. Endlich rutscht es über das rettende Ufer, und das Meer gleitet von ihm ab wie ein Gewand. Für einen Moment bleibt es nackt im Sand liegen, aber dann kommen die Wellen noch einmal zurück und tragen es ein Stück weiter den Strand hinauf, wie um ganz sicherzugehen. Kurz streift es eine Muschel, und aus dem Sand steigt röchelnd der versalzene Ton einer Violinsaite auf.
1. Satz
Largo
Als der alte Ibrahim sich gerade eine Dattel in den Mund stecken will, während er über die Rücken seiner Schafe hinweg in den Horizont starrt, entdeckt er dort draußen einen Mann, der auf allen vieren aus der Wüste gekrochen kommt. Maskhran ist ein kleiner Ort von solch regloser Gemütlichkeit, dass jede schnelle Bewegung die Jüngeren sofort tief beeindruckt, den Älteren hingegen als entbehrliche Prahlerei erscheint, und so bleibt Ibrahim zunächst einfach auf seinem Stein hocken und beobachtet den sich aus der Ferne nähernden Menschen.
Maskhran liegt weit unten in Syrakesh, und noch weiter südlich bringt nur die Wüste den Mut auf, sich der Hitze auszusetzen. Vermutlich ist das der Grund, weshalb Ibrahim sich schließlich doch erhebt und die Augen zusammenkneift. Der Sand, aus dessen schattenloser Welt der Mann angekrochen kommt, ist heiß wie eine Ofenplatte, und so weit Ibrahim zurückdenken kann, hat sich noch nie jemand in die Hitze hineingewagt, und die bisher einzige Bewegung aus ihr heraus waren die Dünen selbst, die sich alle paar Jahre bis in den Schatten der Häuser von Maskhran schieben, als sei sogar der Sand auf der Flucht vor der Glut.
Ohne den Blick von der Gestalt zu nehmen, greift Ibrahim nach den Zügeln seines alten Esels, dann macht er sich auf den Weg, dem Fremden entgegen. Der Mann aus der Wüste ist am Ende seiner Kräfte und wird eher vom Sand vorangetragen, so als wollten Millionen kleine Körnchen beweisen, dass sie zusammen Dinge in Bewegung setzen können, die größer sind als sie selbst. Als Ibrahim näher kommt, sieht er, dass sich unter den zerzausten Haaren und dem ungepflegten Bart das Gesicht eines höchstens Vierzigjährigen verbirgt. Seine Haut ist von der Sonne verbrannt und seine karge Kleidung grau. Die nackten Füße sind glutrot, und die Schuhe hat der Fremde über seine Hände gestülpt. Als er Ibrahim und den Esel auf sich zukommen sieht, formulieren seine aufgeplatzten Lippen ein paar tonlose Worte, dann entzieht die Aussicht auf Hilfe ihm seine letzten Reserven und lässt ihn zusammenbrechen.
»Warte, mein Freund«, sagt Ibrahim, als er neben dem Mann mühsam in die Knie geht und eine Hand unter seinen Kopf schiebt, »bevor du ruhen kannst, brauchst du noch ein wenig Kraft, um auf den Esel zu kommen.« Der Fremde blickt Ibrahim mit matten Augen an. Dann nickt er. In seinem Innern bäumt sich die erschöpfte Streitmacht seiner Körperzellen noch einmal auf, und gestützt von den Armen des alten Schäfers gelangt er tatsächlich auf den Rücken des Esels, wo er sofort nach vorne sackt. Ibrahim streift ihm die Schuhe von den Händen und bindet ihn mit den Zügeln fest, damit er nicht in den Sand zurückfällt, dann greift er nach dem Halfter und zieht Mann und Esel aus der Wüste. Schritt für Schritt wächst Maskhran heran, und Ibrahim spürt, dass unter seinen Füßen die Hitze im gleichen Maße schwindet, wie in seinem Herzen die Sorge um den Unbekannten anschwillt. Der Fremde hat die Augen geschlossen und schaukelt auf dem Esel wie ein Geschöpf, das es aufgegeben hat, am Leben zu sein.
Als sie in Maskhran ankommen, schickt Ibrahim ein paar von den Jungen los, um nach seinen Schafen zu sehen. In den verwinkelten Gassen, wo jede Aufmerksamkeit sich von ganz allein auf das wenige darin Platz findende Leben verdichtet, ziehen der alte Schäfer und der halbtote Unbekannte auf dem Eselsrücken schnell eine Prozession teils neugieriger, teils aufrichtig besorgter Menschen hinter sich her, ein kleines Wunder in jenen Straßen, auf denen noch vor Kurzem die ausgebluteten Kadaver der eigenen Familie gelegen haben und die Aufmerksamkeit für einen erschöpften Fremden für lange Zeit nur schwer zu erringen ist.
Mit einem Schweif aus Stimmengewirr erreicht Ibrahim schließlich sein kleines Haus, wo er und ein paar Männer den Fremden vom Esel hieven und in der Wohnstube auf die Bodenkissen betten. »Geht nach Hause«, ruft Ibrahim nach draußen, und als die kleine Menschentraube vor seinem Eingang schließlich zögernd auseinandertreibt wie eine Herde meckernder Schafe, holt er ein feuchtes Handtuch und eine Flasche Wasser aus der Küche und legt dem Fremden den kühlenden Stoff auf die Stirn. Dann stehen die, die ihn hereingetragen haben, um das Kissenlager herum und schauen auf den Unbekannten hinab.
»Wir sollten nach dem Derwisch schicken«, flüstert schließlich Ibrahims Nachbar, dessen Gläubigkeit schon immer größer war als sein Vertrauen in die Medizin.
»Wir sollten ihm zunächst etwas zu trinken geben und dann von ihm selbst hören, wie er sich fühlt«, sagt Ibrahim, der gelegentlich sowohl der Religion als auch der Medizin ein paar aufklärende Worte als noch heilsamer vorzieht. »Warum andere nach seinem Zustand fragen, wenn er ihn selbst beurteilen kann?«
Die anderen nicken stumm und starren weiter den Mann aus der Wüste an, während Ibrahim ihm die geöffnete Wasserflasche an den Mund hält.
»Trink etwas, mein Freund«, sagt er leise. »Und willkommen in meinem Haus.«
In diesem Moment lösen sich die verkrampften Finger des Fremden, und die spröden Lippen schließen sich langsam um die Flaschenöffnung. Nach einigen gierigen Schlucken öffnet er die Augen, und eine Hand bewegt sich mühsam zum Gesicht und schiebt die Flasche beiseite, als könnte es in einer solchen Situation Dringlicheres geben als Wasser.
»Wo ist sie?«, haucht der Fremde im Delirium, dann fallen ihm die Augen wieder zu, und sein Kopf gleitet zur Seite.
Die Männer sehen sich ratlos an, und zunächst findet niemand einen Gedanken, der deutlich genug ist, um sich in Worte fassen zu lassen. Durch das geöffnete Fenster dringt das sanfte Rauschen von Baumkronen ins Zimmer. Irgendwo zirpt eine Grille.
»Bei Allah«, murmelt Ibrahim schließlich betroffen, »er hatte eine Frau dabei.«
2. Satz
Calando
Drei Tage schläft und atmet der schweigsame Fremde in der Wohnstube. Ibrahim hält die Welt von ihm fern, gibt ihm zu essen und zu trinken, und mit jedem Bissen und jedem Schluck erwacht ein weiteres Stück Leben in dem Mann aus der Wüste. Ibrahim fragt ihn nicht, woher er kommt, wohin er geht und wer er ist, und wenn er abends von den Schafen nach Hause zurückkehrt, ist sein Gast meistens schon in unruhige Träume gefallen.
Versöhnlich übertüncht schließlich der Morgen des vierten Tages die Wirren einer Nacht, die für den Fremden ein Gemisch aus todtiefem Schlaf und fieberhafter Ruhelosigkeit war, wie eine Tinktur aus unvermischbaren Essenzen. Die letzten Stunden vor dem Morgengrauen wälzt er sich mit leidendem Gesicht hin und her, und als Ibrahim kurz vor Sonnenaufgang leise nach ihm sieht, liegt eine schwere Decke aus Albträumen auf der verkrampften Gestalt und drückt sie tief in die Kissen.
Beim Zwitschern der ersten Vögel setzt Ibrahim Kaffee mit Kardamom auf und lässt dabei die Küchentür offen, damit der Duft den Fremden einlullen kann. Dann hockt er sich in die Wohnstube und wartet. Als die ersten Lichtstrahlen das Gelb der nahen Wüste ins Zimmer tragen, hat sich der Gesichtsausdruck des Unbekannten mit der fiebrigen Nacht ausgesöhnt, und sein verzerrtes Maskenspiel ist der Miene eines Mannes gewichen, der sich durch sich selbst gekämpft hat und nun endlich zu einem annehmbaren Ergebnis gekommen ist. Ein sanfter Wind weht den unaufdringlichen Klang des erwachenden Maskhrans zum Fenster herein, aber erst der Ruf eines Gockels dringt so tief in den Fremden vor, dass er die Augen öffnet und Ibrahim anblickt.
»Ein Hahn«, sagt er. Zwei Tränen ziehen einen Pfad aus glitzernden Erinnerungen über sein Gesicht, aber er lächelt.
»Guten Morgen«, sagt Ibrahim. »Kaffee?«
Der Mann aus der Wüste nickt, und Ibrahim holt ihm Kaffee und Fladenbrot mit Schafskäse aus der Küche. Mühsam richtet der Fremde sich auf und greift nach dem Teller und der heißen Tasse.
»Was ist so besonders an einem Hahn?«, fragt Ibrahim, dankbar, das Ergebnis der dreitägigen Suchaktion einiger Dorfbewohner in der Wüste nicht sofort ansprechen zu müssen.
Der Fremde lächelt wieder und blickt eine Weile schweigend und seinen Gedanken nachhängend ins Leere.
»Das ist eine lange Geschichte«, antwortet er dann und beißt in sein Fladenbrot. »Aber ich weiß von einem Hahn, der keine Flügel hat, keine Krallen und keinen Schnabel, aber doch so viel Kraft, dass er unser Land gerettet hat.«
»Klingt tatsächlich nach einer langen Geschichte«, sagt Ibrahim erleichtert. »Noch mehr Kaffee?«
3. Satz
Fortepiano
Der Junge rannte durch den Wald, als sei der Teufel hinter ihm her. Den hätte er sich als Treiber bei dieser Hetzjagd geradezu herbeigesehnt, denn im Vergleich zu seinem stockschwingenden Vater wäre er eindeutig der weniger diabolische Gegner gewesen. Doch auch an diesem Tag schien das Schicksal nicht sehr offen für Gegenvorschläge.
Diesmal hatte der Vater ein paar Tage Zeit gehabt, um Kräfte anzusammeln, und so musste Selim tiefer in den Wald hineinrennen als je zuvor. Fast eine halbe Stunde lief er nun schon durch die Bäume, stetig bergauf, um den Vorteil seiner kindlichen Kraftreserven voll auszuschöpfen. Und endlich wurden die Schritte seines Verfolgers schleppender. Als die Verwünschungen immer weiter aus der Ferne klangen, schöpfte Selim Hoffnung. Er lief noch eine Weile, dann ließ er sich keuchend auf einem umgefallenen Baumstamm nieder.
Obwohl es eigentlich keinen Grund zur Freude gab, begann er leise zu lachen, vielleicht weil nach Ausbrüchen von Tyrannei jedes plötzliche Freisein eine umso größere Würdigung erfährt. Mit ein paar intensiven Atemzügen brachte Selim seinen Kreislauf zur Ruhe. Dann schloss er die Augen und ließ seinen Rundensieg auf sich wirken, während der Wald ihm in Nase und Ohren drang und sich um seine Seele legte.
Hier auf dem Berg, wo das Existenzgeraune der Menschheit nicht mehr zu hören war, konnte das Orchester des Waldes sich mit all seinen klanglichen Feinheiten entfalten. Ein Windhauch flüsterte durch die Bäume, und mit einem leisen Knacken reckten sich Abertausende Zweige in die Luft, so wie eine erwachende Katze ihren Körper dehnt, um Platz für die Lebensgeister zu schaffen. In der Nähe fiel ein Zapfen in ein Kissen aus weichem Moos. Scheinbar bewegungslos lag der Waldboden zu Selims Füßen, aber er hörte das unentwegte Rascheln und Huschen ganzer Insektenstaaten im Unterholz und im Erdreich, wo ein Milliardenvolk mit einem gigantischen Labyrinth aus konspirativen Kanälen das sichtbare Leben untergrub. In einem davon weit entfernten Kosmos saß ein Eichhörnchen hoch oben auf einem Ast und nagte an etwas herum.
Erst letzten Winter war Selim aufgefallen, dass man, sofern man sich darauf einließ, die Welt um sich herum bis in ihre verborgensten Winkel erkunden konnte, wenn man sich auf seine Ohren konzentrierte. Vor allem aber vernahm man nur dann jene Nuancen, mit denen das Orchester des Lebens seine tieferen Mysterien offenbarte. Schmelzender Schnee klang auf einem Bürgersteig anders als auf herabgefallenem Laub. Das Knistern zusammenwachsender Schneeflocken auf eisigem Boden war heller als das ihrer tauenden Schwestern im Sonnenlicht. Die Stimme des Vaters bekam im Winter einen schrofferen Klang, vielleicht weil die Kälte die Spannung der Stimmbänder veränderte und sie deshalb anders vibrierten. Wenn man gegen das Holz der Haustür klopfte, war der Ton im Winter plötzlich so fremdartig, dass Selim, als er dies zum ersten Mal bemerkte, dachte, er stehe vor dem falschen Haus.
Töne hatten anscheinend zwei Dimensionen – die offensichtliche, die jeder hörte, und ein dahinter verborgenes Klingen, das nicht ganz Dur war und nicht ganz Moll, nicht ganz warm und nicht ganz kalt. Es war eher etwas, das dem Ton sein Volumen verlieh, sein Leben und sein Atmen. Doch offenbar war diese zweite Ebene mancher Geräusche nicht für jedermann hörbar und auch nicht immer da, denn als Selim seinem Vater davon erzählte, hatte dieser seinen Gegenbeweis in einer Ohrfeige von solch trivialer Akustik zusammengefasst, dass ihr jene geheime filigrane Klangebene vollkommen fehlte. Selim war doppelt enttäuscht gewesen, hatte dies aber als Ansporn gewertet, dem Schwingen der Töne fortan noch genauer nachzugehen.
Ein Ergebnis dieser Bemühungen war, dass Selim nun, als er im Wald saß, den ungewöhnlich aufgebrachten Klang einer Lerche vernahm. Schon oft hatte er Lerchen singen hören, aber noch nie eine so hektische Erzählerin, die fürchtete, weniger Zeit als Geschichten zu haben, gehetzt und wie bestrebt, sich selbst zu überholen, mit Tönen darin, die vom Schnabel weggewischt schienen oder vom Baum heruntergespuckt. Vielleicht eine Lerche, die um ihr Leben trällerte, aber welchen Sinn sollte das haben – ein Vogel, dessen Stimme sich in höchster Eile überschlug, der sich selbst aber nicht von seinem Platz rührte?
Dann brach das Gezwitscher plötzlich ab, doch nach einer kurzen Pause war es wieder da, diesmal um eine winzige Spur langsamer und dafür mit mehr Lebensheftigkeit darin, und damit war jeder merkwürdige Unterton und jede Panik verschwunden. Ganz im Gegenteil verkündete die Lerche jetzt mit den scheinbar gleichen Tönen ihre überschäumende Daseinsfreude so euphorisch, dass Selim beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Hier wusste offenbar ein Lebewesen um die geheime Klangebene, und zwar so genau, dass es mit derselben Melodie zwei vollkommen unterschiedliche Geschichten erzählen konnte.
Also erhob sich Selim und ging behutsam in Richtung der Gleichgesinnten. Bei jedem Schritt bettete er die Fußsohle langsam auf den Waldboden, um die wundersame Lerche nicht zu verschrecken, und so dauerte es eine Weile, bis der Gesang des Vogels aus unmittelbarer Nähe an Selims Ohren drang. Hier mischte sich noch ein anderer Beiton ins Gezwitscher, der schleifend klang und entfernt an die Winterstimmbänder seines Vaters erinnerte. Und als Selim sich mit gerunzelter Stirn voll und ganz auf diesen unterschwelligen Laut konzentrierte, trat er doch noch auf einen Ast. Das leise Knacken ließ das Zwitschern sofort verstummen, und eine von beiderseitigem Lauschen durchdrungene Stille übertönte selbst die Geräusche des Waldes. Aufgeregt hielt Selim den Atem an. Und obwohl es bloß um einen kleinen Vogel ging, spürte er seinen Puls im ganzen Körper hämmern, eine Übertreibung, wie sie nur das Herz eines Jungen in abenteuerlicher Mission zuwege bringen konnte.
»Wer bist du?«, fragte die Lerche schließlich.
4. Satz
Moderato
»Selim«, sagt der Fremde, trinkt den letzten Schluck Kaffee und stellt die Tasse langsam auf dem Tisch ab. »Ich bin Selim.«
Der alte Ibrahim, erprobt in der Überschwemmung der Gegenwart durch Erinnerungen und noch gefangen in der Geschichte seines Gastes, blickt ihn eine Weile abwesend an und gießt schließlich frischen Kaffee nach. »Mein Name ist Ibrahim. Ich danke dir, dass ich dir helfen darf.«
»Ich habe zu danken«, winkt Selim ab. »Nicht nur für das Nachtquartier.«
»Das waren keine besonders erholsamen Nächte, nicht wahr?«
»Verglichen mit den anderen, die hinter mir liegen, waren diese wie ein behagliches Wandeln in einem Wonnegarten Allahs«, erwidert Selim, froh, nun endlich genug Kraft zu haben, um jenem Landesbrauch gerecht zu werden, der mit einer nicht unbeträchtlichen Dosis blühender Gesprächskunst Harmonie zwischen Gast und Gastgeber zaubert. Doch sein Satz ist nicht nur süße Sprachschnörkelei, sondern auch bittere Wahrheit.
»Die letzten Nächte mögen unruhig gewesen sein«, fährt er also fort, »dennoch waren sie seit Langem die ersten halbwegs friedlichen für mich.«
»Die Wüste muss sehr hart gewesen sein.«
»Da draußen«, sagt Selim und zeigt durch das Fenster, »war nicht nur die Wüste.«
Ibrahim nickt. »Wenn jemand durch den heißen Sand kriecht und dabei sein Leben aufs Spiel setzt, muss er wohl von einem Ort kommen, der noch bedrohlicher ist.«
Für einen Augenblick zittern Selims Hände, und sein Blick kehrt sich nach innen, wo sich Bilder festgesetzt haben, die ihn offensichtlich so schnell nicht wieder loslassen werden. Doch mit einem Augenaufschlag und einem Lächeln ist er zurück in Ibrahims Wohnstube. »In der Wüste gab es einen Ort, dem es tatsächlich gelungen ist, voller Blut und doch ohne Lebenssaft zu sein.«
»Das lässt mich schaudern und hoffen zugleich«, flüstert Ibrahim. »Es klingt nach einem Ort, der all das, was ganz Syrakesh in den letzten Jahren gezeichnet hat, auf sich vereint. Aber es gibt ihn nun nicht mehr, sagst du?«
»Nein, das ist vorbei«, antwortet Selim und beißt in sein Fladenbrot. »Dank des Hahns.«
»Offenbar gibt es viele merkwürdige Vögel in deinem Leben«, sagt Ibrahim und lacht. »Nun sind es schon zwei, über die du mich unbedingt aufklären musst. Doch jetzt werde ich nach meinen eigenen Tieren, den Schafen, sehen. Aber wenn ich zurückkomme, unergründlicher Selim, musst du meinen brennenden Wissensdurst mit ein paar ziemlich großen Krügen Erleuchtung löschen.«
»Bitte verzeih mir, ich spreche in Rätseln«, lächelt Selim. »Das war nicht meine Absicht. Ausgerechnet ein Fremder, den man unter seinem Dach schlafen lässt, sollte einen nicht durch Unergründlichkeit beunruhigen.«
»Du beunruhigst mich nicht«, erwidert der alte Schäfer und lacht weiter, »du tust etwas noch viel Erbarmungsloseres: Du machst mich neugierig.«
»Entschuldigung«, sagt Selim, der nun ebenfalls laut lachen muss. »Wenn deine Schafe geweidet und getrunken haben, soll auch dein Durst gestillt werden.«
5. Satz
Adagio
Der Mond taucht die Rücken der Schafe in ein silbriges Licht, und die Tiere schieben sich träge über die Weide wie herabgefallene Wolken. Ein leichter Wind bläst aus der Wüste direkt auf Maskhran zu, als sei er auf der Suche nach der geschundenen Gestalt. Doch er selbst hat Selims Spuren längst verweht und auch die der Dorfbewohner, die in den letzten Tagen nach der Begleiterin des Fremden gesucht haben.
Nachdenklich blickt Ibrahim in die Sterne hinauf, die in vermeintlich immer gleicher Konstellation vom Firmament schimmern, ganz gleich, wie radikal sich die Konstellationen menschlicher Bande verändern, fast wie ein trotziges Gegenprogramm am Himmel. Oft hat Ibrahim in den letzten Jahren darüber gebrütet, wieso ausgerechnet das, was mit der größten Bewegung durchs All saust und niemals stillsteht, der einzige feste Ankerpunkt sein kann, die letzte verlässliche und beständige Größe. An manchen Abenden, wenn die Schafe friedlich am Gras zupften und der Himmel sich über Maskhran und die Weide wölbte wie ein schützendes Beduinenzelt, spürte Ibrahim eine tiefe Zuversicht in sich. Vielleicht, ging ihm dann durch den Kopf, zeugten gerade die unsichtbaren Bewegungen von größter Standhaftigkeit, und dann musste er jedes Mal lächeln.
Der Schuss, der das Leben seiner Frau beendet hatte, ließ sein Schmunzeln unter dem Firmament für lange Zeit versiegen, aber nun sitzt er da, und in den letzten Tagen haben die Sterne ihm recht gegeben – und Ibrahim fühlt, wie es beim Anblick der glitzernden Punkte über seinem Kopf in seinen Mundwinkeln zuckt. Es ist das erste Mal nach dem Schuss, dass die Gestirne ihn wieder zum Lächeln bringen, und er spürt, wie ein Gefühl innerer Freiheit durch seinen Körper und überhaupt durch sein ganzes Ich schwappt und sich schäumend überschlägt wie Meereswellen.
»Ja«, flüstert er, und einige Schafe heben kurz ihre Köpfe, grasen aber weiter, als sie merken, dass der alte Schäfer mit den Sternen redet, »am Ende ist immer Licht. Selbst in der Finsternis.«
Am Mittag hat er einen der Jungen gebeten, auf dem Markt ein paar Leckereien zu kaufen und sie seinem Gast zu bringen, und der Junge hat ihm Selims Dank überbracht und versichert, dass der Fremde Maskhrans Behaglichkeit durch das geöffnete Fenster wie Medizin inhaliere und sich in guter Verfassung befinde. Außerdem ließ er fragen, ob er seine Hände mit jener Salbe behandeln dürfe, die im Bad stehe. Ibrahim, dem die ausgeprägte Sorge Selims um seine Hände nicht entgangen ist und der diesen Balsam regelmäßig aus dem Wollwachs seiner Schafe herstellt und auf dem Markt von Maskhran verkauft, hat den Jungen mit der Nachricht zurückgeschickt, dass sein Gast sich reichlich bedienen möge und er und die Schafe erfreut seien, etwas zur Geschmeidigkeit von Selims Händen beisteuern zu können. Der Junge, den Syrakeshs traditionelles Gastgeberpathos wie die meisten seiner Generation eher belustigt als berührt, ist mit einem schiefen Grinsen davongeeilt.
»Veränderung«, sagt Ibrahim nun zu den Sternen, und weil diese nicht antworten können, übernimmt er das beipflichtende Nicken für sie. Dann bewegt er sich auf seine Schafe zu, um sie zusammenzutreiben, denn zwischen den Wänden seiner Wohnstube schwebt noch eine Geschichte in der Luft.
6. Satz
Adagio
Im Wald hatte Selim noch nie einen anderen Menschen angetroffen. Und ausgerechnet oben in den Bergen, wo weit und breit kein Dorf war, schien ihm dies so unwirklich wie die zufällige Begegnung eines Verdurstenden und eines Wasserverkäufers mitten in der unendlichen Wüste. Erst recht, wenn dieser Mensch in Begleitung einer Lerche war.
Mit klopfendem Herzen trat der Junge auf eine kleine Lichtung hinaus, die gut geschützt zwischen den Büschen lag. Die Stämme der Fichten umringten den Platz wie hölzerne Säulen. Der Mann, der inmitten der Lichtung auf einem Holzschemel saß und Selim neugierig studierte, hatte alle äußeren Anzeichen eines Weisen auf sich vereint, bärtig, weißhaarig und vor allem alt. Die Verschlissenheit seiner Kleidung lag leichtsinnig nahe am Zerfall, und mit struppigem Haar bekundete er eine gewisse Furchtlosigkeit gegenüber seinem eigenen Spiegelbild. Sein Körper schien irgendwie kleiner als er selbst.
Doch anscheinend war der Alte kein Philosoph, sondern ein Musiker. In der linken Hand hielt er eine Geige. Die rechte ruhte in seinem Schoß und ließ den Violinbogen langsam hin und her schwingen. Ein harmloses Werkzeug nur, geschaffen, um zu streicheln, doch die Wahrnehmung Selims, der eben noch von Stock und Vater durch den Wald gejagt worden war, abstrahierte das lange Holz zu einem Instrument der Macht. Aber es erfüllte ihn nicht mit Furcht, sondern mit einer so unerwarteten Erkenntnis, dass er erschrocken stehen blieb und auf die Violine starrte. Vielleicht waren es der weise Nimbus des alten Mannes und die Annahme, dass der Bogen in seiner Hand unendlich mehr Ausdrucksmöglichkeiten in sich barg als der Stock des Vaters.
- Ende der Buchvorschau -
Impressum
Texte © Copyright by Andreas Séché Ulmenweg 8 41379 Brüggen Die Originalausgabe ist 2013 als Hardcover im »ars vivendi verlag« erschienen. Dieses eBook ist, auch in Auszügen, urheberrechtlich geschützt.
Bildmaterialien © Copyright by © Coverbild: Geiger: Unter Verwendung einer Illustration von art3/Shutterstock.com. Gasse im Hintergrund: Aleksandra Zatelepina/Shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 978-3-7393-5246-6