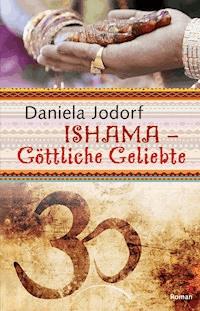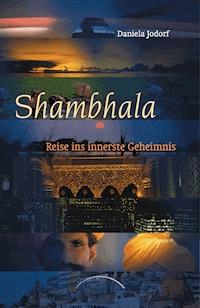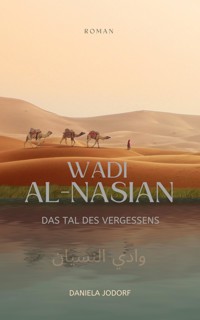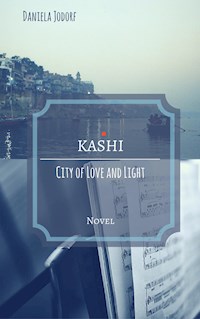Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Goa, der indische Küstenstaat, ist ein Sehnsuchtsort für viele Aussteiger und Suchende. So zieht er auch zwei sehr unterschiedliche Suchende an: die ehemalige Sannyasi, Meera, und den Techno-DJ, Timm. Meera wandelt auf den Spuren der Erweckungsgeschichte ihres ehemaligen Gurus. Verzweifelt versucht sie zu verstehen, wie er der spirituelle Lehrer werden konnte, mit dem sie über zwölf Jahre ihres Lebens verbracht und unter dessen geistiger Führung sie sehr gelitten hat. Bisher sind alle ihre Versuche, sich von Guru-Abhängigkeit und Indoktrination zu befreien, gescheitert. Hier, mitten unter Touristen und freundlichen, mitfühlenden Einheimischen, die sie herzlich aufnehmen, kommt sie langsam wieder zu sich und kann endlich einen ehrlichen Blick auf ihre Vergangenheit und die leidvolle Beziehung zu ihrem Lehrer wagen. In Goa findet sie den Mut zu leben und wieder zu lieben und noch viel mehr als das. Timm sucht seit frühester Jugend nach anderen Bewusstseinszuständen, die er zuerst durch die Musik entdeckt. Er wird zu einem leidenschaftlichen Sinnsucher, der spürt, dass er eine spirituelle Aufgabe hat. Seine zielstrebige Suche führt ihn von der elektronischen Musik, über die Psychologie zum integralen Life Coaching. In Goa schenkt ihm ein verführerisches Angebot seines großen DJ-Idols, ShivChandra, unerwartet Zugang zu höheren Bewusstseinsebenen und die lang ersehnte innere Gewissheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARANARI
Mehr als Glückseligkeit
Daniela Jodorf
IMPRESSUM
Text
© Copyright by Daniela Jodorf 2021
Umschlag
© Copyright by Daniela Jodorf 2021
Lizenzfreies Coverfoto und Design mit Dank an Canva.com
Verlag
Daniela Jodorf
Leonhard-Kraus Str. 2353604 Bad [email protected]
veröffentlicht durch
epubli - ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Danksagung
Mit besonderem Dank an alle, die bei der Entstehung dieses
Buches mitgewirkt haben:
Monika Winterstein
Serga Falck
Bianca Dauber
Monika Jodorf
NARANARI ist unser gemeinsames Werk.
Schön, dass es Euch gibt!
Disclaimer
Alle in diesem Roman vorkommenden Figuren, Schauplätze und Organisationen sind rein fiktiv. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind vollkommen zufällig und beruhen allein auf der Tatsache, dass in dieser Erzählung allgemeingültige Verhaltens- und Erfahrungsmuster zu den Themen Guru-Abhängigkeit und spiritueller Missbrauch dargestellt werden, die sich zu verschiedenen Zeiten an ganz unterschiedlichen Orten und zwischen völlig anderen Menschen ereignen können und trotzdem fast identisch wirken.
Für Menschen, die selbst die Abhängigkeit von einem Guru, einer spirituellen Institution oder Tradition oder spirituellen Missbrauch in körperlicher, sexueller, seelischer oder anderer Form erlebt haben oder gerade erleben, kann dieser Roman triggernd wirken. Er bietet aber auch die Möglichkeit, die Muster der Guru-Schüler-Dynamik zu verstehen und die eigenen Schatten zu erkennen und zu integrieren.
Es ist nicht die Absicht der Autorin, mit dieser Erzählung in irgendeiner Form Heilwissen anzubieten. Dieser Roman soll lediglich auf die Gefahren und Illusionen auf dem spirituellen Weg hinweisen und so die Möglichkeit zu einem ehrlicheren, realistischeren Umgang mit dem Thema Spiritualität eröffnen, der auch die negativen Seiten mit einschließt und den Leser zu einem kritischen Bewusstsein ermutigt, das ihn in die Lage versetzt, sich selbst vor leidvollen spirituellen Begegnungen zu schützen.
•
•
•
Die Schatten auf dem spirituellen Weg
sind lang und unsichtbar
•
•
Die richtigen Dinge sind immer einfach,
aber die einfachen Dinge nicht immer richtig
•
•
•
1
MEERA
Die saftig grüne, tropische Landschaft flog mit der gemächlichen Geschwindigkeit des alten rostigen Taxis an Meera vorüber. Sie konnte kaum fassen, dass sie endlich hier war. Wie viele Jahre hatte sie von Goa geträumt. Wie oft hatte sie sich vorgestellt, hier mit Janaka herzukommen, sich von ihm alle Orte zeigen zu lassen, die ihn berührt und inspiriert hatten; die Orte, an denen er erwacht war, die ihm seinen Weg und seine Mission enthüllt hatten. Nun war sie hier, doch der Sitz neben ihr leer. Tränen rollten über ihre Wangen, als sie sich sein schönes Gesicht vorstellte. Er fehlte ihr so.
Das Taxi wurde im Laufe der Fahrt immer schneller, als hätte es sich erst vom Rost befreien müssen. Inzwischen düste der Fahrer hastig und eckig um die Kurven. Meera sah angestrengt und konzentriert aus dem Frontfenster, um die Übelkeit zu bekämpfen. Trotz der wunderschönen Umgebung wanderten ihre Gedanken immer wieder zurück zu Janaka und seinen bunten, ausgeschmückten Erzählungen von seiner Zeit in Indien.
In ihr regte sich unendliche Traurigkeit. Sie hätte ständig weinen können. Um Janaka, der so tief gefallen war. Und auch um sich, weil sie geglaubt hatte, alles gefunden zu haben, wonach sie sich gesehnt hatte, nur um am Ende alles wieder zu verlieren. Der Schmerz saß tief und schien unheilbar. Sie war unerträglich verletzt, furchtbar verstört und verwundet. Sich das einzugestehen, war ihr so schwer gefallen, dass sie mehr als zehn Jahre dafür gebraucht hatte. Jahre, in denen sie sich täglich eingeredet hatte, dass alles in Ordnung war, obwohl gar nichts in Ordnung gewesen war.
Sie mahnte sich zur Disziplin. Wenn sie einigermaßen heil in ihrem Hotel ankommen wollte, dann durfte sie jetzt nicht darüber nachdenken. Sie musste sich konzentrieren. Auf das Hier und das Jetzt. Jetzt saß sie in einem Taxi in Goa und schwitzte. Jetzt freute sie sich auf Ferien am Strand. Jetzt schien die Sonne. Jetzt spürte sie Durst. Es gelang ihr, die Vergangenheit auszublenden, sie rigoros auszuschließen aus ihrem Erleben.
Der Fahrer deutete auf einen Tempel und rief begeistert: „Shiva Temple, Madame. Sehr heilig.“
Er konnte nicht wissen, dass sie auch das an Janaka erinnerte, wie eigentlich alles die schmerzlich geliebten Erinnerungen hochspülte. Hatte sie überhaupt ein Leben ohne ihn, fragte sie sich verzweifelt und ein bisschen wütend. Würde sie jemals wieder ein Leben ohne ihn haben?
Der Fahrer wartete offenbar auf ihre Reaktion, denn er starrte sie im Rückspiegel erwartungsvoll an. Sie nickte freundlich. „Ja, ich kenne Shiva. Sehr, sehr heilig“, antwortete sie, und endlich blickte der Fahrer wieder auf die holprige Straße vor ihnen, die in Richtung Ashvem Beach im nördlichen Teil Goas führte. Er konnte nicht wissen, wie verbunden sie mit Shiva war, was er ihr bedeutete, obwohl sie Deutsche war. Auch Shiva verband sie mit Janaka, mit ihrem geliebten Lehrer, der ihr alles, was sie über die geistige Welt wusste, beigebracht hatte. Der ihr vor allem zuerst das Vertrauen in die Existenz der geistigen Welt gegeben hatte. Sollte das alles Illusion gewesen sein? Sie konnte und wollte das nicht glauben. Was war überhaupt noch wahr in einer Welt, in der die Menschen nicht das waren, was sie zu sein vorgaben? Was war wirklich, in einer Welt, in der man dem, den man am meisten liebte, nicht vertrauen konnte? Wieder begannen ihre Tränen zu fließen und diesmal ließ sie es geschehen.
„Traurig, Madame?“, fragte der Fahrer mitfühlend und starrte wieder nur in den Rückspiegel, statt die Straße im Blick zu behalten.
„Nein, sehr glücklich“, log sie, um ihn dazu zu bewegen, nach vorne zu sehen. „Ich wollte schon so lange herkommen.“
Der Fahrer freute sich und lachte. „Goa sein beste Platz von India! Alles hier: Meer, Strand, Kultur, Musik, Party, Yoga, Tempel, Gewürze, Ayurveda… Alles.“
Sie nickte wieder und war froh, dass er ihre Gedanken nicht hörte. „Ja, alles ist hier, aber nicht das, was ich mir am sehnlichsten wünsche.“
Der Taxifahrer spürte, dass er sie nicht aufmuntern konnte und schwieg den Rest der Fahrt. Sie fuhren jetzt auf kleineren Landstraßen kreuz und quer durch Palmenhaine, kleine Siedlungen, vorbei an einer schneeweißen christlichen Kapelle, über Brücken und Flüsse. Goa war so schön. Meera atmete tief durch, als sie ein überraschender Hoffnungsschimmer mitriss.
„Vielleicht finde ich hier doch die Erlösung, die ich suche“, dachte sie. „Aber was, wenn nicht“, durchfuhr sie gleich wieder der alte, grauenvolle Schrecken. Was, wenn sie keinen Weg fand, mit dem Schmerz und der Enttäuschung, die sich tief in ihr Herz gegraben hatten, zu leben? Was, wenn sie keinen Weg fand, mit ihrer eigenen Vergangenheit zu leben?
Nach etwa eineinhalb Stunden bog der Fahrer in der ihm eigenen zackigen Weise in eine von hohen Kokospalmen gesäumte, enge Straße ein. Er deutete nach vorne auf ein schwarzes Eisentor, das von einem bewaffneten Mann und einem schlafenden, beigefarbenen Hund bewacht wurde.
„Hotel Cozy Yoga, Madame! Sehen Sie. Sie haben geschafft Reise und jetzt an Ihre Ziel!“
Wie schön wäre es, wenn sie ihre Reise wirklich endlich geschafft, wenn sie ihr Ziel erreicht hätte. Sie war jetzt Mitte Dreißig und von sich selbst und der Verwirklichung ihrer Ziele vielleicht so weit entfernt wie niemals zuvor. Einst hatte sie gehofft, dass Janaka sie zu ihrer Berufung führen würde, dass er ihr zumindest helfen würde, sie zu entdecken. Aber es war alles ganz anders gekommen.
Das Tor öffnete sich automatisch, nachdem der Fahrer dem Wächter ihren Namen genannt hatte. Der lächelte sie an und nickte freundlich, als ihr Taxi in Schritttempo an ihm vorbeifuhr. Der Hund würdigte sie keines Blickes. Er schlief ungerührt tief und fest in der schwülen Hitze des indischen Nachmittags.
Sie folgten weiter der schmalen, palmengesäumten Straße, bis sie ein zweistöckiges Gebäude in satten Erdtönen erreichten, das über und über mit blühenden Ranken bewachsen war. Schon als Meera die Wagentür öffnete, stieg ihr der betörende, süßliche Duft von Frangipani-Blüten in die Nase. Automatisch atmete sie tief ein und spürte, wie sich etwas in ihr entspannte und zur Ruhe kam, das in den letzten fünfzehn Jahren immer rastlos und angespannt gewesen war.
Der Fahrer hatte bereits ihr Gepäck ausgeladen und es an einen eilig herbeigeeilten Porter übergeben, der geduldig auf sie wartete, während sie das Taxi bezahlte und dem Fahrer ungewöhnlich freundlich alles Gute wünschte. Vielleicht hatte er ja doch einen sechsten Sinn und sie war wirklich am Ziel ihrer Reise. Jetzt, als sie hier vor dem Hoteleingang stand, auf der Schwelle zu einem neuen Kapitel ihres Lebens, fühlte sie jedenfalls etwas, das sie lange nicht empfunden hatte: das Gefühl, sich endlich nicht mehr schützen zu müssen. Fast hätte sie wieder geweint, doch der Porter blickte sie auffordernd an. Er wartete darauf, sie zur Rezeption zu führen.
Sie folgte ihm in das Innere des zweistöckigen Gebäudes, das sie ein bisschen an eine französische Villa erinnerte. Die Fassade war aus beigefarbenen und bräunlichen Natursteinen gebaut, das Dach mit terrakottafarbenen Ziegeln gedeckt. Meera hatte Mühe, in der schattigen und angenehm kühlen Lobby etwas zu erkennen, nachdem das Sonnenlicht sie auf der ganzen Fahrt geblendet hatte. Zuerst hörte sie deshalb das laute Kreischen und Plappern eines munteren Papageien. „Hallihallo. Fremde. Hallihallo.“
Meera antwortete dem Vogel lachend. „Hallihallo. Wer bist denn du?“
„Ich heiße Captain Hook. Captain Hook. Hallihallo.“
„Hallo, Captain Hook. Ich bin Meera.“
„Meera, Meera, Meerabai!“
„Du kennst Meerabai?“ fragte sie erstaunt, denn ihr Name stammte tatsächlich von der bekannten indischen Heiligen, die im sechzehnten Jahrhundert in Rajasthan gelebt hatte. Janaka hatte Meera vor Jahren so genannt. „Dieser Name ist sehr besonders“, hatte er damals nach der Einweihungszeremonie, bei der er allen neuen Sannyasins indische Namen gegeben hatte, zu ihr gesagt. „Meerabai war die vielleicht größte Bhakta, die es je gegeben hat. Ihre Liebe zu Krishna, zum Göttlichen, war so groß, dass sie jedes Hindernis und jede Gefahr überwand. Sie konnte an nichts anderes denken als an ihren Geliebten, sang von ihm Tag und Nacht. Die Sehnsucht nach ihm zerriss fast ihr Herz. Dein Weg ist der Weg dieser Liebe, Meera. Doch dieser Weg ist der schwierigste von allen. Er ist wie das Balancieren auf Messers Schneide. Wenn du abrutschtst, wirst du dich schwer verletzen. Nur wenn dein Herz vollständig von der Liebe gereinigt ist, wirst du dein Ziel erreichen. Du musst den Mut haben, dich ganz und gar in der Liebe zu verlieren...“
Die warme Stimme des Concierge riss sie aus ihren Erinnerungen. „Willkommen im Cozy Yoga Resort. Captain Hook ist ein schlauer Kerl, der wirklich weiß, wer Meerabai ist. Wir singen hier oft ihre Bhajans. Manchmal singt er sogar mit oder er flötet dazu. Nicht wahr, Captain Hook?“
Wie zur Bestätigung stimmte der Papagei eine melancholische Melodie an.
„Sie sind also auf jeden Fall richtig bei uns.“ Der Concierge lachte fröhlich und sie stimmte - zurückhaltend zwar - in sein gelöstes Lachen mit ein. „Sie werden drei Wochen bleiben?“, fragte der Concierge.
„Ja. Voraussichtlich.“
„Wunderbar. Dann werden Sie sehr viel Zeit haben, sich gut bei uns zu erholen und viel von Goa zu sehen.“
„Ich habe sehr viel von Goa gehört und wollte schon lange herkommen. Jetzt bin ich endlich da.“
„Dann noch einmal ein herzliches Willkommen. Bitte füllen Sie das Anmeldeformular in aller Ruhe aus und geben es mir später zurück. Jetzt sind Sie sicher müde. Rajkumar wird Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Wenn irgendetwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit ist, geben Sie mir bitte sofort Bescheid. Wir finden eine Lösung.“
Im ersten Moment dachte sie, dass dieser Hotelangestellte sehr gut dressiert war und seine Rolle als zuvorkommender Freund perfekt spielte. Ihre Gefühle widersprachen. Seine Worte und Versprechungen fühlten sich echt und ehrlich an. Doch gerade diesen Gefühlen vertraute sie nicht mehr. Wie viele Worte und Versprechungen hatte sie schon für echt und aufrichtig gehalten, die doch nur leer und unaufrichtig gewesen waren.
∞
Rajkumar führte Meera durch das Haupthaus hindurch, hinaus ins Freie, über verschlungene Wege zwischen zweistöckigen Bungalos, die wie kleine Kopien des Haupthauses aussahen, kreuz und quer durch die Anlage. Unmöglich konnte sie sich den Weg merken. Überall zwitscherten Vögel, zirpten Grillen, schwirrten Insekten. Und immer wieder erreichte sie der unvergleichliche Duft der Frangipani, die neben Hibiskus und anderen exotischen Pflanzen und Blumen auf den Wiesen und in den Beeten des paradiesischen Hotelgartens standen.
Fast fünf Minuten später hatten sie endlich ihr Zimmer im Parterre eines Bungalows direkt am Meer erreicht. Meera roch den salzigen Duft und hörte die ersten Wellen. Rajkumar öffnete die schwere, eisenbeschlagene Holztür und führte sie hinein. Er schien ihre Reaktion sehr genau zu beobachten. Meera spürte seine Neugierde. Wie viele Gäste mochte er schon auf ihre Zimmer gebracht haben? Wie oft hatte er sie wohl Staunen sehen? So, wie Meera jetzt. Die weiß gekalkten Wände waren mit erdfarbenen Mandalas bemalt. Das große Bett aus dunklem Teakholz hatte einen weißen Baldachin. Überall standen kleine Vasen mit Blumen. In einer Ecke, direkt neben dem großen Fenster, gab es einen kleinen Altar, auf dem ein Elefantengott stand.
„Das Zimmer ist wunderschön, Rajkumar. Danke.“
Der Porter lächelte glücklich. Meera spürte, dass ihre Reaktion ihn berührte und erfreute.
Rajkumar stellte ihren Koffer neben den Wandschrank und ging Richtung Fenster. „Warten Sie, bis Sie den Blick gesehen haben, Miss Meera.“
Stolz öffnete er die Tür zur Veranda, die wie ein Safarizelt mit Stoff überdacht war und zwei herrlichen Liegen mehr als ausreichend Platz bot. In etwa fünfzig Meter Entfernung sah sie den gelben Strand und das tiefblaue Meer. Ein Schauer des Wohlbefindens lief ihr durch den ganzen Körper. Wann hatte sie sich zuletzt so gefühlt? Ihr war, als sei das in einem anderen Leben gewesen. In einem Leben, an das sie sich kaum mehr erinnerte.
Rajkumar ließ die Türen zur Veranda weit geöffnet und kam zurück ins Zimmer, um ihr die wichtigsten Dinge zu erklären.
„Das ist unser Haustelefon. Über die 202 erreichen Sie die Rezeption. Hier in diesem Prospekt finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Mahlzeiten, Yogastunden, Meditationen, Ausflügen. Alles, was wir täglich für unsere Gäste anbieten.“
Meera hatte plötzlich große Mühe zuzuhören. Ihr Kopf schien leer und schwer von Begriff. Langsam wiederholte sie: „Rezeption 202?“
„Die Nummer finden Sie auch hier in unserem Prospekt. Sie müssen sehr müde sein, nach Ihrer langen Reise, Miss Meera.“
„Ja. Das bin ich auf einmal. Ich glaube, ich lege mich direkt ein bisschen hin.“
Sie drückte Rajkumar dankbar ein paar Rupien in die Hand und schloss die Tür hinter ihm.
„Ein fremder Mensch ist aufmerksamer und fürsorglicher zu mir, als die Menschen, die mir am meisten bedeuten“, dachte sie erschüttert, nur um sofort wieder den Schmerz und die negativen Erinnerungen niederzukämpfen.
Sie trank durstig einen Schluck eiskaltes Wasser aus einer Thermoskanne, die zwischen Bett und Veranda auf einem Sideboard neben einem Wasserkocher, Tee und Instant-Kaffee bereitstand. Dann ging sie ins Bad, wusch sich Gesicht und Hände und legte sich anschließend völlig erschlagen auf das riesige, himmlische Bett, wo sie binnen Sekunden in einen tiefen, traumlosen Schlaf fiel.
∞
Zwei Stunden später wachte Meera von ihrem laut und unkontrolliert klopfenden Herzen auf. Es raste in ihrer Brust in einem wild galoppierenden, undefinierbaren Rhythmus. Das Atmen fiel ihr schwer. Sie hatte das Gefühl zu ersticken. Hatte sie etwa ihre Tabletten nicht genommen? Panisch sah sie auf ihr Handy, das sie zwei Mal täglich an ihre Tabletten erinnerte und stellte erschrocken fest, dass die Funktion ausgeschaltet war. Wieso hatte sie das nicht bemerkt? Meera rannte zu ihrem Handgepäck, das sie vorhin achtlos auf dem Sideboard unter dem Fernseher abgestellt hatte. Ihr Herz raste weiter ungestüm. Sie versuchte, sich zu beruhigen. Gleich konnte sie die Betablocker nehmen, die es wieder in den richtigen, sanften Rhythmus bringen und die Atemnot der Angstattacke auflösen würden. Hastig schüttete sie den Inhalt ihrer Tasche auf den kühlen Steinboden vor dem Bett. In ihrem Schminketui waren die Tabletten. Sie fingerte nervös eine der kleinen Pillen aus der Aluverpackung und schluckte sie ohne Wasser. Der psychische Druck ließ sofort nach, die körperlichen Symptome jedoch nicht.
Meera ging wackelig in das Badezimmer und ließ kaltes Wasser über ihre Hände und Unterarme laufen. Anschließend klopfte sie mit einer Hand mehrfach auf die Haut unterhalb der Schlüsselbeine und sagte sich laut: „Ich bin sicher und geborgen. Ich bin sicher und geborgen. Ich bin sicher und geborgen.“
Das Klopfen und die Affirmation beruhigte sie langsam. Ihr Herz raste nicht mehr, aber es klopfte noch immer viel zu schnell. Meera wiederholte ihr Ritual drei Mal. Und endlich spürte sie, dass sie wieder tiefer und ruhiger atmen konnte. Die Lungen öffneten sich, die Blockade hatte sich gelöst. Zittrig und mit weichen Knien ging sie zurück zum Bett und legte sich auf den Rücken. Ihr Herz klopfte weiter laut und arhythmisch, aber wesentlich langsamer als zuvor. Jetzt spürte sie die Wirkung des Adrenalins in ihrem Körper. Sie fühlte sich, als wäre sie einen Marathon gelaufen.
Meera wusste, was sie jetzt zu tun hatte. Sie hatte es mit ihrer Therapeutin tausendfach geübt. Noch einmal klopfte sie die EFT-Punkte an den Schlüsselbeinen und sagte sich: „Ich bin geborgen und sicher“. Dann klopfte sie weitere Punkte im Gesicht, an den Handkanten und Rippen und wiederholte verschiedene Affirmationen, die sie in- und auswendig kannte. Die Enge löste sich mehr und mehr, ihr Brustraum dehnte sich weiter aus, und Meeras Herz begann, sich zu beruhigen. Zuletzt atmete sie abwechselnd durch das rechte und linke Nasenloch ein und aus. Diese alternierende Nasenatmung brachte das Nervensystem, Sympatikus und Parasympatikus, wieder in sein natürliches Gleichgewicht, das durch die Panikattacke verloren gegangen war.
Eine halbe Stunde nachdem die Angst sie aus dem Schlaf gerissen hatte, war Meera wieder ruhig. Herz und Atmung hatten sich normalisiert. Doch die Gedanken rasten noch wild hin und her, angepeitscht von Wut und Verzweiflung, von Selbsthass und dem Hass auf Janaka. Seitdem sie ihn und seine Gruppe verlassen hatte, litt sie unter dieser Angststörung. Auch eine zweijährige Therapie hatte sie nicht davon geheilt, sondern ihr nur geholfen, mit ihr zurechtzukommen. Für Meera war das nur ein weiterer Beweis dafür, dass Janaka ihr Leben noch immer bestimmte, obwohl sie ihn fast vier Jahre nicht gesehen hatte. In geistiger Form lebte er weiter mit ihr, sagte ihr noch immer, was sie glauben, tun und lassen sollte, lobte sie, tadelte sie, trieb sie an … und liebte sie.
Mühsam riss sie sich aus der Gedankenspirale, die sie immer tiefer hinab in die Traurigkeit zog. Sie hatte doch ihrer Mutter versprochen, sich zu melden, sobald sie sicher im Hotel angekommen war. Meera stand auf, stieg über den Inhalt ihrer Handtasche, der überall auf dem Boden verstreut lag und suchte auf dem Hotelprospekt nach dem WiFi-Passwort. Schnell hatte sie es gefunden und tippte es in ihr Handy ein. Wenige Sekunden später klingelte bereits das Handy ihrer Mutter in Deutschland.
„Meera, endlich. Wie geht es dir?“
„Sehr gut, Mama. Der Flug war super, die Fahrt zum Hotel total interessant und das Hotel ist ein Traum.“
„Gott sei Dank, mein Schatz. Ich habe mir solche Sorgen gemacht.“
„Alles gut, Mama. Ich bin hier sehr gut aufgehoben. Sobald ich mich ein bisschen umgesehen habe, schicke ich dir ein paar Fotos. Vor allem von meinem bombastischen Zimmer mit Himmelbett.“
„Unbedingt. Wie spät habt ihr denn jetzt?“
„Ich habe keine Ahnung. Es wird langsam dunkel. Vielleicht so gegen sechs. Ich habe einen Riesenhunger und gehe gleich etwas essen.“
„Mach das, Schatz. Pass gut auf dich auf. Wenn etwas ist, kannst du mich jederzeit anrufen. Ich lass dich in Ruhe, damit du die Zeit ganz für dich hast.“
„Ach, Mama. Du weißt doch, wie viel mir unsere Gespräche bedeuten.“
„Ich weiß, mein Schatz. Aber du weißt auch, dass du viel zu lange viel zu wenig Freiheit und Privatsphäre hattest.“
Meera schwieg und spürte den ganzen Schmerz ihrer Mutter, die ihr Kind fast verloren hätte und dann viele Jahre hatte leiden sehen, ohne ihm helfen zu können. „Danke, Mama. Ich hab dich lieb.“
„Ich dich auch, Meera. Bis bald...“
„Küsschen und bis bald.“
Den Tränen nahe legte Meera das Handy weg. Ihre Mutter so besorgt und so traurig zu erleben, war schlimm für sie. Nur selten wagte sie sich einzugestehen, dass sie nicht die einzige war, die in ihrer Zeit bei Janaka gelitten hatte. Wie sehr hatte sie ihre Mutter verletzt. Heute schämte Meera sich dafür. Wie blind war sie gewesen, wie egoistisch und wie dumm.
Nachdem Meera den Inhalt ihrer Tasche sortiert und wieder eingeräumt hatte, meldete sich der Hunger erneut. Sie suchte online nach der aktuellen Uhrzeit. Es war 18:30 Uhr. In einer halben Stunde öffnete das Restaurant. Ausreichend Zeit also, ihren Koffer auszupacken und etwas Leichteres, Bequemeres anzuziehen.
∞
In einem weiten Hosenanzug mit Spaghettiträgern schlenderte Meera eine halbe Stunde später über die verschlungenen Wege durch den Hotelgarten. An jeder Wegbiegung tauchte sie in einen anderen floralen Duft ein. Mal waren es Hibiskus, mal Bougainvillea, mal einfache Geranien und immer wieder die betörenden Frangipani-Blüten.
Sie brauchte über zehn Minuten, um das Restaurant zu erreichen, das am anderen Ende des Geländes oberhalb des Strandes lag, und Meera genoss jede Minute des Weges. Es war so herrlich hier, so beruhigend und entspannend. Ihr war, als bröckele hier im Cozy Yoga Hotel Stück für Stück eine verkrustete Schutzschicht von ihr ab, die sie hart, unbeweglich und angespannt gemacht hatte. Meera wusste, dass diese Schutzschicht sie gerettet hatte. Ohne sie hätte ihre Psyche nicht überlebt, hätte sie selbst nicht überlebt. Aber sie wusste auch, dass sie nur eine Zukunft hatte, wenn sie es schaffen würde, diese Härte, diesen emotionalen Panzer, wieder abzulegen und sich dem Leben erneut zu öffnen.
Ein adrett gekleideter Kellner empfing sie am Eingang zum Restaurant, das eigentlich nur eine überdachte Terrasse war. Der Boden schien aus Ton oder Sand gestampft zu sein. Das Dach bestand aus robusten Hölzern, Stoffen und Palmblättern. An verschiedenen Tischen saßen bereits drei bis vier Personen zusammen und redeten leise.
„Möchten Sie sich zu jemandem setzten, Madame, oder lieber alleine speisen?“, fragte der Kellner in akzentfreiem Englisch.
„Ich wäre gerne allein, wenn das möglich ist.“
„Aber selbstverständlich. Kommen Sie.“ Der Kellner führte sie an einen Tisch neben einer aus Blättern geflochtenen Brüstung. „Wie gefällt Ihnen dieser Tisch? Sie können sogar das Meer sehen.“
Und tatsächlich. Rechts von sich hörte sie das Rauschen des Meeres, und als sie genauer hinsah, sah sie es sogar. „Dieser Tisch ist wunderbar. Danke.“
Der Kellner rückte ihr den Stuhl zurecht und zündete eine Eukalyptuskerze an. „Kann ich Ihnen schon etwas zu trinken bringen. Wasser, Wein, Bier, Softdrinks, Mangolassi?“
„Ein Wasser und ein Lassi wären toll. Danke sehr.“
Immer mehr Gäste trafen in kleinen Gruppen ein. Die meisten waren braun gebrannt, wirkten fröhlich und erholt. Niemand schien allein hier zu sein.
Der Kellner brachte Meeras Getränke. „Wenn Sie möchten, können Sie sich direkt am Buffet bedienen. Es beginnt mit den Vorspeisen. In der Mitte finden Sie die Hauptgerichte und am Ende die Desserts. Wenn Sie noch etwas brauchen, rufen Sie mich.“
Meera nickte dankend und trank durstig einen Schluck des eiskalten Mangolassis, sobald der Kellner sich anderen Gästen zugewandt hatte, die einen Tisch suchten. Schnell füllte sich das Restaurant mit fast fünfzig Leuten. Und Meera begann, sich unwohl zu fühlen. Wieder krochen die Erinnerungen aus ihrem Unterbewusstsein hervor, nicht schnell und überwältigend, sondern leise und verführerisch. Sie dachte an die vielen, köstlichen Mahlzeiten, die sie in Janakas Ashram auf dem Boden sitzend mit den Fingern gegessen hatte. Oft hatte sie selbst in der Küche geholfen. Eine Zeit lang hatte sie sogar die Küche geleitet und stets versucht, gute, ausgewogene, vegetarisch- ayurvedische Ernährung für über hundert Bewohner auf die Teller zu zaubern. Diese Arbeit hatte sie geliebt. Bis Janaka eines Tages bemerkt hatte, mit wie viel Freude und Leidenschaft sie bei der Sache war und wie sie täglich mehr aufblühte. Er hatte sie noch am gleichen Abend zu sich in sein Apartment auf dem Ashramgelände, einem alten Gutshof im Odenwald, gerufen. Nichtsahnend war sie zu ihm gegangen, hatte sich sogar auf die Zeit mit ihm allein gefreut. Doch sein strenger Blick hatte ihr gleich verraten, dass sie etwas falsch gemacht hatte. Er hatte sie nicht lange im Ungewissen gelassen. „Was bedeutet vairagya, Meera?“ hatte er sie gefragt, und sie hatte gleich gewusst, dass das eine Fangfrage war.
„Losgelöstheit, Verhaftungslosigkeit.“
„Genau. Und wie praktiziert man Verhaftungslosigkeit?“
„Indem man an nichts festhält, nichts als sein Eigentum betrachtet.“
„Richtig. Und warum praktizieren wir vairagya?“
„Weil das Leben ein stetiger Wechsel und Wandel ist und wir stets bereit sein müssen, Dinge, die uns lieb sind, loszulassen.“
„Bist du bereit, das, was dir lieb ist, loszulassen?“
„Ich glaube schon.“
„Du glaubst schon? Ist das die Antwort eines reifen spirituellen Menschen?“
Meera hatte verunsichert auf den Boden geblickt. Jetzt hatte er sie, und sie war dagegen völlig machtlos gewesen. Den Tränen nahe, wäre sie am liebsten fortgerannt.
„Sieh mich an, wenn ich mit dir rede, Meera. Ist das die Antwort eines reifen spirituellen Menschen?“
Meera hatte den Blick wider Willen gehoben und Janaka, in dessen Gesicht sie weder Zuneigung noch Mitgefühl erkannte, sondern nur Kälte und Verachtung, direkt angesehen.
„Nein, Guruji. Das ist die Antwort eines ängstlichen und verunsicherten Menschen.“
Meera hatte sich zur Gewohnheit gemacht, in solchen Situationen, die beinahe wöchentlich vorkamen, stets offen und ehrlich zu sein. Wenn er sie kleinmachen und demütigen wollte, war das seine Sache. Sie wollte zu sich und ihren Gefühlen stehen, auch wenn die Konsequenzen schmerzhaft waren. Sie würde nicht vorgeben, etwas oder jemand zu sein, der sie nicht war. Sie wusste genau, dass ihn das wütend machte, doch er ließ sich nichts anmerken.
„Du wirst die Chance bekommen, vairagya zu üben, Meera. Ab morgen wirst du deinen Dienst im Garten verrichten und nicht mehr in der Küche.“
Es hätte keinen Sinn gehabt, mit ihm zu diskutieren und seine Entscheidung in Frage zu stellen.
Meera hatte sich mit vor der Brust aneinandergelegten Händen verneigt und war gegangen.
„Bedeutet vairagya, dass man nichts lieben darf? Dass man nichts mit Leib und Seele und mit Herzblut tun darf?“, hatte sie sich damals traurig und verletzt gefragt. „Bedeutet Verhaftungslosigkeit, dass Freude bei dem, was man tut, schlecht ist? Dass man dann gehen muss, wenn es am schönsten ist? Das glaube ich nicht.“ Janaka selbst sprach immer davon, dass man leidenschaftlich bei der Sache sein sollte, dass man nichts nur mechanisch tun sollte, sondern stets achtsam und mit der Kraft der Seele. Warum galten diese Dinge immer nur dann, wenn er in seinem Satsang, seinem sonntäglichen Vortrag, darüber sprach? Warum galten sie nicht im Leben hier im Ashram? Warum galten sie für ihn, aber nicht für sie und die vielen anderen, die hier lebten und für die Janaka ein Lehrer und Vorbild war?
Meera wischte sich die Tränen mit einem Taschentuch aus den Augen. Der Kellner sah, dass sie weinte und kam mitfühlend zu ihr. „Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Madame? Kann ich etwas für Sie tun?“
Sie schüttelte den Kopf und versuchte, sich zu sammeln. „Danke, das ist sehr freundlich von Ihnen. Es geht schon wieder. Ich habe mich nur gerade an etwas erinnert.“
„Etwas Schönes oder etwas Schlechtes?“ fragte der Kellner unschuldig.
„Das ist eine sehr gute Frage. Mal scheint es schön zu sein und mal schlecht. Auf jeden Fall ist es vorbei, und das macht mich traurig.“
„Jetzt sind Sie ja hier, und hier werden Sie viele neue, schöne Erinnerungen sammeln. Dieser Ort hat schon viele traurige Menschen glücklich gemacht.“
Meera lächelte und sah sich dabei zu, wie sie eine Hand auf ihr Herz legte. Die Reaktion des Kellners berührte sie sehr. Er ahnte gar nicht, wie sehr sie hoffte, dass seine Worte wahr wären, dass auch sie wieder glücklich sein könnte.
Mit einem Mal hatte Meera keinen Hunger mehr. Vielleicht lag es am sättigenden Lassi oder an ihren schweren Erinnerungen. Nach der langen Reise und dem anstrengenden Tag hatte sie nicht die Kraft, dem Fluchtimpuls zu widerstehen. Sie stand auf und ging am Buffet vorbei, nahm sich eine Banane, ein paar Datteln und eine Orange und verließ das Hotelrestaurant.
Zurück in ihrem Zimmer aß sie die Orange und eine Dattel, duschte endlich ausgiebig und legte sich dann erschöpft ins Bett. Kurz bevor sie einschlief, dachte sie: „Wie soll ich hier nur drei Wochen aushalten, wenn die Erinnerungen jeden Tag so stark sind. Ich dachte, ich wäre schon viel weiter in meinem Heilungsprozess.“
Meera war noch wach genug, eine Bitte an Shiva zu formulieren: „Ich brauche deine Hilfe. Bitte hilf mir. Ich brauche Heilung. Bitte heile mich.“
Noch nie hatte sie so deutlich gespürt, dass es so, wie es jetzt war, nicht weitergehen konnte.
2
TIMM
Timm wusste nicht mehr, wann er das erste Mal begriffen hatte, dass er anders war. Es musste irgendwann in der siebten oder achten Klasse gewesen sein. Auf der jährlichen Klassenfete hatte er gerade noch ausgelassen getanzt, da dimmte der DJ das Licht und legte einen Schmuseblues auf. Jeder Junge schnappte sich ein Mädchen, und es bildeten sich im Nu eng umschlungene Paare, die sanft im Kreis wogten und kuschelten. Vorwärts, rückwärts, vor und zurück. Nur Timm stand da, wie gelähmt, unfähig sich eine Tanzpartnerin zu suchen. Er fand die Mädchen blöd, hasste die Musik, wollte weder schmusen noch knutschen. Er hätte gar nicht gewusst mit wem. Also rannte er davon. Verkroch sich auf der Toilette, bis er hörte, dass sich die Musik wieder änderte. Erst als alle wieder ausgelassen herum hopsten, wagte er sich aus seinem Versteck. Doch seine gute Stimmung war dahin. Timm fühlte sich klein, leer, mut- und kraftlos und hoffte, dass es keiner bemerken würde. Doch Petra hatte ihn schon im Visier. Sie steuerte direkt auf ihn zu, als er ins Klassenzimmer zurückkehrte.
„Hey, Timmy. Was ist mit dir? Tanzen wir gleich den nächsten Blues?“
„Nee. Ich muss heim!“
„Was? Jetzt schon? Der Spaß fängt doch gerade erst an!“
Sie kam immer näher. Er fühlte sich bedrängt. „Ich hasse Blues!“
„Warum?“
Warum, hatte er sich bereits selbst die gesamte halbe Stunde gefragt, die er allein auf der Toilette gehockt hatte. Petras Fragen waren ihm unangenehm und noch mehr ihre Distanzlosigkeit. Er fühlte sich irgendwie ertappt und wollte nichts als seine Ruhe haben. „Weiß nicht. Mag´s halt nicht“, gab er deshalb nur lakonisch von sich und blickte dabei unbeteiligt aus dem Fenster.
Ihr Blick wurde ein wenig hämisch, fast verächtlich. „Bist du etwa zu schüchtern!?“
„Ich muss jetzt wirklich nach Hause, Petra.“
Unsanft schob er sie an die Seite und rannte wie ein Gejagter aus der Tür, durch die halbe Schule und endlich hinaus ins Freie, tief verstört von seinen eigenartigen Empfindungen der Abwehr und der Scham. Warum wollte er nicht, was alle anderen toll fanden? Warum fand er es sogar so schlimm, dass er sich verstecken und weglaufen musste? Den Tränen nahe, konnte er in diesem Moment seine unsagbare Einsamkeit kaum ertragen. Ein eigenartiger Schmerz legte sich auf seine Brust, so schwer wie ein Fels, der ihm auch die Kehle zuschnürte.
„Wie, schon zu Hause?“, fragte seine Mutter, als er viel früher als erwartet heimkam.
„Ja, war doof!“
„Hast du Hunger?“
„Nee. Bin müde.“
Sie sah ihm besorgt nach, als er sich in sein Zimmer zurückzog. So wortkarg und niedergeschlagen hatte sie ihren Sohn nur selten gesehen.
Timm schmiss sich auf seine Matratze und grub sein Gesicht in das Kissen, damit niemand hörte, wie verzweifelt er weinte.
Er lag an diesem Abend lange wach und kämpfte gegen die unbeherrschbaren Gefühle, die ihn noch immer fest im Griff hatten. Erst weit nach Mitternacht fasste er, des inneren Kampfes müde, einen tiefgreifenden Entschluss. So wollte er sich nie wieder fühlen. So würde er sich nicht wieder fühlen. Er beschloss an diesem Tag, alles zu tun, was in seiner Macht stand, um sich selbst vor dieser tiefen Traurigkeit und Einsamkeit zu schützen. Es war wie ein Gelübde, wie ein heiliger Schwur, den er vor sich selbst und für sich ablegte: „Nie wieder werde ich mich so fühlen. Koste es, was es wolle!“
∞
Am nächsten Morgen ging es Timm wieder gut. Er war noch ein bisschen matt und müde, aber der Schmerz war fort, und eigenartigerweise wusste er, sobald er die Augen aufschlug, ganz genau, was er zu tun hatte. Es war alles ganz einfach; er sah es klar und deutlich vor sich.
Gleich am Wochenende fuhr er in den Technostore am Frankfurter Hauptbahnhof, in dem alle DJs der Stadt einkauften. Timm fragte die Verkäufer nach den neuesten Tracks, den aktuellen Trends und freundete sich schnell mit ihnen an. Plötzlich tauchte er in eine magische Welt ein und lernte jeden Tag etwas dazu. Er gab sein ganzes Taschengeld für Musik aus und schlachtete sein blaues Sparschwein für sein erstes, gebrauchtes DJ-Pult. Jeden neuen Track probierte er sofort aus, testete die besten Übergänge, stand täglich in seinem Zimmer hinter seinen Turntables und übte so lange, bis er jede Note und jeden Beat auswendig kannte. Und ein Jahr später, beim nächsten Klassenfest, legte er selbst auf; machte er die Musik.
Die Klasse tanzte ohne Pause zu seinen liebsten Elektro-Sounds. Plötzlich wollte keiner mehr Blues tanzen, und Timm hatte das Erlebnis vom letzten Jahr völlig vergessen. Hier und heute war er in seinem Element. Jetzt gab er den Ton an. Und er war gut, sehr gut sogar. Nichts liebte er mehr, als die Musik, die ihn elektrisierte, bewegte, beflügelte. Sie machte etwas mit ihm, veränderte ihn, und er ließ das gerne geschehen.
Spät an diesem Abend spielte er den letzten Song und beobachtete seine Mitschüler, die sich in den letzten Stunden fast in Ekstase getanzt hatten. So ausgelassen, so frei hatte er seine Freunde noch nie gesehen. Etwas war geschehen an diesem Abend, aber Timm hätte nicht sagen können, was.
Nach dem Wochenende zurück in der Schule, noch vor dem ersten Klingeln, umringte Timm ein großer Pulk von Klassenkameraden und bombardierte ihn mit Lob und Fragen.
„Was war das denn, Timm?“
„So coole Musik hab´ ich noch nie gehört.“
„Mega, was du drauf hast.“
„Ich will mehr davon.“
„Kannst du mir das aufnehmen?“
Timm wusste gar nicht, mit wem er zuerst reden, wem er zuerst antworten sollte. Der Englischlehrer, der pünktlich mit dem Gong die Klasse betrat, hielt von diesem Aufruhr gar nichts und scheuchte alle Schüler auf ihre Plätze. „Es ist ja toll, Timm, dass du deine Klassenkameraden mit dieser Elektro-Musik erfreut hast, aber heute ist Schule und nicht Klassenfete!“
Widerwillig grummelnd und schimpfend folgten alle der Aufforderung.
„Ich hoffe, deine Noten leiden nicht unter deinem musikalischen Interesse und Talent.“
Plötzlich applaudierten alle und Timm errötete.
∞
Von jetzt auf gleich war alles anders; Timm war ein anderer. Er wusste plötzlich genau, was er mochte, was er konnte und wollte. Timm begann, für das Auflegen und durch das Auflegen zu leben. Die Musik bestimmte fortan sein Leben, war in kürzester Zeit sein Lebensinhalt geworden. Nichts interessierte ihn so sehr. Nichts ließ ihn so sehr sich selbst vergessen. Schon im Sommer legte er auf der Schulparty auf und bewegte die Masse. Tausend Schüler der Mittel- und Oberstufe tanzten zu seinen Beats und jeder, der dabei war, fühlte sich besonders und beflügelt.
Seine Eltern beobachteten Timm zuerst besorgt, doch als sie merkten, dass es ihm gut ging und seine schulischen Leistungen nicht nachließen, ließen sie ihn machen. Irgendwie waren sie sogar stolz auf ihren Sohn, sein neu entdecktes Talent, seine Disziplin und Zielstrebigkeit. Er war ein Teenager und hätte seine Zeit auch ganz anders verbringen können.
Sogar seine zwei Jahre ältere Schwester begann, sich für Timm und seine Musik zu interessieren. Sie hing oft in seinem Zimmer ab, wollte immer die neusten Stücke hören und verteilte seine Aufnahmen stolz an ihre Freunde.
Schon nach kurzer Zeit spielte Timm erste kleinere, bezahlte Gigs. Und jeden Abend wieder sah er die Menschen tanzen und eins mit seiner Musik werden. Die meisten Tänzer vergaßen alles, solange die Musik spielte; sogar oder vor allem sich selbst. Viele berichteten von einem Gefühl der Leichtigkeit und Leere. „Mein Körper hat einfach getanzt. Ich hätte ihn nicht stoppen können“, beschrieben mehrere Freunde ihre Erlebnisse auf der Tanzfläche.
Die elektronische Musik versetzte alle in einen eigenartigen Rausch. Timm fühlte sich von einem nie gekannten Flow getragen, der ihn einfach mitriss. Er hätte sich nicht gegen diesen magischen Fluss wehren können und genoss das Gefühl, dass er nichts dafür tun musste, um Neues zu entdecken und weiterzukommen. Alles ergab sich wie von selbst, jeder nächste Schritt, jede Handlung, jede Entscheidung. Leider war er erst sechzehn und durfte deshalb keine Angebote bis spät in die Nacht annehmen. Er legte hauptsächlich auf Partys von Freunden oder Schulfesten auf. Doch weil er immer in seinem geliebten Technoladen unter dem Bahnhof auf der Suche nach neuen Sachen war, knüpfte er enge und wichtige Kontakte zu den älteren Vorreitern der Frankfurter Technoszene. Manchen gab er seine Aufnahmen und immer wieder hörte er dasselbe:
„Zu dumm, dass du noch keine achtzehn bist. Deine Musik ist wirklich besonders.“
Timm bekam sein erstes Engagement auf einem Rave in einer alten Lagerhalle im Casellahafen und legte zwei Mal im Monat samstags von elf bis vierzehn Uhr auf. Die Halle war immer voll. Viele der Raver kamen tatsächlich nur wegen ihm. Manche reisten von weit her an. In kürzester Zeit war er zu einem Geheimtipp der echten Raver geworden. Wer ihn kannte, gehörte wirklich zum engsten Kreis der Frankfurter Clubszene.
Petra, mit der er seit einigen Monaten zusammen war, begleitete ihn sichtlich stolz zu fast jedem Gig. Timm selbst sah „die Sache“, wie er seine erste Beziehung nannte, wesentlich nüchterner als Petra. Sie hatte lange darum gekämpft, ihn für sich zu interessieren. Auf der letzten Klassenfahrt hatte er einfach nicht länger nein sagen können. Vielleicht verletzte seine Unnahbarkeit sie, aber sie ließ es sich nicht anmerken. Ebenso, wie er ihre Anhänglichkeit tolerierte. In seiner Gegenwart war sie stets fröhlich und wirkte verliebt. Timm nahm sich nicht die Zeit, sich zu fragen, ob ihm eine solch unausgeglichene Beziehung reichte, ob er vielleicht etwas ganz anderes wollte oder sogar gar keine Freundin. Wenn es morgen aus gewesen wäre zwischen ihnen, hätte es ihn wohl kaum berührt. Petra passte perfekt in sein Leben. Sie forderte nichts, außer ein wenig seiner Aufmerksamkeit und ging mit ihm, wohin er wollte.
An einem heißen Spätsommersamstag stand sie plötzlich neben seinem DJ-Pult und legte ihm drei bunte Pillen neben seine Cola. Timm trank keinen Tropfen Alkohol.
“Die musst du probieren, das ist unglaublich. Wie fliegen. Alles ist soo leicht...“
Timm sah sie skeptisch an. „Lass die Finger weg von den Drogen, Petzi. Guck dir die ganzen Leute doch an, die jedes Wochenende etwas anderes einwerfen.“
„Ach, Mensch, Timmy. Du bist ein echter Spielverderber. Du stehst hier an deinem Mischpult und liebst, was du tust. Gönn´ mir doch auch ein bisschen Spaß.“
„Drogen sind kein Spaß, und das weißt du ganz genau.“
Sie tänzelte davon, hinein in die wogende Menge, in der wahrscheinlich achtzig Prozent der Leute diese Pillen genommen hatten.
Während der nächsten zwei Stunden würdigte Timm die Pillen keines Blickes. Er brauchte kein Ecstasy, um high zu sein. Später, beim Einpacken, steckte er die Dinger achtlos in die Brusttasche seiner Jeansjacke und fuhr nach Hause, während Petra unermüdlich auch beim nächsten DJ weiter tanzte.
Nur eine Woche später waren Timm und Petra bei einer gemeinsamen Freundin eingeladen, auf deren Geburtstagsparty Timm ausnahmsweise mal nicht auflegte. Susanne konnte, wie so viele, mit Techno gar nichts anfangen. Sie liebte Independent und Rock und hatte deshalb einen anderen Freund gebeten, die Musik zu machen. Timm hatte sich erst vor der Party drücken wollen, hatte das dann aber doch nicht übers Herz gebracht. Jetzt stand er mit Petra in einer Ecke und fühlte sich irgendwie unwohl. Die Musik langweilte ihn zu Tode. Er hatte weder Bock zu reden, noch zu tanzen. Das hier war gar nicht seine Welt, und er spürte das mit jeder Faser seines Körpers. Doch er wollte Susanne und Petra auf keinen Fall enttäuschen. Es bedeutete ihnen viel, dass er hier war. Die paar Stunden würde er ihnen zuliebe schon durchhalten.
Petra hatte immer und überall Spaß. Das war vielleicht ihre größte Stärke, die er ganz besonders an ihr schätzte. Sie zerrte ihn kurze Zeit später fröhlich hopsend auf die enge Tanzfläche. Sie musste einfach tanzen, wenn sie Musik hörte, egal, welche. Wie anders war er doch, dachte Timm. Für ihn gab es nur noch Techno. Jede andere Musik erschien ihm furchtbar. Er gab sich Mühe, seine wahren Gefühle zu verbergen, fühlte sich aber gerade deshalb auf der Tanzfläche wie ein schwerer, steifer Betonklotz. Nach drei Liedern zog er sich wieder einmal auf die Toilette zurück. Dort kämpfte er tapfer gegen die Abwärtsspirale der negativen Stimmung. Er versuchte, sich mental zu motivieren, den Abend durchzuhalten, als er sich unvermittelt an die Pillen in seiner Jackentasche erinnerte. Vielleicht sollte er doch einmal eine probieren? Er kämpfte nicht lange mit sich, denn er erinnerte sich an seinen Schwur. Koste es, was es wolle… Mit einem Schluck Leitungswasser spülte er eine grüne Pille hinunter.
Zurück bei Petra fühlte er sich bereits entspannter, dem Geschehen um sich herum und seinen eigenen Reaktionen und Emotionen weniger ausgeliefert. Eine halbe Stunde später spürte er den Rhythmus der Musik in seinem ganzen Körper so deutlich wie seinen eigenen Herzschlag und ließ sich einfach von ihm bewegen. Mit einem Mal spielte es gar keine Rolle mehr, ob er Indie oder Techno hörte. Er fühlte die Musik in sich, und er liebte es. Petra sah ihn fragend an. So kannte sie Timm gar nicht. War er endlich aufgetaut, fragte sie sich. Timm tanzte und tanzte, zu jedem Song, zu jedem Beat, völlig frei und losgelöst. Die Abwehr, die Beklemmung und die Hemmung von vorhin waren gänzlich vergessen. Stattdessen breitete sich ein seltsames Gefühl des entspannten Glückes in ihm aus. Je mehr er tanzte, desto stärker wurde dieses Glücksgefühl, das fast seine Liebe zum Techno in den Schatten stellte.
Timm und Petra verließen die Party als Letzte und fuhren mit dem Fahrrad zu Timm nach Hause. Vor der Haustür hielt Petra ihn fest und sah ihm tief in die Augen. „Mal ehrlich, Timmy. Hast du eine von den Pillen genommen?“
„Nur eine.“
„Ist das nicht ein irres Gefühl?“
„ Ich hab´s mir nicht so befreiend vorgestellt.“
Petra küsste ihn leidenschaftlich. Fast hatte er das Gefühl, als liebe sie ihn dafür, dass er eine Ecstasy genommen hatte, noch mehr. „Willkommen im Club“, sagte sie grinsend, während er sich über diese Logik wunderte.
Obwohl die Wirkung der Pille längst nachgelassen haben musste, träumte Timm in dieser Nacht einen eigenartigen Traum. Er sah sich an seinem DJ-Pult vor Tausenden von Leuten, die alle synchron zu seinen Beats tanzten. Die Masse wogte wie ein Wesen, wie ein Fischschwarm, der graziös durch das Wasser tanzte. Die Einzelnen schienen jegliche Identität verloren zu haben. Aber das war nicht erschreckend, sondern schön, schöner als alles, was Timm jemals gesehen und erlebt hatte. Irgendwie wusste er in diesem Moment, dass er deshalb auflegte: um diesen Zustand, an dem er selber teilhatte, zu erleben. Dieses Einheitsgefühl berührte ihn tief, bewegte ihn sogar zu Tränen. Dies war ein Moment der Seligkeit, der Glückseligkeit, und er wollte ihn unbedingt festhalten.
Doch Träume können grausam sein. Timm wachte unvermittelt auf. Er hatte noch nicht länger als eine Stunde geschlafen. Petra setzte sich verschlafen neben ihm auf. Kurz sah er auch sie mit den Augen der Verbundenheit und für diesen Moment liebte er sie. Erstmals sah er, wie hübsch sie eigentlich war, und für einen winzigen Augenblick schätzte er sie, ihre Zuneigung und ihre Anhänglichkeit, die plötzlich wie unerschütterliche Loyalität wirkten.
„Ist alles in Ordnung?“, fragte sie ein wenig besorgt, als sie seinen verklärten Blick wahrnahm.
„Ja, ja, alles in Ordnung. Hab nur komisch geträumt...“
„Komisch? Was denn?“
„Weiß auch nicht. Ist schon wieder weg. Irgendwas vom Auflegen.“
Der Traum war flüchtig. Ebenso flüchtig wie das Einheitsgefühl, das Timms Unterbewusstsein für einen nächtlichen Moment in archetypische Traumbilder gefasst hatte. Am nächsten Morgen erinnerte Timm sich nur daran, dass er etwas Schönes gefühlt und gesehen hatte.
∞
Timms DJ-Karriere nahm weiter Fahrt auf. Er konnte sich vor Anfragen kaum retten und verbrachte fast jeden Nachmittag im Technostore. Mattes, der Besitzer, hatte ihn unter seine Fittiche genommen. Oft probierten sie im Hinterzimmer des Ladens neue Tracks gemeinsam aus oder kreierten Loops und ganze Songs.
„Du musst unbedingt im Sommer auf der Frank Beats auflegen, Timm“, sagte Mattes eines nachmittags.
„Auf der Frank Beats?“
„Ja, der Frank Beats!“
„Machst du Witze? Das Festival ist legendär.“
„Genau. Deshalb musst du unbedingt dabei sein.“
„Ehrlich, Mattes? Das ist ein Traum für mich.“
„Gut, dann hätten wir das also geklärt.“ Mattes klopfte Timm freundschaftlich auf den Rücken und spielte den nächsten Beat an.
Petra kreischte wie verrückt, als sie hörte, dass Timm im Sommer auf dem weltberühmten Techno-Festival an einem Baggersee außerhalb von Frankfurt spielen würde. „Timmy, das ist Wahnsinn. Nimmst du mich mit?“
„Natürlich, Petzi. Du bist überall dabei!“
„Ich kann´s kaum erwarten. Da sind alle. Einfach alle.“
„Ja, und wir zwei.“ Timm umarmte Petra herzlich und ließ sie seine Freude und Zuneigung spüren.
Petra wirkte auf einmal nachdenklicher als sonst. „Ich weiß gar nicht, was wir ohne die Musik machen würden.“
„Wie meinst du das?“
„Ich meine, Techno bedeutet uns so viel. Wir verbringen soviel Zeit damit. Du noch mehr als ich. Ich hab´ das Gefühl, dass es nichts auf der Welt gibt, das uns so wichtig ist. Nichts, das uns so sehr verbindet.“
Timm ließ sich von ihrer Nachdenklichkeit anstecken. „Ja, das ist wahr. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nur am DJ-Pult und durch die Musik wirklich lebe.“
„Und wir gehören alle zusammen. Ich meine, die, die Techno lieben, sind wie eine große Familie. Wir verstehen uns blind. Wir lieben das Gleiche, wir denken das Gleiche, wir machen das Gleiche. Ich hätte nie gedacht, dass es so etwas gibt.“
Timm sagte nichts mehr. Ihre Worte hallten in ihm nach. Irgendwie erschienen sie ihm groß und wichtig. Warum hatte er noch nie so über Techno nachgedacht? Ja, auch er hatte das Gefühl, irgendwie angekommen zu sein; das gefunden zu haben, was ihn ausmachte und erfüllte. Techno bedeutete ihm alles. Die Liebe zur Musik erfüllte ihn mit nie gekannter Leidenschaft. Er hatte das Gefühl, endlich das gefunden zu haben, was ihn ausmachte. Die Musik gab ihm Kraft, Identität und Selbstbewusstsein.
Das nächste Ziel stand für Timm also fest. Je konzentrierter er darauf hinarbeitete, desto rasender verging die Zeit. Timm bereitete sich akribisch auf seinen Auftritt auf der Frank Beats vor. Mattes spielte ihm ungefragt immer wieder neue Ideen und Anregungen zu. Er rückte nicht richtig mit der Sprache heraus, aber Timm hatte das Gefühl, als wolle er ihn aufbauen, als hätte er in Zukunft irgendetwas mit ihm vor.
Und dann war es endlich soweit. Timm und Petra standen im Hochsommer zum Soundcheck auf der riesigen Bühne des sandigen Festival-Areals, das größer als zwei Fußballfelder sein musste. Bald würden hier tausende Technofans aus aller Welt vor ihnen stehen und tanzen. Timm sah es schon vor seinem geistigen Auge. Das Ganze wirkte auf die beiden Schüler vollkommen surreal und überwältigend.
Die Sonne knallte vom blauen Himmel. Das Wetter war einfach perfekt für diesen Rave, der am späten Freitagnachmittag begann und erst Sonntagmorgen enden würde. Mattes kam vorbei und klopfte Timm auf die Schulter. „Na, aufgeregt?“
„Total. Meine Knie schlottern. Diese Bühne und dieser Blick sind einfach gigantisch.“
„Du machst das schon. Denk daran: du tust hier nur, was du immer machst und am besten kannst. Lampenfieber ist gut. Es gibt einem den nötigen Kick, um noch ein bisschen besser zu sein als sonst.“
Und genau so war es. Timm war einer der ersten Künstler, die am Freitag das Festival eröffneten. Als er von seinem Synthesizer aufsah und in die erwartungsvolle Menschenmenge blickte, klopfte sein Herz rasend schnell und laut. Jetzt galt die gesammelte Aufmerksamkeit ihm. Jetzt konnte er zeigen, was er konnte. Mit seiner Musik konnte er die Menge in Ekstase versetzen. Er konnte ihr Freude schenken, das Gefühl, sich wie ein Wesen zu bewegen, eine große, begeisterte Einheit zu sein. Nach den ersten Tracks spürte er, dass der Funke übersprang, dass seine Intention aufging und seine Musik ankam. Jetzt erst verstand er, dass Techno so viel mehr als Musik, Tanz und Vergnügen war. Techno war eine Einstellung, eine Lebensart, eine Philosophie, die einen beinahe unergründlichen Tiefgang zu haben schien und sich mit nichts vergleichen ließ, das er bisher kannte oder erlebt hatte.
Sie rauschten euphorisch durch die Tage auf der Frank Beats. Nach seinem Gig war Timm selbst in die Menge getaucht, hatte mit Petra die ganze Nacht durch getanzt und alles andere vergessen. Es hatte nur noch diesen Moment gegeben und sonst nichts.
Wenn Timm später nach dieser Zeit gefragt wurde, fand er nie die richtigen Worte, um sie zu beschreiben. Er sagte dann immer: „Das alles war größer als wir. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich richtig lebendig und dazugehörig gefühlt. Das alles war ich. Es war genau so, wie ich sein wollte, wie ich mich ausdrücken wollte. Alle waren so und alle wollten dasselbe.“
Nach seinem Auftritt auf dem Festival wurde Timm mit Angeboten für Gigs überschwemmt und verkaufte inzwischen eigene Aufnahmen in Mattes Laden. Dies war keine Zeit für Selbstzweifel, keine Zeit zur Selbstreflexion. Das Leben schenkte Timm Spaß, Anerkennung und vieles mehr, und er musste nie darüber nachdenken, welchen Schritt er als nächstes machen sollte. Die Frage, ob er das Richtige tat, stellte sich ohnehin nicht.
„Hör mal, Timmy. Wann wirst du denn endlich achtzehn?“, fragte Mattes ihn irgendwann. Timm spürte, dass dies ein ernsteres, wichtigeres Gespräch war, als sonst.
„Nächstes Jahr im November! Warum?“
Mattes lachte. „Es gibt ein paar Leute, die dich gerne häufiger hören würden.“
„Ich will das Abi machen, Mattes. Ich will unbedingt studieren.“
„Das schaffst du doch mit links, oder?“
„Na ja. Ich muss schon was dafür tun. Ohne Petra wäre es viel schwieriger. Sie hilft mir oft aus, wenn ich in der Schule zu müde bin und nur die Hälfte verstanden hab.“
„Ihr seid ein gutes Team. Ich mag Petzi. Also, nochmal fürs Protokoll: nächsten November wirst du achtzehn und im Sommer darauf machst du Abi?“
„Wenn alles so läuft, wie geplant...“
3
MEERA
Nach einer traumlosen Nacht erwachte Meera vom aufgeregten, morgendlichen Kreischen der Möwen, die vom Meer über den Hotelgarten hinweg segelten. Meeras Körper fühlte sich schwer und wie erschlagen an, obwohl sie gut geschlafen hatte. Nichts hätte sie motivieren können aufzustehen. Weder die herrliche Sonne, noch der goldgelbe Strand, oder das blaue Meer. Nicht einmal die Aussicht auf viele, tolle Sehenswürdigkeiten, oder Yoga und Meditation. Sie wollte einfach nur schlafen; so lange, bis sie endlich nicht mehr matt und müde war, ganz egal, wie lange das dauern würde.
Sie schlief direkt wieder ein, bis die Hitze des Mittags sie erneut aufweckte. Das Zimmerthermometer zeigte fünfunddreißig Grad. Der Himmel war wolkenlos und die Luftfeuchtigkeit hoch. Ende Oktober! Meera verließ das Bett matt und dösig für eine kurze kalte Dusche. Die Banane von gestern Abend und zwei Datteln aß sie auf der Terrasse und trank dazu einen Tee, den sie mit dem zimmer-eigenen Wasserkocher selbst aufbrühte.
Es schien sehr ruhig in der Hotelanlage. Die meisten anderen Gäste waren sicher am Strand oder unterwegs, überlegte Meera. Stille und Alleinsein taten ihr seelisch gut. Doch körperlich verstärkten beide nur ihre unendliche Müdigkeit. Meera wusste, dass ihre Psyche sich mit extremer Erschöpfung schützte. Ihre Therapeutin hatte diese bleierne, körperliche Schwere Heilungskrisenfatigue genannt, als sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Das war kurz nach der Flucht aus Janakas Ashram gewesen.
Bei Nacht und Nebel war sie damals mit einem einzigen Rucksack geflüchtet. Sie hatte wochenlang auf den richtigen Moment gewartet und ihren Plan geheim gehalten. Inzwischen war sie die rechte Hand von Janaka geworden, hatte viel Verantwortung im Ashram und wusste viel zu viel. Janaka hätte sie niemals freiwillig gehen lassen, vor allem dann nicht, wenn er gewusst hätte, was sie vorhatte. Sie war die halbe Nacht durch den Wald nach Nordwesten gelaufen. Den ganzen nächsten Tag hatte sie sich im Unterholz versteckt. Erst in der darauffolgenden Nacht war sie weiter gewandert und hatte gegen Morgen Darmstadt erreicht. Dort war sie in einen Zug nach Hannover gestiegen. Ohne sich vorher angemeldet zu haben, hatte sie nach zwölf Jahren fast ohne Kontakt bei ihrer Mutter vor der Haustür gestanden. Die war in Tränen ausgebrochen, hatte kein Wort herausgebracht, keine Erklärung verlangt, sie einfach nur umarmt und festgehalten. Später hatte sie Meera im Souterrain ein Bett zurechtgemacht, ihr einen neuen Schlafanzug gebracht und gesagt: „Schlaf dich aus. Hier bist du sicher!“
Und Meera hatte geschlafen und geschlafen. Der ganze Schlafmangel, der sich über zwölf lange, arbeitsame Jahre in ihr angesammelt hatte, hatte scheinbar auf einmal nachgeholt werden wollen. Als Meera nach zwei Wochen noch immer zu müde und zu schlapp gewesen war, das Bett länger als eine Stunde am Tag zu verlassen, hatte ihre Mutter Franka angerufen, eine alte Freundin, die als Therapeutin arbeitete. Franka war sofort gekommen und hatte sich Zeit für Meera genommen. Damals war es noch zu früh für Meera gewesen, ihre Geschichte zu erzählen. Zum Glück hatte Franka gewusst, wo sie gewesen war und auch geahnt, was ihr geschehen war. Deshalb hatte sie keine Fragen gestellt. Doch ihre erste klare Feststellung hallte noch heute in Meeras Gedächtnis wieder. „Diese Müdigkeit heißt Heilungskrisenfatigue. Sie schützt dich vor allzu schlimmen Erinnerungen, die jetzt, wo du dich sicher fühlst, aus dir herausbrechen könnten. Wehre dich nicht gegen die Müdigkeit. Sie wird von selbst weniger, wenn deine Psyche versteht, dass es vorbei ist.“
Zynisch hatte Meera entgegnet: „Es ist noch lange nicht vorbei. Das Schlimmste steht mir noch bevor.“
„Da könntest du recht haben. Aber du wirst es erst dann angehen, wenn du bereit dazu bist. Darauf werden wir gemeinsam achten, versprochen?“
Meera hatte die krasse emotionale Wirkung von Frankas Worten im ganzen Körper gespürt. Endlich, nach so vielen Jahren, schien ihr wieder jemand zu erlauben, ihrem eigenen Urteil und Rhythmus zu folgen und sie dabei unterstützen zu wollen. Das hatte so gut getan, dass Meera unvermittelt in Tränen ausgebrochen war. In diesem Moment hatte sie begriffen, dass die Zeit des stummen Dienens endlich vorbei war, und dass sie erst wieder lernen musste, selbstbestimmt ihren eigenen Impulsen zu folgen.
Vier Jahre später saß sie allein in Goa und spürte dieselbe Müdigkeit. Doch von dem ersten Gespräch mit Franka trennte sie heute so viel; viele kleine Schritte, die ihr Urteilsvermögen und ihre Eigenständigkeit teilweise zurückgebracht hatten. Viele kleine Schritte, die Aufarbeitung und Heilung bedeuteten. Die Reise nach Goa war der größte Schritt, den sie bisher allein gewagt hatte, denn sie hatte ihr Versprechen, das sie Franka gegeben hatte, gehalten. Sie hatte auch diesen Schritt erst dann gewagt, als sie bereit dafür war. Doch warum war sie dann jetzt so unendlich müde? Wovor schützte ihre Psyche sie diesmal? Meera schloss die Terrassentür, stellte den Deckenventilator an und kletterte wieder in ihr herrliches Himmelbett.
∞
Sie schlief insgesamt drei Tage und drei Nächte, bestellte sich nur ab und zu beim Zimmerservice ein Sandwich oder ein Lassi. Am zweiten Tag fragte Rajkumar, der ihr ein Gurkensandwich, eine Mango und Nüsse brachte: „Sind sie in Ordnung, Miss Meera? Sollen wir einen Arzt rufen?“
„Nein, danke, Rajkumar. Mir fehlt nichts. Ich bin nur sehr, sehr müde. Das habe ich manchmal. Ich habe eine schwere Zeit hinter mir.“
Der Zimmerkellner sah sie warmherzig an. „Das tut mir sehr leid. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, sagen Sie das bitte. Ich könnte Ihnen auch Misses Mukherji vorbeischicken, die Besitzerin vom Cozy Yoga Hotel. Sie ist eine sehr mitfühlende Frau und weiß immer Rat.“
„Danke, Rajkumar. Ich weiß Ihre Besorgnis sehr zu schätzen. Wenn es mir übermorgen nicht besser gehen sollte, komme ich gerne auf Ihr Angebot zurück. Bis dahin würde ich lieber abwarten, denn ich glaube, dass mein Körper sehr genau weiß, was er braucht.“
„Da haben Sie Recht, Miss Meera. Wenn Sie Ihrem Körper so vertrauen, dann tue ich das auch.“ Er lachte und verabschiedete sich fröhlich und merklich erleichtert.
Erst am Abend des dritten Tages fühlte Meera sich wach und stark genug, ihr Zimmer zu verlassen. Sie wollte endlich den Strand sehen, ein bisschen schwimmen, umherlaufen und frische, salzige Meeresluft atmen. Sie zog sich also einen Badeanzug an, wickelte sich ein Tuch um die Hüften und packte ein Handtuch in ihre Badetasche.
Auf dem Weg zum Strand begegneten ihr die ersten Menschen. Die meisten grüßten sie lächelnd. Meera bog nach links ab. Auf dem Hotelplan hatte es so ausgesehen, als wäre der Strand dort breiter und das Meer flacher und ruhiger. Sie fand schnell den Hauptweg, der unter Kokospalmen direkt am Strand entlang führte und folgte ihm. Die sanfte Brise, die vom Meer herüber wehte, ließ sie tief durchatmen. Der goldgelbe Strand wirkte relativ leer. Meera lief fast bis ans äußerste Ende des Hotelgeländes und suchte sich dann einen Liegeplatz auf einer breiten Holzliege unter einem großem Sonnenschirm.
Kurz darauf schwamm sie schon im lauwarmen Arabischen Meer. Kleine Fischchen knabberten an ihren Füßen und Waden, und sie lachte, weil das kitzelte. Dann legte sie sich auf den Rücken und ließ sich einfach treiben. Das salzige Meer trug sie, und sie fühlte sich beinahe schwerelos. Danach hatte sie sich gesehnt. Wie viele Jahre hatte sie einfach nur einmal unbeschwert den Moment genießen wollen? Stattdessen hatte sie immer etwas zu tun gehabt. Aber am schlimmsten war der psychische Druck gewesen, sich ständig entwickeln zu müssen. Immer hatte es etwas zu heilen gegeben, etwas zu erkennen, etwas loszulassen. Nie war sie einfach so, wie sie war, genug gewesen. Janaka hatte ihr und allen seinen Schülern ständig das Gefühl gegeben, dass sie noch besser, noch wacher, noch schneller, noch bewusster werden konnten – und werden mussten. War ein Ziel erreicht, hatte er im selben Moment schon das nächste gesteckt.
Meera zwang sich, sich nicht erneut in Erinnerungen zu verlieren. Jetzt wollte sie einfach das Meer genießen und sich selbst erlauben, für einen kurzen Moment glücklich zu sein. Wasser spritzte in ihr Gesicht. Der blaue Himmel, mit kleinen weißen Wolken getupft, tanzte über ihr. Ihr Körper wurde immer leichter. Ihr Herz schien sich zu öffnen und auszudehnen. Ein einfaches, doch sehr essentielles Glücksgefühl überkam sie. Sie spürte den Impuls, dieses Gefühl abzuschneiden, es schnell zu beenden. „Diesmal nicht“, sagte sie sich. „Diesmal lasse ich es zu.“
Meera hatte schon so oft darüber nachgedacht, warum man Glück nicht mehr aushalten konnte, wenn man zu viel Leid erlebt hatte. Sie hatte diesen inneren Mechanismus bis heute nicht verstanden. Wenn man Glücklichsein am meisten brauchte, konnte man es am wenigsten ertragen. Heute konnte Meera es aushalten, obwohl sie sich erst bewusst dafür entscheiden musste. Sie genoss jede Sekunde, die sie im flachen, warmen Meer in Ufernähe wie eine Luftmatratze trieb. Leicht und unbeschwert. Es war einfach großartig.
Nach dem Baden legte sie sich in den warmen Sand, panierte sich fröhlich ein, wie sie es als Kind immer getan hatte. Und plötzlich flammte eine neue Erinnerung auf. Die Erinnerung an das glückliche Kind, das sie einst gewesen war. Das Gefühl, das sie damals gehabt hatte, durchflutete ihren ganzen Körper. Meera staunte über die Kraft und Lebendigkeit dieses Wesensteils, der viel zu viele Jahre tief in ihr versteckt gewesen war. Die Wucht, mit der das Leben in sie zurückkehrte, war gewaltig. Die Kraft des unschuldigen Kindes, des unverletzten Kindes, durchbrach den Panzer des Selbstschutzes wie eine Tsunamiwelle. Gleichzeitig überwältigte Meera ein nie gekanntes Gefühl der Liebe für sich selbst und für das Leben. Erst jetzt erfasste sie, was sie wirklich verloren hatte und wie groß ihr Verlust tatsächlich war. Doch diese Erkenntnis erfüllte sie nicht mit Trauer, Wut oder Hilflosigkeit, so wie es viele Erkenntnisse vorher getan hatten. Nein, diese klaren, starken Empfindungen erfüllten sie mit Hoffnung, mit dem tiefen Glauben, dass sie frei sein würde, so frei und unbeschwert wie ihr kindliches Selbst, das in ihr, unter den vielen Trümmern ihrer verletzten Persönlichkeit, noch immer lebte. Instinktiv hörte Meera auf zu denken, die tiefe Empfindung in irgendeiner Form zu analysieren, zu rationalisieren. Statt dessen erlaubte sie ihr, sich in ihr auszubreiten, Besitz von ihr zu ergreifen, ihren Körper und ihr Herz zu füllen.
Irgendwann verebbten die Empfindungen, doch die Veränderung in Meeras innerem Zustand, den die Erinnerung an das heile, unschuldige Kind in ihr bewirkt hatte, blieb. Statt sich nach dem Sonnenbaden direkt wieder in ihr Zimmer zurückzuziehen, ging Meera voller Tatendrang zur Rezeption, um sich nach Ausflugsangeboten und Hotelaktivitäten zu erkundigen.
Schon als sie die Lobby betrat, hörte sie das fröhliche Kreischen Captain Hooks. „Hallihallo, Meera. Meerabai. Hallo. Hallihallo.“
Meera ging zu der Holzstange, auf der er auf einem Bein hockte und sie fröhlich mit schräg gelegtem Kopf ansah.
„Na, Captain Hook. Du kennst mich ja.“