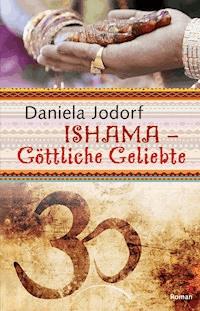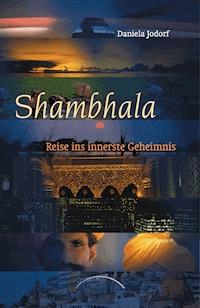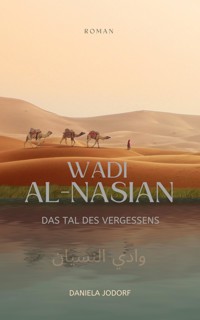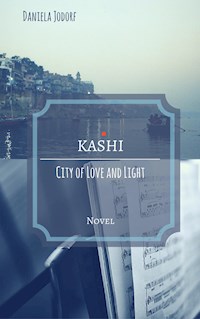Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: J. Kamphausen Mediengruppe GmbH
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Leben als geistige Schulung... Als die junge Inderin Amrita ihr Kunststudium in London beendet hat und nach Delhi zurückkehrt, sollen die üblichen Schritte folgen: Ehe, Kinder, Haushalt. Doch Amrita sehnt sich nach Selbsterkenntnis und Wahrheit. Beides wird sie im Laufes des Buches gewinnen und wir mit ihr. Als Amrita ihre Meisterin, die weise tantrische Lehrerin Amma, findet, wird ihr gesamtes Leben zu einer geistigen Schulung. Ihre Liebe zu Gopal, dem Mann ihrer Schwester, den sie schon aus vergangenen Leben kennt und ihre Bereitschaft, alte karmischen Verstrickungen zu lösen, verweben sich zu einer spannenden Geschichte, die gleichzeitig eine Lektion in den Prinzipien des Tantra ist. Eine junge Inderin auf der Suche nach Wahrheit und Selbsterkennnis verwoben in eine spannende und wunderbar zu lesende Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die
Meisterschülerin
Bildmotive zum Cover:Schloss: © Irina Lauterbach – photocaseStreifen: © Sunnydays – Fotolia.comYantra: Mahesh Patil – Fotolia.comFrau: TheFinalMiracle – Fotolia.com
Vollständige E-Book-Ausgabe der beiJ.Kamphausen Verlag & Distribution GmbHerschienenen Printausgabe
Daniela Jodorf:Die Meisterschülerin© J. Kamphausen Verlag &Distribution GmbH, Bielefeld [email protected]:Marianne Nentwig
Lektorat: Regina RademächersUmschlag-Gestaltung/Satz:Wilfried KleiDruck & Verarbeitung Printausgabe:Westermann Druck Zwickau GmbHDatenkonvertierung E-Book:Bookwire GmbH
www.weltinnenraum.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diesePublikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internetüber http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN E-Book: 978-3-89901-491-4
ISBN Printausgabe: 978-3-89901-195-1
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen undsonstige Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte Wiedergabesowie des auszugsweisen Nachdrucks vorbehalten.
Daniela Jodorf
Die
Meisterschülerin
Roman
DIE MEISTERSCHÜLERIN
Sri Vijnana Bhairava Tantra
1. Sri Devyuvacha:Shrutam deva maya sarvam rudrayamalasambhavam;Trikabhedam asheshena sarat saravibhagashah.Sri Devi sagt:„Ich habe alles über das Göttliche, über die verschleiernde Kraft,über dasRudramala-Tantra und über die vollständige Bedeutungder Dreiheit gehört.“
2. Adyapi na nivritto me samshayah parameshvara; ...„Dennoch ist mein Zweifel nicht verschwunden, Höchster Herr.“
2b. Kim rupam tattvato deva; …„Welche ist die tatsächliche Gestalt des Göttlichen?“
7. Prasadam kuru me natha nihshesham chhindhi samshayam;„Ich bitte Dich, zerstöre meine Zweifel vollständig.“
Bhairva uvacha:Sadhu sadhu tvaya pristham tantrasaram idam priye.Bhairava sagt:„Sehr gut gesprochen, meine Liebste. Du fragst nach der Essenzvon Tantra.“
54. Svadehe jagato vapi sokshmasokshmatarani cha;Tattvani yani nilayam dhyatvante vyajyate para.„Wer dem Weg der immer subtiler werdenden Elemente in der Weltund im eigenen Inneren bis zum subtilsten folgt, dem wird die Quelledessen offenbar, was jenseits der Erscheinungen liegt.“
95. Maya vimohini nama kalayah kalanam sthitam;Ityadidharmam tattvanam kalyan na prithag bhavet.„Wer der Versuchung der Täuschung nicht erliegt und insbesondereden Schleier der Individualität lüftet, ist auf dem rechten Weg.Er wird deshalb nicht dauerhaft von der Wahrheit, dem reinen Sein,getrennt sein.“
106. Grahyagrahaksamvittih samanya sarvadehinam;Yoginam tu vishesho´sti sambandhe savadhanata.„Subjekt-Objekt-Bewusstsein ist jedem gleichermaßen zu eigen.Dem Yogi aber ist dies suspekt und er betrachtet es mitbesonderer Achtsamkeit.“
109. Sarvajnah sarvakarta cha vyapakah parameshvara;Sa evaham shaivadharama iti dardhyaad bhavechchhivah.„Das Göttliche ist allwissend, allmächtig und alldurchdringend.Wahrlich, ich bin Er.Durch dauerhafte Affirmation dieser Wahrheit,erlangt man Shiva-Natur.“
PROLOG
Mein Name ist Amrita. In dem Land, in dem ich lebe, hat jeder Name eine Bedeutung. Jedes Kind erhält seinen Namen nach seiner Bestimmung. Viele Eltern lassen sich vor der Geburt von einem Astrologen oder Heiligen den Namen für ihr Kind nennen, der sein individuelles Selbst, jivatman, symbolisiert, damit es – gelenkt von seiner Bedeutung – sein karma erfüllen oder überwinden kann ...
Ich kenne mein karma nicht, aber ich kenne die Bedeutung meines Namens. Amrita bedeutet „Nektar der Unsterblichkeit“.
Obwohl wir Inder auch wissen, dass Namen Schall und Rauch sind, dass es das Namenlose und das Formlose ist, was wir suchen, haben wir doch ein untrügliches Gefühl für die Bedeutungsschwere eines Namens oder eines Wortes. Wir leben tief verwurzelt in einer spirituellen Tradition, die uns mit unserer Intuition verbindet, einem Wissen jenseits des Benennbaren, das über uns kommt – von Gott gesandt.
Ich, Amrita, liebte meinen Namen, als ich ihn noch nicht verstand. Doch irgendwann wurde er zu einer Bürde, zu einer schweren Last, denn ich begann, nach dem Nektar zu suchen, der irgendwo in mir fließen sollte, dem Nektar, der Unsterblichkeit verhieß – der Unsterblichkeit, die Meisterschaft bedeutet.
Es sollte lange dauern, bis ich sie fand ...
1
Die Musik der Sitar schallte leise durch den Garten. Die Zimbeln klingelten wie klare, helle Glocken und vermischten sich mit dem zarten Lachen, das durch die Nachtluft wie eine leise Brise zu mir herüberwehte. Der Priester stand zwischen Braut und Bräutigam. Beide sahen aus wie ein königliches Paar, in kostbare, golddurchwirkte Brokate gehüllt. Das Kleid meiner Schwester wog 15 Kilo. Es schien, als hätte man sie gegen Gold aufgewogen, um dem Bräutigam und seiner Familie ihre Kostbarkeit zu beweisen. Liebevoll glitt mein Blick über Indu. Sie hielt aufgeregt die Hand ihres Bräutigams. Gautam sah jung aus heute Abend. Jünger als sonst. Er war nervös. Obwohl er einige Jahre älter war als Indu, hatten meine Eltern schließlich in die Ehe eingewilligt. Viele junge Männer hatten sich auf die Heiratsanzeige gemeldet, die Vater vor einem halben Jahr aufgegeben hatte. Doch Indu hatte sich sofort in Gautam verliebt. Er sah blendend aus, er kam aus einer wohlhabenden Familie und verdiente selbst viel Geld. Das waren die Dinge, die für Indu entscheidend waren, um einem Mann ihr Leben zu schenken. Sie tat es voller Freude. Auch meine warnenden Worte hatten sie nicht davon abhalten können, Gautam das Eheversprechen zu geben.
Ich hatte die beiden von der ersten Begegnung an zusammen beobachtet. Sie sprachen höflich und interessiert miteinander, sie lachten viel. Gautam war aufmerksam und gebildet. Er kam häufig zu uns nach Hause, um Indu und unsere Eltern besser kennen zu lernen. Keiner schien zu sehen, was ich sah, oder besser gesagt, zu fühlen, was ich fühlte. Es war diese leise, kaum wahrnehmbare Disharmonie, die in Gautams und Indus Lachen zu hören war. Eine Dissonanz, die mir niemand glauben wollte. Seine Gesten wirkten oft starr in ihrer Gegenwart, manchmal hart. Aus Indu schien ein Stück des vibrierenden Lebens zu weichen, wenn sie Arm in Arm mit Gautam im Park vor unserem Haus spazieren ging. Ich wollte alles andere, als die Kassandra sein, die ihrer Schwester Unglück prophezeite. Vielleicht war ich wirklich neidisch, wie Indu glaubte, und hatte deshalb nur Augen für die Unstimmigkeiten. Vielleicht war ich neidisch, weil ich die jüngere Schwester war und erst in vier Jahren heiraten würde, wenn ich mein Studium – das ich heute noch nicht einmal begonnen hatte – abgeschlossen haben würde.
Damals war ich geneigt, meiner eigenen Wahrnehmung zu misstrauen. Ich fürchtete die Hellsicht, die ab und an über mich kam; Dinge, die ich sah, die ich nicht erklären konnte, weil es keine Sprache für sie gab oder weil die anderen die Sprache, in der sich das Wissen ausdrückte, nicht verstanden.
So war ich auch heute die Außenseiterin am schönsten Tag im Leben meiner älteren Schwester. Ich stand im Abseits unter einem Banyanbaum. Traurig, obwohl ich mich hätte freuen sollen. Einsam, obwohl viele Menschen den Garten mit ihrem Lachen und ihren Gesprächen füllten.
Die Lampions schwebten wie an unsichtbaren Fäden unter den Blättern der Bäume und warfen ihr buntes Licht auf mich und meinen indigofarbenen Sari, der mich wunderschön und anmutig aussehen ließ. Manche hielten mich für hübscher als meine Schwester. Für mich gab es diesen Vergleich nicht. Indu war anders. Feingliedriger zwar, und doch weniger anmutig. Ihrem Gang fehlte ein wenig des Schwunges, der meinen weich und schwebend wirken ließ. Aber das waren nur Äußerlichkeiten. Vielleicht sahen die Menschen die Dinge, die uns im Innern unterschieden. Vielleicht sahen sie die Tiefe meiner Gedankenkraft, die mir eine seltsame, fast magische Andersartigkeit verlieh, unter der ich litt, wie ein Bettler unter Lepra.
Niemals war ich mir meiner Andersartigkeit so bewusst gewesen wie heute. Ich hatte Mühe, die Tränen zu unterdrücken, als ich Indu so grundlos glücklich sah. Sie war mit so wenig zufrieden. Sie war bereit, einen Mann zu heiraten, den man für sie ausgesucht hatte, und hörte die Zeichen nicht, die davon sprachen, dass er der Falsche für sie war. Das war Indu, meine geliebte Indu, die in der Welt lebte und die das Formlose nicht wahrnahm. Das, was mich bewegte, gab es für sie nicht. Ich wünschte mir, ich wäre so wie sie. Das Leben wäre so leicht. So einfach. Aber auch so bedeutungslos. Ich wünschte mir Bedeutungslosigkeit, weil mich Bedeutungsschwere erdrückte.
Ich kämpfte mit den Tränen. Ich wusste, dass jeder, der mich weinen sah, glaubte, es wären Tränen der Freude und der Rührung, die meine Wangen benetzten. Nur ich wusste, dass es Tränen der Trauer waren. Ich weinte nicht um den Verlust meiner Schwester, nein, ich weinte um meine innere Einsamkeit und die Ohnmacht, die ich angesichts der Erkenntnis empfand, dass ich nicht sagen durfte, was ich dachte, weil die anderen meine Gedanken nicht verstehen konnten.
Die Zeremonie schritt weiter fort. Der Priester rezitierte mantras, warf Weihrauch und Geld in das Feuer, agni, das er zwischen den zu Vermählenden entzündet hatte. Ich suchte mit den Augen nach meiner Mutter. Sie stand mit Gautams Mutter Arm in Arm neben dem Zelt, unter dem in der Mitte des Gartens die Vermählung stattfand. Vater saß neben Indu. Er würde sie gleich Gautam übergeben. Dann würden die beiden einander einen Rosenkranz um den Hals legen und sich ewige Treue schwören. Alle waren voller Hoffnung. Nur in mir herrschte düstere Hoffnungslosigkeit.
Ich suchte die Ablenkung, ging hinein in das festlich geschmückte Zelt, suchte den Oberkellner, um mich zu vergewissern, dass das Buffet bereitstand, wenn die Gäste nach der prunkvollen Abreise des Paares zurückkämen. Das Essen sah wundervoll aus. Wir hatten mehr als 300 Gäste zu bewirten. Alles zeugte vom Reichtum unserer Familie. Ich verhandelte streng und fordernd mit dem Oberkellner. Er hatte die Desserts noch nicht aufgestellt, Dekorationen fehlten, die wir ausdrücklich bestellt hatten. Er sah mich konsterniert an. Ich wusste, dass er diese Bestimmtheit nicht gewohnt war. Missmutig tat er, wie ich ihn hieß.
Ich war das Befehlen von Kind auf gewöhnt. Wir waren mit Dienern, Köchen und Gehilfen aufgewachsen. Ich wusste, dass ich all diese Dinge selbstverständlich und natürlich tat. Ich wusste auch, dass ich niemals überheblich nur befahl, sondern in jedem Befehl nur einen Wunsch äußerte, eine Bitte, die sich nach Erfüllung sehnte. Ich forderte mit Mitgefühl, niemals willkürlich, sondern immer nur das Nötige. Dennoch schien es dem Kellner zu missfallen, sich meinem Wunsch beugen zu müssen. Seine Reaktion machte mich noch trauriger. Selbst dieser fremde Mann gab mir das Gefühl, anders zu sein, irgendwie befremdlich. Mir war, als löste ich eine ganze Reihe von negativen Gefühlen in ihm aus, ohne es zu wollen.
Gerade in dem Moment, als das Brautpaar die Rosenkränze austauschte und sieben Mal Hand in Hand im Kreis um das Feuer schritt, kam ich zurück nach draußen. Mutter winkte mir aufgeregt zu. Sie hielt ein Taschentuch in der Hand, um die Tränen der Freude zu trocknen. Ich lief zu ihr hinüber, um den frisch Vermählten, die nun aus dem Zelt heraus ins Freie traten, zu folgen, hinunter zu den Bäumen, hinaus aus dem Garten. Die Musiker folgten uns. Es bildete sich eine lange, fröhlich-andächtige Prozession. Indu und Gautam führten sie an – wie im Rausch des Glücks. Gautam sprang als Erster in den MG, der bereitstand, um die beiden zum Flughafen zu bringen. Indu folgte ihm, er hupte kurz, und dann jubelte die Menge, als der glückliche Bräutigam den Wagen startete und schnell davonbrauste, um seiner Frau und sich die Zweisamkeit zu schenken, die sie die letzten zehn Tage, während der endlosen Zeremonien ihrer Hochzeit, niemals hatten finden können.
Wenige Tage später war es auch Zeit für meine Abreise. Man hatte mein künstlerisches Talent schon früh erkannt. Als Kind zeichnete ich stundenlang, tief versunken in die Gegenstände, die ich betrachtete, und schon als Schülerin hatte ich ein oder zwei kleine Ausstellungen gehabt. Meine Lehrer prophezeiten mir eine „schöpferische, erfolgreiche Zukunft“. Was immer das bedeuten sollte.
Ich liebte die Malerei. Erst wenn Gegenstand, Auge, visuelle Vorstellungskraft, Hand und Papier, miteinander verschmolzen, war ich glücklich, fühlte ich mich frei und ganz ich selbst. Aber ich war nicht die verträumte Malerin, die allein auf ihr Talent baute. Ich wusste, dass es viel zu lernen gab, wenn ich meine Begabung, die mir geschenkt worden war, vervollkommnen wollte.
So hatte ich den Wunsch geäußert, in England studieren zu dürfen. Vater und Mutter waren weltoffene Inder, die selbst viel gereist und häufig in England gewesen waren. Sie legten nur den nötigsten Wert auf die traditionelle Erziehung ihrer Töchter. Doch mein Anliegen stieß an die Grenzen ihrer liberalen Gesinnung. Es fiel ihnen schwer, ihre jüngste Tochter allein ins westliche Ausland gehen zu lassen. Aber sie wussten, dass die Malerei meine Verbindung zum Leben war, dass ich den schöpferischen Ausdruck zum Leben brauchte wie ein Fisch das Wasser. Zu guter Letzt durfte ich nach England gehen, wenn ich bei der Familie eines Onkels meiner Mutter wohnen würde.
Ich verbrachte vier Jahre in London. Es war eine Zeit des Experimentierens. Eine Zeit, in der ich mich von meinen indischen Wurzeln entfernte und endlich die Einsamkeit der Andersartigkeit vergaß. Ich lebte, was das Leben mir schenkte, studierte und malte voller Leidenschaft. Ich kleidete mich ganz im europäischen Stil. Ich war jung – und ich hatte viel nachzuholen. Niemand beobachtete mich, niemand kritisierte mich. Ich war ein junges Mädchen, wie jedes andere. Vielleicht etwas hübscher als der Durchschnitt, etwas mysteriöser und etwas nachdenklicher.
Ich fand viele Freunde. Wir feierten Partys, fuhren aufs Land. Die Kunst verband uns und schenkte uns eine Freiheit und eine Sorglosigkeit, um die uns viele beneideten. Ich stürzte mich vorurteilslos in das leichte Großstadtleben und vergaß die Fragen, die in Indien immer so dringlich für mich gewesen waren.
Eine Zeit lang hatte ich sogar geglaubt, nach England zu gehören und nie mehr nach Indien zurückkehren zu wollen. Jede Ferien, die ich bei meinen Eltern verbrachte, endeten mit einem bitteren Streit. Vater wollte, dass ich, sobald ich zurückkam, heiratete – wie Indu. Mutter fürchtete um meinen Ruf. Sie hatte gehört, dass ich in England mit jungen Männern ausgegangen war. Kein Inder war darunter gewesen. Ich fühlte jedes Mal, wie sich mir die Kehle verengte, wie meine Eltern mir die Luft zum Atmen nahmen. Die Fesseln lagen bereit, wenn ich indischen Boden betrat, und ich hatte scheinbar nicht die Wahl, sie mir anlegen zu lassen oder nicht. War das meine Bestimmung?
Immer wieder fragte ich mich voller Verzweiflung, ob es sein konnte, dass ich eine außergewöhnliche Begabung hatte, und doch gezwungen war, ein gewöhnliches Leben zu leben. Sobald ich nach England zurückkehrte, stürzte ich mich nur noch tiefer in die vermeintliche Freiheit, in das leichte, verantwortungslose Leben, das der Selbsttäuschung entsprang. Ich hatte Angst vor dem, was kommen sollte, wenn mein Studium beendet war.
Mit dieser Angst im Nacken waren die vier Jahre schneller vorüber, als es möglich schien. Ich hielt mein Zeugnis in der Hand und wusste, dass mir drei Wochen der Freiheit blieben. Dann würde ich zurück nach Indien fliegen. Dort würden die vorausgewählten Ehemänner auf mich warten.
Mein Leben wäre zu Ende ...
Eine Freundin bot mir an, vorübergehend bei ihr zu wohnen. Sie wollte, dass ich in England blieb. Ihrer Meinung nach war ich englischer als die meisten Engländerinnen. Doch schien es mir nicht richtig, einfach dort zu bleiben und alles andere für immer zu verleugnen. Es schrie nach Flucht, nach Boykott und Rebellion, und bei allem freiheitlichen Geist, der in mir wohnte und aus mir heraus nach Entfaltung strebte, kam es nicht für mich in Frage, meinen Eltern und meiner Heimat trotzig den Rücken zu kehren, um allein in der Fremde mein Glück zu versuchen. Ich hatte viele Inder gesehen, die in England lebten und nicht wieder in ihre Heimat zurückkehren wollten. Sie lebten in einer eingeschworenen Gemeinschaft unter ihresgleichen, niemals ganz englisch und schon lange nicht mehr ganz indisch. Sie wirkten wurzellos, voller Unruhe und nirgendwo wirklich zu Hause. Gehörten weder hierhin noch dorthin. Das war kein Leben für mich. Ich wollte klare Verhältnisse. Das eine oder das andere – aber niemals beides.
Ein bekannter Galerist bot mir eine permanente Ausstellung an. Auch er ließ mich wissen, dass er mich unterstützen würde, sollte ich vorhaben, in London zu bleiben. Ich musste mich entscheiden. Beide Alternativen schienen machbar. Was also sollte ich tun?
Je länger ich darüber nachdachte, desto verwirrter war ich. Ich hatte alles daran gesetzt, in den letzten vier Jahren meine indischen Wurzeln zu verdrängen, zu verleugnen. Ich hatte eine neue Identität angenommen. Aber wenn ich ehrlich zu mir war, gefiel sie mir nicht. Sie war oberflächlich, mondän, sie war gleichgültig, und sie war bedeutungslos. Hatte ich nicht eben diese Eigenschaften an meiner Schwester so sehr kritisiert, als sie Gautam heiratete und damit zufrieden gewesen war, einen Ehemann zu haben und ein gutes Auskommen?
Ich hatte Spaß und Erfolg. Ich sonnte mich in der Aufmerksamkeit, die die Menschen mir schenkten, weil sie meine Bilder für hervorragend hielten, weil sie meine lockere Art mochten, weil sie meine exotische Schönheit bewunderten. Aber das alles war nicht ICH. Ich versuchte krampfhaft, eine moderne Europäerin zu sein – doch niemals war ich weiter von mir entfernt gewesen.
Die Erkenntnis traf mich schmerzhaft. Aber zur rechten Zeit. Was wollte ich wirklich? Leise drängte die Frage aus den Tiefen meiner Seele an mein inneres Ohr. Was wollte ich, Amrita? Es hatte eine Zeit gegeben, in der hatte ich nach dem Geheimnis des Lebens gesucht, nach dem Geheimnis der Unsterblichkeit. Nun suchte ich nach nichts als Zerstreuung, nach Vergnügen, Erfolg, Anerkennung und Lustbefriedigung. Als ich jünger gewesen war, war das Leben magisch für mich gewesen. In allem, was mein Auge erblickt hatte, hatte ich mehr gesehen, als der Augenschein zu sehen erlaubte. Wie lange war das her, dass ich die unsichtbare Schwingung der Menschen und der Dinge um mich herum wahrgenommen hatte. Wann hatte ich zuletzt den Klang gehört, den jeder zu dem einen, unvergleichlichen Vers des Universums beitrug?
Heute weiß ich, dass ich das leichte Leben in London ohne Wenn und Aber hatte leben müssen. Ich hatte mich in die Unbewusstheit fallen lassen müssen, nachdem meine ewig fragende Bewusstheit mir so sehr zur Last geworden war. Die Waage musste ausgeglichen sein, bevor ich in ein neues, ein anderes Leben aufbrechen konnte. Ich musste schmerzhaftes Wissen und leichtlebiges Nichtwissen erlebt haben, um mich bewusst entscheiden zu können, welchen Weg ich wirklich gehen wollte. Nicht viele Menschen haben diese Wahl. Viele haben sie und bemerken es nicht. Andere bemerken es vielleicht zu spät; vielleicht viel zu spät – erst bei ihrem Tod.
Ich war 21, als ich mir die eine Frage stellte, auf der alle Erfahrungen meines späteren Lebens aufbauten. Ich war 21, als ich mich fragte, was ich wirklich wollte. Ich war 21, als ich die Verantwortung für mich und mein Leben vollständig übernahm. Damals wusste ich nicht, dass ich die einzige Frage gestellt hatte, die man zu stellen braucht, um mit Erkenntnis, Wachstum und immerwährender Freude belohnt zu werden. Damals glaubte ich noch, ich wählte das, was am meisten Mut und Kraft von mir verlangte. Vielleicht war es auch so. Aber die Früchte, die ich für meine Mühen erntete, machten alles andere wett. Ich wurde reicher beschenkt, als ich es vom Leben erwartet hatte. Reicher, als ich es für möglich hielt.
Die Freude war groß, als ich nach Hause zurückkehrte. Mutter hatte ein großes Gartenfest organisiert. Fast glaubte ich, die Zeit seit Indus Hochzeit sei stehen geblieben. Die gleichen Lampions schwebten in den Bäumen, die gleichen Musiker spielten. Ich war zurück und ich war fest entschlossen, mich an Indien zu verschenken, ohne mich für Indien zu verleugnen.
Viele Freunde und Verwandte waren gekommen. Indu mit ihren beiden Kindern. Chandra war gerade erst geboren. Er war der erste Sohn meiner Schwester und Kronprinz sowohl in unserer, als auch in Gautams Familie. Chandra blickte mich aus klugen, wachen Augen an und als Indu ihn mir in den Arm legte, spürte ich zum ersten Mal, dass mein Gespür für das Wesen der Menschen, die mir begegneten, zurückkehrte. Noch war es nur eine leise Ahnung. Fein und flüsternd im Hintergrund der tosenden Gedanken, die meinen benebelten Kopf erfüllten. Aber es lebte noch. Ich hatte meine Gabe nicht verloren. Ich hatte nur vergessen, dass sie zu mir gehörte.
Indu war etwas kräftiger geworden. Sie war stolze Mutter und wirkte erwachsener als bei meiner Abreise. In den letzten vier Jahren hatten wir uns nur selten gesehen. Sie lebte mit Gautam in Bombay. Sie waren kurz nach der Hochzeit aus Delhi zu Gautams Eltern gezogen, wie es Sitte war. Soweit ich wusste, fühlte Indu sich wohl bei ihren Schwiegereltern. Sie hatte mich nicht ein Mal in England besucht. Zuerst war ich ihr böse gewesen. Vor ihrer Hochzeit waren wir unzertrennlich gewesen. Jetzt lebte jede von uns ihr eigenes Leben. Ich befürchtete, dass wir einander fremd werden könnten. Erst als ich sie heute, bei meiner Rückkehr, sah, verstand ich. Indu hatte nicht nach London kommen können. London war nicht ihre Welt. Indu war Mutter und Ehefrau. Sie hütete das Haus der Familie ihres Mannes. Gemeinsam mit ihrem Elternhaus hatte sie ihr altes Leben verlassen. Das war nun meine Indu, das musste ich akzeptieren.
„Wie geht es euch? Wo hast du deinen Mann gelassen?“ Ich hatte so viele Fragen und wünschte mir so sehr, Indus neues Leben zu erkunden.
„Gautam musste in Bombay bleiben. Er hat einige wichtige Aufträge zu erledigen. Aber er hat versprochen, nach Shimla zu kommen, sobald wir da sind.“
Shimla! Ein Gefühl der Freude ergriff mich. Unsere Familie besaß in den Bergen, am Rande des Himalaja, ein Sommerhaus. Seit ich denken konnte, hatten wir jeden Sommer in Shimla verbracht. Ich wünschte, wir wären schon dort, denn bis dahin standen mir drei grauenhafte Wochen bevor. Vater hatte unzählige ermüdende Treffen mit Heiratskandidaten arrangiert. Ich hatte es ihm nicht ausreden können.
Mühsam kämpfte ich den Trotz in mir nieder. Ich wusste, dass ich Vater bloßstellen würde, wenn ich sagte, was ich dachte.
Der neue Kandidat war gut gekleidet. Er war Angehöriger der Kriegerkaste, ein kshatriya, wie wir. Er verfügte über ein beachtliches ererbtes Vermögen und war in England und den Vereinigten Staaten erzogen worden. Ich registrierte jede seiner Bewegungen. Er benahm sich wie ein dressierter Hund: „Ja, Sir. Nein, Sir. Gerne, Sir.“
Jetzt zwinkerte er verlegen, als Vater ihn fragte, ob ich ihm gefalle. Er begann zu schwitzen und seine Hände verkrampften sich. Er war offensichtlich unerfahren im Umgang mit Frauen.
„Ja sehr, Sir“, brachte er mühsam heraus. Mir wurde speiübel.
„Warum sind Sie noch nicht verheiratet?“ Vaters Frage traf ihn unvorbereitet. Dabei lag sie nahe. Immerhin war er schon 26 und seit drei Jahren zurück in Indien. Er begann, verlegen zu stottern. Jetzt tat er mir fast leid. Ich schenkte ihm einen verständnisvollen Augenaufschlag, was ihn nur noch tiefer in Verlegenheit und Verzweiflung stürzte. Er blickte verschämt durch das Fenster hinaus in den Garten und holte mehrmals tief Luft, bevor er rührend ehrlich antwortete: „Nun, äh, Sir. Es hat sich bisher nicht ergeben. Wir hatten einige Kandidatinnen ausgewählt, aber es kam immer etwas dazwischen.“
Wir brauchten nicht weiter zu fragen. Er war abgelehnt worden. Die Tatsache an sich war Schande genug. Auch wir würden ihn abweisen müssen. Selbst Vater sah, dass der junge Krieger nicht zu mir passte. Als er unser Haus mit hängenden Schultern verließ, konnte ich meine Ungeduld und meine Wut nicht länger zügeln. „Vater, ich habe die Nase voll von dieser Farce. Wann wirst du endlich akzeptieren, dass ich keine Frau bin, die man einfach so verheiratet!“
Ich wusste, dass Vater diese offenen Worte gefürchtet hatte, seit ich aus London zurück war. Ich hatte versucht, höflich und diplomatisch zu sein. Ich hatte versucht, die Tradition zu wahren und es meinem Vater leicht zu machen, selbst einzusehen, dass ich nicht so einfach zu verheiraten war wie Indu. Aber das Ergebnis war verheerend. Keiner der Männer kam für mich auch nur annähernd in Frage und Vater tat alles, sein diesbezügliches Wissen zu ignorieren, indem er die Rolle des Heiratsvermittlers verkrampft bis zum Ende spielte, obwohl wir beide wussten, dass das Ende keine Hochzeit im Spätsommer sein würde.
„Was für eine Frau bist du dann, Amrita? Sag es mir, um Himmels willen! Ich weiß es nicht.“
Es tat weh, meinen Vater auf diese Weise verletzen zu müssen. Meine Stimme wurde weich und mitfühlend. „Ich weiß es auch nicht, Papa. Ich weiß nur, dass ich keinen dieser Männer heiraten kann!“
„Wen denn dann? Wen willst du heiraten? Irgendeinen Engländer, irgendeinen Filmstar oder einen verrückten Maler?“
Das war absurd. Vater versuchte, mich zu verletzten, weil ich anders war, als er es sich wünschte.
„Natürlich nicht, Vater. Ich will einen Mann, der zu mir passt. Jemanden, mit dem ich das Leben teilen kann, der neugierig ist, voller Freude und Verspieltheit. Jemand, der nicht nach Regeln und Ritualen lebt. Ich will einen Mann, der für das Leben offen ist. Der stark und selbstständig genug ist, mich sein zu lassen, was ich bin. All diese Kandidaten suchen eine Frau ohne Eigenleben. Wie kann ich das Leben in mir abtöten und dennoch Kinder gebären? Wie kann ich die Freude in mir abtöten und eine getreue und gute Ehefrau sein? Wie kann ich meine Neugier verleugnen und mein Leben einem Fremdem schenken, der mein Herz nicht berührt?“
Meine Tränen, die flossen, waren Tränen der Sehnsucht und Tränen der Trauer. Es war so schwer, einem anderen zu erklären, welche Bedeutung das Leben und die Liebe für mich hatten. Ich sah oftmals nicht mit den Augen, sondern mit einem anderen, einem inneren Organ, das selbst für mich nicht sichtbar und ohne Namen war. Was ich sah, war so klar, dass ich nicht gegen das, was ich sah, handeln konnte. Es hätte mich ins Unglück gestürzt. Und so sah ich diesmal, dass ich nicht, noch nicht oder niemals heiraten würde.
Die Stimmung war schlecht. Wir brachen hastig und übel gelaunt nach Shimla auf. Mutter war mit Leela, unserem Hausmädchen, schon vorgefahren, um alles zu richten. Vater, Indu, die Kinder und ich kamen nach. Ich wusste, dass ich an der Spannung, die wie eiskalter Nebel zwischen uns hing, schuld war. Ich klagte mich an und wünschte mir – zum ungezählten Male – unkomplizierter und angepasster zu sein. So wie Indu.
Der kleine Chandra schlief in Indus Arm. Jaya schlief an mich gelehnt. Der Zug ratterte in gleichmäßigem Takt über die Geleise. Ich ließ mich von seinem Rhythmus beruhigen, hypnotisieren, einschläfern. Die Widerstände, auf die ich von außen stieß, ermüdeten mich. Es tat weh, zu sehen, dass die, die ich am meisten liebte und glücklich machen wollte, mich nicht verstanden und mich in ein Leben zwingen wollten, das nicht das meine war. Wieso war meine Welt so anders als die ihre? Wir lebten im selben Haus, teilten dieselben Gewohnheiten. Ja, wir waren vom selben Fleisch und Blut. Nur unsere Wünsche und Sehnsüchte waren verschieden. Sie waren so verschieden, dass wir sie einander nicht einmal mitteilen konnten.
Mutter erwartete uns freudestrahlend mit der Nachricht, dass Gautam angerufen hätte. Er würde schon morgen hier sein. Ich nahm Indus und Jayas Freude nur am Rande wahr. Sie waren so leicht zufrieden zu stellen. Ich fühlte mich arrogant, wählerisch und undankbar.
Die zweieinhalbjährige Jaya rief unentwegt: „Papa kommt, Papa kommt!“
Indu nahm sie auf den Arm und ließ sie wie ein Flugzeug durch die Luft fliegen. Jaya quietschte wild und ausgelassen.
Ich zog mich sofort in mein Zimmer zurück. Mutter suchte mich nach dem Abendessen auf, das ich bewusst versäumt hatte. „Soll das nun ewig so weitergehen, Amrita?“, fragte sie vorwurfsvoll.
„Mutter, bitte. Versteh mich doch. Ich kann nicht anders!“
Mutter setzte sich zu mir auf den Rand des Sessels, der vor dem geöffneten Fenster meines Zimmers stand. Die Geräusche des Gebirges füllten unsere Ohren und doch hörten wir sie nicht.
„Ich verstehe, dass du all diese Männer nicht heiraten willst. Ich hätte auch keinen der anderen Kandidaten genommen, die mit deinem Vater um meine Hand angehalten hatten. Ich wusste sofort, dass ich nur deinen Vater wollte. Damals war es noch so, dass ich geschickt meinem Vater den Eindruck vermitteln musste, dass er ihn ausgewählt hatte, nicht ich, sonst hätte er mir einen anderen gesucht. Du solltest versuchen, deinem Vater nicht böse zu sein. Er will nur dein Bestes. Er will dich nicht zwingen, etwas zu tun, das du nicht willst.“
„Ich bin ihm nicht böse. Ich bin hilflos, denn er versteht mich nicht. Ich weiß nicht, wie ich ihm erklären soll, was ich fühle. Er hört mich nicht!“
„Vielleicht hast du noch nicht die richtigen Worte gefunden?“
„Vielleicht ...!“
„Wirst du nach ihnen suchen, Amrita?“
Ich sah Mutter warmherzig an. Mutter tat, was sie konnte, um zwischen Vater und mir zu vermitteln. Sie wollte nichts als Frieden in ihrem Haus. Ihr größter Wunsch war, dass alle immer miteinander auskamen. Sie hätte immer geschwiegen, ihre Meinung für sich behalten, wenn es zu einer offenen Konfrontation gekommen wäre. Mein Temperament war ein anderes. Ich war hitzig, schnell aufgebracht und unvernünftig. Nicht launisch, aber emotional und leidenschaftlich. Ich konnte mich nicht verstellen. Ich war immer authentisch, immer echt. Je mehr ich versuchte, meine Gefühle im Zaum zu halten, desto machtvoller brachen sie aus mir hervor und wurden für meine Umgebung sofort sichtbar. Es war in jedem Fall besser, sie sofort zu äußern.
Dennoch verstand ich ihren Wunsch.
„Natürlich werde ich nach ihnen suchen“, versprach ich ihr.
Als Gautam am späten Nachmittag des nächsten Tages endlich eintraf, machten sich alle, außer Mutter und mir, auf den Weg zum Bahnhof. Ich saß im Garten und zeichnete. Es war lange her, dass ich gegenständlich gemalt hatte. In England hatte ich meist abstrakt und modern gemalt. Ich hatte viele Techniken ausprobiert, selbst einige neue kreiert. Gegenständliche Malerei erschien mir danach naiv und langweilig. Abstrakt und verfremdet ließ sich vieles besser ausdrücken, als naturgetreu abgemalt, so dachte ich.
Doch hier in Shimla, wo die Welt der Farben und Formen so lebendig und so faszinierend war, schien es unmöglich, abstrakte Dinge zu Papier zu bringen. Ich sah die Dinge mit völlig anderen, mit neuen Augen, fast so als erlebte ich sie zum ersten Mal. Die Bewegung eines Blattes faszinierte mich so sehr, dass ich Zeit und Ort vergaß und nur noch der Bewegung folgte, die mein Bleistift nachzeichnete, als geschehe sie auf dem Papier.
Erst der Lärm der Ankommenden schreckte mich aus meiner Selbstvergessenheit. Ich erinnerte mich, dass Gautam gekommen sein musste, und beruhigt versank ich sofort wieder in mein Werk. Die freudigen Rufe der Ankommenden hörte ich nicht. Erst als Indu und Gautam gemeinsam durch den Garten zu mir herüberkamen, sah ich uninteressiert auf. Widerwillig blickte ich den beiden entgegen. Erst jetzt wurde mir klar, dass ich sie seit ihrer Hochzeit nicht zusammen gesehen hatte. Müde erinnerte ich mich an die schreckliche Ahnung, dass die beiden nicht zueinander passten. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Immerhin hatten sie inzwischen zwei gemeinsame Kinder und schienen selbst nach vier Jahren Ehe noch glücklich. Ich musste mich damals getäuscht haben. Heute war sicher alles anders ...
Aber ich sah es auch heute wieder. Diesmal noch deutlicher, noch fordernder, noch unübersehbarer. Gautam trug einen englischen Anzug, weiche teure Lederschuhe, die seinen Gang geschmeidig und federnd machten. Sein Haar musste frisch geschnitten sein. Es lag schwarz glänzend und schnurgerade gescheitelt an seinem Kopf. Er ging neben Indu her, ohne sie zu berühren. Fast wie ein Fremder. Zumindest aber wie ein Mann, der seine Frau, ihre Haut, ihre Bewegungen, ihre Träume und Wünsche nicht kannte. Ich erschrak so heftig, dass mir der Stift aus den Händen zu Boden fiel. Indu lachte heiter und doch eine Spur zu laut. Sie wirkte unsicher. Ich hoffte, dass es nicht mein Verhalten war, das sie verunsicherte. Vielleicht hatte sie meinen kritischen Blick nicht einmal bemerkt, so hoffte ich jedenfalls inständig.
Ich stand auf, suchte den Stift im Gras und bekam ihn zu fassen, bevor die beiden bei mir ankamen.
„Amrita, Gautam ist gekommen. Ihr habt euch seit der Hochzeit nicht gesehen. Willst du deinen Schwager nicht begrüßen?“
Ich versuchte, Herrin meiner Gesichtszüge zu werden, die verräterisch meine Gedanken hinausposaunten, lauter, als deutliche Worte es gekonnt hätten. „Er gehört nicht zu dir, Indu!“, dachte ich.
Ich verstand den Sinn meiner Gedanken kaum, als Gautam mich auch schon herzlich in seine Arme zog. „Amrita! Wie schön, dass du wieder hier bist. Deine Mutter hat dich so vermisst. Seit Indu und die Kinder mit mir in Bombay leben, ist sie viel zu viel allein.“
Sein männlicher Duft drang in meine Nase. Gautam hielt sich an mir fest wie ein Ertrinkender. Das musste ich mir einbilden. Ich versuchte, tief ein- und auszuatmen, um einen klaren Kopf zu kriegen. Aber ich atmete nur noch mehr seines angenehmen Duftes und spürte, dass mir heiß wurde. Endlich entließ er mich aus seiner festen Umarmung, hielt mich mit ausgestreckten Armen an den Schultern fest und sah mich heiter prüfend an. „Du bist noch hübscher geworden, kleine Amrita. Ich habe gehört, die Londoner sollen dir zu Füßen gelegen haben. Und doch bist du zu uns zurückgekehrt ...“
Ein unerklärliches Lächeln umspielte seine Augen. Für eine Sekunde glaubte ich, es zu kennen. Woher? Ich begann zu zittern. Gautam hielt mich noch immer fest und redete ohne Pause irgendeinen Unsinn daher. „Vater sagt, du willst keinen der Männer heiraten, die er für dich ausgesucht hat?! Ich habe schon immer zu Indu gesagt, dass du ein Vogel bist, den man nicht einfangen kann. Du bist etwas ganz Besonderes, Amrita.“
Indu lachte und fiel dem schwätzenden Gautam ins Wort: „Gautam, lass sie. Siehst du nicht, dass ihr dein Gerede peinlich ist? Seit Wochen hört sie nichts anderes, als dass sie ungezogen und überheblich ist. Wenigstens wir sollten Verständnis für sie haben.“
„Verständnis kann man nicht erzwingen, noch kann man es heucheln. Es ist eine Angelegenheit des Herzens, ob man jemanden wirklich versteht.“ Ich erschrak über die Heftigkeit meiner gedanklichen Reaktion. Irgendetwas an der Situation schien mir unerträglich. Ich musste fort von hier, fort von den beiden. Fort von Gautam?
Ich faselte einige kaum verständliche Worte: lange Reise, ihr wollt sicher allein sein … hinein … Mutter helfen ... Die beiden blickten verdutzt hinter mir her, als ich meinen Sari mit der rechten Hand zusammenraffte und zurück zum Haus lief. Tränen liefen mir über die Wangen. Keiner sah sie.
2
Ich lief blind vor Tränen, deren Ursache ich nicht verstand, ins Haus. Mutter bereitete mit Leela und den Küchenhilfen das Abendessen vor. Hastig wusch ich mir im Bad das Gesicht mit kaltem Wasser, trocknete es sorgfältig und trat dann gefasst in die Küche, um zu helfen. Mutter und Leela lachten, während sie paneer machten.
Wir machten den Käse immer selbst. Es war ganz einfach. Man kochte frische Milch, gab einige Spritzer Zitronensaft hinzu, so dass die Milch ausflockte. Dann goss man alles durch ein Tuch und drückte den Käse so lange zusammen, bis er zu einer festen Masse wurde. Diese legte man zwei Stunden zwischen zwei schwere Bretter und fertig war der Käse, der dann, in Stücke geschnitten, in Spinat oder Tomatensoße gekocht oder auf dem tandoori gegrillt wurde.
Ich sah, dass meine Hilfe überflüssig war. Also zog ich mich in mein Zimmer zurück.
Mutter hatte den Tisch auf der Veranda gedeckt. Shimla liegt zwar 2.100 Meter über dem Meeresspiegel, dennoch ist es im Sommer auch an den Abenden angenehm warm. Noch war der Monsun nicht gekommen. Aber die Luft wurde täglich feuchter und wir rechneten bald mit den ersten Regenfällen, die hier in den Bergen die Luft wenigstens ein wenig abkühlten. In Delhi war es im Sommer unerträglich heiß und stickig. Das Leben in der Stadt war im Sommer eine Qual.
Indu hatte die Kinder schon zu Bett gebracht. Selbst der kleine Chandra schlief ruhig und schrie selten. Jegliche Meinungsverschiedenheit schien plötzlich vergessen und Vater scherzte locker und fröhlich mit Gautam. Ich saß neben Vater, Indu gegenüber. So sehr ich auch versuchte, mich zu konzentrieren, das Gespräch glitt an mir vorüber wie Eisschollen auf dem Meer. Ich hörte einige Fetzen, aber sie banden meine Aufmerksamkeit nicht.
Wieder und wieder glitt mein Blick hinüber zu Indu und Gautam. Sie reichte ihm gerade ein Stück naan. Er nahm es kaum zur Kenntnis. Einmal traf mich sein Blick. Ich erschrak und ließ fast die Gabel fallen, die ich gerade zum Mund führte. Ich wusste nicht, was es war, das mich so durcheinanderbrachte. Aber ich hasste es. Wir tranken französischen Rotwein zum Essen. Indu lachte immer ausgelassener – wie ein hysterischer Teenager.
Bald wurde abgeräumt und Mutter ließ frischen Milchreis bringen. Ich bat um einen süßen chai mit Gewürzen. Ich fror. Grausame Kälte breitete sich in mir aus. Es war eine innere Kälte. Irgendetwas in mir schien plötzlich versteinert zu sein. Ich wünschte, dass das gemeinsame Essen schnell vorüberginge, aber es dauerte scheinbar endlose Stunden. Endlich, als es mir kaum mehr möglich war, Haltung zu bewahren, hob Vater die Tafel auf. Erleichtert sprang ich auf und lief in die dunkle Nacht, die den Garten wie ein tiefschwarzer Sari umhüllte.
Ich hörte, wie Mutter „Gute Nacht, Amrita!“ in die Dunkelheit hineinrief. Dann ertönte wieder Indus künstlich übertriebenes Lachen. Und endlich erfüllte Ruhe die Natur. Und auch mein Gemüt kam langsam zur Ruhe. Die Zikaden sangen, und ein Nachtvogel, dessen Melodie mich durchdrang, als käme sie aus meinem tiefsten Innersten.
Das Herz blieb mir fast stehen, als ich seine Stimme hinter mir hörte: „Was ist los mit dir, Amrita?“
Panisch drehte ich mich zu ihm um, mir wünschend, dass er nicht hier bei mir stünde, dass er nicht wüsste, dass es mir nicht gut ging, obwohl jeder andere in meiner Umgebung es übersah. Ich log: „Nichts, Gautam, nichts!“
Er kam näher. „Das ist nicht die Wahrheit!“
Ich wandte ihm die Seite zu, wie um mich vor ihm zu schützen und lachte bitter auf: „Nein, das ist nicht die Wahrheit. Aber ich kenne die Wahrheit nicht.“
Obwohl ich nicht erklärte, welche Bedeutung meine Worte für mich hatten, spürte ich, dass er ihre ganze Tragweite erfasste. Ich fühlte mich aufgefangen und von einer unerträglichen Last, die ich zuvor allein hatte tragen müssen, befreit.
„Versuche, es mir zu erklären, Amrita!“ Seine Stimme klang weich und einfühlsam. So hatte er noch nie mit Indu gesprochen. Vielleicht nur nie, wenn ich dabei gewesen war? Er berührte mich leicht an der Schulter. Seine Hand lag weich und fließend wie Stoff auf meiner Haut. Wie selbstverständlich suchte sie nun die meine und die Berührung gab mir Kraft, unsagbar viel Kraft. Kraft, die ich niemals zuvor besessen hatte.
„Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen kann“, begann ich zaghaft. „Indu wollte mich nicht hören, damals bevor ihr geheiratet habt ...“
Er sah mich fragend an und erhöhte doch langsam den Druck seiner Hand, um mir Mut zu machen, weiterzureden. „Wenn du es mir nicht sagst, werden wir nie wissen, ob ich es verstehen kann.“
Ich lachte erleichtert und doch voller Angst, ihn zu verletzen und vor den Kopf zu stoßen. „Damals, als du um Indus Hand angehalten hast ... Ich habe euch zusammen beobachtet. Eure Unterhaltungen, eure Bewegungen. Ich war mir sicher, dass ihr nicht zusammengehört. Etwas zwischen euch war falsch. Disharmonisch. Du schienst hölzerner als sonst. Indu verlor an Farbe und Lebendigkeit. Ich mochte dich deshalb nicht. Ich weiß, dass das seltsam klingt, aber heute sah ich es wieder. Sogar deutlicher als bei eurer Hochzeit. Ihr gehört nicht zusammen, ich weiß es – aber ich weiß nicht, wie ich es euch erklären soll – oder was die Konsequenz meiner Beobachtung ist. Ihr seid verheiratet und habt zwei Kinder. Selbst wenn ihr nicht zusammengehört, was sollte das ändern?“
Ich erwartete, dass er wütend seine Hand zurückziehen, mich anschreien und für verrückt erklären würde. Stattdessen lächelte er. Seine Worte waren voller Mitgefühl und Verständnis: „Ich meinte es ernst, als ich vorhin sagte, dass du etwas Besonderes bist, Amrita. Deine Gedanken sind von äußerster Klarheit und großer Kraft. Du siehst Dinge, die nur das innere Auge zu sehen vermag. Das Leben hat etwas Wichtiges mit dir vor.
Ich glaube dir, wenn du sagst, dass Indu und ich nicht zusammenpassen. Das heißt, ich glaube dir nicht nur, ich bin sogar derselben Meinung. Ich wollte deine Schwester heiraten, obwohl ich das Gleiche sah. Ich habe mich ganz bewusst für sie entschieden. Sie war die perfekte Frau für mich. Ich wollte nicht darauf warten, dass ich auf wirkliche Liebe traf. Ich wollte eine Frau, die immer zu mir steht, die bereit ist, mit mir bei meinen Eltern in Bombay zu leben, eine Frau, die für meine Kinder und für mich alles tun würde. Ich wollte eine Frau, die keine Forderungen stellte. Nicht Leidenschaft und Harmonie prägen unsere Beziehung, sondern Planung und der Wunsch, gemeinsam etwas aufzubauen. Wir arbeiten zusammen für ein gemeinsames Ziel: eine glückliche Familie – bewusst und gewollt.“
In mir regte sich Entrüstung, Unverständnis und Widerwillen. Wie oft hatte ich in den letzten Wochen erlebt, dass die Menschen meiner nächsten Umgebung nicht an das glaubten, was für mich das einzig Lebenswerte war. Wieder regte sich das Gefühl der Einsamkeit in mir. Ich stand abseits von den Menschen und den Dingen, die mir wichtig waren. Das Leben spielte sich ab, und ich sah dabei zu, aber es berührte mich nicht, weil ich sah, dass niemand mit Leib und Seele sein Leben lebte. Alle sicherten sich ab, planten und kontrollierten. Deshalb bewegten sie sich nur an der Oberfläche der Dinge. Selbst vor der Liebe fürchteten sie sich. Niemand war bereit, sich an das Leben zu verschenken, ohne zu wissen, welchen Lohn er erhalten würde. Warum?
Aufgebracht rief ich: „Wie könnt ihr nur so leben!“
Die Ehrlichkeit seiner Antwort erschreckte mich: „Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir es nicht. Vielleicht verleugnen wir uns selbst, weil wir nicht den Mut haben, mehr für uns zu fordern ... und mehr von uns zu geben. Vielleicht leben wir auf Sparflamme, weil wir Angst haben, unsere Lebenskraft zu verschwenden. Vielleicht haben wir nicht die Lebenskraft, die du hast, nicht die visionäre Kraft, den Idealismus, der dich mehr fordern ... und mehr geben lässt.“
Überrascht spürte ich, dass Gautam mich aufrichtig bewunderte. Nun verstand ich auch, warum er sich vorhin wie ein Ertrinkender an mich geklammert hatte. Hatte er vielleicht dieselbe Kraft gespürt wie ich, als wir einander berührten?
Endlich drehte ich ihm wieder meinen ganzen Körper zu. Ich glaubte nicht mehr, mich vor ihm schützen zu müssen. „Ich bin nicht mutig, Gautam, im Gegenteil. Ich bin hilflos ... und ich bin einsam. Zeit meines Lebens habe ich mich anders gefühlt. Ich habe andere Dinge gesehen als andere. Ich habe andere Dinge gehört als andere. Ich habe andere Dinge gefühlt als andere. Ich habe andere Dinge gewollt als andere. Das ist nicht leicht. Es birgt die Gefahr der Verbitterung ...“
„Ich glaube, du kennst dich nicht, Amrita. Du siehst nicht, wie du dich bewegst, wie du sprichst, wie deine Augen leuchten, mit welcher Kraft du lachst, wie alles stillzustehen scheint, wenn du einen Raum betrittst. Du kennst deine Wirkung auf die Menschen nicht ...“
Ich wusste, dass er auch davon sprach, welche Wirkung ich auf ihn hatte. Wir waren uns so nah in diesem Moment. Es war eine Nähe, die jenseits von Worten und Gedanken lag. Eine Nähe, die sich anders mitteilte als durch Erklärung. Gautam verstand etwas in mir, das ich selbst kaum verstand und doch in mir wusste. Er sah etwas in mir, das ich selbst nur mit Mühe erkennen konnte. Und er war der Erste, der meine Art nicht befremdlich fand, sondern akzeptierte und sogar bewunderte. Ich ließ es geschehen, als seine linke Hand zärtlich meine Wange streichelte, während seine rechte die meine noch immer fest umschlossen hielt. Ich ließ es geschehen, als seine schlanken Finger die Linie meiner geraden Nase nachzeichneten und meine Lippen berührten. Gautam streichelte mich sanft und zärtlich – und unsagbar vertraut.
Mir schien, als erinnerte ich mich an etwas. Es war wie ein Déjà-vu; nur von kurzer Dauer, dann löste sich der flüchtige geistige Eindruck wieder auf. Ich sah mich unfähig, ihn festzuhalten, denn meine Aufmerksamkeit sah sich gefangen von Gautams zärtlicher Berührung. Seine Finger glitten weiter von meinen Lippen über die sanfte Kuhle in meinem Kinn hinunter zu meinem Hals. Willensstark unterdrückte ich einen Schrei. Es war der Mann meiner Schwester, der mich kannte wie kein anderer, der mich streichelte, als sei meine Haut die seine, der meine Gefühle besser kannte als ich und der in dieser kleinen, unscheinbaren Berührung mit mir zu verschmelzen schien.
Ich wusste, dass ich ein schlechtes Gewissen hätte haben müssen. Aber ich hatte es nicht. Jetzt und hier in dieser Begegnung gab es keine Indu, keine Jaya, keinen Chandra, keine Moral und kein Schuldgefühl. Gautam gehörte niemandem außer sich selbst. Etwas verband uns und trug uns zueinander hin, das wir nicht erklären und schon gar nicht beherrschen konnten.
Wieder nahm ich seinen Geruch wahr und schloss verzaubert die Augen. Er bewegte sich leicht auf mich zu. Langsam und geschmeidig und doch gezielt und bestimmt. Zuerst umfasste er mit der linken Hand meine Taille, dann löste er seine rechte von der meinen und ließ sie langsam und heiß glühend über meinen Rücken gleiten. In meinem Bauch pulsierte das Leben in Form von forderndem Begehren. Unsere Lippen trafen sich und in dieser Sekunde blitzte erneut der Funke der Erinnerung in meinem Gedächtnis auf. Wir kannten einander! Der Schleier der Amnesie lüftete sich leicht, kaum merklich, als hätte der Wind ihn für eine Sekunde zurückgeweht. In dieser Sekunde gewährte er mir Einblick in die Vergangenheit, die durch Tod und Geburt von diesem Moment getrennt war. Gautam und ich waren zwei andere gewesen. Wir hatten uns lange gekannt. Wir hatten uns lange geliebt. Aber wir hatten einander niemals wirklich gehört ...
Zu Tode erschrocken von der Vision riss ich mich los. Ich lief blind Richtung Haus, Richtung Licht und Helligkeit. Ich wollte nicht sehen, was die Dunkelheit und die Grenzenlosigkeit der Leidenschaft mir gezeigt hatten. Ich war noch nicht bereit, der langen Kette von Leben ins Auge zu sehen, die hinter mir lag. Ich war noch nicht bereit, zu verstehen, wer ich gewesen war und wer ich heute war, um meine Aufgabe für die Zukunft zu erkennen.
Ich hörte, dass Gautam hinter mir herlief. Er traute sich nicht zu rufen, weil er die anderen nicht auf uns aufmerksam machen wollte. Sie schliefen bereits und ahnten nicht, was mit uns geschah, ohne dass wir es beeinflussen konnten. Erst kurz vor der Veranda holte er mich ein. Er ergriff meinen Arm eine Spur zu fest, etwas zu aggressiv. Er tat mir weh. Ich unterdrückte einen Schrei. Seine Augen flehten mich an. Sein hilfloser Blick brach mir fast das Herz. Ich wusste nicht, wie ich ihm erklären sollte, was ich gesehen hatte. Ich wusste, er glaubte, dass ich ihn nicht wollte, dass ich Skrupel oder Schuldgefühle hätte und mich deshalb von ihm abwandte. Aber das war es nicht. Das, was uns verband, hatte mit Indu nichts zu tun. Sie war nur ein weiteres Hindernis auf unserem Weg. Ein weiterer Mensch, der verhinderte, dass wir zusammen sein konnten. So, wie es immer gewesen war... Ich wusste nicht, warum das so war. Die Erkenntnis brachte mich fast um, so weh tat sie, weil sie unvorbereitet über mich kam.
„Lass mich los!“, zischte ich ebenfalls eine Spur zu kalt und zu angriffslustig. Aber ich war so verletzlich in diesem Moment, dass mich nur der scheinbare Angriff schützen konnte. Resigniert ließ Gautam meinen Arm fallen. Gleichzeitig krümmte sich sein Rücken, fielen seine Schultern traurig herab. Seine sonst so gerade, schlanke, anmutige Gestalt wirkte irgendwie gebrochen. Ich wusste, dass ich nur ein Wort hätte sagen müssen, dass ich ihn nur kurz hätte zärtlich berühren müssen, um ihm die gespannte Kraft seiner Glieder wiederzugeben. Ich wusste, dass er sich danach sehnte, dass ich einen Schritt auf ihn zu wagte. Aber es ging nicht. Etwas hielt mich davon ab. Ich war nicht bereit, noch mehr zu sehen, als ich gesehen hatte.
Ohne ein weiteres Wort wandte ich mich von ihm ab und lief die Stufen zur Veranda hinauf. Mechanisch öffnete ich die Tür, ging die Treppe hinauf und warf mich, wie ich war, auf mein Bett.
Ich war mit dem Wissen um die Bedeutung von Geburt, Tod und Wiedergeburt für die individuelle Seele, jiva, die in ihrer reinsten Form, atman, nichts als kontinuierliches Bewusstsein, ohne Anfang und Ende und ohne Körper, ist, aufgewachsen. Aber das schien heute bedeutungslos. Schlagartig erkannte ich den Unterschied zwischen philosophischem Wissen und erlebter Erkenntnis. Alles, was ich gelesen und von weisen Lehrern gehört hatte, verlor seine Bedeutung in der Sekunde, als ich die Kontinuität meines eigenen Bewusstseins erlebte und mich über die Grenzen dieses Körpers und dieser Nacht hinwegsetzte, als seien sie nicht absolut existent. Dabei war ich ein Mensch, der es gewohnt war, die normalen Grenzen des alltäglichen Verstandes zu überschreiten und Dinge zu erleben, die andere für Hirngespinste oder Hokuspokus hielten. Aber das, was ich in den Armen von Gautam erlebt hatte, erschreckte mich dennoch im tiefsten Kern meiner Persönlichkeit.
Ich versuchte, die Einzelheiten meiner Erinnerung zurück in mein Gedächtnis zu rufen, um wenigstens ihrer Herr zu werden. Wie hatten wir ausgesehen? Wo waren wir gewesen? Wie alt waren wir gewesen? Aber die Erinnerung war zu vage. Sie war fast durchsichtig. Sobald ich sie festzuhalten versuchte, wurde sie dünner und flüchtiger. Das Einzige, was ich noch sicher zu wissen glaubte, war, dass ich eine Frau und Gautam ein Mann gewesen war. Genauso wie es heute war...
Erschöpft schlief ich ein. Ich wusste nicht, wie ich Gautam und Indu am nächsten Tag begegnen sollte.
Es war leichter, als ich vermutet hatte. Mit dem Tageslicht schlüpften wir wie selbstverständlich zurück in unsere alten Rollen. Gautam, der Ehemann, Vater und Schwiegersohn. Amrita, die Schwester, Tante und Tochter. Das Frühstück verlief wie gewohnt ausgelassen, Jaya sprang um den Tisch herum, von einem Schoß auf den nächsten. Endlich kam sie bei mir zur Ruhe und wir aßen gemeinsam die scharf gewürzten Rühreier, die Leela gemacht hatte. Ich war nervös, das muss ich zugeben. Ich war darauf bedacht, Gautam nicht zu lange und nicht zu intensiv anzublicken oder ihn gar zu berühren. Deshalb hielt ich mich absichtlich mehr von ihm fern, als ich es sonst getan hätte. Auch er mied den direkten Blickkontakt, sprach eifrig mit Vater über seine Geschäfte und erzählte, dass er heute Nachmittag in die Stadt müsse, um im Hotel einen Geschäftspartner zu treffen.
Soviel ich wusste, handelte Gautam mit Düngemitteln. Das war ein lukratives Geschäft, wenn man bedenkt, dass Indiens Bruttosozialprodukt zu mehr als 25 % aus der Landwirtschaft hervorgeht. Aber Gautams Beruf interessierte mich nicht. Er war nur eine der Identitäten, die wir gezwungen waren anzunehmen, eine der Rollen, die wir im Spiel der göttlichen lila spielten. Nur eine weitere relative Ausdrucksweise des Seins, die keine absolute Bedeutung hatte. Ich wusste, dass Indu sehr viel wert auf Gautams Beruf und das Ansehen seiner Familie legte. Jedem, der es hören wollte, und auch denen, die es nicht hören wollten, erzählte sie, wie erfolgreich und wohlhabend ihr Mann war. Ich wusste, dass Gautam sie reden ließ, aber selbst auch nichts darauf gab. Hinter dieser Maske des erfolgreichen Geschäftsmannes war er im Grunde frei und ungebunden. Er machte sich nichts aus Geld, aus vergänglichen Dingen und Unternehmungen. Umso mehr wunderte es mich, dass er eine Familie gegründet hatte – noch dazu absichtlich, wie er mir gestern erklärt hatte.
Mutter hatte für heute ein Picknick geplant. Erleichtert, Gautam und der Enge des Hauses, das eigentlich riesig war, entfliehen zu können, half ich beim Einpacken des Essens und der Getränke. Leela verstaute alles im Wagen und bald waren wir Frauen mit den Kindern unterwegs an einen Gebirgsbach. Ich war nicht sicher, ob ich es mir nur einbildete, aber Indu wirkte ungewöhnlich schweigsam. Sie gab Chandra während der Fahrt die Brust und täuschte dann Müdigkeit vor.
Als wir endlich den Picknickplatz erreichten, lief ich wild und ausgelassen mit Jaya ans Wasser. Wir warfen achtlos unsere Schuhe zur Seite und wateten barfuß durch den eiskalten Bach. Jaya planschte und war im Nu vollkommen durchnässt. Auch meine Hose, die ich unter dem Oberkleid meines graugrünen Suits trug, war längst bis an die Knie durchnässt. Jaya und ich störten uns nicht daran, sondern liefen durch das knöcheltiefe Wasser, bespritzten uns und kreischten um die Wette. Indu kam herbei und schimpfte. Ob wir nicht besser aufpassen könnten. Ich lachte nur, ebenso wie Jaya. Wir waren Kinder. Warum verbot man uns die Freude am einfachen Spiel?
Ich vermutete, dass Indu selbst diese Freude nicht kannte. Schon als wir jünger gewesen waren, hatte sie mich oft zurückgepfiffen, wenn ich ihr zu ausgelassen gespielt hatte. Oftmals hatte sie mich wie ein Wachhund beobachtet. Neid sprach dann jedes Mal aus ihren Augen. Manchmal wirkte sie fast verbittert. Sie konnte es nicht fassen, welch einfache Dinge mich amüsierten. Noch schlimmer: Sie hasste es, wenn ich mich amüsierte, als ginge mein Vergnügen auf ihre Kosten.
Hungrig kamen Jaya und ich zu den anderen zurück. Mutter hatte gerade das Tischtuch auf dem Boden ausgebreitet und es kunstvoll gedeckt. Ich fiel gierig über eine Mango her und nahm mir einige chapatis dazu. Mutter lächelte, aber Indu fuhr mich an, ich solle nicht so ein schlechtes Vorbild für die Kleinen sein.
Ich hielt im Kauen inne und blickte Indu herausfordernd an. „Was ist los mit dir, Indu? Worum geht es dir wirklich?“
„Nichts ist los.“
Ich entließ sie nicht aus meinem durchdringenden Blick. „Ach, und deshalb siehst du den ganzen Tag durch mich hindurch oder schreist mich an und versuchst, mich zu erziehen?“
Ich wusste, dass Indu es hasste, wenn ich ihr auf den Kopf zusagte, dass sie etwas auf dem Herzen hatte. Natürlich war meine Angriffslust nicht ganz fair. Vielleicht war sie nicht mehr als eine Flucht nach vorn, um Indu zu verunsichern und meine eigenen Schuldgefühle zu vertuschen.
„Das bildest du dir ein“, fauchte sie.
„Indu, was ist los?“ Ich ließ nicht locker. Hatte sie etwa Gautam und mich im Garten gesehen? Was sollte ich ihr sagen? Sie hätte meine wahren Gefühle niemals verstanden.
„Du hast mit ihm gesprochen!“, brachte Indu hervor.
Der Schock fuhr mir in alle Glieder. Sie hatte uns tatsächlich gesehen. Es war besser abzuwarten, als etwas zu erklären, was die Situation nur noch schwieriger gemacht hätte.
Mutter sah, dass wir beide etwas sehr Persönliches zu besprechen hatten. Sie nahm ein Fladenbrot und einige Kekse und schleppte die aufgeregte Jaya zum Wasser hinunter. Chandra schlief ungerührt in Indus Arm. Die Stille zwischen uns war unerträglich. Sie war angefüllt mit Wut und Vorwürfen, Hass und Schuldgefühlen. Ich zwang mich, nicht loszureden, nur um die grausame Stille zu durchbrechen, stattdessen erlaubte ich ihr, sich in mir auszubreiten und wartete gelassen auf Indus Vorwürfe. Vorwürfe, die mehr als berechtigt waren. Anklagen, die ich gegen mich selbst erhob, auch wenn ich es nicht wahrhaben wollte. Als Indu endlich das unerträgliche Schweigen brach, musste ich fast vor Erleichterung lachen. Sie wusste nichts. Mein schlechtes Gewissen hatte mich das Schlimmste befürchten lassen. „Du hast ihm gesagt, dass du der Meinung bist, dass er und ich nicht zusammenpassen.“
Schnell hatte ich mich wieder gefasst. „Er wusste bereits, dass ich so denke. Jeder weiß das. Es ist kein Geheimnis.“
„Ach ja, deshalb kam er zitternd und völlig aufgelöst erst gegen Morgengrauen in unser Bett? Deshalb bat er mich, ihn nicht zu fragen, was geschehen sei? Weil du ihm gesagt hast, was er bereits wusste? Das ist lächerlich, Amrita. Wahrscheinlich hast du ihm in deiner typischen theatralischen Ausdrucksweise erklärt, dass du etwas zwischen uns siehst, was ich nicht sehen kann. Wahrscheinlich hast du ihm gesagt, dass er neben mir hölzern wirkt, dass mir das Leben entweicht, wenn er in meiner Nähe ist ... stimmt´s? So drückst du dich doch gerne aus, Schwester!“
Die Verachtung, die aus ihren Worten sprach, traf mich tief. Meine Kehle wurde eng, mein Atem ging heftig. „Was willst du von mir, Indu? Warum hasst du mich für meine Ehrlichkeit? Warum hasst du mich dafür, dass ich dir sage, was du längst weißt, aber nicht glauben willst? Warum?“
Indu schwieg. Meine Worte sollten sie nicht verletzen. Aber sie mussten es.
Ihre Stimme wurde plötzlich weicher. „Ich liebe ihn so sehr!“
Endlich war es so weit, dass ich sie liebevoll in den Arm nehmen konnte. Sie war so hilflos. So unfähig zu einer bewussten Entscheidung, obwohl sie glaubte, immer bewusst und gewollt zu handeln. Selbst wenn sie sah, was ich sah, konnte sie es nicht annehmen und noch weniger danach handeln. Warum waren wir so verschieden?
„Indu, meine kleine Indu!“, dachte ich mitfühlend. Manchmal schien es tatsächlich, als sei ich die Ältere von uns beiden.
Dann sagte ich etwas, für das ich mich schon eine Sekunde später hätte ohrfeigen können: „Mach dich nicht zu abhängig von ihm, sonst wird er dich verletzen.“
In diesem Moment fühlte ich mich wie eine Mutter, die ihr Kind vor nahendem Unglück schützen wollte. Nur zu gerne hätte ich all die Schmerzen Indus auf mich genommen, um sie vor jeglichem Leiden zu bewahren. Aber das ging nicht. Das wusste ich. Jede von uns musste ihre Prüfungen bestehen, ihre Erfahrungen machen, ihre Wunden erleiden. Nur dann konnten wir unser Bewusstsein ausdehnen. Indu stand an einem anderen Punkt in ihrer Entwicklung als ich. Es war nicht damit getan, dass ich ihr sagte, dass sie etwas falsch machte, und sie es daraufhin änderte. Nein, sie musste herausfinden, was sie falsch machte, und es dann selbst ändern. Nur dann wäre sie an der eigenen Erkenntnis gereift. Ich konnte ihr unmöglich sagen, dass sie Gautam von sich forttrieb, wenn sie sich an ihn klammerte. Ich konnte ihr unmöglich sagen, dass sie einen teuflischen Kreis in Bewegung setzte, dass er sich um so weiter von ihr distanzieren würde, je mehr sie ihn festhielt, und dass sie ihn noch fester halten würde, je weiter er sich von ihr löste. Ich konnte ihr unmöglich sagen, dass sie ihn in meine Arme trieb, denn bei mir fand er die Freiheit, welche Liebe erst möglich machte.
Wir saßen noch lange schweigend beieinander. Ich wusste, dass meine Worte Indu nachdenklich stimmten, aber in mir war keine Hoffnung, dass sie ihr Verhalten ändern würde. Als dicke Wolken am Horizont aufzogen, packten wir eilig zusammen. Sobald die ersten Regengüsse losgingen, wären die Straßen nur noch schwer zu befahren. Der Fahrer fuhr in schnellem Tempo über die holprige Gebirgsstraße. Wir passierten einen kleinen Vorort von Shimla. Dort standen einige einfache Holzhäuser im typischen nordindischen Stil. Einer plötzlichen Eingebung folgend, rief ich:
„Ich könnte eigentlich Amma besuchen, wenn ihr nichts dagegen habt.“
Mutter sah mich fragend an. Indu blickte missbilligend.
„Muss das jetzt sein, Amrita! Es wird gleich regnen.“
Doch ich hatte den Fahrer schon angewiesen, auf der linken Seite vor einem der einfachen Häuser zu halten. Während ich aus dem Wagen sprang, rief Mutter hinter mir her: „Wie wirst du nach Hause kommen?“
„Zu Fuß natürlich.“
„Pass auf dich auf, Amrita.“
Leichtfüßig lief ich den schmalen Pfad zum Haus hinüber und war schon durch die offene Tür verschwunden, als der Fahrer wieder anfuhr.
„Amma, bist du zu Hause? Ich bin’s, Amrita.“
Nichts rührte sich. Ich lief durch den einfachen Wohnraum und sah durch ein geöffnetes Fenster hinaus in den Garten, in dem allerlei Gemüse und Kräuter wuchsen. Amma stand am Brunnen und holte Wasser herauf. Sie war älter geworden, seit ich sie das letzte Mal gesehen hatte. Und sie sah müde aus. „Amma, das sollst du doch nicht ...“, rief ich besorgt. Schon war ich an ihrer Seite und übernahm den schweren Zinkeimer, der bis oben hin mit Wasser gefüllt war.
Ammas Gesicht erhellte sich. „Amrita. Wie schön, dass du wieder da bist. Ist das Jahr schon vorüber?“
„Ja, Amma, das ist es. Ich bin froh, wieder hier zu sein.“
„Gut siehst du aus! Was ist geschehen?“
Kraftlos stellte ich den schweren Eimer auf den Boden. Das Wasser schwappte zu allen Seiten hinaus. „Was soll geschehen sein?“
„Das wirst du mir gleich erzählen, wenn ich uns einen Tee gekocht habe.“
Ächzend schleppte ich den Eimer hinter Amma, die mit schlurfenden Schritten die Treppe hinaufging, ins Haus. Amma war eigentlich alterslos, aber man erzählte sich, dass sie schon