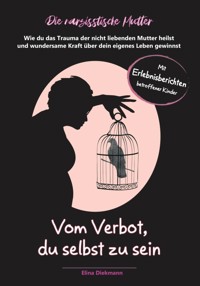
9,99 €
Mehr erfahren.
Was ist, wenn deine eigene Mutter dir das Gefühl gibt, dass du der schlechteste Mensch der Welt bist?
Wenn sie ständig deine persönlichen Grenzen überschreitet und deine Liebe ausbeuten will? Dich immer wieder erniedrigt, kritisiert oder sogar zu ihrem Eigenzweck manipuliert?
Der Missbrauch durch die eigene Mutter ist nichts, was nur blaue Flecken oder Narben auf der Haut hinterlässt. Sowas brennt sich schmerzhaft in deinen Charakter ein und kann dich ein Leben lang mit Schwierigkeiten, Scham- und Schuldgefühlen oder Verlust- und Versagensängsten belasten und kleinhalten.
Doch klar ist, dass der narzisstische Missbrauch durch deine eigene Mutter nicht immer Extremformen annehmen muss. Bereits kleine und grobe Fehler können schwerwiegende Folgen haben und dir deine Kindheit und das Leben zur Hölle machen.
Hier sind wir oft mit unserer Situation hilflos und alleine gelassen oder haben das Gefühl, dass wir uns das alles nur „einbilden“. Aber das stimmt nicht! Genau aus diesem Grund ist dieses Buch da, um dir nicht nur Anteilnahme und Verständnis zu zeigen, sondern auch um dir praktische Lösungen bewusstzumachen. Hiermit kannst du dein Leben wieder mehr genießen und mit der Vergangenheit abschließen.
Wie du dich aus den emotionalen Klauen deiner Mutter befreien kannst:
- Wie du deine eigenen Bedürfnisse, Freiheiten und Rechte erkennst und für sie und dein Leben einstehst, ohne in Schuld- oder Schamgefühlen zu versinken.
- Wie du belastende Gefühle wie Angst, Wut und Trauer gegenüber deiner Mutter besser annehmen und loswerden kannst, um wieder mehr Leichtigkeit im Leben zu verspüren.
- Wie du deine Vergangenheit und Kindheit loslässt, sodass du für dich inneren Frieden finden kannst – auch, wenn du glaubst, dass das unmöglich ist.
- Wird deine Mutter alles wieder gutmachen können, ihre Fehler einsehen oder ihre Taten bereuen? & Wie du mit solchen Hoffnungen und Gedanken umgehen kannst.
- Wie du dich auf einen Kontaktabbruch mit deiner Mutter vorbereiten kannst, wenn sie ständig deine Grenzen überschreitet.
- Wie du vermeidest, dass du wie Vater oder Mutter wirst, sodass du selbstbestimmt dein Leben nach deinen Werten, Vorstellungen und Bedürfnissen leben kannst.
- Und vieles mehr…
Im Vergleich zu Blogs, Ratgebern oder anderen Büchern zeigt dir dieses Buch nicht nur, wie du den narzisstischen Missbrauch durch deine Mutter erkennst, sondern wie du vor allem mit deiner Situation richtig umgehen und sie für dich zum Positiven wenden kannst, ohne rückfällig zu werden.
Denn klar ist: Du kannst zwar deine Mutter nicht verändern, aber dich. Du bist die einzige Person, die dich wirklich glücklich machen kann. Denn Veränderung beginnt bei dir – sei du die Veränderung, die du dir in anderen wünscht.
Dieses Buch öffnet dir die Tore zu einem selbstbestimmten, emotional freien und glücklichen Leben. Bist du bereit, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen?
Alles, was du brauchst, ist der Glaube, dass es für dich möglich ist. Worauf wartest du noch? Sichere dir jetzt dein eigenes Exemplar und nutze die Gelegenheit. Tu es für dich, denn du verdienst es!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Welchen Nutzen hat dieses Buch für dich?
Was bedeutet krankhafter Narzissmus?
Narziss, der schöne Jüngling und seine große Liebe: sein eigenes Spiegelbild
Selbstliebe – Selbstverliebtheit – Selbstwert
Narzissmus in der Gesellschaft: ein Phänomen mit vielen Gesichtern
Die Generationen im Überblick
Narzisstische Persönlichkeitsstile im Vergleich zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Das Begehren des eigenen Ich
Grandios, minderwertig und beziehungsunfähig
Die Diagnose einer Störung
Die narzisstische Mutter und ihre toxischen Eigenschaften
Egozentrik und Selbstsucht
Fehlende Empathie
Neid und Missgunst
Grenzüberschreitungen und kein Respekt vor der Privatsphäre des Kindes
Ihre Meinung zählt – die des Kindes nicht
Ausbeutung
Offen oder verdeckt narzisstisch?
Empfindlichkeit gegenüber Ablehnung und Kritik
Mangel an Empathie und Einfühlungsvermögen
Autoritäten kritisieren und Schuldgefühle vermitteln
Bewunderung durch Pseudo-Altruismus
Weiblicher Narzissmus, Verlangen nach Anerkennung in attraktiver Schale
Angst vor Nähe
Opferempfinden und Minderwertigkeitsgefühle
Mutterschaft und weiblicher Narzissmus
Das vernachlässigte Kind
Das narzisstische Familiensystem: Geheimnisse, fehlende Zuwendung, Grenzüberschreitung & mangelnde Kommunikation
Rollenzuweisung
Rollentausch
Fehlende oder ungesunde Kommunikation
Die Fassade wahren
Beziehungsmuster in Familien mit narzisstischer Mutter
Warum das Problem so lange übersehen wird
Warum selten Hilfe von außen kommt
Jedem seine Rolle: Von Goldkindern, Sündenböcken & unsichtbaren Kindern
Das Goldkind
Das schwarze Schaf und der Sündenbock
Das unsichtbare Kind
Co-Narzissmus oder: Warum Väter oftmals keine Hilfe sind
Anspruchslosigkeit bis hin zur Selbstaufgabe
Harmoniesucht und Helfersyndrom
Übernahme fremder Gefühle
Altruismus
Bindungs- und Entwicklungstrauma durch eine beeinträchtigte Mutter-Kind-Beziehung
Bindungs- & Entwicklungstrauma durch narzisstische Mütter und fehlende Väter
Emotionale Vernachlässigung: Wenn Mütter nicht auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen
Vorgeburtliche Traumata und psychische Deprivation
Kommunikation mit narzisstischen Müttern
Kritik und Abwertung
Schuldgefühle und Dankbarkeit
Lüge, Verleugnung und Konfliktvermeidung
Manipulation von Gefühlen
Sadismus
Unvermögen, sich zu entschuldigen
Anspruch auf das Eigentum der Kinder
Toxische Kommunikation und Double Binds
Triangulation als Mittel zur Kontrolle
Gaslighting als Manipulationstechnik
Gewaltfreie Kommunikation: Konflikte verstehen und lösen
Wie entwickeln sich narzisstischen Wurzeln & Prägungen?
Der Narzisst in Therapie
Therapieziele - Narzissten benötigen ein realistisches Selbstkonzept
Neue Beziehungsbilder entwickeln
Probleme, die in der Therapie mit Narzissten auftreten können
Narzissmus in Paarbeziehungen, die Wiederholung des Dramas
Charmeure und Manipulatoren
Partner mit narzisstischen Tendenzen und Verhalten
Ghosting
Ignoranz von Gefühlen und Bedürfnissen des Partners
Gaslighting
Abwertung
Isolation
Beziehungen zwischen Empathen und Narzissten
Kindheit mit der narzisstischen Mutter
Schneewittchen und die beiden Mütter, die Böse und die Gute
Instrumentalisierung des Kindes durch die narzisstische Mutter
Einengung und Kontrolle: Anpassung des Kindes an die Vorstellungen der narzisstischen Mutter
Kinder als verlängertes Selbst und Konkurrenz
Was Kindern narzisstischer Mütter fehlte und was der Erwachsene jetzt braucht
Was bedeutet krankhafter Narzissmus?
Emotionale Befreiung von Schuld, Scham & Pflichtgefühlen
Selbstreflexionsübung
Bewusstwerden über den Missbrauch & Verstrickungen lösen
Identifiziere Annahmen über deine Person und dazugehörige Gefühle
Selbstreflexionsübung:
Manipulation erkennen und sich dagegen wehren
Beobachte die Situation und spüre in dich hinein
Begrenze den Kontakt
Nimm das Verhalten deiner Mutter nicht persönlich
Suche öffentliche Orte und Unterstützung auf
Smalltalk statt Bigtalk
Beende den inneren Kampf
Verändere den Kontext: deine Freiheiten und Rechte
Therapie und Heilung
Reflexionsübung zur Wahl des Therapeuten
Unterdrückte Gefühle identifizieren und integrieren
Sei mutig und erforsche deine Gefühle
Selbstreflexionsübung:
Wo spürst du deine Gefühle in deinem Körper?
Selbstreflexionsübung
Deine Emotionen verstehen und deine Identität kennen lernen
Ventile und Ausdruck für Gefühle finden durch Sport & Kreativität
Gefühle ausdrücken durch Kreativität
Zeit für Sport und Bewegung
Zeit für Entspannung
Selbstreflexionsübung
Die heilsame Wirkung von Selbsthilfegruppen
Sorge für ein schützendes Umfeld und Freiräume
Reflexionsfragen
Grenzen setzen und Kontaktabbruch - wenn nötig
Grenzen setzen und Bedingungen festlegen
Lügen zurückweisen, nicht manipulieren lassen
Kontaktreduktion
Konsequent bleiben
Zeit allein verbringen
Bewusstwerdung und Reaktion auf Triggersituationen
Kontaktabbruch
Bereite den Kontaktabbruch vor
Vergebung für deinen inneren Frieden
Ein liebender Vater, eine liebende Mutter werden
Selbstvertrauen gewinnen und hohe Anforderungen hinterfragen
Sei dir selbst und deinem Kind liebende Eltern
Narzissmus, eine gesunde Portion ist notwendig und hilfreich
Gesunder Narzissmus als Voraussetzung für Erfolg & Resilienz
Stabiler und robuster Narzissmus
Echoismus, die Angst, ein Narzisst zu sein
Regeneration und Selbstfürsorge: Vom falschen zum wahren Selbst
Authentisch leben , das wahre Selbst finden
Fremd- und Selbstbild wahrnehmen & Konstrukte der Kindheit lösen
Fremd- und Eigenwahrnehmung vergleichen mit dem Johari-Fenster
lte Projektionen erkennen und lösen
Zeit für Entwicklung und Reflexion
Selbsterkenntnis: persönliche Fähigkeiten, Werte und Eigenschaften
Deine individuellen Werte und Überzeugungen
Verbundenheit und Autonomie: Wie und mit wem möchte ich mein Leben heute gestalten?
Sinnhaftigkeit in Beruf und Ehrenämtern
Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentfaltung
Selbstwirksamkeit und Erfolgsbewusstsein
Zu guter Letzt
weitere Erfahrungsberichte
Buchempfehlungen
Genutzte Links zur Recherche
Welchen Nutzen hat dieses Buch für dich?
Dieses Buch soll dich unterstützen, wenn du selbst unter einer ausgeprägt narzisstischen Mutter leidest oder gelitten hast. Es bietet insbesondere einen Mehrwert für Menschen, deren Mütter starke narzisstische Tendenzen oder eine vermehrte narzisstische Akzentuierung haben. Oft ist es schwer, Narzissmus als solchen zu erkennen, besonders bei der eigenen Mutter. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass nicht jeder Mensch mit narzisstischen Tendenzen psychisch krank ist. Ein klein wenig Narzissmus ist sehr oft Teil eines durchaus gesunden Persönlichkeitsspektrums. Nicht jedes narzisstische Verhalten lässt also auf eine pathologische narzisstische Persönlichkeitsstörung schließen. Bei letzterer handelt es sich jedoch um eine tiefgreifende Störung, bei der der Betroffene unter mangelndem Selbstwertgefühl leidet und sich kaum in andere Menschen einfühlen kann. Ist der Betroffene zusätzlich auch noch Mutter, so ergeben sich daraus auch massive Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung und den Selbstwert des Kindes.
Dieses Buch zeigt die verschiedenen narzisstischen Merkmale auf und unterscheidet außerdem zwischen den unterschiedlichen Ausprägungen des krankhaften Narzissmus. Vielleicht erkennst du darin Merkmale deiner eigenen Familienkonstellation wieder? Dann kann dieses Buch eine Starthilfe sein, um dich intensiver mit den Auswirkungen einer narzisstischen Mutter auf das eigene Leben auseinanderzusetzen. Viele Betroffene haben bereits mit dem Erkennen narzisstischer Merkmale eine deutliche Verbesserung ihrer Lebenssituation bemerkt. Ein sicherer und gefestigter Umgang mit einer schwierigen Mutter-Kind-Beziehung passiert allerdings nicht von allein und auch nicht über Nacht. Es ist ein Weg, der Schritt für Schritt gegangen werden muss – am besten in Begleitung eines ausgebildeten Therapeuten.
Die enthaltenen Aussagen von Betroffenen sollen dir verdeutlichen, dass du nicht allein mit dieser Problematik bist. Die Erzählungen sind eine Sammlung von Aussagen tatsächlich Betroffener, deren Namen jedoch geändert wurden. Die beiden Mütter, die dir im Verlauf des Buches vorgestellt werden sind jedoch rein fiktiv und sollen der Veranschaulichung dienen.
Oft ist es hilfreich sich anderen Menschen anzuvertrauen, um den Verarbeitungsprozess zu vereinfachen. Mein Tipp, erkundige dich nach Selbsthilfegruppen in deiner Nähe und suche den direkten Austausch. Du wirst merken, du bist nicht allein!
Schnelle Hilfe, wenn du jemanden zum Reden brauchst, findest du außerdem beim Seelsorgentelefon. 0800.1110222 (www.telefonseelsorge.de)
Hierbei sei ganz klar gesagt: Das Buch kann eine Therapie nicht ersetzen! Es ist in erster Linie als eine Art Erste-Hilfe-Maßnahme im Umgang mit dem narzisstischen Verhalten der Mutter gedacht. Die Strategien sollen dir helfen, das Erlebte als Teil eines narzisstischen Musters zu erkennen und so besser verarbeiten zu können. Solltest du jedoch bemerken, dass du Hilfe benötigst, dann scheue dich nicht, einen Therapeuten aufzusuchen. Vor allem dann, wenn deine Mutter an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung erkrankt ist, ist eine Therapie meist dringend notwendig. Denn Kinder von Müttern mit schwerer Persönlichkeitsstörung erlebten massive Belastungen an der Grenze zum Trauma. Nicht selten erlitten die Kinder auch emotionalen Missbrauch. Sie leiden und wissen oft nicht, weshalb. Dann ist eine komplexe und oft länger andauernde Begleitung erforderlich und eine Therapie der erste Schritt in ein selbstbestimmtes Leben.
Bei Anregungen oder Fragen, kannst du dich gern an mich wenden. Du erreichst mich unter der [email protected].
Viel Erfolg wünscht,
Elina Diekmann
Was bedeutet krankhafter Narzissmus?
Mir war kalt und ich fühlte mich allein. Meine Mutter nahm meine Hand, doch sie achtete dabei nicht auf mich. Sie zog mich nach draußen in die klirrende Kälte und führte mich durch einen finsteren Wald. Ich fröstelte und fürchtete mich. Meine Mutter schien nichts davon zu bemerken. Ich fragte zaghaft, wohin wir denn gehen und ob ich unbedingt mitgehen müsse, aber meine Mutter antwortete nicht. Sie hielt mich weiter an der Hand und ich durfte ihr nicht von der Seite weichen. Es kam mir vor, als liefen wir viele Stunden, bis der Wald sich endlich aufhellte. Wir durchquerten eine Lichtung, ich staunte, wie farbenfroh und herrlich die Bäume im Sonnenlicht strahlten und blieb entzückt stehen. Doch meine Mutter zog erneut an meiner Hand. Sie meinte, dass wir uns beeilen müssen, einen Grund nannte sie nicht. Schließlich erreichten wir einen kleinen See. Tausend winzige Sterne glitzerten auf der Wasseroberfläche und die Sonnenstrahlen wärmten mein Gesicht. Meine Mutter ließ meine Hand los und lief allein voraus, ich eilte ihr hinterher, doch sie forderte mich mit einer abwehrenden Geste auf, stehenzubleiben. Sie sagte, ich sollte mich hinsetzen und warten, bis sie wiederkomme. Ich setzte mich ans Ufer und beobachtete sie.
Als sie weiterging, wandte sie ihren Blick immer wieder zu mir, anscheinend wollte sie sicherzugehen, dass ich auch wirklich dortblieb. Meine Mutter lief immer weiter, zur schönsten Stelle des Sees, sie schritt über einen prächtigen Steg. Am Ende des Steges angekommen blieb sie stehen und breitete ihre Arme aus. Die Sonne diente ihr als Scheinwerferlicht. Mich beachtete sie kaum noch. Nur ein paar Mal sah sie zu mir, wie um sich zu versichern, dass ich sie sah und bewunderte. Ich dufte sie nicht stören. So war ich zwar in ihrer Nähe, doch ich war ihr nicht wirklich nah. Nach und nach versammelten sich auch allerhand Schaulustige rund um den See. Nun blickte meine Mutter nach unten, auf die malerische Oberfläche des Wassers und fand ihr Spiegelbild darin. Mit beiden Händen versuchte sie, es zu liebkosen, doch es gelang ihr nicht. Sie bemerkte nicht, dass es ihr Spiegelbild war. Es frustrierte sie nur, dass es ihr nicht gelang, es zu umarmen, und irgendwann gab sie auf.
Plötzlich rief sie nach mir, ich lief so schnell mich meine Beine trugen. Als ich sie erreichte, zerrte meine Mutter mich nun auf einen höher gelegenen Felsen, direkt neben dem Steg. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Kurzzeitig glaubte ich, sie würde mir nun endlich etwas Aufmerksamkeit und Fürsorge schenken. Doch nein, sie prahlte vor all den Schaulustigen, wie gut sie mich erzogen hätte und welche Fortschritte und Leistungen ich durch sie täglich erreichte. Ich war sprachlos, denn ich diente ihr nur als Vorzeige-Objekt. In meinem Hals hatte sich ein dicker Kloß gebildet und ich würgte ein „Danke, Mutter!“ hervor. Alle bewunderten meine Mutter, in ihrer Vollkommenheit und Großartigkeit. Man jubelte und klatschte. Mir raunte ihr Publikum hingegen zu, dass ich mich wirklich glücklich schätzen könne, eine solch fürsorgliche Mutter zu haben. Der Applaus klang nach und nach ab und das Fußvolk verschwand. Meine Mutter wandte sich daraufhin wieder ihrem Spiegelbild auf dem Wasser zu. Mich schickte sie zurück zum Uferrand. Ich setzte mich niedergeschlagen ins Gras und umklammerte meine Beine. Ich wartete und wartete. Wann würde sie wohl zurückkommen? Sie würdigte mich keines Blickes mehr. Würde mich ein wildes Tier angreifen oder ich versehentlich ins Wasser fallen, sie würde es nicht bemerken.
Das Einzige, was sie wohl stören könnte, wären dann die Wellen, die ihr Spiegelbild zerstört hätten.
Narziss, der schöne Jüngling und seine große Liebe: sein eigenes Spiegelbild
Ein Kind, das sich auf diese Weise von der Mutter allein gelassen fühlt, hat es mit einer Form des pathologischen Narzissmus zu tun. Die Wahrnehmung der Mutter ist ganz auf sich selbst gerichtet. Sie will ihrem Kind nichts Böses. Sie nimmt es nur einfach nicht mit all seinen Bedürfnissen wahr.
Narzissmus zeigt sich auf unterschiedliche Art und Weise: Narzisstische Tendenzen sind auch Teil eines gesunden Persönlichkeitsbildes. Es ist ja an sich nichts Schlechtes daran, sich selbst zu sehen. Narzissmus als Persönlichkeitsstörung hat hingegen ganz massive Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen – und auf das Leben all jener, die in deren Umfeld leben. Um zu verstehen, was Narzissmus ist und wie er sich zeigt, möchte ich zunächst auf den Ursprung des Begriffs zurückgehen:
Der Begriff Narzissmus leitet sich aus der griechischen Mythologie um Nárkissos ab, den schönen Sohn des Flussgottes Kephissos und der Quellnymphe Leiriope, der als selbstverliebter Jüngling einen tragischen Tod finden sollte. Es sind mehrere Versionen seiner Geschichte bekannt. In der geläufigsten Fassung, jener aus den berühmten „Metamorphosen“ von Ovid, wird Nárkissos bzw. Narziss, dessen Mutter den Seher Teiresias befragt, ein langes Leben prophezeit - allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der schöne Jüngling sich selbst nicht erkennt. Viele junge Mädchen und auch Jünglinge verehren und bewundern den jungen Narziss aufgrund seiner Schönheit. Doch der
attraktive Jüngling verschmäht die Liebe, er weist ausnahmslos alle Bewunderer und Verehrer zurück. Einer der zurückgewiesenen Bewunderer fühlt sich so gekränkt, dass er sich an die Göttin Nemesis wendet. Narziss soll am eigenen Leib erfahren, wie schmerzhaft sich die Qualen unerwiderter Liebe anfühlen. Auf die Bitten des Verschmähten hin straft die Göttin den jungen Narziss mit einer nichtstillbaren Selbstliebe. Narziss, der sich, durstig vom
Jagen, an einer Wasserquelle niederlässt, erblickt auf der Wasseroberfläche sein eigenes Spiegelbild und verliebt sich. Das Bild kann die Liebe nicht erwidern. Schließlich erkennt er sich selbst und stirbt an unerfüllter Liebe. Am Ufer wird kein Leichnam gefunden. Doch an der Stelle wächst eine Blume. Diese Blume ist in der Mitte gelb und hat weißlich-gelbe Blütenblätter.
Nach anderen Überlieferungen weist Narziss einen Verehrer ab, der sich daraufhin erdolcht. Beim Anblick seines Spiegelbilds wird Narziss nun nicht nur von abnormer Liebe zu sich selbst ergriffen, sondern auch vom Bewusstsein seiner Schuld, woraufhin er sich ebenfalls erdolcht. Dort, wo sein Blut den Boden berührt, wächst eine Blume.
In der einen Überlieferung durchleidet Narziss denselben Schmerz wie sein abgewiesener Verehrer und stirbt daran. In der anderen führt der Schmerz der unstillbaren Selbstliebe allein nicht zum Tod des Jünglings. Er empfindet auch Reue für den Schmerz, dem er seinem Verehrer zugefügt hat. In beiden Überlieferungen ist das Ende jedoch tödlich. Und in beiden wächst dort, wo der Jüngling stirbt, eine Blume.
Exkurs
Die Narzisse mit ihren weißen und gelben Blütenblättern ist wohl die Blume, die laut Ovid am Ufer wächst, wo Narzissus den Tod findet. Der Name der schönen Frühlingsblume leitet sich von „narkein“, griechisch für „betäuben“, „erstarren“ ab. Beide Übersetzungen machen Sinn, denn der betörende Duft der Narzisse hat eine fast betäubende Intensität und in den Zwiebeln der Pflanze steckt ein lähmendes Gift. Ähnlich zweischneidig ist auch die Rolle der Blume im Brauchtum: Während wir die Narzisse hierzulande als Frühlingsbotin schätzen und gerade in der Osterzeit zur Feier des neu erwachenden Lebens in vielen Blumengestecken wiederfinden, so ist sie im arabischen Raum als Todesbote bekannt. Ebenso mehrschichtig wie ihr Name und ihre kulturelle Bedeutung ist auch ihr Symbolgehalt in Bezug auf die Liebe, denn die Narzisse steht sowohl für Zuwendung bis hin zu tiefem Verlangen als auch für Eigenliebe bis hin zur Unfähigkeit, andere Lebewesen zu lieben.
Selbstliebe – Selbstverliebtheit – Selbstwert
Was können wir aus dieser Erzählung aus der griechischen Mythologie lernen? Sicher nicht, dass Selbstliebe etwas Schlechtes ist. Im Gegenteil, im alten Griechenland galt die Liebe zu sich selbst als durchaus positiv für den Menschen und auch als besonders eng verknüpft mit der Liebe zu anderen. Auch Sigmund Freud betrachtete Selbstliebe als gesund und notwendig für die Selbsterhaltung:
Ein gesunder Narzissmus wäre demnach die Grundlage für gelebtes Selbstvertrauen und erlebten Selbstwert.
Bei krankhaftem Narzissmus kippt gesunde Selbstliebe jedoch in eine ungesunde Selbstverliebtheit und eine übersteigerte Ichbezogenheit, die den Narzissten selbst und auch andere verletzt, die versuchen, Nähe zu ihm aufzubauen.
Die Geschichte aus Ovids „Metamorphosen“ lässt vermuten, dass der schöne Narziss nicht über einen gesunden Selbstwert oder gar Selbstliebe verfügte. Denn der Jüngling konnte die Liebe anderer schon nicht wahrnehmen, bevor er sich noch in sein Spiegelbild verliebte. Bei diesem Spiegelbild handelte sich außerdem nicht um sein wahres Selbst, sondern nur um ein Bild seiner selbst. Narziss ist der Selbstliebe nicht fähig. Seine Selbstbezogenheit und Selbstverliebtheit erlauben es ihm nicht, eine Verbindung zu seinem Selbst und dem Bild, welches er vor sich hat, herzustellen. Diese Verzweiflung und die aus seiner Fixierung resultierende Einsamkeit sind schmerzlich und führen schließlich zu seinem tragischen Tod. Der Leser empfindet Mitleid mit dem schönen Jüngling. Er sieht seine Verzweiflung. Seine Unfähigkeit, andere zu lieben, wird nicht als ein Nicht-Lieben-Wollen aufgefasst, sondern als ein Nicht-Lieben-Können. Wir sind ihm nicht böse, sondern leiden mit ihm in seiner Not.
In unserer kleinen Geschichte am Anfang steht jedoch nicht ein Jüngling am Wasser, sondern eine Mutter. Auch sie bewundert ihr eigenes Spiegelbild. Auch sie versucht es zu umarmen, aber für sie empfinden wir wenig Mitleid. Warum ist das so? Nun es gibt ein paar gravierende Unterschiede zum Narziss des Ovid: Diese Frau sieht nicht zufällig ins Wasser. Sie geht zu dem See, weil sie bewundert werden will. Von ihrem Kind, von anderen, von sich selbst. Als sie versucht, ihr Spiegelbild zu liebkosen, stürzt sie nicht ins Wasser. Sie nimmt sich nicht das Leben. Im Gegenteil. Sie erfährt Bewunderung durch andere – für ihre Schönheit und für das Kind, das sie bei sich hat. Trotzdem ist es eine tragische Geschichte. Diese Narzisstin ist Mutter. Statt die Bedürfnisse ihres Kindes zu erfüllen, sieht sie in diesen lediglich den Glanz der eigenen Leistung, für die sie Bewunderung ernten möchte. Der Plan funktioniert. Die Zuschauer sind keine Zeugen der eigentlichen Geschehnisse. Sie können dem Kind nicht helfen, denn ihnen präsentiert sich das Bild einer fürsorglichen und aufmerksamen Mutter. Die perfekte Inszenierung. Doch die narzisstische Verhaltensweise der Mutter hat verheerende Folgen. Das Kind, das Zuwendung und Sicherheit durch die Mutter braucht, dient lediglich dazu, der Mutter Zuwendung und Sicherheit zu verschaffen. Daraus ergibt sich eine Mutter-Kind-Beziehung, die weder für das Kind noch für die Mutter Erfüllung bieten kann. Die Mutter kann dem Kind nicht bieten, was es braucht. Doch auch das Kind kann der Mutter auf Dauer nicht das bieten, was sie sucht. Wie der Narziss in der Geschichte ist die narzisstische Mutter mit einer unerfüllbaren Selbstverliebtheit gestraft. Ihr Bedürfnis kann nie erfüllt werden. Ihre Reaktion darauf ist wiederum hochproblematisch, denn in den meisten Fällen folgen nun Instrumentalisierung und Manipulation, Lügen, ungerechtfertigte Kritik und Bestrafung. In unserer kleinen Geschichte zu Beginn dieses Kapitels sehen wir die unerfüllten Bedürfnisse des Kindes. Weniger offensichtlich sind die unerfüllbaren Bedürfnisse der Mutter, die dieses Leid verursachen. Während wir aber leicht Mitleid mit Narziss empfinden können, fällt es schwer, dasselbe für die narzisstische Mutter aufzubringen. Vielmehr interessiert uns, wie ein Kind mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung seiner Mutter zurechtkommen kann.
Innerhalb einer Familie – und auch von außerhalb – ist es nicht leicht, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu erkennen. Narzisstische Anteile haben viele Menschen. Narzissmus zeigt sich somit in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Außerdem gibt es viele verschiedene Ausprägungen eines narzisstischen Persönlichkeitsstils. Dieser muss, sofern er sich in Grenzen hält, auch noch nicht krankhaft sein. (Vgl. dazu auch Kapitel 6) Werden die Grenzen jedoch stetig überschritten, so liegt vermutlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vor. Und auch diese hat – wie der Narzissmus an und für sich – viele Gesichter.
Narzissmus in der Gesellschaft: ein Phänomen mit vielen Gesichtern
Umgangssprachlich verbinden wir mit Narzissmus Überheblichkeit, Empathielosigkeit und eine allumfassende Selbstverliebtheit. Doch bei dem pathologischen, also krankhaften Narzissmus handelt es sich um eine Selbstentfremdung, die dadurch entsteht, dass es den Betroffenen an einem angemessenen Selbstgefühl mangelt.
Selbstinszenierung: Narzisstische Tendenzen sind heute allgegenwärtig. Tagtäglich posieren abertausende Menschen vor der Kamera, verschicken Selfies, posten Kommentare und veröffentlichen ihre aktuellen Eindrücke, ihre Meinung und ihre Befindlichkeiten. Legitimiert werden solche Selbstdarstellungen durch falsch verstandene Werte wie Selbsterfahrung und Selbstoptimierung, zum Beispiel in Hinblick auf Schlankheit, Schönheit oder beruflichen Erfolg. Die Realität wird jedoch nicht hinterfragt, sondern nach den jeweiligen Idealvorstellungen geschönt und dann auf den sozialen Netzwerken präsentiert. Jeder kann sich auf diese Art und Weise selbst inszenieren, nicht nur Stars, Politiker oder Schauspieler. Narzissmus geht weit über Personen von öffentlichem Interesse hinaus und betrifft keinesfalls nur Führungskräfte und Personen, die auffallend erfolgreich sind. Eine große Zahl jener Menschen, die sich regelmäßig online bewundern lassen, lebt sogar recht unauffällig und wird abseits der medialen Selbstinszenierung kaum wahrgenommen.
Wunsch nach Anerkennung: Ein wenig Narzissmus ist dabei gar nichts Schlechtes. Wir alle wünschen uns Erfolg und Bewunderung. Selbstliebe, die Freude, sich selbst zu sehen, und der Wunsch, auch von anderen gesehen zu werden, sind durchaus gesund und natürlich. Das Bedürfnis nach Leistung und Erfolg und auch die Abgrenzung von anderen sind ein wichtiger Motor für die persönliche Weiterentwicklung. In vielen Fällen gewinnt der Schein, die Fassade jedoch mehr Bedeutung als das Gerüst dahinter. Gefühle und Gedanken werden verdrängt. Und bleiben die eigenen Leistungen aus, so wird versucht, Anerkennung auf andere Weise zu erlangen.
(Selbst-)Betrug: Narzissmus zeigt sich außerdem nicht nur in einer strahlenden und oftmals geschönten Selbstinszenierung. Auf der Suche nach Anerkennung und Bewunderung rücken Personen mit narzisstischen Tendenzen gerne die Darstellung der Realität ein wenig zurecht. Andere gehen noch weiter und verleugnen sogar die eigene Lebensrealität. Um ihrem Umfeld zu gefallen – und von diesem bewundert zu werden –, leben sie eine vermeintliche Idealvorstellung, die ihnen eigentlich gar nicht zusagt. Das Bedürfnis nach Anerkennung ist größer als die Umsetzung der eigenen Wünsche und Ziele. Dies führt letztlich zu einer Selbstentfremdung und Selbstaufgabe.
Misstrauen: Manch ein Narzisst hält sich für unersetzlich. Ohne den eigenen Wert, das eigene Selbst zu hinterfragen, glaubt er an sich. Dadurch wirkt er selbstbewusst und erreicht so, dass auch andere zu ihm aufsehen. Er vergleicht sich mit anderen und sucht Gründe wie Reichtum, Schönheit, Intelligenz oder Erfolg, um sich überlegen zu fühlen. Er agiert arrogant, egoistisch oder selbstverliebt. Gleichzeitig fürchtet er den Neid der anderen. Sein Verhältnis zu seinem Umfeld ist daher von stetem Misstrauen geprägt.
Abwertung: Ein Narzisst, der sich selbst in einem strahlenden Licht sehen möchte, nutzt außerdem oftmals nicht nur die eigenen Stärken, sondern auch die Schwächen anderer, um sich besser darzustellen. Er ist herablassend, verletzend und erhebt sich selbst auf Kosten anderer. Hinter der großartigen, jedoch nur mit Mühe aufrecht erhaltenen Fassade stecken oftmals große Selbstzweifel, Unsicherheit und Minderwertigkeit.
Gelingt es ihm dann nicht mehr, die Fassade aufrecht zu erhalten und weiterhin bewundert zu werden, so kann er auch die Schuld für die eigene Schwäche auf andere schieben und nach Vergeltung suchen. Solche Narzissten sind oft streitsüchtig oder verletzend sarkastisch, üben gerne negative Kritik und missachten Autoritäten. Viel Raum für anonyme Abwertung und seelische Verletzungen bietet beispielsweise das Internet.
Schuldzuweisung: Abwertung kann aber nicht nur auf direktem Weg geschehen. Personen, die ihren Frust indirekt zum Ausdruck bringen, agieren passiv-aggressiv. Das heißt, sie lösen Probleme nicht auf eine offene Art, sondern meiden die direkte Konfrontation. Negative Emotionen werden durch die Blume oder auf Umwegen zum Ausdruck gebracht. Oft wird dabei das Gegenüber so manipuliert, dass es sich schuldig und schlecht fühlt.
Narzissmus zeigt sich also auf unterschiedliche Art und Weise. Um narzisstische Persönlichkeitseigenschaften zu messen, entwickelten Robert N. Raskin und Calvin S. Hall 1979 den sogenannten Narcissistic Personality Inventory, kurz NPI-Test. Mit Hilfe einer Reihe von Fragen können narzisstische Tendenzen festgestellt werden. Für die Diagnose eines „pathologischen Narzissmus“, also der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ist der NPI allerdings nicht geeignet.
An der San Diego State University führten die US-Wissenschaftler Jean M. Twenge und W. Keith Campell mit Hilfe dieses Tests eine Langzeitstudie durch und stellten dabei eine deutliche Zunahme an Narzissmuswerten fest. Ihre 2009 in „The Narcissism Epidemic“ veröffentlichten Studienergebnisse werden auch von anderen Sozialforschern und Psychologen bestätigt.
Interessant ist, dass nicht nur die Anzahl narzisstischer Tendenzen, sondern auch die Zahl an Depressionen in den letzten Jahren anstieg. Aber auch das soziale Mitgefühl und die Solidarität sind, so der amerikanische Sozialpsychologe Jeffrey Jensen, heute bei jüngeren Menschen stärker ausgeprägt als in vorherigen Generationen. Eine Studie, die das Fachmagazin „Personality and Individual Differences“ veröffentlichte, kommt wiederum zu dem Schluss, dass die sogenannte Baby-Boomer-Generation empfindlicher gewesen sei als die Generation Y, die sogenannten Millenials. Dieser Studie zufolge waren Hypersensivität und auch Selbstbezogenheit, sowie das Aufdrängen eigener Meinungen in früheren Generationen deutlich höher als heute.
Die Generationen im Überblick
Silent: 1928 bis 1945
Babyboomer: 1946 bis 1964
Generation X: 1965 bis 1979
Generation Y: 1980 bis 1993
Generation Z: 1994 bis 2010
Generation Alpha: ab 2010
Quellen: PEW Research Center, Washington DC, USA / Wikipedia /verschiedene Institute und Fachhochschulen (www.adigiconsult.ch)
In den zuvor genannten Studien stellt sich – unabhängig davon, zu welchem Schluss sie kommen – jeweils die Frage, ob eine ganze Generation narzisstisch veranlagt sein kann. Die deutsche Psychotherapeutin Bärbel Wardetzki schreibt in ihrem Buch „Weiblicher Narzissmus“: „Wir leben in einer narzisstisch geprägten Welt, in der Werte des Alles-Machbaren und des Besser-Seins vorherrschen.“ Was bedeuten solche Beobachtungen für eine Gesellschaft? Haben sich tatsächlich die Menschen verändert oder sind es die Rahmenbedingungen? Oder gehen wir heute nur leichtfertiger mit dem Begriff „Narzissmus“ um, als dies noch vor zehn, zwanzig oder hundert Jahren der Fall war?
Ein Arzt, der einen Fehler nicht zugibt oder ein Vorgesetzter, der egoistisch agiert, muss nicht zwangsläufig ein Narzisst sein. Wer selbstbewusst auftritt, wer erfolgreich ist oder wer gar Stolz auf den eigenen Erfolg zeigt, ist ebenso wenig ein typischer Narzisst. Und auch ein Mensch mit narzisstischen Tendenzen kann darüber hinaus noch viele andere Persönlichkeitsmerkmale haben, die weitaus stärker ausgeprägt sind. In diesem Buch interessiert uns vor allem die Grenze von einer gesunden narzisstischen Neigung zu einer pathologischen narzisstischen Störung. Wann kann bzw. muss man einen Menschen mit narzisstischen Tendenzen als „krank“ begreifen?
Hinter der schweren Persönlichkeitsstörung stecken oftmals der Glaube an die eigene Großartigkeit und Einzigartigkeit, starker Empathiemangel, die Bereitschaft zur Ausbeutung und Manipulation anderer Personen, aber auch starke Erwartungen der übermäßigen Anerkennung und Bevorzugung sowie Neid und Arroganz. Pathologische Narzissten haben meist große Angst vor Kränkung und zugleich ein riesiges Bedürfnis nach Bewunderung. Für ihr Umfeld sind sie nicht selten unberechenbar.
Narzisstische Persönlichkeitsstile im Vergleich zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung
Das Narzissmus-Spektrum mit seinen unterschiedlichen Ausprägungen und Intensitäten ist groß. Es ist zunächst wichtig, narzisstische Tendenzen, Akzentuierungen und einen narzisstischen Persönlichkeitsstil von der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu unterscheiden. Akzentuierungen oder Persönlichkeitsstile ähneln den zugehörigen Persönlichkeitsstörungen zwar, sie sind aber weniger stark ausgeprägt. Personen mit einem narzisstischen Persönlichkeitsstil können zum Beispiel leistungsorientiert sein und darauf Wert legen, als etwas Besonderes zu gelten. Sie tragen vielleicht ausgefallene Kleidung, sind ehrgeizig und haben einen hohen Anspruch an sich selbst und an andere. Von einer Störung kann man in diesem Fall aber noch nicht sprechen.
Lange glaubte man, dass pathologische, narzisstische Persönlichkeitsstörungen nur selten auftreten und vor allem bei besonders einflussreichen oder auffallend charismatischen Persönlichkeiten vorkommen. Neueren Studien zufolge lassen darauf schließen, dass mindestens 0,5 Prozent aller Frauen und Männer von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung betroffen sind. Andere Studien sprechen sogar von bis zu 7 Prozent. Außerdem stellte sich heraus, dass krankhafter Narzissmus weit mehr in das private Leben hineinwirkt als ursprünglich angenommen. Vor allem die hohe Zahl narzisstischer Mütter ist beunruhigend, gilt doch die Mutter-Kind-Beziehung als wichtigste Beziehung im Leben eines Menschen. Eine narzisstische Störung der Mutter hat somit auch vehemente Auswirkungen auf das Kind. Um hier helfend und heilend einwirken zu können, ist es zunächst wichtig, die Störung als solche zu erkennen.
Das Begehren des eigenen Ich
Sigmund Freud, der „Vater der Psychoanalyse“ (1856-1939), greift den Begriff Narzissmus erstmals im Jahr 1910 auf und bringt ihn mit seiner Libidotheorie in Verbindung. Demnach ist Narzissmus als extreme Ich-Bezogenheit zu verstehen, als eine Ich-Libido, also ein Begehren des eigenen Körpers und des eigenen Ich. Dieser primäre Narzissmus sei als frühe Phase des Begehrens ganz natürlich und werde erst problematisch, wenn es in einer späteren Phase nicht gelingt, ein Gleichgewicht zwischen Ich- und Objektlibido, also dem Begehren des Ich und des anderen, herzustellen. Freud spricht dann vom sekundären Narzissmus. 1914 erläutert Freud diese Theorien ausführlich in seiner Schrift „Zur Einführung des Narzissmus“. Darin beschreibt er auch die narzisstische Neurose, bei der das Objekt (der andere) nicht als solches begehrt wird, sondern lediglich als Projektionsfläche für das eigene Ich dient. Gleichzeitig wird alles, was dieses Ich bedrohen könnte, vorsorglich auf Distanz gehalten. 1931 beschreibt Freud den narzisstischen Charaktertypus als einen Menschen, der ganz auf Selbsterhaltung ausgerichtet ist, unabhängig und selbstsicher wirkt. Das Ich verfügt über ein hohes Maß an Aggression, das er auch auszudrücken bereit ist. Er imponiert den anderen als „Persönlichkeit“, dient ihnen gerne als Anhalt, übernimmt gerne Führungsrollen, kann zur Kulturentwicklung beitragen oder Bestehendes schädigen und bevorzugt „Lieben“ dem Geliebtwerden.





























