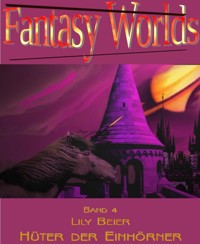3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: vss-verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nach dem Tod ihres Vaters verlässt die junge Alima ihr Heimatdorf, um mit einem Schiff auf die nächste größere Insel überzusetzen, wo ihre Tante, die sie noch nie zuvor gesehen hat, im Binnenland einen Bauernhof führt. Sie ist traurig, denn seit ihrer frühesten Kinfheit zieht sie das Meer magisch an. Doch da ihre Mutter vor einigen Jahren spurlos verschwand, bleibt ihr keine andere Möglichkeit. Doch bevor sie ihr Ziel erreicht, wird ihr Schiff von Nereids überfallen, einem geheimnisvollen Seevolk, das vor langer Zeit Krieg gegen die Menschen führte. Die Nereids verlangen von Alima mit ihnen zu kommen. Die Nereids bringen sie zu einer alten Frau auf einer einsamen Insel. Diese gibt ihr die Möglichkeit, in der Wasserwelt zu bestehen, sowie in einem Orakelspruch auch einen Hinweis, warum ihre Mutter vor all den Jahren verschwand. Alima soll nach der verlorenen Stadt unter den Wellen suchen. Anscheinend sind sowohl das Mädchen als auch seine Mutter tiefer mit dem Meer verbunden als sie bisher wusste. Fortan wird sie von schrecklichen Träumen geplagt, in denen sie einen mysteriösen Tempel unter den Wellen besucht, wo eine geheimnisvolle Macht auf sie zu warten scheint. Und am Ziel der Reise erfährt Alima, was vor all den Jahren wirklich passiert ist - und was ihre Mutter damit zu tun hatte. Ihr wird klar, was das Ziel ihres weiteren Lebens ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Nereids Zehnt
Titel
Nereids Zehnt
Lily Beier
Impressum
Copyright: Chiara-Verlag im vss-verlag
Jahr: 2022
Lektorat: Annemarie Werner
Covergestaltung: Ulf Marquardt
Verlagsportal: www.vss-verlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig.
Prolog
Es war nicht immer dieselbe Erinnerung, die sie heimsuchte, doch alle hatten eins gemeinsam. Im Hintergrund war stets das Geräusch der Wellen zu hören, die sich an den Klippen brachen, ganz gleich, ob das Meer zu sehen war oder nicht. Manchmal konnte sie sogar das Meersalz auf ihrer Zunge schmecken, wie es ihren Rachen hinab lief, nur um sich dann, wenn sie aufwachte, mit den Tränen auf ihrer Wange zu vermischen, bis sie fürchtete, keine Luft mehr zu bekommen.
Diesmal sah sie jedoch nicht die kleine Fischerhütte, in der sie ihre Kindheit verbracht hatte. Keine löcherigen Netze hingen von der Decke und der Geruch von frisch gefangenem Fisch lag nicht dick und schwer in der Luft. Das waren Gedanken an eine glückliche Zeit, an die sie sich gerne erinnerte.
Stattdessen fand sie sich an einem weißen Sandstrand wieder, den es so bezaubernd nur in ihrem Kopf gab. Mit Erinnerungen war das so eine Sache – je weiter sie zurücklagen umso mehr verfälschte sie die Zeit. Für ein Kind ragte eine Felswand unendlich hoch in den Himmel, während ein Erwachsener sie in wenigen Stunden erklimmen konnte. Was das Auge wahrnahm, wurde ausgeschmückt mit der Phantasie eines Kindes, bis der Kontrast zwischen dem, was es zu sehen gab und den Geschehnissen, die sich auf dieser Kulisse abspielen sollten, so weit voneinander entfernt lagen wie Himmel und Erde.
Genauso war es auch mit diesem Strand. Der feine weiße Sand klebte an ihren feuchten Füßen, als sie den Fußspuren ihrer Mutter folgte, die sich bald schon in den Wellen der Brandung verloren.
Ich muss mich beeilen, sagte sie sich, damit wir wieder zu Hause sind, bevor Papa kommt. Sonst schimpft er mit uns, wenn er erfährt, dass wir alleine zum Meer gegangen sind.
Das Abendessen köchelte bereits in einem schweren Eisentopf über dem Kochfeuer und sie hatte alle ihre Aufgaben erfüllt. Wenn sie jetzt noch ihre Mutter wiederfand, würde der Tag ein gutes Ende finden.
„Alima.“
Zuerst meinte sie, der Wind würde den Klang ihres Namens zu ihr tragen. Sie blieb stehen, schloss die Augen und genoss die salzige Brise auf ihrer Haut. Wenn der Wind zu einem sprach, sollte man zuhören, sagte ihr Papa immer und da er jeden Tag so viele Stunden auf dem Fischerboot verbrachte, musste er es wissen.
„Alima.“
Die Stimme klang diesmal näher. Alima blinzelte, wandte sich um… und begegnete den seegrünen Augen, die sie nur zu gut kannte, denn sie sahen fast so aus, wie ihre eigenen.
„Mutter.“
Die Gestalt der Frau, die wenige Meter von ihr entfernt stand, glich der eines Geistes. Hoch gewachsen und dürr überragte sie die meisten Männer. Wer sich davon nicht abschrecken ließ, musste sich ihrer zumeist grimmigen Miene entgegenstellen. Es fiel ihr leichter, ihren Unmut kundzutun als ein lobendes Wort zu verlieren. Trotzdem galt sie unter den Leuten im Dorf als Schönheit. Ihre Haare schimmerten weiß, wie die einer alten Frau. Im Licht der untergehenden Sonne besaßen sie dieselbe Farbe wie ihre Augen. Zusammen mit ihrer blassen Haut wirkte sie in diesem Moment wie eine Statue, reglos und unbeugsam.
Wäre Alima ihrem Papa auf diese Weise begegnet, wüsste sie, was sie zu tun hatte. Sie würde auf ihn zulaufen und ihre dünnen Ärmchen ausstrecken. Er wiederum würde lachen und sie hoch in die Luft werfen, nur um sie mit geschickten Händen wieder aufzufangen. Auch nach ihrem achten Sommer war Alima kleiner als alle anderen Kinder des Dorfes, obwohl ihre Eltern beide sehr groß waren. Es gab keinen Ort, an dem sie sich je sicherer gefühlt hatte als in den bärenstarken Armen ihres Papas.
Mit ihrer Mutter war das nicht so einfach. Es gab Tage, da bekam Alima sie gar nicht zu Gesicht. Sie verschwand spurlos und tauchte abends wieder auf, müde und abgekämpft, obwohl sie nie verriet, wo sie hingegangen war. In letzter Zeit passierte das ziemlich häufig. Und wenn sie doch zu Hause war, wirkte sie abwesend, als ob lediglich ihr Körper da wäre, während ihr Geist an einem anderen, spannenderen Ort verweilte. Nur selten sprach sie direkt mit Alima. Meistens gab sie ihrer einzigen Tochter das Gefühl, als sei sie unsichtbar.
Auch jetzt glitten die seegrünen Augen schnell vom Gesicht des Mädchens und wandten sich wieder den Wellen des Meeres zu, die sich sanft in der Brandung brachen. Bald schon würden sie nicht mehr so still angerauscht kommen, sondern sich auftürmen, bis der Sand komplett von der dunklen Flut verdeckt wurde.
„Wir sollten nach Hause gehen“, schlug Alima vorsichtig vor. „Der Sturm fängt bald an.“
Ihre Mutter drehte den Kopf in ihre Richtung, bis sie ihre Tochter aus den Augenwinkeln ansehen konnte. „Du spürst ihn also auch, den Ruf des Meeres?“
Alima runzelte die Stirn. Was genau meinte sie damit? „Ich weiß, dass bald ein Sturm kommt, auch wenn noch keine großen Wellen zu sehen sind“, erklärte sie vorsichtig.
„Du spürst es auch, wenn an anderen Orten Stürme drohen, nicht wahr? Rätst du deinem Vater, wo er mit seinem Schiff hinfahren soll, um einen guten Fang zu machen oder Unruhen zu vermeiden? Spürst du, wenn das Meer sich regt und zürnt, wenn es sich ausruht oder zu lange verharrte?“ Etwas leiser fügte sie hinzu: „Spricht es zu dir, bis du dich so sehr nach ihm verzehrst, bis du freiwillig in die Fluten waten und dich seiner Umarmung hingeben würdest, auch wenn es dein Ende bedeuten würde?“
Alima erschauderte und sie war sich nicht sicher, ob es nur an dem plötzlich auftretenden kalten Windstoß lag. Manchmal spielten sie und ihr Vater ein Spiel, wann immer er zu häufig vergeblich aufs Meer hinausfuhr und nach Fischen suchte. Dann tat sie so, als wäre sie der Kapitän seines Schiffes und er fragte sie, wo sie hinfahren würde, wenn sie es sich aussuchen konnte. Alima kannte alle wichtigen Sternzeichen und wie sie Seekarten richtig las. Schon jetzt wusste sie mehr über die Seefahrt als Kendrick, der fünf Jahre ältere Nachbarsjunge. Auch wenn der bereits mit seinem Vater zur See gefahren war, während sie selbst das noch nicht durfte. Meinte ihre Mutter das damit?
„Ich würde nie hinaus ins Meer gehen“, erklärte Alima schließlich, als ihr keine bessere Antwort einfiel. „Papa sagt, es ist zu gefährlich da zu schwimmen.“
Die ältere Frau seufzte tief und streckte eine blasse, feingliedrige Hand aus, um ihr damit über den Kopf zu streichen. Beinahe wäre das Mädchen zurückgeschreckt – dies war die erste Berührung ihrer Mutter, an die sie sich erinnern konnte.
„Du verstehst es nicht“, sagte sie und ihre Stimme klang gleichzeitig resigniert und erleichtert. „Vielleicht spricht das Meer nur manchmal zu dir, oder du weißt nicht, wie du ihm richtig zuhören sollst. Es ist wohl besser so. Ich wünsche dir, dass du niemals verstehst, wovon ich gerade geredet habe.“
„Spricht das Meer denn zu dir?“ Alima konnte sich nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte. Die Wellen waren ständig in Bewegung und dabei nicht gerade leise. Konnte ihre Mutter aus der Brandung Worte heraushören?
„Nicht das Meer direkt, nein. Nur jene, die ich ihm entrissen habe.“ Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Es wirkte eher traurig als fröhlich, so wie alles andere, was sie sagte oder tat. Dann drehte sie sich um und ging fort, in Richtung des Hauses.
Dies war nicht nur die längste Unterhaltung, die Mutter und Tochter je geführt hatten, sondern es sollte auch das letzte Mal sein, dass Alima ihre Mutter am Strand sah. Wenige Tage später kehrte sie gar nicht mehr nach Hause zurück und galt fortan als vermisst. Alles, was sie zurückließ, waren Erinnerungen und Geheimnisse, die das Mädchen nicht verstehen würde, bis es sehr viel älter war.
1.
Wer sein ganzes Leben an der Küste verbrachte, kannte die Lebensweise, die Gerüche, einfach alles, was für ein friedliches Zusammenleben mit dieser mächtigen Naturgewalt wichtig war. Man lernte, den Himmel zu betrachten, um Unwetter zu erahnen, achtete stets darauf, Fensterläden zu schließen und half Nachbarn aus, wenn sie Gefahr liefen, dem nächsten Sturm nicht standhalten zu können. Die endlose Reihe an Fischeintöpfen, in denen fast nie das Fleisch eines Tieres zu finden war, das nicht aus dem Wasser kam, die steife Brise, die an manchen Tagen selbst die süßesten Nachtische salzig schmecken ließ. Aber auch der Anblick des grenzenlosen Himmels gehörte dazu, egal ob wolkenverhangen oder klar, die vielen Blautöne von Horizont und Wasseroberfläche, die ineinander liefen und einer Person das Gefühl gaben, bis in die Unendlichkeit blicken zu können.
Freiheit, die sich nur den Stürmen unterwerfen musste, brachte recht eigenbrötlerische Völker hervor, hieß es in den Städten im Landesinneren. Dickköpfig und eigensinnig seien sie, dafür aber beständig und zuverlässig. Sie hielten ihre Versprechen ein, sodass man sich auf ihr Wort stets verlassen konnte.
Doch die verschiedenen Küstenbewohner hegten auch Vorurteile untereinander. Die Nordküstenbewohner nannten die an der wärmeren Südküste lebenden Leute verweichlicht, da die Stürme sie nicht so hart trafen. Dafür behaupteten die Menschen im Süden, die Nordmänner seien unnahbar und hätten keinen Sinn für Humor. Was davon stimmte, musste jeder für sich selbst herausfinden, aber manche Vorurteile hielten sich hartnäckig.
Und in vielen von ihnen steckte zumindest ein kleines Körnchen Wahrheit. Ihre Insel, Talytha, mochte vielleicht nicht unendlich groß sein, dafür war sie in die Länge gezogen, sodass sich die Temperaturen an beiden Küstenenden unterschieden und sich andere Lebensumstände entwickelten. Zudem lagen die größeren Städte alle am Nordende und von dort aus war auch der beste Ausgangspunkt, um zur Schwesterinsel, Taleigha, überzusetzen. In den Hafenstädten, so wie hier, in Angwych, sammelten sich viele verschiedene Menschen, Händler, Glücksritter und einfache Reisende. Manche blieben länger, andere zogen schnell weiter. Während ein neues Gesicht in den südlicher gelegenen Ortschaften sofort auffiel, konnte einjeder in den Küstenstädten im Norden unerkannt ein und ausgehen.
Für ein Mädchen, das in seinem Leben nie mehr als hundert Leute an ein und derselben Stelle versammelt gesehen hatte, war die Erfahrung erschreckend. Mit weit aufgerissenen Augen starrte es die hohen Bauwerke an, die überall an den breiten Straßen lagen und hinter deren Fenstern unzählige Leute hin und her liefen. Auch draußen herrschte reges Treiben, egal zu welcher Tageszeit. Jeder ging seinen eigenen Geschäften nach, kaum jemand verharrte, um sich mit einem Bekannten zu unterhalten. Vermutlich kannten die meisten aneinander vorbeilaufenden Leute nicht mal die Namen der Person, die sie gerade anrempelten oder von der sie ihr Frühstück erwarben.
Das war es, was Alima am meisten Angst machte – niemand kannte sie in dieser großen, grauen Stadt. Zum ersten Mal in ihrem Leben war sie völlig auf sich alleine gestellt. Auf dem langen Weg in Richtung Norden fragte sie sich jeden Tag, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Sie versuchte, sich vorzustellen, wie es in der fremden Stadt aussehen mochte. Noch während die Welt an den schmalen Fenstern der Postkutsche vorbei flog, wanderten ihre Gedanken immer weiter fort. Wenn ihr hier schon alles so sonderbar vorkam, wie würde es ihr dann erst auf einer ganz anderen Insel ergehen? Denn in wenigen Stunden würde sie mit dem Schiff nach Taleigha aufbrechen und ihr bisheriges Leben hinter sich lassen.
Nun stand sie im Morgengrauen vor dem Gasthaus, in dem sie die Nacht verbracht hatte und blickte den verschiedenen Händlerkarren hinterher, die sich jetzt schon in Richtung des Marktplatzes auf den Weg machten. Hier und da stolperten Betrunkene aus den Tavernen, laut grölend und blind für alles und jeden, außer ihrem eigenen Vergnügen. Einige in schäbige Umhänge gehüllte Gestalten liefen zielstrebig die Straßen entlang, harte Arbeiter, denen das Glück nicht hold gewesen war. Der Anblick kam ihr vertrauter vor als die goldenen Kutschen, die sie gestern gesehen hatte, die prächtig im Sonnenlicht glänzten und deren Wert das Mädchen nicht einmal erahnen konnte.
Zu Hause in Tanis, einem kleinen Ort an der Südküste, wohnten fast nur Fischer und sie alle waren einander gleich gestellt. Erst hier in der großen Stadt merkte sie, dass es einen Unterschied zwischen den Leuten gab, der sich vor allem durch die Qualität ihrer Kleidung und ihr Auftreten bemerkbar machte.
Sie selbst fiel dabei in die Kategorie der ärmeren Personen. Ihr grauer Umhang war robust, aber nicht neu und keine Spangen oder Broschen zierten ihn. Ihre braunen Haare und etwas dunklere Hautfarbe verdankte sie ihrem Vater, der von einer Insel kam, die noch weiter im Süden lag. Zwischen all den Leuten fiel sie kaum auf, auch wenn blonde Schöpfe und bleichere Haut im Norden häufiger vertreten waren. Ihre wenigen Habseligkeiten passten in einen Seesack, den sie sich nun über die Schulter schlang und sich dann mit schnellen Schritten auf den Weg zum Dock machte.
Dort lag das eigentliche Herz der Stadt. Die meisten Geschäfte wurden nicht auf dem Marktplatz gemacht, sondern direkt hier, wenn die Ware von den Schiffen noch frisch und neu war. Im Vorbeigehen hörte Alima bestimmt zehn unbekannte Sprachen, in denen verhandelt, geschimpft oder leise getuschelt wurde. Wie erwartet fiel auch hier ein alleine reisendes, ärmliches Mädchen kaum auf. Sie war nur eine von vielen, die hofften, von hier aus in die See zu stechen, um ein neues Leben an einem weit entfernten Ort anzufangen.
Nun ja, hoffen stimmte in ihrem Fall nicht ganz. Ihr blieb keine andere Wahl, als diesen Schritt ins Ungewisse zu wagen.
Es dauerte nicht lange, bis sie es schaffte, sich zum richtigen Steg durchzufragen. So früh am Tag hatten die meisten Leute ihre Geduld für nervige Halbwüchsige noch nicht aufgebraucht und sie fand „Halvas Glück“, ihr Schiff, wie versprochen an einer der kleineren Anlegestellen. Arbeiter waren bereits damit beschäftigt, die Warenkisten aufzuladen. Da keine anderen Passagiere zu sehen waren, blieb sie in einiger Entfernung sitzen und beobachtete das Geschehen.
Bei allen Unterschieden fiel Alima jetzt erst ein weiterer ein – der Geruch hier war ganz anders als in Tanis. Salzig, ja, das lag an der Nähe des Meeres, doch da hörten die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Die Luft war viel kälter, beinahe unangenehm blies der Wind ihr ins Gesicht, peitschte die Wellen auf, bis das Wasser zornig und unzugänglich wirkte. Ganz anders als die sanfte Brandung an dem weißen Sandstrand, der nur noch in ihrer Erinnerung existierte. Was blieb war Leere und Fremde und der Geruch vieler Menschen, die auf zu engem Raum zusammenwohnten. Das Meer hier versprach keine Freiheit, es war nur eine weitere Barriere, die man überwinden musste, um von hieraus irgendwo anders hinzureisen. Der Gedanke hinterließ einen bitteren Nachgeschmack in ihrem Mund.
Nach einiger Zeit begann Alimas Magen zu knurren. Vielleicht hätte sie im Gasthaus frühstücken sollen, aber die unfreundliche Wirtin hatte ihr schon gestern Abend böse Blicke zugeworfen und ihr zu verstehen gegeben, sie solle am besten so schnell wie möglich wieder verschwinden. Deswegen hatte sie sich nicht getraut, das Mahl, das ihr eigentlich zustand, einzufordern und ihr ohnehin viel zu schmaler Geldbeutel ließ es nicht zu, dass sie sich zusätzliches Essen kaufte. Angeblich sollte es auf dem Schiff während der Überfahrt jeden Tag drei Mahlzeiten geben, doch wenn sie sich die harten Gesichter der Crew so ansah, zweifelte sie daran, dass sie den Mut aufbringen würde, ihre Rationen einzufordern.
Alles an ihrer Situation fühlte sich verdreht und falsch an. Wenn es irgendeinen anderen Weg für sie gäbe, so hätte sie ihn stattdessen gewählt. Leider war dies nicht der Fall. Genau genommen hatte sie großes Glück, dass ihre Tante sich überhaupt bereit erklärt hatte, sie aufzunehmen, obwohl sie sich noch nie begegnet waren. Die ältere Frau hatte selbst sechs Kinder großgezogen und schrieb in ihren Briefen, ein Maul mehr oder weniger, das es zu stopfen galt, würde für sie keinen Unterschied machen. Auf einem Bauernhof wurde anscheinend jede Hand gebraucht, die man kriegen konnte, auch die ungelehrte Hand einer Fischertochter.
Allein die Vorstellung, fern vom Meer im Inland leben zu müssen, verursachte Alima Bauchschmerzen. Wenn es sich schon so falsch anfühlte, sich an der Nordküste ihrer Heimatinsel aufzuhalten, wie würde es ihr dann auf Taleigha ergehen? So viele Fragen, die sie allesamt mitschleppen würde in eine ungewisse Zukunft, die nichts Gutes für sie bereithielt.
„Hier.“
Erschrocken sah Alima auf, als eine weiche Kugel sie in den Bauch traf. Ihre Hände schlossen sich automatisch um den in Leinen eingewickelten Laib Brot, der sich noch warm anfühlte und herrlich duftete. Sofort lief ihr das Wasser im Munde zusammen. Am liebsten wäre sie auf der Stelle über das Essen hergefallen, doch dann erinnerte sie sich an ihre Manieren und sah den Mann, der vor ihr stand und sie mit neugierigem Blick musterte, fragend an. Er sah aus wie ein einfacher Seemann, vielleicht etwas jünger als ihr Vater, mit einer ernsten, aber nicht unfreundlich wirkenden Miene und erschreckend hellen Augen in einem ansonsten wettergegerbten, dunklen Gesicht.
„Ich hab deinen Magen bis zum Schiff hin knurren hören“, erklärte er mit einem Schulterzucken. „Genieß das frische Essen, solange du noch kannst, denn bald gibt es nichts außer Zwieback und Trockenobst zu essen.“
Alima zögerte nicht länger und biss in das warme Brot. Lange war es her, dass sie etwas so gutes zu Essen bekommen hatte. Zwischen zwei Bissen fragte sie den Fremden: „Woher wusstest du, dass ich zu dem Schiff gehöre?“
„Sicher war ich mir nicht“, gab er zu, „aber ich beobachte dich schon eine Weile, Mädchen. Entweder du bist der schlechteste Spion, der mir je begegnet ist, eine faule Herumtreiberin oder die erste Passagierin, die Halvas Glück jemals gesehen hat.“
Sie runzelte die Stirn. „Ich dachte, das Schiff nimmt häufiger Leute mit nach Taleigha?“
Der Fremde nickte bedächtig seinen Kopf. „Passagiere, ja. Aber keine Frauen. Es heißt, Frauen auf dem Schiff zu haben bringt Unglück. Unser Kapitän ist ein eigensinniger Mann, der seinen Aberglauben sehr, sehr ernst nimmt. Deswegen hat er sich lange gewehrt, dich überhaupt mitzunehmen.“
„Warum hat er sich anders entschieden?“
Ihr Gegenüber grinste und zeigte dabei seine unvollständigen, vergilbten Zahnreihen. „Er schuldete deinem Vater einen Gefallen. Und jetzt, wo er ihn nicht mehr einfordern kann, hat er Angst, zu sterben, ohne die Schuld beglichen zu haben. Ein weiterer Aberglauben, wenn du so willst. Also nimmt er dich mit übers Meer, aber er tut es nicht gerne. Deswegen solltest du gut auf dich aufpassen, wenn du an Bord kommst.“
Alima schluckte nervös. Jetzt saß das leckere Brot wie ein Klumpen in ihrem Magen. Was, wenn sie doch mehr Probleme bekam als befürchtet?
„He, so schlimm wird es schon nicht werden“, fügte ihr Gegenüber mit einem Stirnrunzeln hinzu. „Die Mannschaft ist in Ordnung, keiner von ihnen wird dich belästigen oder so. Und wenn doch, dann sagst du mir Bescheid und ich hau ihm eine rein!“
Das zauberte ein kleines Lächeln auf ihr Gesicht. „Danke“, meinte sie schließlich. „Daran habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht.“
„Kein Problem. Wir sehen uns dann an Bord!“
Nach diesen erbaulichen Worten machte der Fremde kehrt und ging pfeifend zurück zu den anderen beschäftigten Seeleuten. Alima sah ihm hinterher und fragte sich einmal mehr, worauf sie sich da eingelassen hatte.
2.
Der Rhythmus der Wellen veränderte sich, je mehr das Boot sich von der Küste entfernte. Alima war es gewöhnt, sie an der Brandung aufschlagen zu hören und die Gischt an ihren bloßen Füßen zu spüren. Auf offener See fühlte sich das Meer anders an, bedrohlicher, aber auch freier. Menschen besaßen hier keine Macht, man gab sein Schicksal an die Wellen, die das Schiff hin und her schaukelten.
Obwohl ihr Vater Fischer gewesen war, nahm er seine einzige Tochter nie mit, wenn er aufs Meer hinausfuhr, egal wie sehr sie bettelte. Es sei zu gefährlich, versicherte er ihr immer wieder. Je älter sie wurde, umso mehr ärgerte sie sich darüber. Immerhin nahmen andere Eltern ihre Kinder auch mit auf die Boote, wenn sie gerade mal aufrecht stehen konnten. Manche Nachbarn hatten sie regelmäßig ausgelacht, weil Alima nie das Festland verlassen hatte.
Warum ihr Vater sich so sehr davor fürchtete, sie mitzunehmen, verstand sie immer noch nicht. Doch sie befürchtete, es könnte etwas mit ihrer Mutter zu tun haben, die zwar stundenlang hinaus aufs Meer starren konnte, sich aber nie traute, ein Schiff zu betreten. Schwimmen konnte sie auch nicht. Alima musste es heimlich lernen, damit ihre Eltern es nicht merkte.
Deswegen hätte ihre erste Schiffsfahrt ein wundervolles Erlebnis sein sollen. Leider gab es zu vieles, was sie störte. Zum einen saß sie, zusammen mit drei anderen Passagieren, im Bauch des Schiffes fest, wo sich die angebundenen Warenkisten befanden. Sowas wie Kajüten gab es für die „Ware“, wie der Kapitän seine Mitfahrer abschätzend bezeichnete, nicht.
„Kommt bloß nicht auf komische Ideen“, hatte der dicke, bärtige Mann seinen menschlichen Waren gedroht, als er sie an Bord holte. Vor allem Alima wurde bei diesen Worten misstrauisch beäugt. „Das hier ist kein Luxusschiff, dazu bezahlt ihr nicht genug. Ihr bleibt schön, wo ihr seid, außer ein Mann meiner Crew erklärt sich freiwillig bereit, euch Auslauf zu geben. Alleine habt ihr oben nichts verloren und wen ich da ungefragt erwische, wird Kiel geholt. Habt ihr das verstanden?“