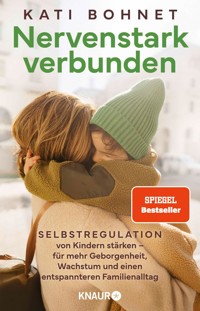
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Entlastender Ansatz für alle Eltern: Der wissenschaftlich fundierte und praxisnahe Ratgeber zum Erziehungsgeheimnis der Co-Regulation Der Alltag mit Kindern kann sehr herausfordernd sein: Das Baby schreit, die Vierjährige wirft sich wütend auf den Boden, der Teenager zieht sich zurück. Was können Eltern tun, wenn sich Kinder nicht beruhigen lassen, einfach nicht kooperieren wollen oder sich verschließen? Die Therapeutin Kati Bohnet erklärt, was hinter diesen emotionalen Reaktionen steckt – und wie wir als Erwachsene besser damit umgehen können. Wie uns die Hirnforschung dabei hilft, Kinder besser zu verstehen Kati Bohnet zeigt uns mit einem Blick auf die Funktionsweise des Nervensystems, wie wir herausforderndes Verhalten von Kindern besser verstehen und entspannter begleiten können. Denn sowohl hinter "anstrengendem" Verhalten von Kindern als auch hinter der manchmal ungehaltenen Reaktion der Erwachsenen steckt in der Regel keine böse Absicht, sondern eine innere Not. Wie können wir uns selbst und Kindern in stressigen Situationen helfen? Wenn das Nervensystem eines Kindes auf Alarmstufe rot schaltet, setzt ein Überlebensimpuls ein, es kann sich nicht alleine wieder zur Ruhe bringen. Jetzt braucht es die erwachsene Bezugsperson, um wieder in einen friedvollen und regulierten Zustand zu gelangen. Das Geheimnis liegt im Verständnis des Nervensystems und in der Co-Regulation durch die Erwachsenen - ein Game Changer im Alltag mit Kindern! Je mehr Co-Regulation ein Baby bzw. Kind erfahren kann, desto besser wird es später in der Lage sein, sich selbst zu regulieren. Dieses Buch nimmt Eltern liebevoll an die Hand, tröstet, vermittelt fachlich fundierte, alltagstaugliche Strategien und macht Mut: Wir Eltern müssen nicht perfekt sein, um Kinder liebevoll zu begleiten. Für mehr Geborgenheit, Wachstum und Leichtigkeit im Umgang mit Kindern. Mit vielen persönlichen Beispielen aus ihrer langjährigen Praxisarbeit erweitert Kati Bohnet den Begriff der bindungs- und bedürfnisorientierten Begleitung. Mit immensem Fachwissen und großer Empathie für die alltäglichen Herausforderungen des Elternseins leuchtet Kati Bohnet aus, was wirklich bei Stress, Überforderung und überwältigenden Gefühlen hilft - bei großen wie bei kleinen Menschen! Ein wichtiges Buch, das aufzeigt, wie Emotionsregulation ganz konkret funktioniert: im Gehirn, im Nervensystem und im Herzen. Nora Imlau, Fachautorin für Familienthemen Warmherzig, fundiert und praktisch – »Nervenstark verbunden« ist ein Kompass für alle, die Kinder begleiten. Kati Bohnet verbindet neurobiologisches Wissen, Praxiserfahrung und persönliche Reflexion zu einem warmherzigen Plädoyer für Co-Regulation und Verbindung im Familienalltag. Zwischen Alltagstrubel und Zweifel zeigt sie Wege, wie Verbindung, Sicherheit und Wachstum entstehen können – für die Kleinen und die Großen. Dieses Buch ist ein liebevoller Werkzeugkasten und ein verlässlicher Halt in herausfordernden Zeiten. Verena König, Traumatherapeutin Dieser Ratgeber schafft es, komplexes einfach und gut verstehbar darzustellen. Anhand von Beispielen aus der eigenen Biographie und der Praxis wird anschaulich erklärt wie Regulation und Co-Regulation zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen gelingen kann. Aber vor allem macht das Buch Mut für "gut genug". Es ist für alle, die Nervenstark verbunden sein möchten: Eltern, Großeltern Pflegeeltern, Adoptiveltern, Erzieher.innen, Pädagog:innen, Kindergesundheitspfleger:innen, Therapeut:innen - kurz: es ist für alle Menschen, die mit Kindern Zeit verbringen - also global betrachtet - für alle. Dr. med. Kerstin Stellermann-Strehlow, Kinder- und Jugendpsychiaterin und Traumatherapeutin Kati hat mit diesem Buch ein wunderbares Werk über das autonome Nervensystem und das bunte Leben mit Kindern geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kati Bohnet
Nervenstark verbunden
Selbstregulation von Kindern stärken – für mehr Geborgenheit, Wachstum und einen entspannteren Familienalltag
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Ein großer Faktor, den ich am Anfang meines Elternseins absolut nicht auf dem Schirm hatte, war die Kraft der Co-Regulation. Und was ich noch weniger auf dem Schirm hatte: dass ich für eine gute Co-Regulation mich selbst gut (genug) regulieren können muss. Die Erkenntnis war sowohl ein Schock als auch ein Segen, denn endlich hatte ich etwas in der Hand, das mir im Alltag wirklich half.
Dieses Buch ist für dich, wenn du auch manchmal in deinem Alltag an den kleinen und großen Krisen scheiterst, nicht weiterweißt. Wenn dein Kind nicht kooperiert und du, statt nach zwei Stunden Einschlafbegleitung immer noch liebevoll zu unterstützen, dein Kind schließlich doch anmeckerst und vielleicht sogar anschreist. Und es ist auf jeden Fall etwas für dich, wenn du dich dafür interessierst, wie soziales Verhalten funktioniert – und warum es manchmal gar nicht funktionieren kann.«
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Einleitung
Wie du dieses Buch lesen kannst
Weniger Kochrezepte – mehr Selbstermächtigung
Schlaf. Ein. JETZT! Warum’s nie klappt, wenn’s muss
Was ist Regulation?
Körperliche Regulation
Emotionale Regulation
Regulation bei Babys
Co-Regulation
Co-Regulation braucht Verbindung
Verbindung unterbrochen? Rupture & Repair
Von Wetter und Klima im Umgang mit unseren Kindern
»Anstrengendes« Verhalten als angemessene Reaktion auf eine anstrengende Situation
Du bist nicht schuld
Wenn du gar keine Idee mehr hast, kannst du dich immer noch selbst regulieren
Selbstregulation
Selbstregulation muss sich entwickeln
Selbstregulation ist nicht das Gleiche wie Selbstkontrolle
Bottom-up und Top-down – 80 Prozent vs. 20 Prozent
Alternative Regulationsstrategien
Unser Körper findet Wege, sich zu regulieren
Veränderung ist möglich
Der Kapitalismus funktioniert besser mit dysregulierten Nervensystemen
Elternschaft ist f***ing anstrengend
Tatütataaa Amygdala – Der Blick ins Nervensystem
Unser Gehirn
Handmodell von unseren Gehirnfunktionen
Eine gute Zusammenarbeit
Das Gehirn unter Stress
Das Nervensystem
Der grundlegende Aufbau
Das autonome Nervensystem
Die Prinzipien der Polyvagaltheorie
Warum das alles wichtig ist
Jetzt geht’s ans Eingemachte: Durchblick mit der Nervensystembrille
Jedes Verhalten hat einen Grund – So vieles ergibt plötzlich Sinn
Wer hat angefangen? Tja, je nachdem
Übersicht: Soziales Verhalten und Körperzustände
Die Stressampel
Stressampel Grün
Schlafen und schlafen lassen
Geborgenheit, Bindung und Intimität
Gut verbunden! Das gesellige Beisammensein
Auf die Fresse, fertig, Spaß! – Action/Interaktion
Stressampel Gelb
Zuflucht – In der Not bist du der Fels in der Brandung
Fight – Der Umgang mit dem inneren Dampfkochtopf
Flight – Ich muss dringend hier weg
Stressampel Rot
Please & Appease (= Gefallenwollen und Beschwichtigen)
»Kann ich dem Schreck einen Arschtritt geben?« – Extremzustand Erstarrung
Wenn man Kinder zu lange schreien lässt – Extremzustand Kollaps
Und nu? – Nervenstark verbunden im Alltag: Vom Wissen in die Praxis
Du musst gar nichts tun – und trotzdem verändert sich etwas
Der Desaster-Kitchen-Blog und Kaaaarl, der an allem schuld ist
Wissen schafft Orientierung, und Orientierung schafft Sicherheit
Manchmal kannst du doch ganz konkret etwas tun
Dein Weg zu Grün
Dein Kind auf dem Weg zu Grün
Du musst es nicht perfekt machen – gut genug reicht
Anhang
S-O-S®-Übungen
Sonnenübungen
QR-Code zur Ressourcenseite
Danke
Einleitung
Während ich dieses Buch schreibe, macht mein jüngster Sohn gerade Abi und plant seinen Auszug. Der ältere Sohn ist bereits ausgezogen. Bei uns ändert sich also eine ganze Menge. Für mich als alleinerziehende Mutter und gleichzeitig als Expertin für Selbstregulation mit großem Fachwissen über das Begleiten von Kindern bedeutet das seit geraumer Zeit eine intensive Phase der Reflexion. Habe ich meinen Kindern alles mitgegeben, was sie brauchen? War ich eine gute Mama? Gut genug? Hatten sie eine gute Kindheit? Haben sie sich geborgen gefühlt? Konnten sie wachsen und sind nun vorbereitet, um in ihr eigenes Leben zu gehen? Kommen sie klar, wenn die Eltern nicht mehr täglich zur Verfügung stehen? All die kleinen Umarmungen, Tröster und Zuhörmomente zwischendurch, die im Alltag manchmal so viel Stabilität verleihen. Habe ich meinen Kindern genügend gute Erfahrungen gegeben?
Ich hatte hohe Ansprüche an mein Elternsein. Ich wollte es anders, am liebsten besser machen als meine Eltern. Wie so viele wahrscheinlich. Als ich mit 27 Jahren Mutter wurde, wusste ich vieles nicht, was ich heute weiß. Oft fehlte mir die Orientierung. Ich war die Erste in meinem direkten Freund:innenkreis, die Kinder bekam. Ich hatte keinen Kontakt zu meinen Eltern und nach früher Trennung vom Vater meiner Kinder auch nur bedingte Unterstützung im Alltag durch meine Schwiegereltern. Ich hatte niemanden, den:die ich fragen konnte: »Was mache ich, wenn …?«, »Es weint die ganze Zeit, was mache ich falsch?«, »Ich bin total am Limit, wie schaffe ich es, mein Kind nicht anzuschreien?« Noch mehr fehlte mir manchmal jemand, der:die mir sagte, dass ich das gut genug machte. Jemand, der:die mich an die Hand oder besser noch in den Arm genommen hätte, wenn ich zu erschöpft war und sich alles grau und unschaffbar anfühlte oder ich meine Kinder doch angeschrien hatte.
Diese Orientierung und Unterstützung gewann ich erst in meiner Integrativen Gestaltausbildung und im Training zur Somatic Experiencing (SE)®-Anwenderin, durch das Lesen von Büchern über die Polyvagaltheorie und schließlich natürlich in meinen vielen Therapiestunden, -ausbildungen und -fortbildungen. Es öffnete sich mir eine neue Welt. Zunächst stieß ich auf vieles, das ich offensichtlich »verkackt« hatte, sah, was meine Eltern nicht gut hinbekommen hatten, und musste mich mit mir selbst (und meiner Vergangenheit) versöhnen. Ich musste lernen, milder mit mir zu sein. Gleichzeitig lernte ich viel über das Nervensystem und Selbstregulation und darüber, was ich brauche, damit es mir gut geht, damit ich gut genug für meine Kinder da sein kann. Je mehr Wissen und Erfahrung ich sammelte, desto sicherer wurde ich. Und es funktionierte vor allem immer besser. Nicht von heute auf morgen. Sondern Schritt für Schritt.
Ein großer Faktor, den ich am Anfang meines Elternseins absolut nicht auf dem Schirm hatte, war die Kraft der Co-Regulation. Und was ich noch weniger auf dem Schirm hatte: dass ich für eine gute Co-Regulation mich selbst gut (genug) regulieren können muss. Die Erkenntnis war sowohl ein Schock als auch ein Segen, denn endlich hatte ich etwas in der Hand, das mir im Alltag wirklich half.
Dieses Buch ist für dich, wenn du auch manchmal in deinem Alltag an den kleinen und großen Krisen scheiterst oder mal nicht weiterweißt. Wenn du nicht verstehst, warum dein Kind nicht kooperiert und du , statt es beim fünften wieder Aufstehen nach ausgiebiger Einschlafbegleitung immer noch liebevoll zu unterstützen, schließlich doch anmeckerst und vielleicht sogar anschreist. Und es ist auf jeden Fall etwas für dich, wenn du dich dafür interessierst, wie soziales Verhalten funktioniert – und warum es manchmal gar nicht funktionieren kann.
Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich viele Umwege gemacht habe und in meinem SE-Training (Somatic Experiencing®) bei Heike Gattnar gelernt habe: »Umwege erhöhen die Ortskenntnis.« Diese Ortskenntnis gebe ich gern weiter. Nach über zehn Jahren Praxisarbeit in der Traumatherapie mit Kindern, Jugendlichen und (deren) Erwachsenen habe ich wahrlich viel gesehen und zahlreiche Familien begleitet, denen es genauso geht. Dieses Buch bündelt, was ich mir damals als junge Mutter sehr gewünscht habe: fachlich fundiertes Wissen in alltagstauglicher Sprache, das sich im Alltag anwenden lässt. Keine Verurteilung, sondern ein liebevoller Blick auf den Versuch, es so gut es geht zu machen, und gleichzeitig trotzdem manchmal zu scheitern. Ich sehe dich in deinem Bemühen, es anders und besser zu machen. Und ich sehe dich auch in den Momenten, in denen du an allem und am meisten an dir selbst zweifelst. Dieses Buch soll dir zeigen, wie du deiner Verantwortung als Eltern, als Pflegeeltern, als Adoptiveltern gerecht werden kannst, und es soll dich gleichzeitig an die Hand nehmen und trösten, wenn es nicht so läuft wie geplant. Dieses Buch ist Werkzeugkasten und warme Umarmung in einem.
Ich hätte jemanden gebraucht, der:die mir die Erlaubnis gibt, Fehler zu machen. Die Zeit zurückdrehen kann ich nicht, aber mit meinem heutigen Wissen kann ich dir zeigen, warum es für die gesunde Entwicklung deines Kindes sogar wichtig ist, dass du Fehler begehst.
Falls du es als pädagogische Fachkraft liest, dann wisse bitte, dass ich auch viel an dich beim Schreiben gedacht habe und dass du genauso viel mitnehmen kannst, auch wenn es in erster Linie für Eltern, Pflege- und Adoptiveltern geschrieben ist.
Nervenstark verbunden, so heißt dieses Buch. Und ich werde dir zeigen, wie der Zustand unseres Nervensystems darüber entscheidet, ob wir uns verbunden fühlen können oder nicht. Das Wissen darüber ist mehr als reine Theorie – es ist die Basis für unser Miteinander. Wenn wir verstehen, wie Regulation funktioniert, können wir Verbundenheit nicht nur spüren, sondern aktiv gestalten. Und du wirst – wahrscheinlich – merken: Wenn du die Nervensystembrille einmal aufgesetzt hast, wird es schwierig, sie wieder abzusetzen. Sie verändert deinen Blick auf die Welt.
In diesem Buch erfährst du, was Regulation wirklich ist, wie Co-Regulation funktioniert – und warum sie der manchmal magische Schlüssel zu einem entspannteren Familienalltag ist. Du lernst das Nervensystem kennen, die Stressampel und bekommst konkrete Übungen, Bilder und Werkzeuge an die Hand, um mit deinem Kind immer wieder in Verbindung zu kommen – und dabei gleichzeitig auch dir selbst eine gute Begleitung zu sein.
Wie du dieses Buch lesen kannst
Dieses Buch kannst du auf unterschiedliche Arten und Weisen lesen. Ein paar Dinge sind mir dabei wichtig: erstens, dass es dir beim Lesen gut geht, und zweitens, dass du möglichst viel an Wissen direkt in deinen Alltag einbringen kannst, damit du schnell Entlastung erfährst. Ich habe daher ein paar Symbole für dich eingebaut, die an manchen Stellen auftauchen und dir ein bisschen helfen können.
HIER UND JETZT: PAUSE? Da dieses Buch eine Menge über die Funktionsweise des Nervensystems erklärt und wir sowohl die Theorie als auch viele Beispiele durchgehen werden, kann es sein, dass dein eigenes Nervensystem darauf reagiert. Eventuell berührt das Gelesene einen Teil deiner Vergangenheit, und dein Körper antwortet darauf im Hier und Jetzt. Das passiert unter Umständen selbst dann, wenn du kognitiv gar keinen Zusammenhang zu deiner eigenen Geschichte ausmachen kannst. Manchmal bringt das unangenehme Empfindungen mit sich. Achte daher bitte während des Lesens gut auf dich. Wenn du bemerkst, dass dir bestimmte Kapitel nicht leichtfallen, dann überspring sie vielleicht erst einmal oder lese sie in kleinen Häppchen von maximal zehn Minuten am Stück. Danach mache etwas, das dir guttut, oder wende eine Soforthilfe-Maßnahme zur Regulation an, die ich dir an heiklen Stellen immer wieder beschreiben werde.
REFLEXION: AHA-MOMENTE! Besorge dir für das Lesen dieses Buches ein kleines Heft oder Buch, in das du deine Notizen schreiben kannst. So vertieft sich das Gelesene viel besser und du kannst später deine Erkenntnisse nachlesen. Natürlich darfst du auch in dieses Buch direkt reinschreiben. Was hat dich in diesem Kapitel bewegt? Was hast du mitgenommen? Was waren deine AHA-Momente? Notiere deine Gedanken und die Verbindungen zu deinem Alltag.
NERDBOX Die Nerdboxen liefern tiefergehendes Nervensystemwissen. Durch die Kennzeichnung findest du komplexere Begriffe und Zusammenhänge schnell wieder.
SOFORTHILFE-BOX Für manche Situationen gibt es ganz konkrete Strategien, die du ausprobieren kannst. Bedenke dabei, dass jede Familie anders ist und andere Dinge braucht. Suche dir heraus, was für dich und deine Familie passt. Auf jeden Fall kann dich meine Soforthilfe-Box zu einem anderen Blickwinkel inspirieren.
Am meisten nimmst du wahrscheinlich aus dem Buch mit, wenn du zunächst vorne anfängst und dir das Wissen über Regulation und die Funktionsweise des Nervensystems aneignest. Die Details sind in viele, alltagstaugliche Beispiele integriert, sodass du sie gut verinnerlichen kannst. Viele Begriffe und Prozesse findest du in den Nerdboxen erklärt. Im dritten Kapitel, in dem wir uns unser Verhalten durch die Nervensystembrille anschauen, kannst du nach der Einleitung einfach in jenes Kapitel springen, das dich gerade beschäftigt.
Gib dir Zeit, die Themen ankommen zu lassen. Wenn du alles ohne Pause hintereinanderweg liest, kann es sein, dass du zwar kognitiv vieles für dich mitnimmst, jedoch den besten Part verpasst. Unser Nervensystem liest nämlich grundsätzlich mit, braucht jedoch etwas Zeit, um Gelesenes mit alten Erfahrungen zu verknüpfen, Gedankengänge anzuregen und im Endeffekt tiefgreifende Veränderung zu initiieren. Es lohnt sich also, am Ende eines Kapitels oder an dich bewegenden Stellen kurz innezuhalten und sowohl kognitiv zu reflektieren, was du aus dem jeweiligen Abschnitt mitgenommen hast, als auch deinem Körper die Zeit zu geben, das Gelernte zu verarbeiten.
Weniger Kochrezepte – mehr Selbstermächtigung
Du wirst in diesem Buch vergeblich nach Anleitungen wie »Mache diese drei Dinge, und danach ist alles super« suchen. Wenn du dir klarmachst, wie unterschiedlich wir alle sind, wie verschieden unsere Geschichten, unsere Erfahrungen, Ressourcen und, ja, auch unsere Genetik, dann ist genauso klar, dass allgemeine Rezepte gar nicht funktionieren können. Das, was meinen Kindern guttut, prallt von deinen möglicherweise völlig wirkungslos ab. Was in der Praxis mit dem einen Klienten funktioniert, kann in der nächsten Stunde bei einer anderen Klientin scheitern.
Entsprechend wirst du sehr oft Formulierungen lesen wie »eventuell könnte xyz hilfreich sein, aber vielleicht auch nicht«. Das Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems lehrt uns viele generelle Zusammenhänge in unserem Körper und somit auch viel über unsere Mitmenschen und natürlich über unsere Kinder. Doch wir werden nie genau wissen, ob wir das, was wir beobachten, richtig interpretieren und ob die Schlussfolgerungen, die wir ziehen, den gewünschten Effekt erzielen. Wir können mit dem Wissen und viel Erfahrung unsere Trefferquote erhöhen, doch wir dürfen uns nicht anmaßen, so zu tun, als wüssten wir, was in einer anderen Person vor sich geht. So schön das manchmal wäre.
Mit diesem Buch geht es mir also darum, dich zu ermächtigen, dir mehr und mehr selbst die Antworten auf deine Fragen geben zu können. Ich möchte, dass du deinen Blick schulst und schließlich selbst in der Lage bist, dein Kind besser zu verstehen und selbstbewusste Entscheidungen zu treffen.
Dieses Buch ersetzt keine therapeutische oder professionelle Begleitung oder Beratung. Wenn du merkst, dass du oder dein Kind an Grenzen stoßt, die ihr nicht allein handhaben könnt, dann sucht euch bitte fachkundige Unterstützung. Eventuell kannst du durch dieses Buch besser erkennen, wann es Zeit für professionelle Unterstützung ist, und vielleicht kann an der ein oder anderen Stelle Therapie sogar verhindert werden, weil deine Sicht durch die Nervensystembrille dir die passenden Impulse gegeben hat, um eure Situation ausreichend zu verbessern. Das wünsche ich mir.
Schlaf. Ein. JETZT! Warum’s nie klappt, wenn’s muss
Über Regulation, Selbstregulation, Co-Regulation und Selbstkontrolle
Wenn du Elternteil bist, kennst du aus der Babyzeit wahrscheinlich die folgende Situation in ähnlicher Variante:
Du musst ein wichtiges Telefonat führen und hast den Termin so organisiert, dass dein Baby zum verabredeten Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit schläft. Bereits am Vortag achtest du darauf, dass es seinen Mittagsschlaf nicht zu spät beginnt oder zu lange schlummert, damit es abends zur gewohnten Zeit müde und der kommende Vormittag dadurch planbarer wird. Je näher dein Termin am nächsten Tag rückt, desto mehr spürst du deine Anspannung, da dir das Telefonat wirklich wichtig ist. du hoffst, dass alles gut klappt, und spielst ausgiebig mit deinem Baby, damit es sicher müde ist und tief und fest schläft, während du telefonierst. du planst extra genug Zeit ein, fängst rechtzeitig mit eurer Routine an, gibst deinem Baby etwas zu trinken und legst dich neben ihm ins Bett. Obwohl du den Druck spürst, dass das jetzt unbedingt klappen muss, atmest du bewusst langsam und schließt deine Augen, damit dein Baby denkt, dass du dich ebenfalls ausruhst. »Sch-sch-schttt, wir schlafen jetzt beide. Ich bin genauso müüüde wie du – gähn.«
Nach außen scheint es, als würdest du wirklich gleich einschlafen. Dein Baby spürt jedoch, dass dein Nervensystem etwas ganz anderes als »müde« und »ich schlafe gleich« erzählt. Neben der Erschöpfung, die ja in Zeiten mit kleinen Kindern häufig ein Dauerzustand ist, nimmt dein Baby die Spannung wahr, die in dir herrscht. Es merkt, dass deine Atmung nicht natürlich fließt, sondern kontrolliert geht, und dass dein ganzer Körper »unter Strom« steht. Es hört, dass deine Stimme leicht gepresst und erzwungen ruhig klingt, und es kann fühlen, dass in der Sanftheit deiner Berührungen eine gewisse Bestimmtheit mitfließt. Vielleicht riecht es sogar den leicht veränderten Geruch deines kaum wahrnehmbaren Schweißes.
All diese Signale sind Teile der Sprache unseres Nervensystems, die wir nicht bewusst verändern können. In diese Sprache werden wir später tiefer eintauchen, um sie besser zu verstehen. Was hier jedoch geschieht, ist, dass dein Baby die Signale deines Nervensystems registriert und darauf reagiert. Sie sagen ihm: »Achtung, wir befinden uns in einer angespannten Situation! Alarm!« Kein Wunder, dass dein Baby unruhiger wird. Eventuell fängt es sogar an zu weinen und strampelt mit Armen und Füßen.
Du wirst nun deinerseits immer unsicherer und nervöser und schielst auf deine Uhr. Nur noch zehn Minuten bis zu deinem Telefonat! Mist, Mist, Mist! dein Stresslevel steigt und steigt. Dein Atem, dein Körpergeruch, deine Muskeln, deine Berührungen, deine Stimme transportieren diese Extra-Portionen Angespanntheit sofort – und dein Baby merkt das und reagiert wiederum darauf. Zwischen euch beiden ist ein Stress-Loop entstanden, ihr schaukelt euch quasi gegenseitig hoch. Gut möglich, dass in der nächsten Sekunde das Telefon klingelt und du mit deinem schreienden Baby auf dem Arm rangehen und dich für heute entschuldigen musst …
Oder es geschieht Folgendes – vielleicht: Irgendwann gibst du dich der Situation hin und fährst in deiner Erschöpfung runter, du lässt das Telefonat los, dein Atem beruhigt sich und geht tiefer, dein Puls wird langsamer und … du schläfst ein. Und dein Baby mit dir.
Dein Nervensystem ist in einen anderen Zustand gewechselt, und mit seinem aufmerksamen Nervensystem hat dein Baby das registriert. Deine Muskeln sind weicher geworden, deine Atmung tiefer und regelmäßiger, dein Herzschlag ruhiger. Dein gesamter Körper vermittelt deinem Baby: »Jetzt ist es sicher genug, dass ich mich meiner Müdigkeit hingeben und einschlafen kann.« Und weil du dich nun offensichtlich gefahrlos genug zum Schlafen fühlst, entspannt sich auch dein Baby. Das ist Co-Regulation. Darüber werden wir später noch ausführlicher sprechen. Ebenso über die Notwendigkeit, sich sicher (genug) zu fühlen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt in diesem Buch!
Tja, leider ist das Telefonat auch bei dieser Variante inzwischen verstrichen, aber zumindest hast du neben deinem Baby geschlafen und konntest dich ein wenig ausruhen. Yeah (mit leichter Ironie).
Ich selbst kenne diese Situationen übrigens zur Genüge. Es muss nicht unbedingt das wichtige Telefonat sein, das sie auslöst, oder andere essenzielle Termine. Manchmal reicht »einfach nur« der Wunsch zu duschen, in Ruhe etwas erledigen zu wollen oder der Haushalt, der nach Aufmerksamkeit verlangt und uns deshalb unter Druck setzt, dass das Baby heute unbedingt zur gewohnten Zeit einschlafen muss. Das Halten oder manchmal auch Aushalten dieser Gleichzeitigkeit von Frustration und der dann entstandenen »Erholung« ist eine große Herausforderung für mich in meinem Mamasein von kleinen Kindern gewesen und ist – glaube ich – kaum zu vermeiden. Wenn du aber erst mal die Mechanismen dahinter verstehst, fällt es dir vielleicht leichter, damit umzugehen.
Was du in diesem Beispiel auf jeden Fall gut sehen kannst, ist der Unterschied zwischen Selbstkontrolle und Selbstregulation. Nach außen sieht beides manchmal ganz ähnlich aus, doch es handelt sich um zwei sehr unterschiedliche Vorgänge in unserem Nervensystem. Später beschreibe ich ausführlich den Unterschied und erkläre dir außerdem, wie die sogenannte Co-Regulation funktioniert.
Wir werden in diesem Buch viel über Selbstregulation sprechen und weniger über Selbstkontrolle. Denn ein großer Baustein von nervenstarker Verbindung ist das Prinzip:
»Eine gute Selbstregulation der Bezugsperson ermöglicht über Co-Regulation die Selbstregulation des Kindes.«
Ich habe diesen Grundsatz meiner Arbeit als Therapeutin entnommen, aber du kannst ihn 1:1 auf den Umgang mit Kindern außerhalb der Therapiepraxis übertragen. Egal, ob es sich um deine eigenen handelt oder welche, für die du in einer Kita, Schule oder an einem anderen Ort Verantwortung übernimmst.
Meine eigene Selbstregulationsfähigkeit als Therapeutin hat einen großen Einfluss auf den Therapieerfolg, da hier durch Co-Regulation viel nachgenährt1 werden und Selbstregulationsfähigkeit entstehen kann. Alle Interventionen, die ich in der Therapiestunde anbiete, erzielen eine viel bessere Wirkung, wenn ich mich gut selbst reguliere. Das Stichwort lautet: »Regulation vor Lernen!«2
Ein weiterer Aspekt, der hier wichtig wird, ist der Zusammenhang zwischen dem Gefühl von Sicherheit und der Selbstregulation. Auf diesen essenziellen Punkt werde ich später immer wieder eingehen.
Lass uns jetzt noch ein bisschen tiefer in das Thema (Co-)Regulation eintauchen.
Was ist Regulation?
Körperliche Regulation
Der Begriff Regulation wird im pädagogischen Alltag und auch in aktueller Literatur häufig mit Verhalten bewusst steuern oder sich beruhigen gleichgesetzt.1 Im neurobiologischen Sinne meint er jedoch die Fähigkeit des autonomen Nervensystems, innere Zustände selbstständig in Balance zu bringen.
Ganz allgemein versteht man im neurobiologischen Sinne unter Regulation das Zusammenspiel von Prozessen, die ein bestimmtes System im Gleichgewicht halten. Auf unser menschliches Nervensystem bezogen umfasst der Begriff also die autonomen Prozesse in unserem Körper, die unser Überleben sichern und »den Laden am Laufen halten«, indem sie bestimmte Körperfunktionen, aber auch unsere Emotionen steuern.
Bei der Regulation physiologischer Prozesse unseres autonomen Nervensystems werden körperliche, lebenswichtige Funktionen im Gleichgewicht gehalten. Dazu gehört der Herzschlag, die Atmung, die Körpertemperatur, das Herz-Kreislauf-System und die Verdauung (wobei es bei Babys gerade bei der Verdauung ja manchmal noch zu Schwierigkeiten kommen kann und es etwas Zeit braucht, bis diese sich eingespielt hat). Diese physiologischen Prozesse kannst du dir wie eine Menge größerer und kleinerer Zahnräder vorstellen, die alle miteinander verbunden sind und möglichst »rund« laufen sollen, damit alles für das Leben Notwendige gut funktioniert und stets genügend Ressourcen vorhanden sind, damit wir alle kommenden Situationen überstehen.
Viele Komponenten davon regelt unser Nervensystem bereits von Geburt an selbst – wie zum Beispiel die Herzfrequenz, Atmung und zu großen Teilen die Verdauung. Anderes – wie beispielsweise die Regulation der Körpertemperatur – müssen Neugeborene erst erlernen. Um weder zu überhitzen noch zu unterkühlen, sind sie auf die Fürsorge von erwachsenen Bezugspersonen angewiesen. Sie sorgen dafür, dass das Baby warm genug angezogen ist, die Bettdecke oder der Schlafsack über ihm liegt oder eben auch nicht, falls es zu warm ist.
Ebenso fehlt Neugeborenen ein eigener Schlaf-Wach-Rhythmus, und sie benötigen erwachsene Unterstützung, um ihn zu entwickeln. Wie wir noch sehen werden, geht es dabei nicht einfach darum, ein bestimmtes Verhalten zu lernen, sondern darum, dafür zu sorgen, dass sich im Gehirn neuronale Pfade bilden, die zu einem möglichst gesunden Schlafrhythmus führen. Dazu können sich wiederholende Schlafroutinen, sanfte Beruhigungsmethoden und eine Schlafumgebung gehören, die gewährleisten, dass das Baby sich sicher genug fühlt, damit es »loslassen« kann (erinnere dich an unser Beispiel mit dem wichtigen Telefonat: Nur wenn sich dein Kind sicher genug fühlt und spürt, dass keine Gefahr droht, sind die inneren Bedingungen für das Einschlafen gegeben)3.
Emotionale Regulation
Neben den physiologischen Prozessen unseres Nervensystems müssen auch unsere Gefühle im Gleichgewicht gehalten werden. Bei dieser Emotionsregulation geht es darum, uns in die Lage zu versetzen, uns aus einem Zustand großer Aufruhr (im Fachjargon sagen wir dazu »Aktivierung«) wieder auf ein normales Level »runterzufahren«. Wir regen uns auf, wir regen uns auch wieder ab. Wir haben Angst, und die geht auch wieder weg. Wir freuen uns, und auch diese Freude wird irgendwann abebben. Nach dem Hoch geht es irgendwann wieder runter. Regulation bezeichnet den neuronalen Prozess, der uns von einem Zustand der Aufgeregtheit oder des Stresses zurück in einen Zustand von Ruhe und Sicherheit bringt. Das ist etwas, das zum Leben dazugehört.
Ich betone das, weil ein weiterer, weitverbreiteter Irrglaube »reguliert« sein mit »nie gestresst/wütend/aufgewühlt/traurig/etc.« sein gleichsetzt. Das ist falsch, denn die Regulationsfähigkeit beschreibt den Vorgang, der uns von einem aktivierten Zustand zurück in einen Zustand von Ruhe und Sicherheit bringt. Es geht um die Bewegungsfähigkeit zwischen diesen verschiedenen Zuständen, unsere sogenannte Schwingungsfähigkeit.Daher können wir uns auch nicht bewusst regulieren. Wir können nicht sagen: »Jetzt entspann dich mal«, und dann gehen automatisch Puls, Blutdruck etc. runter, und wir werden ruhig. Das Nervensystem braucht die richtigen Signale, damit es autonom runterfahren kann.
Wie gesagt: Das Auf und Ab gehört – nicht nur in der Emotionsregulation – zum Leben dazu.
Regulation bei Babys
Wenn Menschen auf die Welt kommen, dann können sie sich zum großen Teil noch nicht selbst regulieren. Als Beispiel haben wir uns das Halten einer gleichbleibenden Körpertemperatur oder den Schlaf-Wach-Rhythmus angeschaut. Aber auch ihre Emotionen können Neugeborene noch nicht selbst regulieren.
Das Baby hat noch sehr wenige Möglichkeiten, sich differenziert auszudrücken. Wenn es also Hunger hat, müde ist, ihm zu warm oder zu kalt ist oder die Windel überquillt, gerät es in einen Zustand von Unbehagen, der dazu führt, dass die inneren Vorhersagen im Gehirn des Babys für die Zukunft des Babys eher düster ausfallen. Das klingt vielleicht übertrieben, doch bedenke, dass ein Baby viele dieser Unannehmlichkeiten noch nicht kennt und deshalb nicht einschätzen kann, welche Konsequenzen ihm möglicherweise drohen. Es denkt, bzw. ist es besser zu sagen, es fühlt: »Wenn ich nicht sofort etwas zu essen bekomme, wenn dieser Zustand nicht sofort beendet wird, dann werde ich sterben«4.
Das Baby fühlt sich, als wäre sein Leben ernsthaft in Gefahr. Beachte hier die Wortwahl, sie ist ganz wichtig: Ich sage nicht, dass das Leben des Babys in Gefahr ist. Aber es fühlt sich ernsthaft bedroht. Das hat etwas mit unserer inneren, unbewussten Wahrnehmung – der Neurozeption5 – zu tun, auf die ich später eingehen werde.
Das Baby registriert etwas Unangenehmes. In enger Zusammenarbeit werten Gehirn und Nervensystem die körperlichen Empfindungen und die vielen anderen Informationen sowie vergangene Erfahrungen aus. Gab es so etwas schon einmal? Wie ist das ausgegangen? Da das Baby noch nicht so viele positive Erfahrungen gemacht hat, dass dieses Gefühl keine Lebensgefahr bedeutet, wird die innerliche Vorhersage »eher gefährlich« getroffen. Sein innerer Alarm springt aufgrund fehlender Nuancen sofort auf Dunkelgelb und versetzt seinen Körper in einen Zustand, der diesem Alarm ein entsprechendes Verhalten ermöglicht: Das Baby fängt an zu schreien, um auf die für sich selbst als fast lebensbedrohlich empfundene Situation aufmerksam zu machen, damit jemand etwas daran ändert und das Baby rettet.
Was wir Erwachsenen dem Baby voraushaben: Wir besitzen Lebenserfahrung und haben bereits über mehrere Jahrzehnte Vertrauen in die Zukunft aufbauen können. Unser Gehirn kann also auf viele gute Erfahrungen zurückgreifen, dass uns Hunger nicht sofort sterben lässt und dass auch unser Baby in der Regel nicht gleich verhungert, wenn die Nahrungszufuhr sich ausnahmsweise verzögert oder wir ein Weilchen brauchen, um erst mal herauszufinden, wo überhaupt das Problem liegt. Auf Basis anderer Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, trifft unser Gehirn also eine andere Vorhersage als das unseres Babys.
Obwohl wir also davon ausgehen dürfen, dass unser Baby mit großer Wahrscheinlichkeit überleben wird, wenn es im Alltag schreit, reagiert unser inneres Alarmsystem dennoch. Wir alle kennen das: Das Geschrei stresst uns, und je länger es anhält, desto hektischer werden wir. Wir geraten in einen körperlichen Zustand, der uns darauf fokussiert, das Gebrüll zu beenden. Unser Nervensystem treibt uns ins Handeln, um uns um das Baby zu kümmern. Und das ist ja auch gut so.
Doch wir haben einen großen Vorteil: Unser innerer Alarm springt eben nicht auf Dunkelgelb – hohe Gefahr –, sondern eher auf Gelb – Gefahr –, und damit kommen wir in einen körperlichen Zustand, der uns dabei unterstützt, aktiv zu werden, alles andere in diesem Augenblick »Unwichtige« links liegen zu lassen, uns dem Baby zuzuwenden, wachsam zu sein und genau hinzuhören, ob das Baby Hunger hat, eine frische Windel braucht oder die Temperatur nicht stimmt.
Der große Unterschied zwischen uns und dem Neugeborenen liegt also in der unterschiedlichen Vorhersage über die Zukunft, der daraus resultierenden unterschiedlichen inneren Alarmhöhe6 und unserem damit verbundenen Körperzustand – unserer Physiologie. Das Baby fühlt sich ernsthaft in Gefahr (Stressampel auf Dunkelgelb). Wir geraten zwar in Stress, bewegen uns aber allenfalls auf einem Niveau von Handlungsbedarf (Stressampel Gelb).
Wenn das Baby nun bemerkt, dass wir uns ihm zuwenden, mit beruhigender Stimme mit ihm sprechen und Sätze sagen wie: »Mensch, da schreist du ja ganz schön, was ist denn da los bei dir? Hast du Hunger? Ist dir zu warm? Brauchst du eine neue Windel? Lass mal schauen, ich bin auf jeden Fall da, du bist nicht allein«, dann sind es nicht nur die konkreten Worte, die bei ihm ankommen, sondern vor allem unsere Stimme, unsere Mimik, unsere Stimmmelodie, die Lautstärke, unsere Sanftheit, unser Körpergeruch, unsere Bewegungen und Berührungen. All das vermittelt dem Baby: »Hey, du wirst nicht sterben, ich bin da. Das, was du erlebst, ist schlimm, aber nicht so schlimm, wie es sich für dich anfühlt. Das können wir lösen, und du wirst es überleben. Ich bin da.« Wir bestätigen damit das Erleben des Kindes, ordnen es jedoch gleichzeitig ein, sodass beim Baby eine Feinjustierung und Differenzierung stattfinden und es in Zukunft andere Vorhersagen treffen kann, wenn dieses Gefühl erneut auftaucht.
Das Baby-Nervensystem reagiert darauf, der innere Alarm fährt runter, und somit verändert sich auch der körperliche Zustand. Das Baby wird ruhiger und muss nicht mehr so intensiv schreien (Stressampel Gelb). Dadurch sinkt unser eigener innerer Alarm, und wir werden ebenfalls ruhiger (Stressampel Grün). Das wiederum bemerkt das Baby-Nervensystem7, das noch weiter »runterfahren« kann (Stressampel Grün), und so regulieren sich unsere beiden Nervensysteme gegenseitig. Das nennt man Co-Regulation (sie ist also das genaue Gegenteil vom Stress-Loop8 aus unserem Telefonat-Beispiel).
Das Baby-Nervensystem hat bis dahin noch keine bzw. nur wenige Erfahrungen abgespeichert, die ihm in der Bewertung aktueller Situationen eine gute Prognose geben könnten, dass es das furchtbare Gefühl höchstwahrscheinlich überleben wird. Durch unser Dasein und unseren eigenen, im günstigsten Fall regulierten Körperzustand werden genau diese Erfahrungen in das Gehirn-Netzwerk des Babys eingespeist und gestärkt. Fire and wire – feuern und verbinden – lautet die Devise. Das heißt: Je häufiger ein neuronaler Pfad im Netzwerk des Gehirns genutzt wird, desto stabiler wird er. Durch Co-Regulation werden im Baby-Nervensystem neuronale Pfade für die Stressregulation angelegt und gestärkt. Je mehr Co-Regulation ein Baby bzw. Kind also erfährt, desto besser entwickeln sich in der Regel seine neuronalen Stress-Regulations-Pfade, sodass es später immer mehr in der Lage sein wird, sich selbst zu regulieren. Die Fähigkeit zur Selbstregulation entwickelt sich schrittweise ab dem Kleinkindalter und ist ein lebenslanger Lernprozess.
Zusammengefasst: Das neugeborene Baby kann von Anfang an wahrnehmen, ob sich etwas sicher oder gefährlich anfühlt. Da es auf diesem Gebiet noch keine großen Lebenserfahrungen sammeln konnte, fehlen ihm allerdings die Nuancen für eine differenzierte Einschätzung, sodass es Situationen häufig als gefährlich – sogar lebensgefährlich – wahrnimmt, die für uns erwachsene Begleitpersonen ganz eindeutig nicht bedrohlich sind. Das bedeutet, dass der innere Alarm des Babys oft sehr viel schneller und deutlich höher anspringt als der innere Alarm von uns Erwachsenen.
Die für dieses Rauf und Runter der Emotionsregulation benötigten neuronalen Pfade sind beim Baby noch nicht gut genug entwickelt, sodass es sich noch nicht selbst beruhigen kann. Es bleibt also im aktivierten Zustand stecken und versucht, auf sich aufmerksam zu machen, damit jemand kommt und die »Gefahr« beseitigt.
Es verfügt zwar über einige grundlegende Fähigkeiten zur Selbstberuhigung, wie zum Beispiel das Saugen und Nuckeln am Daumen, einem Tuch, einer Brust oder einem Schnuller, die frühe Formen der Selbstregulation und Selbstberuhigung darstellen, doch zur Besänftigung von hohen Wellen reicht das nicht.
Später – so ab dem 6. bis 9. Lebensmonat – kommt das rhythmische sich Hin- und Herwiegen als weitere Möglichkeit der Selbstberuhigung hinzu.2 Dazu benötigt das Baby jedoch eine gewisse motorische Kontrolle über seine Bewegungen.
Ich kann mich noch sehr gut an die vielen Stunden erinnern, in denen ich meine Babys im Tuch vor mir her getragen habe, kontinuierlich in Schaukelbewegung, damit sie sich beruhigen. Und wehe, ich habe es gewagt, sie für den Gang auf die Toilette abzulegen oder auf der Toilette – bzw. besser: über der Toilette hockend – still zu halten. Alles für eine gute Co-Regulation, yeah!
Heute bin ich dankbar für jede Co-Regulation, die ich geben konnte, da ich sehe, wie daraus Selbstregulation bei meinen Kindern entstanden ist. Gleichzeitig bin ich milde mit mir selbst, wenn ich an die Momente denke, in denen ich es nicht geschafft habe und meine Babys eine Minute habe schreien lassen, weil ich diesen kleinen Augenblick allein auf dem Klo einfach brauchte. Es kommt nicht auf einzelne kleine Momente an, sondern auf die Gesamtheit. Und es reicht ein gut genug.
Diese frühen Erfahrungen prägen nicht nur die Fähigkeit zur Selbstregulation, sondern auch das Vertrauen in Beziehungen und das Erleben von Sicherheit – wichtige Grundlagen für Resilienz und psychische Gesundheit im späteren Leben.
Damit kommen wir zu dem Thema, worum es mir mit diesem Buch zuvorderst geht: Co-Regulation.
Wenn eine starke Emotion entsteht, aktiviert unser Gehirn blitzschnell eine Vielzahl vernetzter Bereiche, darunter solche, die auf Körpersignale, gespeicherte Erfahrungen und mögliche Gefahren reagieren. Dabei geht es nicht um ein einzelnes Zentrum, sondern um ein Zusammenspiel aus Wahrnehmung, Bewertung und Vorhersagen – je nachdem, was das Nervensystem in der jeweiligen Situation für notwendig hält.
Bei Babys reagiert dieses System besonders schnell und heftig auf Stressreize, weil sie noch keine differenzierten Erfahrungen mit der Welt gemacht haben. Sie können Situationen noch nicht zuverlässig einschätzen, daher werden viele Reize als potenziell lebensbedrohlich erlebt.
Für die gesunde Entwicklung der Selbstregulation ist es entscheidend, dass Babys in solchen Zuständen nicht zu lange allein bleiben, da sie sonst Erfahrungsmuster abspeichern, die die Welt grundsätzlich als einen eher gefährlichen Ort bewerten. Das kann dazu führen, dass später ein Großteil des Erlebens viel eher als bedrohlich interpretiert wird, als es sein müsste. Durch unsere feinfühlige und schnelle Reaktion (Co-Regulation) erlebt das Baby hingegen: »Ich bin nicht allein, es ist Hilfe da – ich bin sicher.« Sein Stresssystem fährt herunter, und wir ebnen die neuronalen Pfade für die spätere Selbstregulationsfähigkeit.
Je öfter sich diese Erfahrung wiederholt, umso stärker werden im kindlichen Gehirn die neuronalen Netzwerke, die langfristig eine bessere Integration zwischen emotionalen Empfindungssystemen und regulierenden Strukturen wie dem präfrontalen Kortex ermöglichen. Co-Regulation ist damit die Basis für die spätere Fähigkeit zur Selbstregulation.
Co-Regulation
Co-Regulation braucht Verbindung
Damit das Baby-Nervensystem neuronale Pfade entwickeln kann, die die Regulation von Emotionen ermöglichen, braucht es genügend Co-Regulation durch andere (erwachsene) Bezugspersonen. Denn »Kinder, die keine Co-Regulation erfahren, lernen nicht, sich selbst zu regulieren.«3Wir nehmen mit unserem erfahreneren Nervensystem das Baby-Nervensystem an die Hand, wir leihen quasi unser Nervensystem aus,4 damit das Baby-Nervensystem auf neuronaler Ebene lernt, wie es vom inneren Alarm in den Zustand der Ruhe zurückkehren kann. Dadurch, dass wir diese Fähigkeiten bestenfalls selbst gut genug erworben haben, können wir gemeinsam mit dem Baby immer wieder co-regulieren. So werden die neuronalen Pfade des Baby-Nervensystems stabiler und stabiler. Dabei ist Co-Regulation nichts, das wir aktiv anwenden können, sondern etwas, das geschieht, während wir mit unserem Baby interagieren. Genau das konnten wir in dem obigen Beispiel sehen beim Versuch, das Kind vom Schlafen zu überzeugen: Das Nervensystem des Babys reagierte nicht auf den erwachsenen Willen (nach der Größe meines Willens zu urteilen, hätte ich in solchen Situationen ganze Stadien in den Schlaf bringen können), sondern hauptsächlich auf die Körpersprache der erwachsenen Bezugsperson. Unser Wille und unser körperlicher Zustand können manchmal sehr entgegengesetzt sein – mega frustrierend und nicht selten verbunden mit dem Gefühl von Hilflosigkeit.
Doch wir haben ja gerade angefangen, die Welt des Nervensystems zu erkunden, und werden Stück für Stück weiter herausfinden, wie sich das Wissen um seine Funktionsweise nutzen lässt, um unseren körperlichen Zustand zu beeinflussen.
Hilfreich ist es natürlich, wenn wir als erwachsene Bezugspersonen über eigene, gute Selbstregulationsfähigkeiten verfügen. Denn dann fällt es uns leichter, uns in das Baby einzufühlen und herauszufinden, was der Beweggrund für sein Weinen oder Schreien ist. Wir sind in der Lage, es in seiner Not zu sehen und zu versorgen.
Bei genügend Co-Regulation festigen sich die neuronalen Pfade des Baby-Nervensystems mit der Zeit immer mehr – wie ein neuer Weg in einem Dschungel, der erst schmal und lediglich als Spur durchs Dickicht führt, der jedoch immer mehr wächst, je häufiger man ihn geht, bis er vom Trampelpfad nach vielen, vielen Nutzungen zu einem gut ausgetretenen und leicht zugänglichen Weg geworden ist, den man selbst dann noch automatisch nutzt, wenn es stressig wird.
Sind die neuronalen Pfade des Kinder-Nervensystems stabil genug, kann das Kind sich in leicht aufregenden Situationen immer besser selbst regulieren und die durch die Co-Regulation gestärkten neuronalen Pfade mehr und mehr nutzen. Genau das bedeutet aber gleichzeitig, dass dein Baby und später Kleinkind sich lange Zeit noch nicht selbst regulieren kann und auf deine Co-Regulation angewiesen ist. Das ist wichtig zu verstehen, denn nur so wird uns klar: Selbst wenn wir manchmal alle uns denkbaren Optionen durchgegangen sind, alles versucht haben, um das Kind zu beruhigen, und an die Grenzen unserer eigenen Regulationsfähigkeit stoßen: Das Kind macht das nicht mit Absicht. Es will uns nicht ärgern.
Ich musste das manchmal laut zu mir selbst sagen, weil ich so verzweifelt war und nur noch die Möglichkeit in Betracht zog, dass mein Kind mich »verarschen« wolle. Dem war aber nicht so. Nie. Und auch dein Kind möchte dich nicht verarschen. Es ruft nach Hilfe, um aus seiner gefühlten Not herauszukommen. Es ergibt also keinen Sinn, von einem Kind zu fordern, dass es aufhört, solche starken Emotionen zu haben, und sein Verhalten auf Befehl verändert. Damit stärken wir nur die neuronalen Pfade der Selbstkontrolle, nicht jedoch die der Selbstregulation. Aber keine Angst: Wenn das mal geschieht und dir eine ungünstige Forderung (»Hör auf zu weinen!«) rausrutscht, okay, dann ist das nicht schön, doch auch kein Beinbruch. Es geht hier nicht um hundertprozentige Perfektion, sondern um die Grundfärbung des Miteinanders.
Die Grundlage für eine gute Selbstregulation ist also immer eine möglichst gute Co-Regulation.
Kinder können sich nicht einfach selbst beruhigen – das ist ein Lernprozess, der sich Schritt für Schritt entwickelt und im Gehirn verankert. Am Anfang brauchen sie dafür vor allem eins: uns Erwachsene. Wenn wir ruhig atmen, eine sanfte Stimme haben, unser Blick liebevoll ist oder wir einfach präsent bleiben, dann sendet unser Körper Signale von Sicherheit. Und genau diese Signale helfen dem Nervensystem unseres Kindes, sich auch wieder zu beruhigen.
Dieses Zusammenspiel nennt man Co-Regulation. Zwei (oder mehr) Menschen (oder Säugetiere) sind in Kontakt, achten (unbewusst) aufeinander und helfen sich gegenseitig, in einen guten Zustand zu gelangen. Vielleicht kennst du das von dir selbst: In der Nähe eines ruhigen, stabilen Menschen fällt es dir leichter, dich zu entspannen.
Wenn wir als Eltern innerlich halbwegs stabil sind – also in einem Zustand von Sicherheit, Präsenz und Verbindung –, kann sich unser Kind an uns »andocken«. Das Nervensystem spürt: »Ich bin nicht allein, ich bin sicher.« So entsteht echte Regulation – nicht durch Kontrolle oder »sich zusammenreißen«, sondern durch Beziehung in einem möglichst regulierten Zustand.
Die US-amerikanische Therapeutin Deb Dana sagt, dass Co-Regulation ein Bedürfnis ist, das »zwingend erfüllt werden muss, um das Leben zu erhalten«5.
Selbstregulation entsteht mit der Zeit und steht Kindern erst ab einem gewissen Alter zur Verfügung. Ob und wann ein Mensch sich selbst gut regulieren kann, hängt neben den individuellen neuronalen Gegebenheiten und der ganz natürlichen neuronalen Entwicklung stark von der Co-Regulation der erwachsenen Bezugspersonen ab. Und auch wir Erwachsenen regulieren uns nicht ausschließlich selbst. Im Gegenteil: Selbstregulation ist nie rein unabhängig. Besonders bei Stress oder emotionaler Erschöpfung brauchen auch wir Erwachsenen Co-Regulation, durch ein gutes Gespräch beispielsweise, eine liebevolle Berührung oder einfach durch das Dasein eines wohlwollenden Menschen.
Bei Kindern ist es dabei egal, ob es sich um die leibliche Mutter, den leiblichen Vater, Pflegeeltern, Adoptiveltern, Großeltern oder andere dem Kind nahe und zugewandte Menschen handelt. Es reicht eine nahe Person, die möglichst gut selbstreguliert ist und sich in das Baby/Kleinkind/Kind einfühlt, um ihm die notwendigen neuronalen Erfahrungen zu geben.
Wie wir Gefühle erleben und ausdrücken, ist dabei kein angeborenes Repertoire, das sich automatisch entfaltet und bei allen gleich ist. Die Emotionsforscherin Lisa Feldman Barrett zeigt in ihrer Theorie der konstruierten Emotionen, dass Gefühle auf der Basis von körperlichen Zuständen, Sprache, Beziehungserfahrungen und Bedeutungszuschreibungen entstehen. Das heißt: Babys und Kinder lernen im Kontakt mit uns nicht nur, was sie fühlen, sondern auch, wie sie damit umgehen.
Du kennst das vielleicht, wenn dein Kind hinfällt und es erst einmal zu dir schaut und auf deine Reaktion wartet. Reagierst du mit »O du meine Güte!«, dann übernimmt es diese Emotion und erschrickt ebenfalls. Oder du reagierst vielleicht gar nicht. Dann steht dein Kind eventuell auch einfach wieder auf und setzt sein Spiel fort. Unsere Reaktion ordnet das Erlebte für das Kind ein.9
Und auch diese eine Person muss nicht immer zu hundert Prozent gut reguliert sein. Das ist niemand. Es reicht gut genug. Es ist keine ununterbrochene Eingestimmtheit zwischen der erwachsenen Bezugsperson und dem Baby/Kind notwendig. Nach dem britischen Kinderarzt und -psychiater D. W. Winnicott genügt es, wenn wir uns in ca. einem Drittel der Zeit gut in das Baby/Kind einfühlen können!6 Ist das nicht entlastend?
Als ich das vor Jahren erfahren habe, löste sich tief in mir drin ein großer Seufzer und ein: »O wie gut, ich habe doch nicht alles verkackt!«
Wenn wir unser Baby in einer Situation nicht gut co-regulieren konnten, ist das nämlich kein Drama. Wir können diese Fehleingestimmtheit erkennen und reparieren. Die Fachsprache nennt das Rupture & Repair.
Verbindung unterbrochen? Rupture & Repair
In Situationen, in denen ich mit anderen Dingen belastet und völlig am Limit war, habe ich mich manchmal richtig doof gegenüber meinen Kindern verhalten und sie mit meinem Frust beballert. Oft waren sie einfach die Einzigen, die da waren. Und sie hatten keine Chance, mir Grenzen zu setzen. Das war bescheuert – und ist trotzdem geschehen. Dank der vielen Begleitung durch Therapie und der therapeutischen Ausbildungen samt Peerkolleginnen und Freund:innen ist es mir aber zumindest (fast) immer gelungen, nach der verbalen Verletzung und dem kurzzeitigen Gestörtsein unserer Verbindung auf meine Kinder zuzugehen, mich für mein Verhalten zu entschuldigen und ihnen zu sagen, dass es nicht ihre Schuld war.
»Es liegt in meiner Verantwortung, und ich sorge dafür, dass das (hoffentlich) nicht wieder geschieht. Ich habe morgen eine Therapiestunde und telefoniere gleich mit einer Freundin, und dann sorge ich dafür, dass es mir wieder besser geht. Ich hoffe, dass ihr meine Entschuldigung annehmen könnt.« Zum Glück taten sie es immer.
Dann ging es ans »Reparieren«, indem ich mir angehört habe, wie es ihnen in der Situation ging und was sie brauchten, um sich wieder besser zu fühlen. Das waren teilweise Umarmungen, manchmal aber auch einfach das Anerkennen und Erzählen-Lassen, wie sie mein Verhalten geschmerzt hat und wie ungerecht sie es fanden. Manchmal hat es auch ein bisschen gedauert, bis sie in der Lage waren, sich wieder mit mir zu verbinden. Das musste ich dann (aus)halten und respektieren. Aber so funktioniert »Rupture & Repair«10: Wir müssen Verantwortung für unser Verhalten übernehmen.
Ich weiß, dass ich meinen Kindern manchmal gesagt habe, dass ich nicht mehr weiß, wie ich es anders machen soll als laut schreiend, wenn sie mir nach dreimaliger Aufforderung nicht zuhörten. Das gehört definitiv nicht zu meinen Glanzstücken, und ich hätte das gern anders gelöst. Aber selbst viele Jahre später kann ich mit meinen Kindern noch solche Gespräche führen und mich für manche Dinge entschuldigen, die ich damals – aus Nichtwissen, aus Überforderung und schlechten Vorbildern – richtig doof gemacht habe. Ich kann gleichzeitig milde mit mir sein, weil es echt eine harte Zeit war, und ihr Leid anerkennen. Jetzt sind sie erwachsen, und es macht was in unserem Umgang miteinander, wenn ich sie mit dem Bewusstsein von jungen Erwachsenen, die ja nun bereits ein eigenständiges Beziehungs- und Freund:innenleben führen, frage, wie sie diese Situationen rückblickend empfunden haben und ob es noch etwas zu klären gibt. Da kommen manchmal spannende Sachen auf den Tisch, bei denen ich ganz schön schlucken muss und die ich auch teilweise anders erlebt (oder gut verdrängt) habe. Ich sage dann, dass ich das anders in Erinnerung habe, aber ich streite nicht darüber, was sie fühlen. Denn das wissen sie viel besser. Ich darf zuhören, und das schafft Verbindung, wo früher was gestört wurde. Das repariert.
Um dich weiter zu beruhigen, lass dir sagen, dass dein Baby bzw. Kleinkind (und auch älteres und sogar erwachsenes Kind) die Erfahrung mit dysregulierten Nervensystemen und Fehleinstimmungen in seinem Umfeld braucht, um zu lernen, wie es damit umgehen kann. Natürlich kommt es dabei darauf an, welche Folgen das Nicht-Eingestimmtsein auf das Baby mit sich bringt und ob regelmäßig eine Reparatur der Verbindung geschieht. Aber nur weil eine Situation mal aus dem Ruder gelaufen ist, heißt das nicht, dass du deinem Kind alles verbaut hast!
Übrigens kannst du dich bei jüngeren Kindern genauso für dein Verhalten entschuldigen wie bei älteren, dein Baby/Kind in den Arm nehmen und so etwas in der Art sagen wie: »O Mann, da war ich gerade ganz schön doof zu dir. Entschuldige. Das muss dir einen ganz schönen Schreck eingejagt haben. Das wollte ich nicht. Du hast nichts falsch gemacht. Tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Das war nicht okay.«11





























