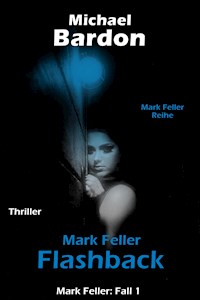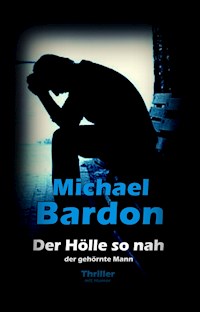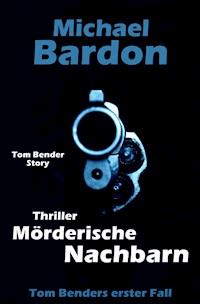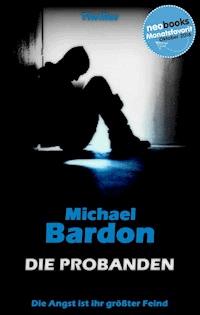Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mark Feller
- Sprache: Deutsch
Ein Terroranschlag erschüttert Frankfurt am Main. Der Fall scheint klar. Alles deutet auf einen islamistischen Hintergrund hin. Mark Feller, Agent beim Bundesnachrichtendienst, leitet den Einsatz. Er stößt mit seinem Team auf ein Netz aus Terror, Verrat, Gewalt, Intrigen und Lügen, dessen Ursprung bis zu einem weltweit agierenden Firmenkonsortium reicht …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Bardon
Netz aus Lügen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Danksagung
Prolog
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-10-
-11-
-12-
-13-
-14-
-15-
-16-
-17-
-18-
-19-
-20-
-21-
-22-
-23-
-24-
-25-
-26-
-27-
-28-
-29-
-30-
-31-
-32-
-33-
-34-
-Epilog-
Impressum neobooks
Danksagung
Manchmal ist es an der Zeit, Danke zu sagen …
Ich bedanke mich bei meinem Lektor Michael Lohmann (worttaten.de), der mich auch bei meinem siebten Buch wieder von der ersten Seite an begleitet hat.
Ich liebe Ihre kleinen Anmerkungen am Seitenrand. Auch wenn ich Sie dafür manchmal auf den Mond schießen könnte. Oder noch ein Stückchen weiter.
Ein ganz besonderer Gruß geht an die Reha-Crew.
Maria, Jens, Sabrina, Steffi, Udo und Antje. Eure Freundschaft bedeutet mir viel. Ich freue mich schon auf unser nächstes Wiedersehen.
Und mein letzter Gruß richtet sich an meinen Kumpel Akim.
Danke, Akim. Du weißt schon, wofür.
Prolog
Amirs Blick schweifte durch das weitläufige Einkaufszentrum. Er stand an der Balustrade, schaute auf den Strom der Passanten. Männer, Frauen, Teenager und Kinder. Alle Altersschichten waren vertreten. Ob Jung oder Alt, jeder schien in Eile zu sein.
Er beugte sich etwas weiter vor und legte die Unterarme auf das verchromte, gut einen Meter zwanzig hohe Geländer. Die Menschen unter ihm waren in Kauflaune. Das christliche Weihnachtsfest stand vor der Tür. In knapp drei Wochen würden die Ungläubigen die Geburt Jesu feiern.
Er kniff die Lider zusammen und schüttelte angewidert den Kopf.
Was für eine verkehrte Welt, dachte er. Die Ungläubigen haben alles, während meine Brüder und Schwestern zu Hause ums nackte Leben kämpfen.
Er nickte – auch das geschah unbewusst.
Ja, der Imam hatte nicht übertrieben, als er behauptet hatte, dass das Volk der Christen keinen Deut besser sei als die verhassten Juden – ein raffgieriger Moloch, der die arabischen Völker zu unterjochen suchte.
Er nickte erneut, während er in Gedanken mit sich selbst sprach. Die Welt gehört denen, die sie sichnehmen. Das ist der Grund, darum bist du ein heiliger Krieger geworden. Du eroberst die Welt zurück. Für Allah. Und für deine Brüder und Schwestern auch.
Sein Blick ging zur Uhr, während unter ihm die Kaufwilligen unaufhörlich dahinströmten. 11.54 Uhr. Noch sechs Minuten.
Gleich passiert es, dachte er. Gleich wird Euch Allahs Schwerthieb treffen.
Sein Blick glitt weiter, streifte über den Stand des türkischen Obsthändlers, blieb kurz an zwei Polizisten hängen, die gelangweilt ihren Dienst versahen, und huschte dann weiter zu einer Gestalt, die etwas abseits der Rolltreppe stand, im Schatten der gegenüberliegenden Balustrade.
Das musste Suleiman sein. Er glaubte, ihn an seiner leicht gebeugten Haltung zu erkennen.
Die Gestalt schien ihn ebenfalls entdeckt zu haben. Sie tat zwei Schritte nach vorne, hob den Kopf und schaute zu ihm hinauf.
Amir schluckte schwer. Er war jetzt wie in Trance, fühlte sich von allem Irdischen abgenabelt. Ein letzter Blick zu Suleiman, dann huschten seine Augen weiter und fanden in einer Traube von Menschen seine jüngere Schwester Amira. Sie war gerade siebzehn geworden. Ihren achtzehnten Geburtstag würde sie nie erleben.
Sein Herzschlag beschleunigte sich – seine Lippen sprachen ein tonloses Gebet.
Amira stand inmitten einer Horde Ungläubiger, überwiegend Kindern mit ihren Eltern. Sie harrten vor einer kleinen Bühne aus, auf der ein dicklicher Mann mit weißem Bart und albernem roten Kostüm auf einem riesigen Holzschlitten saß. Überall lagen Päckchen herum, die in glitzerndes Papier geschlagen waren. Ein Kind nach dem anderen durfte zu dem fetten Kerl auf den Schoß. Es geschah im Minutentakt; er hatte das vorhin schon eine ganze Weile beobachtet.
Sein Blick ruhte weiterhin auf seiner kleinen Schwester, die hölzern inmitten der Menge stand. Ihre Lippen bebten. Sie schien ein Gebet zu sprechen. Wie er auch.
Er schloss die Augen, versuchte die Trauer, die ihm beim Anblick seiner geliebten Schwester überkam, schon im Ansatz zu ersticken. Seine Gebete wurden intensiver, er murmelte jetzt unaufhörlich leise Worte vor sich hin.
Ein Klingeln riss ihn zurück in die Gegenwart. Noch drei Minuten! Das iPhone in seiner Jackentasche hatte soeben Alarm geschlagen.
Seine Reflexe reagierten, seine innere Stimme mahnte ihn, sich schleunigst von hier zu entfernen. Ein letzter Blick nach unten, ein letzter stummer Gruß an seine Schwester, die Allahs Reich lange vor ihm betreten durfte. Er hätte sie gern begleitet, doch als Anführer einer neu geformten Terrorzelle, eine Splittergruppe des IS, musste er unbedingt am Leben bleiben. Vorerst jedenfalls. Irgendwann würde auch er die Erlaubnis erhalten, seinen Freunden in den Märtyrertod zu folgen.
»Allahu akbar …«, murmelte er, während er sich am Geländer abstieß und mit ausgreifenden Schritten auf den Ausgang zueilte. Es wurde Zeit zu gehen. In wenigen Minuten würde hier kaum noch ein Stein auf dem anderen stehen.
-1-
Tag 1
Ich saß auf dem Beifahrersitz und starrte auf das Szenario, das sich vor der Windschutzscheibe unseres Dienstwagens abspielte. Eine graue Wolke walzte auf uns zu – die Menschen waren in Panik; sie liefen schreiend in alle Richtungen davon.
Jemand hämmerte gegen die Scheibe unseres Wagens. Ich riss mich vom Anblick der näherkommenden Staubwolke los und blickte in das rußgeschwärzte Gesicht eines Feuerwehrmannes. Er sah abgehetzt aus, seine Uniform war von Staub bedeckt.
Er donnerte erneut mit der Faust gegen die Scheibe.
»Sie müssen aus dem Auto raus. Die Staubwolke da …« Sein Kopf ruckte herum, er sprach gehetzt, laut, blickte immer wieder in Richtung der sich nähernden grauen Wand, »… ist gefährlich.« Die letzten Worte schrie er fast. Er schien am Ende zu schein, wirkte völlig überfordert und ausgepumpt.
Ich ließ die Scheibe ein Stück weit herab. Kalte Luft drang herein; sie roch nach Verbranntem, schmeckte rauchig, kratzte in der Lunge.
»Wir sind Bundesagenten. Sagen Sie uns, wie wir helfen können.«
»Wie Sie helfen können?« Der Feuerwehrmann verdrehte genervt die Augen. »Mann, indem Sie aus Ihrem Scheiß-Benz aussteigen und die Füße in die Hand nehmen.«
Unsere Blicke trafen sich. Ich sah, dass es ihm ernst war.
Mein Blick ging nach hinten, wo meine beiden Kollegen Sebastian Petermann und Helmut Bräutigam saßen. Mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr trafen gerade ein; sie blockierten unser Fahrzeug.
Verdammt! Wir saßen fest, kamen jetzt nur noch zu Fuß, von hier fort.
»Raus aus dem Wagen, und zwar schnell!«
Hinter mir flogen die Türen auf. Petermann und Bräutigam sprangen ins Freie. Ich stieß meine Tür nun ebenfalls auf und schwang mich aus dem Benz. Mein Blick checkte die Umgebung, flog über Häuserfronten, Geschäfte, abgestellte Fahrzeuge und umherirrende Passanten. Die Besatzungen der Löschzüge saßen gerade ab. Die Feuerwehrmänner fingen sofort damit an, die Kreuzung hinter uns zu sperren; sie trugen Schutzausrüstung und schweres Atemgerät.
»Himmel … was geht denn hier ab?«
Ich schaute über das Wagendach. Meine Kollegin Fariba Sedate stand an die Fahrertür gelehnt. Ihr Blick klebte an den Feuerwehrmännern, die nun dazu übergingen, die umherirrenden Passanten auf die nächstgelegenen Büros und Boutiquen zu verteilen.
Weitere Rettungskräfte trafen ein - das Sirenengeheul war beinahe unerträglich.
»Er hat bei der Herfahrt einen Starbucks gesehen. Gleich da vorne um die Ecke. Er schlägt vor …« Petermann, der am Heck des Wagens gestanden hatte, trat ein paar Schritte vor und gesellte sich zu mir, »… dass sie sich dorthin begeben und sich erst einmal einen groben Überblick über den Schlamassel hier verschaffen.«
Unsere Blicke trafen sich – ich sah ein Flackern in seinen Augen. Er war der Profiler, der unumstrittene Star in unserem Team. Petermann war die Nummer eins in Europa. Es gab keinen weiteren Fallanalysten, der ihm auch nur ansatzweise das Wasser reichen konnte. Sein IQ lag jenseits der hundertsechzig, was den Umgang mit ihm nicht gerade einfach gestaltete. Aber gut! Wer ein Ass im Team haben wollte, musste auch mit dessen Eigenheiten zurechtkommen. Oder sich zumindest, in irgendeiner Form, damit arrangieren.
Ich deutete ein Nicken an und griff mir den Feuerwehrmann, der nach wie vor neben unserem Dienstwagen stand.
»Sie kommen mit!«
»Aber … also ich weiß nicht, ich muss doch …«
Er starrte mich an, wusste nicht so recht, wie er sich verhalten sollte. Ich sah den Zwiespalt in seinen Augen; er hatte Schiss, wollte aber dennoch nicht von seinem Platz weichen.
Ich verstand das, konnte aber auf die Gefühle des Mannes keine Rücksicht nehmen. Informationsbeschaffung stand jetzt, neben der eigenen Sicherheit, an oberster Stelle. Ich brauchte ihn. Er war der direkte Draht zu meinem Pendant: dem Einsatzleiter der Rettungskräfte.
Die graue Wand rückte unaufhörlich näher. Ich nahm es nur aus dem Augenwinkel wahr, da mein Fokus nach wie vor auf dem Feuerwehrmann lag. Erste Nebelschleier stahlen sich an uns vorbei – die Vorboten von dem, was gleich über uns hereinbrechen würde.
»Und Sie sind wirklich Bundesagenten?«, fragte er. Seine Stimme klang rau, kratzig, er hustete immer wieder.
Ich nickte, zog meinen Ausweis aus der Innentasche meiner Lederjacke und hielt ihn gut sichtbar in die Luft.
»Mark Feller vom Bundesnachrichtendienst. Ich bin der Leitende Ermittler hier vor Ort.«
»Okay …« Der Feuerwehrmann nickte, machte jedoch noch immer keine Anstalten, uns zu begleiten.
»Er sollte sich nicht so zieren«, sagte Petermann, dessen ausgestreckter Arm auf die graue Wolke wies, die jetzt nur noch gute dreißig Meter von uns entfernt war. Er war wie immer ganz in Schwarz gekleidet. »Er will jetzt wirklich nicht unken, aber er hat ja eben selbst gesagt, dass die Staubwolke dort risikobehaftet sei.«
Keine Reaktion. Der Feuerwehrmann schien noch immer unschlüssig, ob er seinen Posten so einfach verlassen durfte.
»Wie ist Ihr Name?«
»Was?«
»Wie heißen Sie?«
»Ääh … Grünbeck. Eugen Grünbeck.«
Die Dunstschleier wurden dichter. Ich spürte einen Hustenreiz, unterdrückte ihn jedoch. »Hören Sie, Grünbeck. Wir brauchen Sie. Sie sehen aus, als wären Sie recht nahe am Geschehen dran gewesen«, sagte ich.
»Nahe ist gut.« Er nickte, riss die Augen auf und schüttelte gleichzeitig den Kopf. »Ich war mittendrin. Mein Löschzug war einer der ersten. Unsere Feuerwache liegt gleich um die Ecke, keine fünfhundert Meter von hier.« Er schüttelte abermals den Kopf und stöhnte leise auf. »Gott, was für ein Albtraum! So viele Tote … so unglaublich viele Tote. Überall lagen verkohlte Leichenteile herum …« Seine Stimme brach, er brauchte einen Moment, bevor er weitersprechen konnte. »Und dann die Autos … die halbe Parkebene stand bereits in Flammen. Da war echt nix mehr zu machen. Ein einziges Inferno. So was habe ich in all den Jahren noch nicht erlebt.«
Jackpot!
Das mag jetzt ein wenig herzlos klingen, war es wahrscheinlich auch, doch rein rational betrachtet, war Grünbeck ein Glücksgriff. Er war genau der, den wir jetzt brauchten. Ein Augenzeuge, der uns zumindest ansatzweise schildern konnte, was in dem Einkaufszentrum vorgefallen war.
Unsere Informationen waren nämlich überaus spärlich. Wir wussten nur, dass sich inmitten des belebten Nordwestzentrums, eine schreckliche Explosion ereignet hatte. Mehr hatte mir mein Vorgesetzter Major Starke am Telefon nicht verraten. Er hatte zwar die Möglichkeit eines Terroranschlags eingeräumt, diese Information jedoch als noch ›nicht gesichert‹ bezeichnet. Für mich nicht weiter verwunderlich. Der Islamische Staat ließ sich gern etwas Zeit, um sich zu einem Terroranschlag dieses Ausmaßes zu bekennen.
Grünbecks Blick irrte zwischen mir, Petermann und der grauen Wand hin und her. Sie war bereits bedrohlich nahe, türmte sich bis zu den oberen Stockwerken der umliegenden Wolkenkratzer auf. Die Zeit wurde allmählich knapp – es blieben nur noch wenige Augenblicke, uns in Sicherheit zu bringen.
Zeit zum Handeln! Ich nahm Blickkontakt zu Bräutigam auf, der sich, entgegen seinem aufbrausenden Naturell, bislang erstaunlich zurückhaltend gezeigt hatte. Er war der Haudegen in unserem Team. Ein kleiner Hitzeblitz, dessen schroffe Art gern auch mal missverstanden wurde. Ich mochte ihn dennoch, auch wenn wir anfänglich ein paar Schwierigkeiten miteinander hatten.
Bräutigam, der meine stumme Aufforderung richtig gedeutet hatte, trat um den Wagen herum und näherte sich dem Feuerwehrmann von der Seite. Jetzt hatten wir ihn in der Zange, konnten ihn, notfalls mit sanfter Gewalt, von hier fortbringen. Unsere Blicke trafen sich erneut. Bräutigam nickte mir kurz zu; er nestelte an seinem Gürtel herum.
»Kommen Sie, Grünbeck.« Ein letzter Versuch, ein allerletzter Appell an seine Vernunft. Der Mann war traumatisiert, musste Dinge gesehen haben, die er auf die Schnelle einfach nicht verarbeiten konnte. Ich wollte ihm nicht gänzlich den Verstand rauben, indem ich ihn in Handschellen von hier fortschleifte.
»Na los. Hier können Sie ja doch nichts mehr ausrichten. Schauen Sie sich um, Grünbeck. Ihre Kollegen machen das hervorragend. Die haben alles im Griff! Sie müssen jetzt auch an sich denken. Es ist niemanden damit gedient, wenn Sie hier den Helden spielen und an einer Rauchgasvergiftung sterben.«
»Hier stimmt was nicht! Sein Schuhwerk …« Petermanns Stimme war nur ein Wispern. Er hatte so leise gesprochen, dass ich ihn kaum verstanden hatte.
Ich schaute zu Boden, brauchte jedoch einen kleinen Moment um seine Worte, mit dem, was ich sah, in Einklang zu bringen.
»Sie haben recht!«
Ich sah wieder auf. Der Feuerwehrmann nickte gerade, seine Schultern strafften sich. Er warf noch einen schnellen Blick in die Runde, schien sich zu vergewissern, dass niemand mehr seine Hilfe benötigte. Dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, wandte er sich zu mir um, schaute mir direkt ins Gesicht; er schien nervös, nestelte permanent am Reißverschluss seiner Jacke herum.
»Sie haben recht«, sagte er erneut, während sich ein breites Lächeln um seine Mundwinkel legte. »Machen wir, dass wir von hier wegkommen …«
*
Amirs Blick schweifte in die Ferne. Er stand am Fenster seiner Wohnung, die im sechzehnten Stockwerk eines heruntergekommenen Hochhauses lag. Für deutsche Maßstäbe wohlgemerkt. Nicht für seine. Er war sehr zufrieden. Denn verglichen mit den Behausungen in seiner Heimat war die geräumige Vier-Zimmer-Wohnung, seine Vier-Zimmer-Wohnung, ein Palast.
Deutsche gab es hier kaum noch. Wer es sich irgendwie leisten konnte, zog von hier fort, kehrte den verhassten Asylanten, Arabern und Dunkelhäutigen, die hier eindeutig in der Überzahl waren, den Rücken.
Amir war das recht. Er schätzte die Anonymität, die das Wohnen hier mit sich brachte. Solange man sich still und unauffällig verhielt, ging man im tristen Grau der Masse einfach unter. Wahrscheinlich wusste noch nicht einmal sein Nachbar, wer in der Wohnung nebenan vor gut zwei Wochen eingezogen war.
Amir lächelte, während sein Blick nach wie vor die riesige Rauchsäule fixierte, die weithin sichtbar über Frankfurt schwebte.
Unter ihm, in den Straßenschluchten, erklang Sirenengeheul – die ganze Stadt schien in Aufruhr zu sein.
Sein Lächeln wurde breiter, nahm einen diabolischen Ausdruck an. Dabei war das heute erst der Anfang, dachte er. Allahs Schwerthieb hat Euch bis jetzt bloß gestreift. Wie kopflos werdet Ihr erst sein, wenn Euch sein Schwert mitten ins Herz fährt?
Hinter ihm fiel eine Tür ins Schloss. Amir musste sich nicht erst umdrehen, um zu wissen, wer gerade den Raum betreten hatte.
»Hat alles geklappt? Habt ihr den Transporter?«, fragte er.
»Ja!«
Amir nickte, drehte sich aber nach wie vor nicht um. Sein Blick hing weiterhin auf der Rauchsäule, die wie ein mahnender Zeigefinger in den Himmel stach.
»Gab es irgendwelche Schwierigkeiten, von denen ich wissen müsste?«
»Nein, Amir!« Karims verzerrtes Spiegelbild schüttelte den Kopf. »Es lief alles wie geplant. Wir haben es genau so gemacht, wie du es gesagt hast.«
Amir nickte zufrieden, seine Züge nahmen einen entschlossenen Ausdruck an. Er starrte weiter aus dem Fenster, nahm Karims Spiegelung – auf der seit ewigen Zeiten nicht geputzten Scheibe – nur am Rande wahr.
Seine Gedanken eilten weit voraus, beschäftigten sich mit Dingen, die irgendwann vielleicht einmal bedeutsam für sie werden konnten. Ihre Ziele waren hochgesteckt. Der kleinste Fehler, die nichtigste Schludrigkeit, konnte ihnen bereits das Genick brechen. Die ermittelnden Behörden waren nicht zu unterschätzen. Das hatte ihnen der Imam immer und immer wieder eingeschärft.
»Habt ihr das GPS-Signal des Transporters deaktiviert, bevor ihr ihn zur Halle gefahren habt?«
Karims Spiegelbild nickte erneut. »Natürlich, Amir. Ich habe das Signal so ausgeschaltet, dass wir es jederzeit mit wenigen Handgriffen wieder aktivieren können. So wie du wolltest.«
Zufriedenheit erfüllte ihn. Amirs Lächeln wurde breiter, verlor an Schärfe. Es war ein schönes, ein fast schon vergessenes Gefühl, das er seit vielen Jahren, nicht mehr verspürt hatte. Was er hier tat, fühlte sich richtig an. Die anfänglichen Zweifel, die ihm nachts den Schlaf geraubt hatten, waren verflogen. Die Ungläubigen hatten es nicht besser verdient. Wer Gewalt säte, musste auch damit rechnen, dass der Krieg vor dem eigenen Land keinen Halt machte. Der Islamische Staat verfügte zwar nicht über die militärischen Mittel der westlichen Nationen, doch seine Krieger waren furchtloser, entschlossener und besser als die verweichlichten Soldaten ihrer Feinde.
Er lächelte – es geschah unbewusst.
»Dann geh und bereite Hilal und Ulvi auf den morgigen Tag vor«, verlangte er.
Karims Spiegelbild nickte erneut. »Ja, Amir.«
»Zeig den beiden die Fotos und geh mit ihnen noch einmal die zeitlichen Abläufe durch. Es darf nichts schiefgehen. Von dem Erfolg ihrer Mission hängt unser aller Zukunft ab.«
»Ja, Amir. Ich bin mir sicher: Hilal und Ulvi werden Allah nicht enttäuschen!« Karims Stimme klang unterwürfig. Er war zwar der Ältere, fügte sich jedoch in die Rolle des zweiten Mannes. Der Imam hatte es so bestimmt. Und Karim würde nie etwas tun, was nicht dem Willen des Imams entsprach.
»Wenn ihr fertig seid, schickst du die beiden ins Gebetszimmer«, sagte Amir. »Sie dürfen ihre letzten Stunden mit Allahs Schriften verbringen, damit sie sich innerlich auf die Begegnung mit ihm vorbereiten können.«
Karim Spiegelbild deutete eine leichte Verbeugung an, während er sich wortlos zurückzog.
Als die Tür erneut ins Schloss fiel, war Amir schon wieder tief in Gedanken versunken. Seine Lippen bebten, sein Blick war starr aus dem Fenster gerichtet.
Die Zeit ist reif, dachte er. Allahs Schwert wird die Ungläubigen richten und meine Hand, meine Hand wird das Heft führen.
-2-
»Verdammt! Achtung Leute! Er trägt einen Sprengstoffgürtel!«
Neben mir spritzte Petermann zur Seite; er kannte mich gut genug, um zu wissen, dass ich jetzt ein wenig Platz brauchte. Ich nahm es nur am Rande wahr, da ich mich voll und ganz auf den Feuerwehrmann konzentrierte, der den Reißverschluss seiner schweren Einsatzjacke bereits zu gut zwei Dritteln heruntergezogen hatte.
Die Zeit schien still zu stehen - unsere Blicke verschmolzen miteinander. Ich sah, die Entschlossenheit, ich sah das fanatische Glimmen in seinen Augen. Es war ihm ernst. Er wollte uns alle mit in den Tod reißen.
Zeit zum Handeln! Über das Warum und Weshalb konnte ich mir später noch Gedanken machen.
Meine Hand fuhr zur Waffe. Ich war schnell, zweifelte jedoch, ob ich dieses Mal fix genug sein würde; ich verfluchte mich im Stillen selbst, weil ich nicht sofort, auf Petermanns Hinweis zu den Schuhen reagiert hatte - der Kerl trug schwarze Boots statt der üblichen schweren Einsatzstiefel. Ein dummer Fehler, der uns jetzt alle das Leben kosten konnte.
Meine Finger ertasteten die hölzernen Griffschalen der Pistole, die in einem Schnellziehhalfter an meinem Gürtel steckte. Ein Gefühl der Vertrautheit stellte sich ein. Meine Glock und ich, gemeinsam hatten wir schon eine Menge brenzlige Situationen gemeistert.
Ich hielt den Atem an, während ich die Glock aus dem Holster riss und meine Waffenhand wie von selbst nach oben flog. Der Abstand zum Attentäter betrug nur wenig Meter. Es brauchte also keinen Kunstschuss, um den falschen Feuerwehrmann auszuschalten. Er oder wir – eine andere Möglichkeit gab es nicht.
Ich zwang mich zur Ruhe, zwang mich, nicht überhastet zu schießen. Während ich mein Gegenüber noch ins Visier nahm, geschahen zwei Dinge fast gleichzeitig: Ein Schuss fiel – und mehrere Detonationen verbreiteten sich über den Gehweg. Ich kniff die Augen zusammen, da ich im ersten Moment davon ausging, dass der Attentäter die Sprengung ausgelöst hatte. Sie können mir glauben , meine Erleichterung war grenzenlos, als ich registrierte, dass der falsche Feuerwehrmann nach wie vor an seinem Platz stand und mich ebenso verständnislos anstarrte wie ich ihn.
Er schwankte. Auf seinem weißen T-Shirt breitete sich auf Höhe des Herzens rasend schnell ein roter Fleck aus. Sein Blick fiel nach unten – unser Augenkontakt brach. Er riss den Mund auf, aus dem ein dünner roter Faden sickerte. »Ich muss das tun«, keuchte er, während er fassungslos an sich herabstarrte. Die Finger seiner linken Hand zitterten – sie hielten eine dünne Schnur, die irgendwo im Inneren des sprengstoffbesetzten, gut vierzig Zentimeter breiten Gürtels verschwand.
Keine Zeit, über seine Worte nachzudenken. Seine Augen verrieten ihn; er würde die Sprengung auslösen. Und zwar jetzt!
Ich zog den Stecher durch, jagte zwei Kugeln aus dem Lauf. Beide trafen ihr Ziel. Der Attentäter wurde buchstäblich von den Füßen gerissen.
Gänsehaut. Mich fröstelte. Ich hoffte inständig, dass der Attentäter die Bombe nicht noch in einer Art Reflex hatte auslösen können.
Sekunden im Nichts; ich hielt den Atem weiter an, unfähig mich zu bewegen oder etwas anderes Sinnvolles zu tun.
Bräutigam reagierte als Erster von uns vieren. Er trat zwei Schritte vor, beugte sich zu dem Feuerwehrmann herunter und zog behutsam dessen schlaffen Arm aus dem Inneren der Jacke. Die verkrampften Finger des Toten umklammerten nach wie vor die Zündvorrichtung.
»Hey, kann mir vielleicht mal einer helfen oder wollt ihr die ganze Zeit nur blöde glotzen?«
Ich erwachte aus meiner Schockstarre und eilte zu Bräutigam. Dessen Finger zitterten. Er hielt in der Rechten seine Dienstwaffe, aus deren Lauf noch ein wenig Rauch kräuselte, und in der Linken die Hand des toten Attentäters. Er schwitzte stark, atmete flach und gepresst.
»Mach hin, Alter. Ich scheiß mir gleich in die Hose.«
Unsere Blicke trafen sich. Ich sah das Flackern in seinen Augen, er war nahe dran, die Nerven zu verlieren.
»Guter Schuss!« Bräutigam und seine Dienstwaffe: Er trug sie eigentlich nur, weil er musste.
Bräutigam schnaubte wie ein gereizter Bulle. Schweiß rann von seiner Stirn und tropfte auf den Sprengstoffgürtel.
»Hör auf zu quatschen, Chef, und tu endlich was. Du weißt, ich hab Rücken. Wenn ich noch länger so gebückt stehe, komm ich nie wieder hoch.«
Ich nickte, zog mein Schweizer Taschenmesser aus der Hosentasche und schnitt vorsichtig die Schnur durch, die eine ganz gewöhnliche braune Kordel war.
»Du kannst seinen Arm jetzt loslassen.«
»Bist du dir sicher?«
Ich schaute Bräutigam nur an. Der nickte nach ein paar Sekunden – sein Gesicht war vom Vornübergebeugtstehen rot angelaufen.
»Hast dir ja reichlich Zeit gelassen«, murrte er, während er den Arm des Toten losließ und sich mit verkniffenen Gesicht langsam aufrichtete.
Keine Zeit zum Atemholen, keine Zeit, sich länger als ein paar Sekunden mit dem toten Attentäter zu beschäftigen. Die Staubwolke war nun ganz nah. Uns trennten nur noch wenige Meter vor der nächsten tödlichen Gefahr.
»Komm, Helmut, wir müssen weg.«
»Aber …«
Ich packte Bräutigam am Arm und zog ihn hinter mir her. Mein Ziel war eine kleinere Gruppe Feuerwehrmänner, die fassungslos zu uns herüberstarrten und nicht so recht einschätzen konnten, was da soeben geschehen war. Fariba stand bereits bei den Männern, hielt ihren Ausweis in die Luft und sprach beruhigend auf sie ein.
»Und was ist mit dem da?« Bräutigam sträubte sich, schien die tödliche Gefahr, die von hinten herangekrochen kam, überhaupt nicht wahrzunehmen.
»Um den kümmern wir uns später«, sagte ich und verdoppelte meine Anstrengung. Mein Kollege wog knapp hundert Kilo. Denn konnte man nicht so einfach mit sich fortziehen.
»Und wenn das verdammte Ding doch noch hochgeht?«
»Dann ist niemand mehr da, der Schaden nehmen kann«, erwiderte ich gereizt. Das Atmen fiel mir immer schwerer. Meine Augen tränten, ich musste ständig husten. Der falsche Feuerwehrmann hatte nicht übertrieben, als er die Staubwolke als gefährlich bezeichnet hatte.
Ich sah mich um, suchte nach Petermann, konnte ihn jedoch nirgendwo ausmachen.
»Suchst du was?« Bräutigam, der endlich seinen Widerstand aufgegeben hatte, trabte neben mir her. Er schien noch schlechter Luft zu bekommen als ich, wahrscheinlich wegen seines Asthmas.
»Ja! Ich kann Sebastian nirgendwo entdecken. Hast du gesehen, wo er hingegangen ist?«
»Nee, hab ich nicht. Ich hatte Besseres zu tun, als auf unseren abgetretenen Herrn Professor zu achten.«
Ich nickte. Die alte Leier. Helmut und Sebastian waren sich nach wie vor nicht grün. Die beiden waren einfach zu unterschiedlich, um gut miteinander auszukommen.
Mein Blick machte erneut die Runde, während wir zügig auf die Feuerwehrmänner zuliefen. Von Petermann war auch weiterhin nichts zu sehen. Ich wurde langsam unruhig, machte mir Sorgen, konnte mir selbst aber nicht erklären weshalb. Petermann war ein Eigenbrötler. Ein kleiner selbstverliebter Egomane. Seine Alleingänge waren legendär. Dass er sich damit manchmal in Schwierigkeiten brachte, nahm er billigend in Kauf. Er war eben ein Individualist, dessen brillanter Geist nicht wie unser funktionierte. Und gerade deshalb schätzte ich ihn als festen Bestandteil unseres Teams. Auch wenn er uns allen des Öfteren gehörig auf die Nerven ging.
Ich sah mich erneut nach ihm um. Das Sebastian so einfach verschwunden war, konnte eigentlich nur bedeuten, dass er irgendetwas entdeckt hatte, das es seiner Meinung nach sofort zu ergründen galt.
Der Druck auf meinen Magen nahm zu, während in meinem Kopf ein kleiner Film an möglichen Szenarien ablief.
Ich zog mein Smartphone aus der Tasche, verscheuchte meine düsteren Gedanken und wählte Petermanns Nummer, bekam jedoch keine Verbindung. Das Netz schien komplett überlastet zu sein. Logisch! Die Menschen sorgten sich um ihre Liebsten und versuchten einander zu erreichen.
»Hey, mach dir um Sebastian keinen Kopf. Wer den klaut, bringt ihn nach wenigen Stunden wieder zurück.«
Ich sah Bräutigam an, der ein schiefes Grinsen aufgesetzt hatte. Er schnitt eine Grimasse und winkte mit der Linken ab.
»Schau nicht so. Ich habe doch recht, oder?«
»Haha, wirklich sehr hilfreich, Helmut. Ich lach dann mal später, ja.«
Bräutigam grinste vielsagend, verzichtet jedoch auf einen weiteren Kommentar. Wenige Augenblicke später hatten wir unsere Kollegin Fariba Sedate erreicht, die gerade einer Handvoll Feuerwehrmännern zu erklären suchte, auf was sie bei der Absperrung des Tatorts achten sollten.
Die Zeit drängte. Der Körper des Attentäters war bereits zu gut zwei Dritteln von der Staubwolke verschluckt. Da der Sprengstoffgürtel jedoch noch aktiv war, mussten wir den Tatort sichern, damit niemand, versehentlich oder aus Absicht, die Sprengung doch noch auslösen konnte.
Mein Blick checkte erneut die Umgebung, während ich darauf wartete, dass Fariba ihren Vortrag beendete. Sie nahm es heute wieder einmal besonders genau, obwohl die Zeit oder besser die verdammte Staubwolke uns gehörig im Nacken saß.
»Was hat da vorhin eigentlich so gerumst?«, fragte Bräutigam. »Ich hab im ersten Moment echt geglaubt, dass ich den Scheiß-Sprengstoffgürtel getroffen habe und uns jetzt alles um die Ohren fliegt.«
»Ging mir auch so.« Ich sah Bräutigam an, dessen schweißnasses Gesicht einen nachdenklichen Ausdruck angenommen hatte. Seine Frage war berechtigt. Auch in mir rumorte die Frage, ob es weitere Anschläge in der Stadt gegeben hatte.
Hoffentlich nicht!
Die Rettungskräfte waren mit diesem hier schon sehr gefordert. Nicht auszudenken, was eine ganze Anschlagserie in einer Großstadt wie Frankfurt für ein Chaos anrichten würde.
»Meinst du, dass es noch weitere Anschläge gegeben hat?«, fragte Bräutigam. »Hat jedenfalls ganz danach geklungen, wenn du mich fragst. Das hat ja gescheppert … Das waren mindestens drei oder vier Explosionen.«
Ich zuckte die Schultern. Fürs Spekulieren war jetzt einfach keine Zeit. Wir hatten schon genug um die Ohren. Falls es wirklich weitere Anschläge gegeben hatte, würden wir das noch früh genug erfahren.
»Es waren Detonationen. Und zwar genau fünf an der Zahl! Er hat mitgezählt.«
Ich fuhr herum. Petermann war – von Helmut und mir unbemerkt – von hinten an uns herangetreten.
»Wo warst du denn?« Meine Frage klang vorwurfsvoll. Bewusst.
Lippenschürzen gefolgt von einem tadelnden Kopfschütteln. »Hat er sich etwa gesorgt?« Petermann griente, es sah ein wenig überheblich aus. Sollte es wahrscheinlich auch. Sein Grinsen wurde breiter, seine rechte Hand fuhr die Konturen seines Scheitels nach. »Er kann ihm versichern, dass er dies ganz sicher nicht muss, weil er …«, sein manikürter Zeigefinger stupste gegen seine Brust, »… sich seit vielen Jahrzehnten bestens selbst vorstehen kann.«
»Er nun wieder …« Bräutigam schnaufte erneut wie ein gereizter Bulle. »Hab ich es dir nicht gesagt? Den behält keiner freiwillig. Du hast dir mal wieder ganz umsonst Sorgen um den Kerl gemacht.«
Ich ignorierte Bräutigams Geplapper und konzentrierte mich weiter auf Petermann. »Nun sag schon. Was ist dir aufgefallen? Wen oder was hast du gesehen?«
Erneutes Lippenschürzen. Petermanns Blick fraß sich in meinen. »Er hat kurz gedacht, er habe jemanden Bekanntes gesehen«, räumte er nach einer kurzen Bedenkzeit ein.
»Wen?«
Petermanns Blick blieb an mir haften, obwohl Bräutigam die Frage gestellt hatte. Er hob die Schultern und zog ein bedauerndes Gesicht. »Er hat sich allen Anschein nach getäuscht. Dies geschieht zwar nicht oft, das letzte Mal ist schon sehr lange her, kommt aber hin und wieder leider auch mal vor.«
»Hört, hört! Das sind ja ganz neue Töne.« Bräutigam war begeistert. Hohn schwang in seiner Stimme mit. Er beugte sich vor, tat so, als sei er besorgt. »Du bist doch nicht etwa krank, hast Fieber oder was Schlimmeres?«
Petermann ignorierte seinen Sarkasmus. Sein Blick ruhte weiterhin auf mir, was mir, wenn ich ehrlich bin, leichtes Unbehagen bereitete. Mein Zwerchfell kribbelte. Ich kannte Petermann gut genug, um die Lüge hinter seinen Worten zu durchschauen. Er verschwieg uns etwas. Das war offensichtlich.
Ich wollte gerade nachhaken, wurde jedoch von meiner Kollegin Fariba Sedate daran gehindert.
»Ihr müsst hier weg, Mark«, sagte sie. »Die Staubwolke soll extrem gefährlich sein. Laut Messungen der Feuerwehr transportiert die Wolke ein ganzes Sammelsurium an Giftstoffen. Es besteht akute Lebensgefahr. Und zwar für jeden, der ungeschützt mit der Staubwolke in Berührung kommt.«
Unsere Blicke trafen sich – ich sah den besorgten Ausdruck in ihrem Gesicht.
»Wir können den Attentäter hier nicht einfach zurücklassen. Sein Sprengstoffgürtel ist noch immer aktiv. Wir müssen dafür sorgen, dass dem Kerl keiner zu nah kommt.«
Meine Kollegin nickte. Ein kurzes Lächeln huschte über ihr Gesicht. Es stand ihr gut. Ich mochte dieses altkluge Schmunzeln.
»Ich kümmere mich darum«, sagte sie, während sie sich eine Locke aus dem Gesicht blies. Sie hatte dunkle, beinahe tiefschwarze Haare, die genauso widerspenstig waren wie sie selbst. »Die Jungs haben noch eine komplette Schutzausrüstung. Sie bereiten sie gerade für mich vor.«
»Hey, Feuerwehrmannspielen ist aber Männersache.«
Bräutigam. Niemand schenkte ihm Beachtung.
Ich dachte kurz nach, ging in Gedanken unsere Optionen durch. Zwei Sekunden später drückte ich meine Zustimmung, durch ein knappes Nicken aus.
»Alles klar, Fariba. Dann ziehen wir uns in den Starbucks zurück, den Sebastian vorhin erwähnt hat. Gib gleich Bescheid, wenn die Gefahr vorbei ist. Ich will nämlich so schnell wie möglich an den eigentlichen Tatort ran.«
-3-
Knapp drei Stunden und etliche Kaffee später war es endlich so weit. Fariba rief auf meinem Smartphone an und teilte mir mit, dass die nervige Warterei ein Ende hatte.
Ich schaute mich in dem kleinen Büro des Starbucks-Filialleiters um, das uns die letzten Stunden als eine Art Einsatzzentrale gedient hatte.
Unruhe erfasste mich. Jetzt, wo es so weit war, konnte ich meine Ungeduld kaum noch im Zaun halten.
Ich schob das Smartphone in die Jackentasche und gab meinen beiden Kollegen das Zeichen zum Aufbruch.
»Das war Fariba. Es geht los. Die Feuerwehr hat gerade Entwarnung gegeben.«
»Großer Gott, danke!« Petermann schaute auf, Theatralik schwang in seiner Stimme. »Er hat schon befürchtet, er müsse den ganzen Tag hier sitzen und mit ansehen, wie sich ein gewisser beleibter Kollege ein Blaubeer-Muffin nach dem anderen einverleibt.«
Bräutigams Kopf flog herum. Sein Blick verhieß nichts Gutes. Petermann lächelte süffisant, nahm seine rahmenlose Brille ab und hielt sie prüfend gegen das Licht. Er wusste ebenso gut wie ich, was gleich passieren würde. Bräutigam konnte das nicht auf sich sitzen lassen. Er musste zurücktreten. Und zwar um jeden Preis.
Seine Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Ich hatte gerade einmal bis zwei gezählt, in Gedanken, als Bräutigam auch schon verbal zum Gegenschlag ausholte.
»Sagt ausgerechnet der, der sich ein halbes Dutzend Espresso reingezogen hat«, blaffte er.
Kurzes Schweigen. Petermanns Züge froren ein; in seinen Augen blitzte Schalk auf. Für ihn war das Ganze nicht mehr als ein Spiel. Eine Art Zeitvertreib, um sich selbst bei Laune zu halten.
»Espressos. Es heißt Espressos. Oder wenn er den zweiten Plural favorisieren möchte, kann er gern auch Espressi sagen.«
»Was bist du? Ein Deutschlehrer?«
»Nein!« Petermann wackelte tadelnd mit dem Kopf. »Er ist nur der deutschen Sprache mächtig. Was er von ihm nicht behaupten kann.«
»Er ist nur der deutschen Sprache mächtig …« Bräutigam äffte Petermann nach. »Hast du dir eigentlich schon mal selbst beim Reden zugehört? Gequirlte Scheiße ist Gold dagegen.«
»Es reicht!«
»Er hat aber damit angefangen.«
»Er hat aber damit angefangen …« Jetzt äffte Petermann Bräutigam nach.
»Ich sagte, es reicht. Das galt für euch beide.«
Mein Blutdruck schnellte in die Höhe, während meine Laune allmählich in den Keller sank. Wir hatten wirklich weitaus Besseres zu tun, als unsere Zeit mit unnützen Wortgefechten zu vertrödeln.
»Macht lieber was Sinnvolles und übermittelt das, was ihr an Fakten gesammelt habt, an Arnos Rechner«, sagte ich.
Schweigen als Antwort, dem ein schuldbewusstes Nicken folgte. Beide waren exzellente Ermittler, obwohl ihre Vorgehensweise nicht unterschiedlicher hätte sein können.
»Und vergesst nicht, dass der Browserverlauf noch gelöscht werden muss. Es darf nichts auf dem Computer des Geschäftsführers zurückbleiben, was nicht schon vorher drauf gewesen ist.«
Erneutes Nicken. Dieses Mal jedoch nur von Bräutigam. »Ist klar, Chef! Wird gemacht.«
Ich sah Petermann an, der mir vorhin ein knappes ›Er wird sich ihm später erklären‹ zugeraunt hatte. Er wusste, dass ich seine Lüge durchschaut hatte und keine Ruhe geben würde, bis er mir verriet, wen oder was er gesehen hatte.
Unsere Blicke trafen sich. Er schüttelte fast unmerklich den Kopf, bevor er mit einem knappen Nicken auf Bräutigam wies.
Ich verstand: Er wollte nicht reden, solange ein Dritter mithören konnte.
Also gut, ich konnte warten. Noch.
»Dann geht er mal die Rechnung begleichen.« Petermann erhob sich von seinem Stuhl, trat um den Schreibtisch herum und kramte ein paar Scheine hervor, die er in einer goldenen Spange in der Vordertasche seiner schwarzen Jeans aufbewahrte. »Er hat heute die Spendierhose an«, sagte er. »Der Berg Blaubeer-Muffins geht auf seine Kappe.«
Du elender kleiner Stinkstiefel …
Bräutigam schaute kurz vom Bildschirm auf, verkniff sich jedoch einen neuerlichen Kommentar. Seine Mimik wirkte angespannt, drückte aber auch ein klein wenig Erstaunen, nein eher Unglaube, aus.
»Schaut mal her, Leute«, sagte er. »Ich glaube, ich bin da durch Zufall im Netz auf was gestoßen.« Er drehte den Monitor kurzerhand in unsere Richtung.
Ich schaute kurz hin, war aber nicht recht bei der Sache. Mir gingen zu viele Dinge durch den Kopf. Ich wollte los, wollte mir endlich ein eigenes Bild vom Ausmaß des Anschlags machen.
»Was soll das sein?«, fragte ich. Ungeduld schwang in meiner Stimme mit.
»Sag du es mir. Ich kann mir nämlich keinen Reim darauf machen. Ich kann dir nur sagen, dass das dritte Bild von oben …«, Bräutigams Zeigefinger stach auf den Monitor ein, »… einen alten Bekannten von uns zeigt.«
Ich beugte mich vor, sah mir die abgebildeten Männer jetzt etwas genauer an. Mein Kollege hatte recht: Der dritte Mann von oben war kein Unbekannter für uns.
»Das ist Jussuf Alkbari«, sagte ich. »Wie zum Teufel bist du denn jetzt auf den gestoßen?«
»Keine Ahnung.« Bräutigam zuckte mit den Achseln. »Ich hab bloß ein wenig im Darknet gestöbert. Und dann ist das da plötzlich aufgetaucht.«
Petermann, der den Raum schon beinahe verlassen hatte, blieb wie angewurzelt stehen. Sein Blick ruhte auf dem Monitor, der acht kleinere Porträts arabisch aussehender Männer zeigte. Neben jeder Fotografie stand ein kurzer Text, natürlich in arabischen Schriftzeichen, die, wen wundert’s, keiner von uns lesen konnte.
Petermann trat näher, den Blick weiterhin unverwandt auf den Monitor gerichtet. Lippenschürzen. Nachdenkliche Miene. Er beugte sich herunter, nahm die Brille ab und betrachtete gut eine Minute lang die Gesichter der Männer.
»Er kann es natürlich nicht beschwören …«, sagte er, seine Stimme klang belegt, beinahe schon ehrfurchtsvoll, »… aber er könnte sich gut vorstellen, dass dies eine Todesliste ist.«
Stille im Raum. Jeder von uns dachte über seine Worte nach. Meine Gedanken sprangen ein paar Wochen zurück.
Jussuf Alkbari.
Aufmerksam geworden auf ihn waren wir im Zuge unseres ersten gemeinsamen Falls: Es ging um einen Menschenhändlerring, der jungen Immigrantinnen aus dem Nahen Osten entführt, eingesperrt und meistbietend verkauft hatte. Jussuf, der der Bruder unseres ermordeten Informanten war, hatte in diesem Fall nur eine untergeordnete Rolle gespielt. In diesem Fall. Die Ermittlungen gegen ihn dauerten noch an; er stand unter Verdacht, Sympathisant einer islamistischen Terrormiliz zu sein.
»Wie kommst du denn auf das schmale Brett?«, fragte Bräutigam. Er klang wenig überzeugt.
Petermann wiegte den Kopf, sein Zeigefinger klopfte gegen seine Unterlippe. Er tat dies fast immer, wenn er angestrengt nachdachte.
»Er vermag zwar keine arabischen Schriftzeichen zu lesen, doch die Gestaltung und die Schaustellung dieser Liste, kommt ihm nicht zum ersten Mal unter.« Petermann schwieg einen Moment, trieb die Dramatik seiner nächsten Worte so gekonnt zum Höhepunkt. Als er schließlich fortfuhr, klang seine Stimme blechern. »Er hat dies schon einmal gesehen. Damals war es allerdings eine Todesliste, die die Al-Qaida im Zuge einer Hetzjagd auf fünf westliche Journalisten ins Netz gestellt hatte.«
Ich spürte ein Kribbeln im Bauch. Petermanns Worte lösten Kopfkino bei mir aus. Auch ich hatte solche Listen schon gesehen. Allerdings in Afghanistan, wo ich als KSK-Soldat hinter den feindlichen Linien gekämpft hatte.
»Druck das verdammte Blatt aus, vielleicht kann Fariba ja was damit anfangen.«
Bräutigam nickte, sagte jedoch nichts.
Meine Hoffnung, unsere Kollegin könne etwas mit den Schriftzeichen anfangen, war nicht ganz unbegründet. Sie war eine gebürtige Iranerin oder wie sie es auszudrücken pflegte: eine Perserin. Ihre Eltern, die in ihrer Heimat einer Minderheit angehörten – Christen, wie Fariba auch –, waren vor vielen Jahren nach Deutschland immigriert. Fariba, damals neun, hatte demnach gut die Hälfte ihrer Kindheit im Iran verbracht. Sie sprach fließend Arabisch – inwieweit sie die Sprache allerdings auch lesen konnte, entzog sich jedoch meiner Kenntnis.
Petermann nickte kurz. Sein schlohweißes Haar wippte im Takt seines Nickens. »Gute Idee! Er meint sich zu erinnern, dass die geschätzte Kollegin Sedate die arabische Sprache in Wort und Schrift beherrscht«, sagte er, fügte aber gleich darauf noch hinzu: »Natürlich gibt es Hunderte von Dialekten, bei denen verschiedenste Worte eine ganz andere Bedeutung haben, aber im Großen und Ganzen müsste sie das Dokument normalerweise für uns übersetzen können.«
»Dein Wort in Gottes Gehörgang …«
»Und wenn nicht, bestellen wir eben einen Dolmetscher ein, der uns das Ding übersetzt«, sagte ich und beendete so die Diskussion. Ich wollte los. Die Zeit brannte mir unter den Nägeln. Jede vertrödelte Minute erschien mir eine zu viel zu sein. Ich wollte endlich Klarheit, wollte mit eigenen Augen sehen, was in dem Einkaufszentrum geschehen war.
Ich dachte an den falschen Feuerwehrmann. Er hatte von vielen Toten gesprochen, deren Extremitäten durch die Sprengkraft der Bombe abgerissen worden waren. Lüge oder Wahrheit? Ich war hin- und hergerissen, neigte jedoch dazu, seinen Worten, zumindest in diesem Punkt, Glauben zu schenken. Weshalb hätte er uns auch anlügen sollen? Für ihn war unser Tod eine längst beschlossene Sache gewesen!
»Wie lange brauchst du noch?« Meine Frage galt Bräutigam, dessen beide Zeigefinger unaufhörlich auf die Tastatur einstachen. Er war des Zehn-Finger-Schreibens nicht mächtig, erreichte aber dennoch eine beachtliche Anschlagszahl.
»Hab’s gleich, Chef.« Bräutigam schaute nicht auf, sondern tippte munter weiter. »Muss nur noch den Browserverlauf löschen und den Systempapierkorb leeren.«
»Alles klar, Helmut. Ich geh dann schon mal mit Sebastian vor. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist.«
»Mach ich, Chef.«
»Und denk an die Liste.«
»Hab sie schon ausgedruckt. Kannst sie eigentlich gleich mitnehmen«, sagte Bräutigam, während er hinter sich griff und ein Blatt Papier aus dem Drucker fischte. »Ist aber leider nur in Schwarzweiß. Ich habe Arno das Dokument aber schon zugemailt, damit der schon mal checken kann, ob wir was über die Männer in den Datenbanken haben.«
Das war gut! Arno Strobel war unsere Drehscheibe: der Mann im Büro, der alle losen Enden miteinander zu verknüpfen suchte. Arno war ein Cybercop, ein studierter Nerd, der seinen Platz am Rechner, sofern es sich irgendwie vermeiden ließ, selten bis nie verließ. Wenn einer was über die Männer in Erfahrung bringen konnte, dann er.
Ich nickte Bräutigam zu, steckte das Blatt Papier ein und verließ das kleine Büro, das im hinteren Teil der Starbucks-Filiale lag, in einem schmalen lang gezogenen Korridor, der gleichzeitig als Zugang zu den Toiletten diente.
Stimmengemurmel. Auf der angrenzenden Damentoilette schienen sich mehrere Frauen angeregt zu unterhalten. Gelächter war zu hören – die Menschen kehrten in den Alltag zurück, versuchten zu verdrängen, was vor knapp vier Stunden in ihrer Stadt geschehen war. Ich kannte dieses Phänomen, hatte diese sture Ignoranz, manche nannten es auch Selbstschutz, schon mehr als einmal erlebt. Sofern sie nicht selbst betroffen waren, keine Freunde oder nahen Verwandten verloren hatte, fühlte sich viele nur am Rande betroffen. Das eigene Leben stand im Vordergrund. Empathie, Anteilnahme oder Mitgefühl waren zwar vorhanden, wurde jedoch auf ein Mindestmaß reduziert. Es gab natürlich auch Ausnahmen, die aber – wie sagt der Volksmund so schön? – nur die Regel bestätigten.
Ich eilte weiter und versuchte, nicht weiter über das Verhalten dieser Menschen nachzudenken. Flashbacks stürmten auf mich ein: Vor etwas mehr als vier Monaten hatte ich selbst nur mit knapper Not ein Sprengstoffattentat überlebt.
Die nächsten Stunden würden nicht einfach werden. Auch ich musste mich im Vergessen üben, durfte mich nicht von Gefühlen leiten lassen.
Nüchterne Distanz. Objektivität stand jetzt an oberster Stelle. Sobald man einen Tatort betrat, musste man ihn durch die Brille des eiskalten Ermittlers betrachten.
Für mich stellte dieser Teil unseres Jobs stets eine kleine Herausforderung dar; ich war ein Gefühlsmensch, die Dinge völlig nüchtern zu betrachten, lag einfach nicht in meiner Natur.
Mein Kollege Petermann war das genaue Gegenteil von mir. Er war ein Ass in dieser Disziplin, konnte seine Emotionen auf Knopfdruck ausschalten, beinahe jedenfalls. Seine Tatortbegehungen waren legendär. Ihm fielen Dinge auf, die für andere im Verborgenen blieben.
Ich dachte an den Einsatzleiter der Rettungsmannschaften, mit dem ich vor einer guten halben Stunde telefoniert hatte. Das Bild, das er mir vermittelt hatte, ließ wenig Spielraum für Zweifel: Wir hatten es mit einem Sprengstoffanschlag zu tun, was den Gedanken an einen terroristischen Hintergrund natürlich in den Vordergrund rückte. Ein Bekennerschreiben lag jedoch noch immer nicht vor. Zumindest nicht laut meinem Vorgesetzten, der, davon ging ich aus, als einer der Ersten davon erfahren müsste.
Wir tappten also weiterhin im Dunkeln, konnten noch immer nicht zuordnen, wer der Initiator dieser Wahnsinnstat war.
Ich schüttelte den Kopf – es geschah unbewusst.
Im Grunde spielte es keine Rolle, ob ein Bekennerschreiben vorlag oder nicht. Wir würden ohnehin in alle Richtungen ermitteln, da ein Bekennerschreiben über die eigentlichen Täter keinerlei Aussagekraft besaß.
Ich lief weiter, eilte durch das trendige Café, das vor lauter Gästen fast aus den Nähten platzte. Mein Blick suchte Petermann. Ich fand ihm am Tresen; er beglich gerade unsere Rechnung und bedankte sich bei dem Geschäftsführer, für dessen Entgegenkommen.
Ich nickte dem Mann kurz zu – nach Plaudereien stand mir jetzt wirklich nicht der Sinn. Meine Gedanken kreisten um die kommenden Stunden, die für unsere weiteren Ermittlungen wegweisend werden würden.
-4-
Die Luft schmeckte staubig, kratzte in Hals, Augen, Nase und Lunge. Ich lief neben Petermann her, dessen ausgreifender Schritt, unser Tempo vorgab. Wir schwiegen beide, nahmen die Verwüstungen, die die Staubwolke hinterlassen hatte, mit Fassungslosigkeit in uns auf. Petermann verzog keine Miene, doch ich sah an der Art, wie er sich bewegte, dass es ihm nicht anders erging als mir.
Mein Blick checkte die Umgebung, flog die Häuserzeilen entlang, streifte über Fahrzeuge, Straßenschilder, Bäume und Gehwege. Die ersten Neugierigen lugten aus den Fenstern, hier und da hasteten ein paar Passanten durch die verwaisten Straßen.
Endzeitstimmung. Es sah aus wie in einem Film, der das klassische Endzeit-Szenario heraufbeschwor. Über allem lag eine zentimeterdicke Staubschicht. Die Straßenzüge sahen aus, als hätte ein Verrückter Unmengen an Ruß, Glassplitter und Geröll über der Stadt ausgekippt.
Ich war schockiert. Mit solch einer Apokalypse hatte ich nicht gerechnet. Wenn es hier schon so aussah, wie sah es dann erst am eigentlichen Ort des Geschehens aus, dem Einkaufszentrum?
Mein Blick zuckte zu Petermann zurück, der nach wie vor schweigend neben mir herlief; seine Mimik sprach Bände, von Zeit zu Zeit blickte er verstohlen über die Schulter; es wirkte auf mich, als wolle er sich vergewissern, dass uns niemand folgte oder hinterherspionierte.
»Suchst du jemanden?«
Kopfschütteln. Petermanns Brauen wuchsen zusammen, während er mir unverwandt ins Gesicht starrte. Unwille in seinem Blick. Meine Frage nervte ihn, das sah man ganz deutlich.
»Was ist los, Sebastian? Sprich endlich mit mir!«
Erneutes Kopfschütteln. Petermann machte dicht. Er wollte oder konnte jetzt nicht reden, was wirklich nicht allzu oft vorkam.
»Du schuldest mir noch immer eine Antwort«, sagte ich. »Mit dieser Nummer hier sind es dann zwei.«
Keine Reaktion. Petermann eilte neben mir her, als säße uns der Teufel im Nacken. Sein Blick war jetzt stur auf die Kreuzung gerichtet, an der wir unsere Kollegin Fariba vor gut drei Stunden in der Obhut der Feuerwehrmänner zurückgelassen hatten.
Ich fragte mich, was zum Teufel hier los war. Mein Kollege verhielt sich selbst für seine Verhältnisse absolut sonderbar. Es wurde Zeit für ein klärendes Gespräch. Sobald wir hier fertig waren, würde er mir Rede und Antwort stehen müssen.
»Da vorne ist die Sedate.«
Mein Blick folgte Petermanns ausgestrecktem Arm, der auf eine kleinere Gruppe Feuerwehrmänner wies, die etwas abseits vom Geschehen einträchtig beieinanderstanden. Fariba trug noch immer eine Schutzmontur, hatte jedoch Helm und Atemschutz bereits abgelegt. Unsere Blicke trafen sich. Sie lächelte kurz und winkte uns zu.
Eine Minute später hatten wir die Straßenkreuzung passiert, die als solche kaum noch zu erkennen war. Auch hier: eine zentimeterdicke Staubschicht, die mit Glassplittern, Asche und Gesteinsbrocken übersät war.
»Jesses … der schöne Benz.«
Ich sah mich um, erkannte nun auch unseren Dienstwagen, der vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, nach einem mehrtägigen Aufenthalt in der Werkstatt wieder fahrtauglich sein würde.
»Sieht echt übel aus, was?«
Ich schaute auf. Meine Kollegin Fariba stand neben mir. Ihr Lächeln war verschwunden - sie wirkte müde, sah besorgt und abgekämpft aus.
»Ja! Der Schlitten könnte mal eine anständige Wäsche vertragen. Ich hab ja gleich gesagt, dass Schwarz ’ne Scheiß-Farbe ist.«