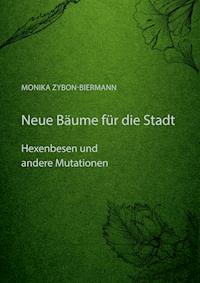
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Während im ersten Buch Hexenbesen und andere Zwerge vor allem kleine Koniferen zu entdecken waren, werden in dieser Fortsetzung bekannte und unbekannte Kultivare heimischer und aus anderen Erdteilen stammender Laubholzarten vorgestellt. Porträts engagierter Gärtner und Hobby-Dendrologen, deren Leidenschaft die Jagd auf neue Bäume ist, sind ebenso zu lesen wie eine Zusammenstellung der bisherigen Beobachtungen und Erkenntnisse zum Thema Hexenbesen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Der Untertitel Hexenbesen und andere Mutationen weist auf das hin, was neu ist an den Bäumen, die für die Verwendung im urbanen Umfeld und für Gärten vorgeschlagen werden. Anders als bei dem Namen Hexenbesen zu vermuten, geht es nicht um Hokuspokus, sondern um ein botanisches Phänomen. So schafft die Natur Gehölze in Kugel-, Säulen- und Zwergform, ohne dass der Gebrauch der Schere nötig wäre. Nicht nur das Thema ist ungewöhnlich, auch die Bildauswahl fällt aus dem Rahmen: Neben Fotos gibt es Zeichnungen und Illustrationen in verschiedenen grafischen Techniken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Hexenbesen zaubern Grün ins Häusermeer
Die Jäger und Sammler
Bömer – Motto: das Unbekannte suchen
Dönigs … und das Arboretum Altdorf
Döring: Ein Name für Liebhaber einer Gattung
Geers: Bäumchen passend zur Spielzeugbahn
Siepe: Im Urlaub Jagd auf Bonsais in spe
Die Gattungen
Acer: Riesen und kleine Sternenbäume
Aesculus: Beliebter Parkbaum mit Schwächen
Buxus: Klassiker des Formschnitts kränkelt
Carpinus: Fit für Stadtklima
Catalpa: Große Herzblätter für Schattenplätze
Cornus: Dekorativ und anspruchslos
Corylus: Von Allergikern gefürchtet
Crataegus: Ein Weißdorn, der nicht sticht
Exochorda: Großer Auftritt im Staudenbeet
Fagus: Wälder wie Kathedralen
Fraxinus: Schwächelt Yggdrasil?
Ginkgo: Daran knabberten schon die Dinos
Hippophae: Ein Pionier braucht feste Grenzen
Ilex: Immergrüne Kulisse
Laburnum: Der Letzte starb im Sturm
Liquidambar: Das war das erste Kaugummi
Philadelphus: Das Parfüm des Bauerngartens
Quercus: Die „Deutsche“ ist nur eine unter vielen
Robinia: Kostbarer Exot oder invasiver Neophyt?
Sorbus: Kleine Kugel war ein Glücksgriff
Tilia: Schattenspender und Kulturgut
Ulmus: Ihnen droht das Aussterben
Weigela: Welcher Zwerg ist der Schönste?
Juniperus: Souvenir an Norwegens Wildnis
Bezugsquellen / Literatur
Pflanzenregister
1. Einführung
Hexenbesen zaubern Grün ins Häusermeer
„Hexenbesen? Die interessieren mich nicht. Entweder es sind Krankheiten oder Koniferen. Ich kann beides nicht leiden.“ Die junge Gartenbesitzerin war sich ihrer Sache sicher. Im Internet hatte sie es gelesen. Bekannte, die sich auskannten, hatten es erzählt. Feste Überzeugungen sind nicht unbedingt ein Privileg höheren Alters.
Die junge Frau steht mit ihrer Abneigung nicht allein. Doch um der guten Sache willen gebe ich nicht auf und füge meiner vor einigen Jahren begonnenen Arbeit über klein bleibende Bäume neue Kapitel hinzu. Das Phänomen mit dem für Nicht-Botaniker steif klingenden Namen Knospenmutation und die Geschichten drumherum verdienen Aufmerksamkeit – mehr als man ihnen bisher gönnte. Die kaum bekannte Art und Weise, mit der die Natur pflanzliche Erbanlagen umkrempeln kann, wird erst seit einigen Jahrzehnten von Gärtnern planmäßig genutzt, und das bisher nur von relativ wenigen, besonders engagierten Vertretern ihres Berufsstandes. Erstaunlich, weil doch knapper Platz in modernen Gärten kaum Gehölze zulässt, die himmelhoch werden.
In dieser Folge stehen Laubbäume im Mittelpunkt. Von denen gibt es inzwischen viele kompakte und zwergwüchsige Formen unterschiedlicher Herkunft. Ein Kapitel ist gartentauglichen Ginkgos gewidmet, den Nachkommen eines lebenden Fossils. Es kommt zwar mit sommergrünen Blättern daher, gehört aber weder zu den anderen Laub- noch zu den Nadelhölzern.
Ein Teil der vorgestellten Sorten hat Hexenbesen-Herkunft. Die daraus gewonnenen Reiser werden meist als Veredelungen, manchmal als Stecklinge vermehrt. Erneut werden aber auch Formen berücksichtigt, die aus einem Samenkorn entstanden sind. Auch sie werden in der Regel als Veredelungen angeboten. Was die Zuordnung schwierig macht: nicht immer ist der Ursprung eines Kultivars, wie man Kulturpflanzen heute nennt, bekannt.
Gärtner sind meist praktisch denkende Menschen. Sie interessieren sich dafür, wie eine Pflanze wächst, wie sie sich vermehren lässt und ob sie aufgrund ihrer Eigenschaften verkäuflich ist. Die Frage der Herkunft ist für sie oft zweitrangig. Fest steht aber: Grüne Mutanten helfen dabei, gestalterische Probleme zu lösen. Selbst wenn sich mit den „X-Trees“ vermutlich nicht wie mit den „X-Men“ im gleichnamigen, verfilmten Comic die Welt retten lässt, so könnten sie doch einen Beitrag zum guten Klima in der Stadt liefern. Und uns nebenher ermutigen, die Gartenkultur nicht ganz abzuschaffen.
Die beängstigende Zunahme von mit Gitterzäunen umrahmten Steinwüsten in Eigenheim-Siedlungen ist vermutlich auf die panische Furcht vor zu viel Gartenarbeit zurückzuführen. Vielleicht ließe sich mit dem Versprechen auf weniger Pflegeaufwand eine Trendwende herbeiführen?
Ein Alpinum ohne Gehölze wäre eine höchst langweilige Angelegenheit: meist nur eine kurze Blühsaison, flache Pflanzenpolster und die Steine als einzige Erhebungen. Erst mit kleinen bzw. schmalen Sträuchern bekommt die Komposition Struktur.
Fällt das Stichwort Hexenbesen, wird selbst von gut informierten Gartenfreunden meist vorausgesetzt, es handele sich um Koniferen. Dazu tragen zwei Veröffentlichungen der letzten Jahre bei, in denen Gehölze aus mutierten Knospen eine große Rolle spielen. In beiden Fällen geht es um Nadelbäume. Der US-Amerikaner Bob Fincham hat sein Buch „Small Conifers for small Gardens“ selbst verlegt; der Ungar Zsolt Mesterhazy, Herausgeber von „Conifer Treasury“, listete auf einer CD alle bekannten Nadelholzarten und Formen auf.
Schon auf Koniferen sind echte Knospenmutationen selten; bei Laubhölzern sind sie so rar wie ein Lottogewinn. Dennoch gibt es in der Lotterie fast jede Woche Leute, die den Jackpot knacken.
Auf allen höheren Pflanzen können Mutationen der Körperzellen auftreten. Nichts anderes sind Hexenbesen nämlich, im Gegensatz zu denjenigen, die im Samen an die Nachkommen weitergegeben werden. Kein Wunder also, dass inzwischen auch Buchen-, Linden- und Eichen-Kultivare mit Hexenbesen-Herkunft existieren. Es gibt etliche Obstsorten aus Knospenmutation wie der Rote Boskoop, einer der weltweit beliebtesten Äpfel. Man fand den rotbackigen Abkömmling des bräunlichen Boskoop schon vor Jahrzehnten auf dem Apfel-Klassiker aus den Niederlanden. Der wurde seinerseits im 19. Jahrhundert als Zufallssämling entdeckt.
Zwergformen, egal welcher Herkunft, sind für Privatgärten auch bei Obstgehölzen zunehmend beliebter. Ein Beispiel: Die höchstens 80 Zentimeter große Johannisbeere Ribes rubrum ‘Jensens Zwerg’ wurde als Hexenbesen gefunden. Die Felsenbirne Amelanchier ovalis ‘Pumila’ habe der Schweizer Staudengärtner Max Frei im Tessin dagegen als Sämling auf einem Felsen entdeckt, berichtet sein Kollege Christian Kreß auf der eigenen Internetseite. Das Wildobstgehölz bringt es auf kaum mehr als einen Meter Höhe – im Gegensatz zur bis vier Meter hohen Art.
Rosensorten gehen außer auf geplante Kreuzungen zu einem hohen Prozentsatz auf Sprossmutation zurück. Die wird in der Rosenzucht „Sport“ genannt und etliche berühmte Sorten gehören dazu. Zu den bekanntesten zählt die Kletterrose ‘New Dawn’, 1930 in England auf der ‘Dr. W. Van Fleet’ entdeckt. In der Tat stammen zahlreiche Gartenformen aller möglichen Arten aus mutierten Körperzellen, nicht nur Nadelhölzer.
Vorurteile gibt es nicht nur im Hinblick auf die Gehölz-Klasse, sondern auch ihr Aussehen. Viele glauben, Hexenbesen seien in der Regel kompakte Kugelbüsche, die einander ähneln. Doch es gibt auch ganz andere Knospenmutationen – sie produzieren nur leicht reduziertes Größenwachstum und außerdem noch Veränderungen des Blattwerks oder der Kronenform. Was jedoch typisch zu sein scheint, ist das dichte Erscheinen junger Triebe bis ins alte Holz hinein.
Da in den letzten Jahrzehnten viele neue, unterschiedliche Sorten hinzugekommen sind, lässt sich mit Recht behaupten: Für jeden Geschmack, jede Lage und den kleinsten Garten ist ein Baum gewachsen!
Im Frühjahr 2012 hörte ich bei einem Vortrag über das Gärtnern im Alter den Rat, notfalls doch ganz darauf zu verzichten, wenn der Platz knapp sei, das Geld für professionelle Hilfe ebenfalls und die eigenen Kräfte durch das ewige Schneiden überfordert. Kein Baum, kein Strauch mehr – das hieße, das Wichtigste wegzulassen: Das Gerüst des Gartens, Konturen, die das ganze Jahr über da sind. Ohne sie kein bewegter Schatten mit Sonnenflecken, Rauschen der Blätter im Wind, keine Herbstfärbung, keine immergrünen Zufluchtsorte oder Gesangsbühnen für Meise und Rotkehlchen, keine Astsilhouetten mit Schneemützchen – was würde uns alles fehlen.
In der Tat bieten besondere Gehölzformen die Chance auf deutlich pflegeleichtere Gartenarchitektur. Schlanke Säulen bringen aufrechte Linien in eine Komposition oder bilden, dicht nebeneinander gepflanzt, schmale Hecken. Breit lagernde „Kissen“ sorgen für die waagerechte Komponente, Kugeln und Zwerge setzen Akzente.
Als Kind liebte ich es, im großen, ländlichen Garten von Freunden unter einer Trauerweide zu sitzen. Ich wusste damals nicht, dass ihr botanischer Name Salix alba ‘Tristis’ lautet, aber sie gefiel mir. Unter der Weide fühlte es sich an wie in einem Freiluftzimmer mit Aussicht. Sie ließ ihre langen dünnen Zweige bis auf den Boden hängen und wie Gardinen im Wind wehen. Das sah meiner Ansicht nach kein bisschen traurig aus.
Eine Auswahl verschiedener kugelförmiger Gehölze ist hier in der Baumschule Wüstemeyer zu sehen. Ihre kompakten, rundlichen Kronen behalten sie auch ohne regelmäßigen Schnitt.
Trauerformen anderer Gattungen offerieren manchmal mehr als nur eine malerische, bizarre Krone. Gönnt man den oft mit dem Zusatz ‘Pendula’ im Namen versehenen Mutanten eine Unterstützung in Form eines Holz- oder Metallgerüstes, werden die seltsam schlaffen Zweige zum grünen Dach – für eine lebendige Gartenlaube. Auch Bäume mit breit und flach wachsenden Kronen eignen sich dazu.
Die für ihr Kochbuch berühmte deutsche Sachbuchautorin des 19. Jahrhunderts, Henriette Davidis, schildert in ihrem weniger bekannten Gartenbuch, wie man eine solche Laube ohne viel Aufwand selbst herstellen kann: „Zuerst bindet man die Zweige des Baumes auf einen kleinen Reifen gleichmäßig auseinander und sowie die Zweige im folgenden Jahre länger gewachsen sind, nimmt man einen größeren Reifen und verfährt wie bei dem ersten. Dies wird so lange wiederholt, bis die Reifen die Größe der Laube erreicht haben, und dann setzt man zur größeren Haltbarkeit einige Stützen darunter.“
Geduld und höherer Preis zahlen sich bald aus
Warum wird bisher so wenig von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht? Das verlangsamte Wachstum und der daraus resultierende höhere Preis für gut entwickelte Exemplare mögen Gründe sein. Es gibt sogar renommierte Gestalter, die verkünden, sie bevorzugten, wenn ältere Kunden ihnen einen Auftrag zur Neuanlage des Gartens erteilten, die stark wachsenden (und billigeren) Bäume, „weil man dann eher etwas sieht“. Die Besitzer würden es vermutlich selbst nicht mehr erleben, wenn das Grünzeug zum Schnäppchenpreis das eigene Heim mit den Nachbarhäusern in ein schattiges Dschungeldorf verwandelt.
Wer länger lebt, wird die Entscheidung bereuen. Entweder greift man selbst zu Säge und Schere, wenn es noch geht oder beauftragt eine teure Fachfirma mit Pflege- und Fällarbeiten. Letztere erfordern in den meisten Gemeinden wegen unterschiedlich strenger Baumschutz-Satzungen einen Behördenmarathon mit vielen gebührenträchtigen Hindernissen. Rechnet man diese Mühen, den Ärger mit der Nachbarschaft und die Kosten zusammen, nimmt sich dagegen der höhere Preis für eine besondere Gehölzsorte in guter Baumschulqualität unbedeutend aus.
Dass es die Gestaltung vereinfacht und leichter gelingen lässt, wenn mehr von Natur aus architektonisch wirkende Baumgestalten in die Gärten einzögen, hat der ehemals sehr populäre Gartenjournalist Karl Heinz Hanisch bereits in seinem 1976 erschienenen „Knaurs großes Gartenbuch“ in einem kleinen Absatz bekannt. Unter „Eine an sich völlig überflüssige Anmerkung“ heißt es da: „Wir wollen unsere Gärten noch immer naturnah haben und möglichst in einem Park leben, selbst wenn es von Zaun zu Zaun nur dreißig Meter sind. Ich schließe mich selbst nicht davon aus.“ Dennoch bekennt er, dass er sich nach Jahren der Erfahrung für einen geometrischen, strenger geordneten Stil entscheiden würde. Was hätte Hanisch sonst anders gemacht? Zum Beispiel Bäume mit kugelrunder Krone gepflanzt, die ohne Schnitt in Form bleiben: Es wären je nach Boden der Spitzahorn Acer platanoides ‘Globosum’ oder die Kugelakazie Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ gewesen. Außerdem hätte er die Laubenulme Ulmus glabra ‘Camperdownii’ und die Trauerbuche Fagus sylvatica ‘Pendula’ ausgesucht.
Das flache, breite Kronendach der alten Ulmensorte hatte es bereits Henriette Davidis angetan. Sie fand es praktisch, dass man sich bei diesem Baum jede zusätzliche Arbeit sparen könne, weil die Laube von allein entsteht.
Rund ein Jahrzehnt später als Hanisch wies die niederländische Gartenbuchautorin Elisabeth de Lestrieux in der 1987 im Ulmer-Verlag erschienenen deutschen Ausgabe ihres Gestaltungs-Ratgebers „Gartenglück“ auf die vielen Möglichkeiten hin, die sich mit der Verwendung ungewöhnlicher Baumgestalten im Garten bieten. Sie zählt rund 57 Trauerformen kleinerer und großer Arten, über 20 Kugelbäume und eine ähnlich große Anzahl säulenförmig wachsender Gehölze auf, die sie für kleinere Gärten besonders empfiehlt. Allen, die unschlüssig sind, rät sie zum Besuch des Arboretums (Gehölzsammlung) Trompenburg bei Rotterdam, wo sein Gründer, der bekannte Dendrologe van Hoey Smith, eine große Auswahl solcher Baumformen zusammengetragen hat. Man solle sich das ansehen, empfiehlt die Niederländerin, um „im eigenen Garten Fehler zu vermeiden.“
Bunte Blätter bringen Farbe für lange Zeit
Nicht nur ungewöhnliche Wuchsformen, auch veränderte Laubfarben sind Mutationen, die sowohl bei Hexenbesen als auch bei Sämlingen zu finden sind. Rötliche, gelbe oder panaschierte, also weiß oder gelb gefleckte Blätter gibt es gelegentlich bei allen Gartenpflanzen, nicht nur bei Gehölzen. Das bunte Blattwerk bringt längere Zeit als Blüten Abwechslung ins Grün, wird aber manchmal mit Argwohn betrachtet: „Das sind nur Krankheiten, die sich in der Natur nicht durchsetzen würden“. Das war erst kürzlich in einer TV-Gartensendung zu hören.
Es ist richtig, dass weiße oder gelbe Sprenkel auf den Blättern durch das Fehlen von Chlorophyll, dem Blattgrün, entstehen. Dieser Farbstoff ermöglicht der Pflanze – vereinfacht gesagt – mit Hilfe des Sonnenlichts aus dem Kohlendioxid der Luft Glukose zu produzieren (Ein „Abfallprodukt“ ist der für uns lebenswichtige Sauerstoff). Der Vorgang heißt Fotosynthese und ist wahrscheinlich durch die Flecken auf den Blättern mehr oder weniger eingeschränkt, weshalb viele ‘Variegata’-Formen empfindlicher und oft weniger wuchskräftig scheinen. Sind sie deswegen krank? Es gibt Sorten mit panaschiertem Blattwerk, die sich seit langem in Gärten behaupten.
Fünf Jahre alt ist dieser Bergahorn mit grün-weißem Blattwerk – eine von 16 unterschiedlichen Aurea- und Variegata-Formen, die von alten Bäumen der Art in der Nähe des Fundortes produziert wurden.
Bei mir lebt seit 30 Jahren ein auffälliger, heimischer Ilex im Vorgarten, lebhaft gelb-grün gemustert, mit rotem Frühjahrsaustrieb und überaus gemächlichem Wachstumstempo. Manchmal treibt er sogar ausschließlich hellgelbe Blätter, die in kalten, sonnigen Wintern schon mal braune Flecken kriegen. Die sind schnell abgeschnitten. Was nachwächst, kann sich dann wieder sehen lassen. Der farbige Stachelbursche übersteht alles – Hitze, Kälte, Schneelasten und Dortmunder Stadtluft – genau wie seine wilden, dunkelgrünen Stechpalmen-Geschwister aus dem Wald.
Jede einzelne der andersartigen Pflanzen verdient, gesondert betrachtet zu werden. Deswegen lassen sich engagierte Gärtner die Zeit, eine Mutation, so attraktiv sie aussehen mag, erst mal ein paar Jahre zu beobachten. Hat sie sich als geeignet erwiesen, darf sie vermehrt und verkauft werden.
Überraschungsgeschenke aus der Ahorn-Wildnis
Gibt es Gründe dafür, wenn in einem eng umgrenzten Areal besonders zahlreich Sämlinge einer bestimmten Baumart mit auffälligen Farbveränderungen zu finden sind? Die Frage stellt sich mir seit langer Zeit daheim, weil ein nach Westen stehender dichter Naturwald mit zahlreichen Bergahornen und Eschen, von Botanikern „Ruderalvegetation“ genannt, jedes Jahr viel Nachwuchs im Garten ablädt. Unter den dicht wie Rasensaat aufkeimenden Ahorn-Sämlingen erscheinen oft Mutanten, manchmal acht bis zehn pro Quadratmeter. Sie sind schon bald nach der Keimung an ihren ersten Blättchen zu erkennen. Meist sehr klein, weiß-rosa, orange-creme, oder nur weißgesprenkelt, tauchen sie überall zwischen ihren größeren, schlicht grünen, der Norm entsprechenden Geschwistern auf.
Seit 2008 habe ich sie regelmäßig eingesammelt, getopft und gepflegt. Nur ein Bruchteil der Jungpflanzen überlebte kalte Winter und sommerliche Pilzattacken. Zwischenzeitlich besaß ich 16 unterschiedliche, mehrjährige Exemplare mit weiß- oder gelb-grünem Muster auf den Blättern in verschiedenen Formen und Größen, die einen recht vitalen Eindruck machten, obwohl sie in Töpfen eingesperrt waren. Inzwischen wachsen sie in Dortmunds Botanischem Garten Rombergpark weiter, wo sie auf Dauer eher am Platz sein werden.
Panaschierungen sollen in der Regel dann häufiger auftreten, wenn bereits ein auf diese Art gefleckter Baum in der Nähe ist, da die Veranlagung vererbt werden kann. Aber auch Viren können solche Erscheinungen verursachen. Ein größerer, buntblättriger Bergahorn, der als Mutter meiner Selektionen infrage käme, war bisher nicht auszumachen. Ob man sich dafür entscheidet, farbiges Blattwerk in die Gestaltung des eigenen Gartens einzubeziehen, ist Geschmackssache. Vielen gefällt es, das rötliche, gelbe oder gefleckte Laub.
Mutationen gehören zum Leben. Selbst wenn sie oft negative Auswirkungen haben – ohne sie gäbe es keine Evolution. Das betont auch Heribert Reif, bis 2013 Leiter des Botanischen Gartens Rombergpark in Dortmund, eines der größten waldartigen Arboreten Europas. Ihm fiel auf, dass in Norddeutschland die ‘Variegata’-Formen beliebter sind als im Süden, wo sie eher auf Ablehnung stoßen und als „krankhaft“ empfunden werden. Er hält es für möglich, dass dies mit dem oft trüberen Licht des Nordens zusammenhängt: „Die Panaschierungen wirken bei Nebel so, als ständen die Bäume in Blüte.“
Der Dortmunder Dendrologe weist darauf hin, dass jede Mutante eine Möglichkeit sein könne, auf sich verändernde Klimabedingungen oder andere Einflüsse zu reagieren. Das heißt, dass Modifikationen im Erbgut, die beispielsweise andere Wuchsformen hervorrufen, auch eine Chance beim Kampf ums Überleben sein können. Und sei es nur deswegen, weil Menschen das neue Erscheinungsbild schön finden.
Wie wär’s mit einem echten Bonsai aus Hexenbesen?
Dass es Hexenbesen heimischer Laubholzarten gibt, dürfte ökologisch orientierte Gärtner interessieren; dass etliche der vorgestellten Sorten nicht nur kompakt wachsen, sondern jeden Schnitt vertragen, könnte Bonsaifreunde in Versuchung führen. Es war übrigens ein Liebhaber dieser Kunstform aus dem Land der aufgehenden Sonne, der mich darauf aufmerksam machte, dass der Ausdruck „Naturbonsai“ für Baumzwerge einen falschen Eindruck erwecke. Auch klassische Bonsais seien natürlichen Ursprungs und keineswegs künstliche Gebilde aus Plastik!
Liebe Bonsaifreunde! Wer käme auf die absurde Idee, die wunderbaren Schöpfungen der Bonsaianer-Gemeinschaft, zu deren Herstellung nicht nur Gestaltungswille und Geschick, sondern auch Wissen um Pflanzen und ihre Ansprüche gehören, mit industriell hergestellten Plastikbäumen gleichzusetzen! Trotzdem hat sich der Ausdruck „Naturbonsai“ für besonders kleine Hexenbesen-Abkömmlinge und Sämlingszwerge durchgesetzt. Nicht weil die nach klassisch-japanischem Rezept geschnittenen und gepflegten Topf-Gehölze kein Stück aus der Natur wären, sondern nur deswegen, weil die Mutationen von allein Miniatur-Format behalten.
Dass die Herstellung eines Bonsais gärtnerisches Wissen, handwerkliches Können und ein künstlerisches Auge erfordern, nötigt allen Betrachtern Anerkennung ab, nicht nur denjenigen, die sich einmal selbst daran versucht haben. Zwischen echter Kunst und künstlicher Imitation liegen Welten (nicht nur die des Geschmacks). Es soll übrigens inzwischen Bonsai-Liebhaber geben, die kompakt und langsam wachsende Pflanzen als praktisches Ausgangsmaterial für ihr anspruchsvolles Hobby entdeckt haben.
Allerdings sind nicht immer alle von ihnen, die per Zufall an ein solches Kultivar geraten, über die besonderen Eigenschaften ihrer Neuerwerbung informiert. In einem Internetforum wundert sich eine Bonsaifreundin, dass ihre Ginkgo-Sorte ‘Mariken’ so dicke, kurze Triebe macht, die sich gar nicht richtig verjüngen und hofft auf spätere „Langtriebe“. Da wird sie wohl vergeblich hoffen. Die aus einem Hexenbesen stammende ‘Mariken’ wird als kompakt mit ausgesprochen dicken Trieben beschrieben, und das wird sie voraussichtlich in ihrem ganzen Ginkgo-Leben bleiben.
Wer sich für eine Zwergform entscheidet, sollte sich überlegen, wie er sich das Endergebnis wünscht und danach die Sorte auswählen. Dass weniger Arbeit mit der Schere nötig ist, mag für geübte Bonsai-Hersteller gewöhnungsbedürftig sein. Dem einen oder anderen wird es vielleicht gefallen, dass man sich mit dem Schneiden und In-Form-Bringen Zeit lassen darf.
Werner Wüstemeyer, seit mehr als einem halben Jahrhundert Hexenbesen- und Gehölzraritäten-Sammler, weist allerdings auf einen Schwachpunkt hin, den Veredelungen von Knospenmutationen aufweisen können: je nach Wahl der Unterlage bildet sich an der Verbindungsstelle eine zunehmend anschwellende Verdickung. Die Unterlage wächst in einem solchen Fall nicht mit in die Breite und wirkt unharmonisch. Bei Sämlingszwergen kann es solche Pannen nicht geben, auch wenn die Samen aus Hexenbesen stammen. Bei der Wahl der richtigen Pfropf-Partner sei das Problem vermeidbar. Bei einer tief angebrachten Veredelung falle es ohnehin weniger auf.
Gehölze in Bonsaiform zu schneiden, sei immer möglich. Wichtigste Regel beim Gebrauch der Schere, nicht nur für Bonsais: Immer so früh wie möglich einkürzen, nicht erst warten, bis aus dünnen Zweigen dickere Äste geworden sind. Übrigens: Einen Bonsaianer, der selbst auf Pflanzenjagd geht, um besonders attraktive, kleinblättrige und schwach wachsende Bäume für sein Hobby zu finden, kann man in dieser Buchfolge kennenlernen.
500 Jahre hinterließen Spuren an „Schöner Eiche“
Wenn Waldbäume wegen auffälliger, ungewöhnlicher Form und Größe aus der Reihe tanzen, so erregte das schon in früheren Jahrhunderten Aufsehen. Das bekannteste Beispiel Deutschlands ist ein seltsamer Laubbaum, die schmale und aufrechte „Schöne Eiche“, ein uraltes Exemplar, seit über 500 Jahren in Harreshausen fest verwurzelt. Der kleine Ort ist heute ein Stadtteil von Babenhausen im hessischen Kreis Darmstadt-Dieburg.
Die Pyramidenform der Stieleiche (Quercus robur ‘Fastigiata’) wurde in früheren Jahrhunderten vor allem in großen Parks angepflanzt. Heute sieht man sie ab und zu als Straßenbaum oder auf Plätzen in der Stadt. Ihre Form erinnert an die früher als Alleebäume beliebten Pappeln.
Was die „Schöne Eiche“ betrifft, so wurde gelegentlich (erstmals Ende des 19. Jahrhunderts) behauptet, alle „schlank“ wachsenden Eichen stammten von der einen aus Hessen ab. Einen Beweis dafür gibt es nicht. Vor rund 250 Jahren fand ein Künstler die entartete Baumschönheit des Zeichnens wert. Dieses Blatt ist heute ihre älteste Abbildung. Heute sieht sie anders aus als damals. Blitzeinschläge spalteten und deformierten die Krone. Die Zeichnung links zeigt die heutige Silhouette.
Rund um dieses außergewöhnliche Naturdenkmal, das schon vor Jahrhunderten in botanisch interessierten Kreisen Prominentenstatus hatte, ranken sich viele Geschichten und Legenden. Fromme Bürger glaubten daran, dass eines Tages der Bischof von Mainz während der Jagd seine Monstranz verlor, die auf die damals noch junge Eiche gefallen und festgewachsen sei. Das wäre also das gute Gegenstück zur bösen Hexenbesen-Geschichte.
Nicht ganz so phantastisch, aber mit Sicherheit ebenso falsch ist die Behauptung, die schmale Wuchsform rühre daher, weil der Baum in einen Brunnenschacht hinein gewachsen sei.
Die ungewöhnlich zierliche Statur der mutierten Deutschen Eiche muss einem in Pflanzen verliebten französischen General während des Siebenjährigen Krieges ins Auge gefallen sein. Der war zu dieser Zeit Kommandant der Besatzungstruppen und hat angeblich das seltene Gewächs von eigenen Soldaten bewachen lassen, damit es nicht versehentlich als Brennholz ende. Er habe zudem Eicheln zur Vermehrung nach Frankreich geschickt, wird berichtet.
Das war, wie wir heute wissen, gar keine dumme Idee. Die aus dem Samen von Pyramideneichen gezogenen Sämlinge weisen häufig die schmale und aufrechte Form der Mutterpflanze auf.
Was aber die schon mal im Internet zu lesende Behauptung, die „Schöne Eiche“ gehe auf eine Knospenmutation zurück, betrifft, so ist das eher unwahrscheinlich. Der Baum wird seit mehr als 300 Jahren in allen Berichten und Darstellungen immer mit schmaler Krone und aufrecht wachsenden Ästen geschildert. Daher liegt die Vermutung, er habe diese Form von Anfang an gehabt, nahe. Das hieße also, er wäre als Sämling entstanden.
Einmal soll die berühmte Pflanze die Tendenz zum Rückfall ins Gewöhnliche gezeigt haben. Angeblich habe um das Jahr 1700 der im Raum Harreshausen als Grundherr verantwortliche Graf seinen Oberförster angewiesen, einen einzelnen Ast, der entgegen der aufrechten Wuchsform seitlich ausbrach – so wie ordinäre Eichenäste – abzuschießen. Die „falschen“ Äste gibt es übrigens bis auf den heutigen Tag immer mal wieder bei Pyramideneichen.
Verhext und trotzdem fruchtbar
Warum kommt es zur Entstehung von Hexenbesen? Welche Eigenschaften zeichnen sie aus? In Deutschland haben sich Wissenschaftler bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Phänomen der Knospenmutation beschäftigt. Der Münchener Botanikprofessor Karl Freiherr von Tubeuf beschrieb schon früh die auffallende Erscheinung an Koniferen. In Jahrbüchern der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft nahm er im Fragekasten dazu Stellung. Von Tubeuf verwies bereits 1912 auf die unterschiedlichen Ursachen der Hexenbesenbildung und auch darauf, dass für dieses Phänomen gelegentlich kein Krankheitserreger feststellbar sei. Es sei ihm geglückt, durch Aussaat aus Zapfen tragenden Fichten-Hexenbesen die Vererbbarkeit der Hexenbesenbildung nachzuweisen.
Er stellte die These auf, es handele sich um eine „Knospenvariation oder Mutation“ und nahm an, dass „alle im gärtnerischen Handel befindlichen Zwergformen“ Abkömmlinge „ähnlich gestalteter größerer oder kleinerer Hexenbesen“ seien. Er erklärte auch, monströse Formen seien auf Verbänderungen (Fasziationen) zurückzuführen. Letztere seien zwar durch äußere Einflüsse verursacht, könnten aber dennoch zum Teil vererbt werden. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts waren diese Theorien völlig neu. Erst 1901 prägte der niederländische Botaniker Hugo de Vries den Begriff der Mutation.
Genetische Veränderungen haben offensichtlich unterschiedlichste Ursachen. Manche sind bekannt; manchmal gibt es Überraschungen. Baumschulen und Gartenbesitzer interessiert vor allem das Fazit von Tubeufs: Für die gärtnerische Praxis ergäbe sich die Möglichkeit, eine „Fülle von Formen“ aus Hexenbesen zu erziehen – und zwar sowohl durch Stecklinge, Veredelung als auch die selten gebildeten Samen.
1933 veröffentlichte der Münchener Botaniker erneut einen Artikel dazu. Er berichtet unter dem Titel „Das Problem der Hexenbesen“ in der Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz über seine 1907 und 1930 durchgeführten Experimente mit Samen von Hexenbesen. Die Aussaatergebnisse brachten im Durchschnitt ein Drittel von Sämlingen mit „buschigem“ Zwergwuchs hervor.





























