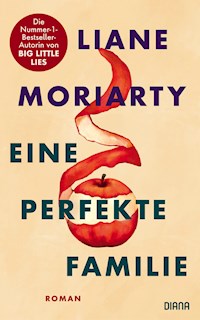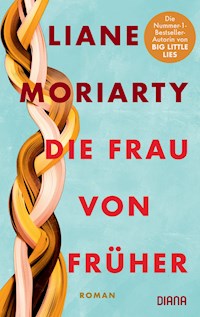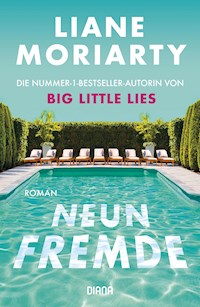
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neun Fremde und zehn Tage, die alles verändern: In einem abgelegenen Wellness-Resort treffen fünf Frauen und vier Männer aufeinander, die sich noch nie zuvor begegnet sind. Sie alle sind in einer Krise und wollen ihr altes Leben hinter sich lassen. Bald schon brechen alte Wunden auf und lang gehütete Geheimnisse kommen ans Licht. Denn nichts ist so, wie es scheint in Tranquillum House …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Der Roman
Ein Aufenthalt im Wellness-Refugium Tranquillum House verspricht Heilung und Verwandlung. Neun vollkommen Fremde treffen hier aufeinander und wollen aus unterschiedlichsten Gründen ihr altes Leben hinter sich lassen und sich verändern. So wie Frances, die Opfer eines Heiratsschwindlers wurde und obendrein ihre Schriftstellerkarriere aufgeben muss. Oder Tony, der als ehemaliger Footballstar inzwischen übergewichtig und planlos ist, genauso wie Carmel, die plötzlich mit ihren vier Kindern allein dasteht.
Masha, die Hotelmanagerin, kennt sie alle und hat eine Mission. Denn hinter der glamourösen Fassade des Retreats geschehen Dinge, von denen niemand etwas ahnt. Und so ist keiner der Gäste auf das vorbereitet, was in den folgenden zehn Tagen passiert ...
»Die Lektüre dieses Romans macht süchtig.« Observer
Die Autorin
Liane Moriarty ist seit Jahren international erfolgreich, ihre Romane werden insgesamt in 46 Länder veröffentlicht. Mit der Verfilmung von Big Little Lies eroberte die Autorin zudem Hollywood: die HBO-Serie wurde mit einem Emmy und dem Golden Globe ausgezeichnet, in den Hauptrollen Reece Witherspoon und Nicole Kidman. Beide sind Produzentinnen und sicherten sich auch die Filmrechte an Neun Fremde. Liane Moriarty lebt mit Mann, Sohn und Tochter in Sydney.
LIANE
MORIARTY
NEUN
FREMDE
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Dietlind Falk
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 by Liane Moriarty
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel
Nine Perfect Strangers bei Flat Iron, New York
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe
© 2019 by Diana Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Katja Bendels
Umschlaggestaltung: Geviert Grafik & Typografie, München
nach einem Entwurf von Penguin UK
Umschlagmotiv: © Gettyimages Motive 157334516, 697642227
Autorenfoto: © Uber Photography
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
e-ISBN 978-3-641-24972-4V002
www.diana-verlag.de
Für Kati.
Und für Dad.
Mit ganz viel Liebe.
Du denkst, du bist das Problem,
Doch du bist die Lösung.
Du denkst, du bist das Schloss an der Tür,
Doch du bist der Schlüssel, der es öffnet.
RUMI
Gerade, als ich den Sinn des Lebens gefunden hatte,
haben sie ihn geändert.
GEORGE CARLIN
1
Yao
»Es geht mir gut«, sagte die Frau. »Mir fehlt nichts.«
Yao war anderer Meinung.
Heute war sein erster Ausbildungstag zum Notfallsanitäter. Sein dritter Einsatz. Nervös war er nicht, aber er konnte es einfach nicht ertragen, auch nur den geringsten Fehler zu machen, und so befand er sich in einem Zustand höchster Konzentration. Schon als Kind hatten Fehler hemmungslose Heulattacken bei ihm ausgelöst, und noch heute bekam er Magenkrämpfe davon.
Eine einzelne Schweißperle rann an der Schläfe der Frau hinunter und hinterließ eine Schneckenspur in ihrem Make-up. Yao fragte sich, warum Frauen sich neuerdings das Gesicht orange anpinselten, aber das tat jetzt nichts zur Sache.
»Es geht mir gut. Das ist bestimmt nur so ein 25-Stunden-Virus«, sagte sie mit dem Hauch eines osteuropäischen Akzents.
»Du musst deine Patienten und die Umgebung genau beobachten«, hatte Yaos Ausbilder, Finn, zu ihm gesagt. »Stell dir vor, du bist ein Geheimagent auf diagnostischer Spurensuche.«
Yao beobachtete die übergewichtige Frau mittleren Alters mit auffälligen roten Ringen unter ihren markanten wassergrünen Augen und dünnem braunen Haar, das sie im Nacken zu einem traurigen Dutt zusammengebunden hatte. Sie war blass und schwitzte, ihr Atem rasselte. Starke Raucherin, ihrem Aschenbechergeruch nach zu urteilen. Die Frau saß in einem ledernen Chefsessel hinter einem riesigen Schreibtisch. Die Größe ihres schicken Eckbüros im siebzehnten Stock mit Blick auf den Hafen von Sydney deutete darauf hin, dass sie es hier mit einem ziemlich hohen Tier zu tun hatten. Das Opernhaus war so nah, dass man die einzelnen diamantenförmigen cremefarbenen Kacheln erkennen konnte.
Die Frau scrollte mit ihrer Maus auf einem überdimensionalen Bildschirm durch ihre E-Mails, als wäre die Untersuchung der beiden Sanitäter nur eine lästige Lappalie – wie zwei kleine Handwerker, die eine Steckdose reparieren sollten. Sie trug ihren maßgeschneiderten blauen Anzug wie eine Strafe. Der Stoff ihres Blazers spannte unbequem an den Schultern.
Yao nahm die freie Hand der Frau und klemmte ihr ein Pulsoximeter an den Finger. Dabei fiel ihm ein schuppig-roter Hautfleck an ihrem Unterarm auf. Prädiabetes?
Finn fragte: »Nehmen Sie irgendwelche Medikamente, Masha?« Er redete mit seinen Patienten immer in einem lockeren Plauderton, als stünde er mit einem Bier in der Hand beim Barbecue.
Yao war aufgefallen, dass Finn die Patienten immer mit Vornamen ansprach. Ihm selbst fiel es schwer, mit ihnen zu reden wie mit alten Freunden, doch wenn er dadurch bessere Resultate erzielte, würde er daran arbeiten, seine Schüchternheit loszuwerden.
»Nein, ich nehme keine Medikamente«, erklärte Masha mit starrem Blick auf den Bildschirm. Entschieden klickte sie irgendetwas an, dann wanderte ihr Blick wieder zu Finn. Ihre Augen sahen aus, als hätte sie sie von einer wesentlich attraktiveren Frau geborgt. Vermutlich gefärbte Kontaktlinsen. »Ich erfreue mich bester Gesundheit. Tut mir leid, dass ich Ihre Zeit verschwendet habe. Ich hätte garantiert keinen Krankenwagen gerufen.«
»Ich habe ihn gerufen«, sagte eine auffallend hübsche dunkelhaarige Frau in High Heels und einem karierten Bleistiftrock, dessen Muster an die Kacheln des Opernhauses erinnerte. Der Rock stand ihr hervorragend, doch auch das tat gerade nichts zur Sache, selbst wenn sie im Grunde Teil der Umgebung war, die Yao genau beobachten sollte. Die junge Frau kaute an ihrem kleinen Fingernagel. »Ich bin ihre Assistentin. Sie … ähm …« Sie senkte die Stimme, als wäre das, was jetzt folgte, ein wenig peinlich. »Sie ist kreidebleich geworden, und dann ist sie vom Stuhl gefallen.«
»Ich bin nicht vom Stuhl gefallen!«, fauchte Masha.
»Sie ist irgendwie runtergerutscht«, verbesserte sich die Assistentin.
»Mir war kurz schwindelig, das ist alles«, sagte Masha zu Finn. »Und dann habe ich direkt weitergearbeitet. Könnten wir diese Sache ein wenig abkürzen? Ich zahle gerne Ihren vollen Preis oder Tarif oder was auch immer Sie für Ihren Service berechnen. Selbstverständlich bin ich privatversichert. Ich habe nur gerade wirklich keine Zeit für so was.« Sie wandte sich an ihre Assistentin.
»Habe ich nicht einen Elf-Uhr-Termin mit Ryan?«
»Ich werde ihm absagen.«
»Habe ich da gerade meinen Namen gehört?« Ein Mann in einem zu eng geratenen lila Hemd kam mit einem Aktenstapel unter dem Arm ins Büro stolziert. »Ist was passiert?« Er sprach mit einem aufgesetzten britischen Akzent, als wäre er ein Verwandter der Queen.
»Nein«, sagte Masha. »Setz dich.«
»Masha ist gerade nicht verfügbar!«, protestierte die arme Assistentin.
Yao fühlte mit ihr. Er konnte Menschen nicht leiden, die leichtsinnig mit ihrer Gesundheit umgingen, und fand, dass sein Beruf mehr Respekt verdient hatte. Außerdem hegte er eine tiefe Abneigung gegen Männer mit gegelten Stachelfrisuren und hochgestochenem Akzent, die zu enge lila Hemden trugen, um ihren übertrainierten Waschbrettbauch zu präsentieren.
»Nein, nein, setz dich, Ryan! Das hier wird nicht mehr lange dauern. Es geht mir gut.« Masha winkte ihn ungeduldig herein.
»Könnte ich bitte Ihren Blutdruck messen, ähm, Masha?« Mutig murmelte Yao ihren Namen, während er ihr die Armmanschette anlegte.
»Erst mal sollten wir die Jacke ausziehen.« Finn klang amüsiert. »Sie haben ja ganz schön viel um die Ohren, Masha.«
»Ehrlich gesagt brauche ich auf denen hier echt dringend ihre Unterschrift«, raunte dieser Ryan der Assistentin zu.
Ehrlich gesagt muss ich hier echt dringend die Vitalparameter deiner Chefin checken, Arschloch, dachte Yao.
Finn half Masha aus ihrem Blazer und legte ihn galant über die Sessellehne.
»Her mit den Dokumenten, Ryan.« Masha richtete die Knopfreihe ihrer cremefarbenen Seidenbluse.
»Sie müssen nur die ersten beiden Seiten absegnen.« Der Typ hielt ihr die Akte hin.
»Soll das ein Witz sein?« Ungläubig hob die Assistentin die Hände.
»Du solltest später wiederkommen, mein Freund«, sagte Finn nun in einem deutlich schärferen Tonfall.
Der Typ machte einen Schritt zurück, doch Masha verlangte mit einem Fingerschnipsen nach der Akte, sodass er augenblicklich nach vorn stürzte und sie ihr aushändigte. Ganz offensichtlich jagte Masha ihm deutlich mehr Angst ein als Finn, und das sollte was heißen, denn Finn war ein ziemlich großer, kräftiger Kerl.
»Das hier dauert höchstens noch vierzehn Sekunden«, sagte Masha zu Finn. Ihre Sprache wurde undeutlich, sodass man statt »Sekunden« nur noch »Sekunnen« hörte.
Yao, noch immer mit der Blutdruckmanschette in der Hand, warf Finn einen Blick zu.
Plötzlich kippte Mashas Kopf zur Seite, als wäre sie gerade eingenickt. Die Akte fiel ihr aus der Hand.
»Masha?« Finn sprach in einem lauten Befehlston.
Sie sackte nach vorn, und ihre Arme schlackerten durch die Luft wie die einer Puppe.
»Genau so!«, rief die Assistentin mit Genugtuung. »Genau das hat sie eben auch gemacht!«
»O mein Gott!« Der Typ im lila Hemd wich zurück. »O Gott. Sorry! Ich werde …«
»Okay, Masha, wir werden Sie jetzt auf den Boden legen«, sagte Finn.
Er griff ihr unter die Arme, und Yao nahm, stöhnend vor Anstrengung, ihre Beine. Sie war eine sehr große Frau, viel größer als er selbst. Mindestens eins achtzig und vollkommen schlaff. Gemeinsam legten sie Masha in stabiler Seitenlage auf den grauen Teppich. Finn faltete ihren Blazer zu einem Kissen.
Mashas linker Arm hob sich wie von Geisterhand stocksteif über ihren Kopf. Die Hände ballten sich zu verkrampften Fäusten. Ihr Atem kam weiterhin stoßartig, und ihr Körper zuckte.
Sie hatte einen Anfall.
Krampfanfälle waren kein schöner Anblick, aber Yao wusste, dass man nichts tun konnte, außer abzuwarten. Masha trug nichts um den Hals, das er hätte lockern können. Er kontrollierte ihre unmittelbare Umgebung, fand aber nichts, woran sie sich den Kopf hätte stoßen können.
»War es vorhin genauso?« Finn sah die Assistentin fragend an.
»Nein. Nein. Da ist sie einfach nur ohnmächtig geworden.« Mit großen Augen und einer Art angewiderter Faszination betrachtete sie ihre Chefin.
»Hat sie häufiger solche Anfälle?«, fragte Finn.
»Ich glaube nicht. Ich weiß nicht.« Während sie antwortete, schlich sie rückwärts Richtung Bürotür, wo sich bereits eine Menschentraube bildete. Jemand reckte ein Handy in die Luft und filmte fleißig mit, als wäre der Krampfanfall seiner Chefin ein Rockkonzert.
»Herzmassage einleiten.« Finns Augen waren ausdruckslos und glatt wie Steine.
Einen Moment lang – nur eine Sekunde, aber dennoch – reagierte Yao nicht, da sein Gehirn noch damit beschäftigt war zu verarbeiten, was gerade geschehen war. An diese erstarrte Schrecksekunde würde er sich ein Leben lang erinnern. Er wusste, dass anfallartige Symptome einem Herzstillstand vorausgehen konnten, doch er hatte nicht sofort daran gedacht, weil sein Hirn nur eine einzige Realität zugelassen hatte: Die Patientin hat einen Anfall. Ohne Finn hätte Yao sich zurückgelehnt und ohne etwas zu unternehmen einer Frau dabei zugesehen, wie sie einen Herzstillstand erlitt. Wie ein Pilot, dessen Flugzeug abstürzte, weil er sich auf kaputte Instrumente verließ. Yaos wichtigstes Instrument war sein Gehirn, und an diesem Tag funktionierte es nicht richtig.
Auch nach zwei Elektroschocks ließ sich kein regelmäßiger Puls wiederherstellen. Finn und Yao trugen Masha Dmitrichenko mit totalem Herzstillstand aus ihrem Eckbüro, in das sie niemals zurückkehren würde.
2
Zehn Jahre später
Frances
An einem heißen, wolkenlosen Januartag fuhr die ehemalige Bestsellerautorin Frances Welty sechs Stunden nordwestlich von ihrem Haus in Sydney allein durch ödes Buschland.
Der Highway rollte sich wie ein hypnotisierendes schwarzes Band vor ihr aus, während ihr die Klimaanlage auf höchster Stufe arktische Luft ins Gesicht fauchte. Wie eine riesige tiefblaue Kuppel wölbte sich der Himmel über ihr winziges, einsames Auto. Für ihren Geschmack war der Himmel hier um einiges zu groß.
Frances musste lächeln. Sie kam sich vor wie einer dieser pingeligen Querulanten auf TripAdvisor: Ich also zur Rezeption, um nach einem tiefhängenden, angenehmeren Himmel MIT Wolken zu fragen. Eine Frau mit starkem ausländischen Akzent sagte mir, es seien gerade keine anderen Himmel vorrätig! Und dann auch noch unfreundlich! NIE WIEDER. REINE GELDVERSCHWENDUNG!
Frances wurde klar, dass sie möglicherweise kurz davor war, den Verstand zu verlieren.
Nein, war sie nicht, ihr ging es gut. Sie war absolut zurechnungsfähig. Indianerehrenwort.
Sie spreizte die Finger und umfasste dann wieder fest das Lenkrad, blinzelte mit trockenen Augen hinter ihrer Sonnenbrille und gähnte, wobei sie den Mund so weit aufriss, dass ihr Kiefergelenk knackte. »Autsch«, sagte sie, obwohl es gar nicht wehgetan hatte.
Seufzend spähte sie aus dem Fenster und suchte nach irgendetwas, das die Monotonie der Landschaft durchbrach. Dort draußen war es hart und unerbittlich. Sie konnte sich alles genau vorstellen: die summenden Schmeißfliegen, die bemitleidenswert muhenden Kühe und dieses weiß glühende Licht. Weites braunes Land, in der Tat.
Komm schon. Wenigstens eine Kuh, ein Feld, eine Hütte. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist …
Nichts.
Sie streckte sich ein wenig auf ihrem Sitz, und ihr Kreuz rächte sich mit einer so heftigen Schmerzattacke, dass ihr die Tränen in die Augen stiegen.
»Verflucht«, sagte sie kläglich.
Die Rückenschmerzen hatten vor zwei Wochen angefangen, genau an dem Tag, an dem sie endlich akzeptiert hatte, dass Paul Drabble verschwunden war. Sie hatte die Nummer der Polizei gewählt und sich gefragt, wie sie sich auf Paul beziehen sollte – Partner, Freund, Lover, Mann für gewisse Stunden? –, als sie das erste Ziehen bemerkte. Das banalste Paradebeispiel für Psychosomatik aller Zeiten, nur dass diese Einsicht das Ganze nicht besser machte.
Es war seltsam, jeden Abend im Spiegel den eigenen Rücken zu betrachten, der so weich und weiß und ansatzweise rundlich aussah wie eh und je. Frances rechnete jedes Mal damit, dort irgendetwas Grässliches zu entdecken, wie etwa ein knorriges Netz aus Baumwurzeln.
Sie schaute auf die Uhr am Armaturenbrett: 14.57 Uhr. Jeden Augenblick musste die Ausfahrt kommen. Sie hatte den Leuten von Tranquillum House gesagt, sie würde zwischen halb vier und vier ankommen, und sie hatte keine unvorhergesehenen Pausen eingelegt.
Tranquillum House war ein »gehobenes Gesundheits- und Wellnessresort«. Ihre Freundin Ellen hatte sie darauf gebracht. »Du musst heilen«, hatte sie Frances beim Lunch letzte Woche nach dem dritten Cocktail (einem exzellenten White Peach Bellini) erklärt. »Du siehst furchtbar aus.«
Ellen hatte vor drei Jahren ein »Cleansing« in Tranquillum House gemacht. Auch sie war »ausgebrannt« und »total down« und »nicht mehr in Form« gewesen und …
»Ist ja gut, ich verstehe schon«, hatte Frances gesagt.
»Es ist eine ziemlich … ungewöhnliche Einrichtung. Ihr Ansatz ist unkonventionell. Es hat mein ganzes Leben verändert.«
»Wie genau hat sich denn dein ganzes Leben verändert?«, hatte Frances mit gutem Recht gefragt, doch eine klare Antwort auf ihre Frage hatte sie nie bekommen. Am Ende ging es offenbar um das Weiß in Ellens Augen, das wirklich richtig weiß geworden war, quasi übernatürlich weiß! Außerdem hatte sie drei Kilo abgenommen! Wobei es in Tranquillum House nicht in erster Linie ums Abnehmen ging – das betonte Ellen in aller Deutlichkeit. Es ging um Wellness, aber weißt du, welche Frau beschwert sich schon, wenn sie drei Kilo abnimmt? Ellen jedenfalls nicht, so viel stand fest. Frances auch nicht.
Zu Hause hatte Frances sich die Homepage von Tranquillum House angesehen. Sie war nie ein Fan von Verzicht gewesen, hatte nie eine Diät gemacht, selten Nein gesagt, wenn ihr der Sinn nach Ja stand und andersrum. Wenn man ihrer Mutter Glauben schenken durfte, war Frances’ gieriges erstes Wort »mehr« gewesen. Sie hatte immer mehr gewollt.
Doch die Fotos auf der Webseite hatten eine seltsame, unerwartete Sehnsucht in ihr geweckt. Alle Bilder hatten einen goldenen Schimmer und waren offenbar bei Sonnenauf- oder -untergang aufgenommen worden, oder ein Filter sorgte dafür, dass es zumindest so aussah. Angenehm mittelalte Menschen in Kriegerpose im weißen Rosengarten neben einem wunderschönen Landhaus. Ein Paar in einer der heißen Quellen, die in der Nähe des Resorts lagen. Die beiden hatten die Augen geschlossen, den Kopf zurückgelegt und lächelten ekstatisch im blubbernden Wasser. Auf einem anderen Foto genoss eine Frau auf einer Liege neben einem türkisfarbenen Pool eine HotStone-Massage. Frances stellte sich vor, wie ebenjene Steine wundervoll symmetrisch auf ihre eigene Wirbelsäule gelegt wurden und die magische Hitze ihre Schmerzen dahinschmelzen ließ.
Während sie von heißen Quellen und sanftem Yoga träumte, blinkte eine Nachricht auf ihrem Bildschirm auf: Nur noch ein Platz frei für das exklusive zehntägige Körper-und-Geist-Retreat »Total Transformation«! Die Nachricht hatte einen albernen Ehrgeiz in Frances geweckt, und sie hatte auf »Jetzt buchen« geklickt, obwohl sie nicht wirklich glaubte, dass nur noch ein Platz frei war. Trotzdem hatte sie die Daten ihrer Kreditkarte verdammt schnell eingetippt, nur für den Fall.
Offenbar würden zehn Tage ausreichen, um sie »auf eine Weise zu verändern«, die sie »niemals für möglich gehalten hätte«. Sie würde fasten, meditieren, Yoga machen und an kreativen »Übungen zur emotionalen Öffnung« teilnehmen. Sie würde ohne Alkohol, Zucker, Koffein, Gluten und Milchprodukte auskommen müssen, doch da sie gerade erst das Degustationsmenü im Four Seasons hinter sich hatte und insofern randvoll mit Alkohol, Zucker, Koffein, Gluten und Milchprodukten war, schien ihr dieser Verzicht keine große Sache zu sein. Die Mahlzeiten würden »speziell an ihre Bedürfnisse« angepasst werden.
Bevor ihre Buchung »akzeptiert« wurde, musste sie einen sehr langen, ihre Privatsphäre ziemlich missachtenden Fragebogen ausfüllen: Beziehungsstatus, Ernährung, medizinische Vorgeschichte, Alkoholkonsum der vergangenen Woche und so weiter. Fröhlich sog sie sich die Antworten aus den Fingern. Das ging die ja nun wirklich gar nichts an. Sogar ein Foto musste sie hochladen, das nicht älter sein durfte als zwei Wochen. Sie wählte eines aus, das sie beim Lunch mit Ellen im Four Seasons zeigte, in der Hand einen Bellini.
Man musste ankreuzen, was man sich von den zehn Tagen erhoffte: von »intensive Paartherapie« bis »deutlicher Gewichtsverlust« war alles dabei. Frances wählte nur die angenehm klingenden Optionen wie »spirituelles Wachstum«.
Wie so vieles in ihrem Leben war ihr das Ganze damals wie eine richtig gute Idee erschienen.
Die TripAdvisor-Bewertungen für Tranquillum House, die sie sich erst angesehen hatte, nachdem sie die nicht erstattungsfähige Anzahlung getätigt hatte, waren auffällig gemischt. Entweder war es die beste, unglaublichste Erfahrung aller Zeiten – die Leute wünschten sich, sie könnten mehr als fünf Sterne geben, priesen fast schon missionarisch das Essen, die heißen Quellen, die Mitarbeiter … –, oder es war das Schlimmste, was sie je erlebt hatten. Sie drohten mit rechtlichen Schritten, sprachen von posttraumatischem Stress und schrieben Warnungen à la »Betreten auf eigene Gefahr«.
Frances warf noch einmal einen Blick aufs Armaturenbrett und hoffte, genau in dem Moment hinzusehen, wenn die Uhr auf drei umsprang.
Lass das. Konzentrier dich. Guck auf die Straße, Frances. Du bist hier die Verantwortliche.
Irgendetwas flackerte am Rand ihres Sichtfelds auf, und sie zuckte zusammen, bereit für den heftigen Rums, mit dem ein Känguru durch die Windschutzscheibe krachen würde.
Doch nichts geschah. Diese imaginären Wildtierkollisionen waren nur in ihrem Kopf. Wenn es passierte, passierte es eben. Vermutlich hätte sie ohnehin keine Zeit, um zu reagieren.
Sie erinnerte sich an einen Roadtrip, vor langer Zeit, mit ihrem damaligen Freund. Ein sterbender Emu, der von einem Auto angefahren worden war, hatte mitten auf dem Highway gelegen. Frances war auf dem Beifahrersitz geblieben wie eine passive Prinzessin, während ihr Freund ausgestiegen war und den armen Emu mit einem Stein getötet hatte. Ein einziger fester Schlag auf den Kopf. Als er sich wieder auf den Fahrersitz fallen ließ, war er verschwitzt und aufgekratzt, ein Stadtkind, entzückt über seinen menschlichen Pragmatismus. Frances hatte ihm dieses verschwitzte Hochgefühl nie verziehen. Es hatte ihm gefallen, den Emu zu töten.
Sie wusste nicht, ob sie ein sterbendes Tier töten könnte, auch jetzt nicht, da sie zweiundfünfzig Jahre alt und finanziell abgesichert war, zu alt für eine Prinzessin.
»Du könntest den Emu töten«, sagte sie laut. »Natürlich könntest du das.«
Du liebe Güte. Gerade war ihr wieder eingefallen, dass ihr damaliger Freund tot war. Oder? Ja, definitiv tot. Irgendwer hatte es ihr vor ein paar Jahren erzählt. Angeblich Komplikationen bei einer Lungenentzündung. Gary hatte tatsächlich immer furchtbar unter seinen Erkältungen gelitten. Frances hatte nie sonderlich viel Mitleid mit ihm gehabt.
Genau in diesem Moment begann ihre Nase, wie ein kaputter Wasserhahn zu tropfen. Perfektes Timing. Mit der einen Hand hielt sie das Lenkrad fest, mit dem Handrücken der anderen wischte sie sich die Nase ab. Ekelhaft. Vermutlich Garys Rache aus dem Jenseits – zu Recht. Früher hatten sie Roadtrips gemacht und sich gegenseitig ihre Liebe geschworen, und heute erinnerte sie sich nicht einmal mehr daran, dass er tot war.
Sie entschuldigte sich im Geiste bei Gary, wobei er, wenn er ihre Gedanken lesen konnte, wissen musste, dass es nicht ihre Schuld war. Dann wusste er, wie unfassbar ungenau und vergesslich man mit dem Alter wurde. Nicht immer. Aber manchmal.
Manchmal bin ich richtig auf Zack, Gary.
Wieder musste sie die Nase hochziehen. Diese grässliche Kopfgrippe schleppte sie schon länger mit sich herum als die Rückenschmerzen. Hatte sie nicht schon an dem Tag geschnieft, als sie das Manuskript abgeliefert hatte? Vor drei Wochen. Ihr neunzehntes Buch. Früher, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, Ende der Neunziger, hätte ihre Lektorin binnen zwei Tagen Champagner und Blumen geschickt, dazu eine handgeschriebene Karte: Ein weiteres Meisterwerk!
Ihr war klar, dass dieser Höhepunkt vorbei war, trotzdem war sie noch solides Mittelmaß. Eine überschwängliche E-Mail wäre schon nett gewesen.
Oder einfach eine freundliche.
Selbst ein knackiger Einzeiler hätte gereicht: Sorry, konnte noch nicht reingucken, kann’s aber kaum erwarten! Das wäre zumindest höflich gewesen.
Eine Angst, die sie ganz weit von sich wegschob, versuchte, sich einen Weg durch ihr Unterbewusstsein zu bohren. Nein. Nein. Auf gar keinen Fall.
Frances umklammerte das Lenkrad und versuchte, ihre Atmung zu beruhigen. Sie hatte jede Menge Medikamente eingeworfen, um eine freie Nase zu bekommen, und das Pseudoephedrin ließ ihr Herz rasen, als stünde etwas Wunderbares oder etwas Schreckliches unmittelbar bevor. Es erinnerte sie an das Gefühl, das sie bei ihren beiden Hochzeiten auf dem Weg zum Altar überkommen hatte.
Vermutlich war sie schon abhängig von diesen Erkältungs- und Grippetabletten. Sie wurde schnell süchtig. Männer. Essen. Wein. Tatsächlich war ihr schon jetzt nach einem Glas Wein zumute, obwohl die Sonne noch hoch am Himmel stand. In der letzten Zeit hatte sie, wenn auch nicht exzessiv, so aber doch leidenschaftlicher als sonst getrunken. Sie befand sich bereits auf dem holperigen Weg Richtung Alkohol- und Drogensucht! Gut zu wissen, dass sie noch zu grundlegenden Veränderungen in der Lage war. Zu Hause stand eine ostentativ halb volle Flasche Pinot noir auf ihrem Schreibtisch, sodass es jeder sehen konnte (nur die Putzfrau sah es). Sie war Ernest Hemingway, verdammt noch mal. Hatte der nicht auch Rückenprobleme gehabt? Sie hatten so viel gemeinsam.
Nur dass Frances eine Schwäche für Adjektive und Adverbien hatte. Offenbar verteilte sie die wie Dekokissen in ihren Romanen. Wie lautete noch mal dieses Mark-Twain-Zitat, das Sol immer vor sich hin gemurmelt hatte, wenn er ihre Manuskripte las, gerade so laut, dass sie es hören konnte? Wenn du ein Adjektiv findest, töte es.
Sol war ein echter Mann, der weder Adjektive noch Dekokissen mochte. Frances hatte ein Bild von ihm im Kopf, wie er scherzhaft fluchend auf ihr lag, ein weiteres der zahlreichen Dekokissen unter ihrem Kopf hervorzog und quer durchs Zimmer pfefferte, während sie kicherte. Sie schüttelte den Kopf, als wollte sie die Erinnerung verscheuchen. Schöne Erinnerungen an Sex fühlten sich an wie ein Punkt für ihren ersten Ehemann.
Wenn es in ihrem Leben gut lief, wünschte Frances ihren beiden Ex-Ehemännern nichts als Glückseligkeit und exzellente Potenz. Jetzt gerade wünschte sie eine Heuschreckenplage auf ihre beiden silberhaarigen Köpfe herab.
Sie saugte an einem winzigen, perfiden Schnitt an ihrem rechten Daumen. Dann und wann fing er an zu pochen, um sie daran zu erinnern, dass er zwar das geringste ihrer Probleme war, ihr aber dennoch den Tag versauen konnte.
Ihr Auto holperte über den unasphaltierten Seitenstreifen. Frances zog den Daumen aus dem Mund und griff wieder nach dem Lenkrad. »Uuups.«
Sie hatte ziemlich kurze Beine und musste den Sitz immer weit nach vorne schieben. Henry hatte immer gesagt, sie sehe aus, als würde sie Autoskooter fahren. Er fand es niedlich. Zumindest etwa fünf Jahre lang. Dann fand er es plötzlich nicht mehr niedlich und fluchte jedes Mal, wenn er ins Auto stieg und den Sitz einstellen musste.
Sie hatte es auch etwa fünf Jahre lang charmant gefunden, dass er im Schlaf redete.
Konzentrier dich!
Die Landschaft flog vorbei. Dann endlich ein Schild: Willkommen in Jarribong. Wir sind stolz darauf, eine SAUBERESTADT zu sein.
Frances bremste auf fünfzig Meilen pro Stunde runter, was sich beinahe absurd langsam anfühlte, und betrachtete im Vorbeifahren die Stadt. Ein Chinarestaurant mit einem ausgeblichenen rot-goldenen Drachen an der Tür. Eine offenbar geschlossene Tankstelle. Ein rot geklinkertes Postgebäude. Ein Drive-Through-Spirituosenladen, der tatsächlich geöffnet hatte. Eine Polizeiwache, die gänzlich unnütz wirkte. Kein Mensch in Sicht. So sauber die Stadt auch sein mochte, man fühlte sich trotzdem wie nach der Apokalypse.
Sie dachte an ihr letztes Manuskript, das in einer Kleinstadt spielte. Dabei war das hier die sandige, trostlose Kleinstadtrealität! Nicht ihr hübsches fiktives Örtchen, das sich an die Berge schmiegte, mit einem warmen, geschäftigen Café, in dem es nach Zimt roch, und – hier war die Fantasie mit ihr durchgegangen – einem Buchladen, der sogar Gewinn abwarf. Ihre Rezensenten würden es zu Recht kitschig nennen, wobei es vermutlich keine Rezensionen geben würde und sie die ohnehin nicht las.
Das hier war also das gute alte Jarribong. Auf Wiedersehen, du traurige, saubere, kleine Stadt.
Sie trat aufs Gas und beobachtete, wie die Tachonadel auf die Hundert zuwanderte. Laut Wegbeschreibung lag die Abfahrt zwanzig Minuten hinter Jarribong.
Vor ihr tauchte ein Schild auf. Frances kniff die Augen zusammen und lehnte sich über das Lenkrad, um es zu lesen: Tranquillum House nächste Abfahrt links.
Ihr wurde leichter ums Herz. Sie hatte es geschafft. Sechs Stunden Autofahrt, ohne komplett verrückt zu werden. Dann wurde ihr wieder schwer ums Herz, denn nun musste sie diese Sache wirklich durchziehen.
»Nach einem Kilometer links abbiegen«, befahl ihr Navi.
»Ich will aber nicht nach einem Kilometer links abbiegen«, maulte Frances.
Eigentlich sollte sie gar nicht hier sein, weder in dieser Jahreszeit noch in dieser Hemisphäre. Eigentlich sollte sie bei ihrem »Mann für gewisse Stunden«, Paul Drabble, in Santa Barbara sein, mit der warmen Wintersonne im Gesicht, während sie Weinkeller, Restaurants und Museen besuchten. Eigentlich sollte sie ausgedehnte Nachmittage damit verbringen, Pauls zwölfjährigen Sohn Ari kennenzulernen und sein trockenes kleines Kichern zu hören, während er ihr irgendein brutales PlayStation-Spiel beibrachte. Ihre Freunde mit eigenen Kindern hatten sie dafür ausgelacht und verhöhnt, doch sie hatte sich darauf gefreut, seine Lieblingsspiele zu lernen. Die Storylines klangen im Grunde wirklich komplex und ansprechend.
Frances erinnerte sich an das ernste Gesicht des jungen Kriminalbeamten. Aus seiner Kindheit waren noch ein paar Sommersprossen übrig geblieben, und er hatte mit einem kratzenden blauen Kugelschreiber jedes ihrer Worte haarklein mitgeschrieben. Seine Rechtschreibung war grauenhaft gewesen. Er hatte »unauffindbar« mit nur einem F geschrieben. Und er hatte ihr nicht in die Augen sehen können.
Bei der Erinnerung daran überkam Frances ein Hitzeschub.
Scham?
Vermutlich.
In ihrem Kopf verschwamm alles. Sie fröstelte. Sofort wurden ihre Hände auf dem Lenkrad feucht.
Fahr links ran, sagte sie sich. Du fährst jetzt sofort links ran.
Sie setzte den Blinker, obwohl niemand hinter ihr war, und hielt am Straßenrand. Dabei besaß sie noch die Geistesgegenwart, die Warnblinkanlage anzustellen. Der Schweiß lief ihr förmlich über das Gesicht. Binnen Sekunden war ihr Shirt klatschnass. Sie zog an dem Stoff und strich sich ein paar feuchte Haarsträhnen aus der Stirn. Wieder überkam sie der Schüttelfrost.
Sie nieste, und durch das Niesen verkrampfte sich ihr Rücken. Der Schmerz war von so biblischem Ausmaß, dass sie zu lachen anfing, während Tränen ihre Wangen hinunterströmten. O ja, sie verlor tatsächlich den Verstand.
Eine riesige Welle universeller, animalischer Wut überrollte sie. Wieder und wieder schlug sie mit der Faust auf die Hupe, schloss die Augen, legte den Kopf in den Nacken und schrie im Einklang mit der Hupe, denn sie hatte diese Erkältung und diese Rückenschmerzen und dieses blöde gebrochene Herz und …
»Hey!«
Frances öffnete die Augen und fuhr erschrocken in ihrem Sitz zurück.
Vor ihrem Fenster stand ein Mann. Er beugte sich hinunter und klopfte fest gegen das Glas. Auf der anderen Straßenseite stand ein Auto, das vermutlich ihm gehörte, ebenfalls mit Warnblinklicht.
»Alles okay?«, rief er. »Brauchen Sie Hilfe?«
Heilige Scheiße. Das hier war ein privater Moment vollkommener Verzweiflung. Wie peinlich. Sie drückte auf den Knopf und ließ das Fenster runter.
Ein sehr großer, unansehnlicher, ungepflegter, unrasierter Mann glotzte zu ihr herein. Über seinem stolzen, strammen Bierbauch trug er ein ausgeblichenes altes Bandshirt, darunter hing seine Jeans. Vermutlich einer dieser Outback-Serienkiller. Wobei das hier genau genommen nicht das Outback war. Vermutlich machte er Urlaub vom Outback.
»Probleme mit dem Wagen?«, fragte er.
»Nein«, sagte Frances. Sie setzte sich ein wenig auf, versuchte zu lächeln und fuhr sich mit der Hand durch die klammen Haare. »Danke. Mir geht es gut. Dem Auto geht es auch gut. Alles ist gut.«
»Sind Sie krank?«, fragte der Mann und wirkte dabei leicht angeekelt.
»Nein«, sagte Frances. »Nicht wirklich. Nur eine schlimme Erkältung.«
»Vielleicht haben Sie die Grippe. Sie sehen echt krank aus.« Der Mann runzelte die Stirn, und sein Blick wanderte zu ihrem Kofferraum. »Und Sie haben geschrien und gehupt, als hätten Sie … Probleme.«
»Ja«, sagte Frances. »Nun. Ich dachte, ich wär mutterseelenallein irgendwo im Nirgendwo. Ich hatte einfach nur einen … miesen Moment.«
Sie versuchte, nicht aggressiv zu klingen. Er war ein guter Mitbürger, der sich richtig verhalten hatte. Er hatte getan, was jeder tun würde.
»Danke, dass Sie angehalten haben, aber mir geht es gut«, sagte sie freundlich und schenkte ihm ihr süßestes, friedfertigstes Lächeln. Mit großen fremden Männern sollte man sich irgendwo im Nirgendwo besser nicht anlegen.
»Na dann.« Er stützte sich auf seinen Oberschenkeln ab und richtete sich stöhnend auf, doch dann klopfte er mit seinen Knöcheln auf ihr Autodach und beugte sich mit plötzlicher Entschlossenheit noch einmal zu ihr herunter. Ich bin ein Mann, mir macht man nichts vor.
»Hören Sie, sind Sie zu krank, um zu fahren? Weil, wenn Sie nicht fahren sollten, wenn Sie eine Gefährdung für den Verkehr sind, kann ich Sie wirklich nicht mit gutem Gewissen …«
Frances setzte sich auf. Herrgott noch mal. »Ich hatte Hitzewallungen«, keifte sie.
Der Mann wurde blass. »Oh.« Er musterte sie. Nach einer kurzen Pause sagte er: »Ich dachte immer, das heißt Hitzewellen.«
»Man kann beides sagen«, antwortete Frances.
Es war ihre dritte gewesen. Sie hatte viel darüber gelesen, mit jeder Frau über fünfundvierzig in ihrem Bekanntenkreis darüber gesprochen und einen Doppeltermin bei ihrem Hausarzt gemacht, wo sie gerufen hatte: »Aber keiner hat mich gewarnt, dass es so sein würde!« Sie waren übereingekommen, die weitere Entwicklung erst einmal zu beobachten. Frances nahm ein paar Nahrungsergänzungsmittel, trank weniger Alkohol und mied scharfes Essen. Ha ha.
»Also geht es Ihnen gut«, sagte der Mann. Er sah die Straße hinauf und hinunter, als hoffte er auf Hilfe.
»Mir geht es wirklich und wahrhaftig gut«, erklärte Frances. Ihr Rücken antwortete mit einem netten kleinen Krampf, und sie versuchte, nicht das Gesicht zu verziehen.
»Ich wusste nicht, dass Hitzewellen …-wallungen so …«
»… dramatisch sind? Tja, nicht jede Frau kommt in den Genuss. Nur ein erlesener Kreis.«
»Gibt es da nicht so eine … wie heißt das noch? Hormonersatztherapie?«
Gott steh mir bei.
»Können Sie mir da was verschreiben?«, fragte Frances enthusiastisch.
Der Mann trat einen Schritt zurück und hob kapitulierend die Hände. »Sorry. Ich glaube, das hat meine Frau … Egal, geht mich ja nichts an. Wenn alles in Ordnung ist, kann ich ja weiterfahren.«
»Absolut«, sagte Frances. »Danke fürs Anhalten.«
»Kein Problem.«
Er hob eine Hand, setzte noch einmal zum Reden an, überlegte es sich aber offenbar anders und ging zurück zu seinem Wagen. Sein T-Shirt hatte Schweißflecken am Rücken. Ein Bär von einem Mann. Zum Glück hatte er beschlossen, dass sie es nicht wert war, getötet und vergewaltigt zu werden. Wahrscheinlich bevorzugte er weniger verschwitzte Opfer.
Sie sah zu, wie er sein Auto anließ und wieder auf den Highway steuerte. Als er davonfuhr, tippte er sich noch einmal mit einem Finger an die Stirn.
Frances wartete ab, bis sein Auto zu einem winzigen Punkt in ihrem Rückspiegel geschrumpft war, erst dann beugte sie sich zum Beifahrersitz hinüber, wo ihre Wechselklamotten für genau diese Art von Situation bereitlagen.
»Wechseljahre?«, hatte ihre achtzigjährige Mutter, die in Südfrankreich glücklich und zufrieden vor sich hin lebte, verwundert durch den Hörer gefragt. »Oh, die haben mir, glaube ich, keine allzu großen Probleme bereitet, mein Schatz. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die an einem Wochenende abgefrühstückt. Das wird bei dir sicher genauso. Diese Hitzewellen hatte ich nicht. Ehrlich gesagt, halte ich die für frei erfunden.«
Pffff, dachte Frances, während sie sich mit einem Handtuch ihren frei erfundenen Schweiß abwischte.
Sie spielte mit dem Gedanken, ein Foto von ihrem knallroten Gesicht an ihre Freundinnen zu schicken, von denen sie manche schon seit dem Kindergarten kannte. Wenn sie miteinander essen gingen, besprachen sie die Symptome ihrer Wechseljahre mit demselben entgeisterten Entsetzen, mit dem sie früher ihre erste Periode besprochen hatten. Keine von ihnen schlug sich mit derart heftigen Hitzewallungen herum wie Frances, die es also sozusagen stellvertretend für alle ausbaden musste. Wie alles andere im Leben wurde auch die Reaktion der Freundinnen auf die Wechseljahre von ihrem jeweiligen Charakter bestimmt: Di erzählte, dass sie permanent wütend sei, und wenn ihr Frauenarzt nicht bald ihre Hysterektomie absegne, würde sie den kleinen Wichser am Kragen packen und an die nächstbeste Wand schleudern. Monica begrüßte die »wundervolle Intensität« ihrer Emotionen, und Natalie fragte sich ängstlich, ob die Veränderungen sich wohl auf ihre Angstzustände auswirkten. Doch alle waren sich einig gewesen, dass es mal wieder absolut typisch für ihre Freundin Gillian gewesen war, noch vor den Wechseljahren das Zeitliche zu segnen, und dann hatten sie gemeinsam in ihre Proseccos geweint.
Nein, Frances würde ihren Schulfreundinnen keine Nachricht schicken, denn plötzlich erinnerte sie sich, dass sie bei ihrem letzten Dinner von der Speisekarte aufgesehen hatte und Zeugin eines Blickwechsels geworden war, der definitiv besagt hatte: »Arme Frances.« Und Mitleid konnte sie nicht ertragen. Gerade diese Gruppe seit Ewigkeiten verheirateter Freundinnen hatte sie all die Jahre lang beneidet oder zumindest so getan, doch offenbar war es etwas vollkommen anderes, mit dreißig Single und kinderlos zu sein, als mit fünfzig. Dann war es nicht mehr glamourös, sondern freudlos.
Ich bin nur vorübergehend freudlos, sagte sie zu sich selbst, während sie eine frische Bluse mit tiefem Ausschnitt überzog. Sie warf das verschwitzte Shirt auf die Rückbank, ließ den Motor an und fuhr wieder auf den Highway. Vorübergehend freudlos. Klang wie ein Bandname.
Wieder ein Schild. Sie kniff die Augen zusammen. Tranquillum House stand darauf.
»Jetzt links abbiegen«, sagte ihr Navi.
»Ich weiß, ich sehe es ja.«
Sie schaute sich im Rückspiegel in die Augen und versuchte, sich mit einem halbgaren »Ist das Leben nicht spannend!«-Blick zu motivieren.
Frances hatte schon immer die Vorstellung von Paralleluniversen gefallen, in denen verschiedene Versionen ihrer selbst verschiedene Leben lebten. In einem war sie keine Autorin, sondern Firmenchefin. In einem anderen hatte sie zwei oder vier oder sechs Kinder. In einem hatte sie sich nicht von Sol scheiden lassen, in einem anderen nicht von Henry … Und die meiste Zeit über war sie mit dem Universum, in dem sie sich tatsächlich befand, zufrieden gewesen oder hatte es zumindest akzeptiert. Nur nicht gerade jetzt, denn gerade jetzt fühlte es sich so an, als hätte es da irgendeinen verheerenden quantenphysikalischen Verwaltungsfehler gegeben. Sie war im falschen Universum gelandet. Sie sollte eigentlich Liebe und Leidenschaft in Amerika erleben, nicht Tortur und Tränen in Australien. Das musste ein Fehler sein. Und der war völlig inakzeptabel.
Und dennoch war sie hier. Es gab keine Alternative, keinen Ausweg.
»Verdammt«, fluchte sie und bog links ab.
3
Lars
»Diesen hier mag meine Frau am liebsten.« Der gut gelaunte Manager des Weinguts, ein untersetzter Kerl Mitte sechzig mit Retro-Schnurrbart, hielt eine Flasche Weißwein hoch. »Sie sagt, er erinnert sie an Seidenbettwäsche. Sein cremiger, samtiger Abgang wird Ihnen gefallen.«
Lars schwenkte das Glas und atmete den Duft ein: Äpfel und Sonnenlicht und das rauchige Aroma von Holz. Erinnerungen an einen Herbsttag. Der Trost einer großen, warmen Hand, die seine hielt. Es fühlte sich an wie eine Kindheitserinnerung, war es jedoch vermutlich nicht – eher eine geborgte Erinnerung aus einem Buch oder einem Film. Er nahm einen kleinen Schluck Wein, ließ ihn seinen Gaumen umspülen und wurde in eine Bar an der Amalfi-Küste versetzt. Weinranken vor den Lampen und der Geruch nach Knoblauch und Meer. Das war bona fide eine glückliche Erinnerung aus dem wahren Leben, und es gab Beweisfotos. Er erinnerte sich an die Spaghetti. Nur Petersilie, Olivenöl und Mandeln. Vielleicht gab es sogar irgendwo ein Foto von den Spaghetti.
»Wie finden Sie ihn?« Der Mann grinste. Sein Schnurrbart sah aus, als hätte er ihn seit 1975 in perfektem Zustand konserviert.
»Fantastisch.« Lars nippte noch einmal, um seinen Eindruck zu vervollständigen. Wein konnte einen an der Nase herumführen: erst Sonnenschein, Äpfel und Spaghetti, dann nichts als saure Enttäuschung und leere Versprechen.
»Ich habe auch noch einen Pinot grigio, der Ihnen zusagen …«
Lars hob die Hand und sah auf die Uhr. »Ich sollte besser aufhören.«
»Müssen Sie heute noch weit fahren?«
Wer hier anhielt, wollte definitiv eigentlich irgendwo anders hin. Lars hätte das kleine hölzerne Weinprobenschild beinahe übersehen und war auf die Bremse gestiegen. So war er nun einmal: spontan. Jedenfalls, wenn er daran dachte, es zu sein.
»Ich muss in einer Stunde in einem Wellnessresort einchecken.«
Lars hielt das Weinglas gegen das Licht und bewunderte die goldene Farbe. »Das bedeutet, kein Alkohol für mich in den nächsten zehn Tagen.«
»Ah. Tranquillum House, richtig?«, sagte der Manager. »Für dieses, wie nennen die das noch, Zehn-Tage-Cleansing oder so ähnlich?«
»Für meine Sünden«, sagte Lars.
»Normalerweise halten deren Gäste hier auf dem Weg nach Hause. Wir sind das erste Weingut auf der Strecke zurück nach Sydney.«
»Und, was erzählen die so über das Resort?« Lars zückte seine Brieftasche. Er würde sich ein wenig Wein nach Hause liefern lassen, als Willkommen-zurück-Geschenk.
»Manche sind ein bisschen durch den Wind, wenn ich ehrlich bin. Aber nach einem Drink und ein paar Chips sehen sie schon wieder besser aus.« Er legte wie zum Trost die Hand um den Hals der Flasche. »Tatsächlich hat meine Schwester gerade angefangen, in deren Spa zu arbeiten. Sie sagt, ihr neuer Boss ist ein bisschen …« Er kniff die Augen zusammen, als suchte er nach dem richtigen Wort. »Anders.«
»Danke für die Warnung«, sagte Lars. Er hatte keine Angst. Schließlich war er ein Wellness-Junkie. Die Leiter dieser Einrichtungen waren tendenziell etwas »anders«.
»Sie sagt, das Haus an sich ist grandios. Es hat eine faszinierende Geschichte.«
»Es wurde von Häftlingen gebaut, glaube ich.« Lars tippte mit einer Ecke seiner goldenen American Express auf den Tresen.
»Ja. Arme Teufel. Die durften garantiert nicht ins Spa.«
Eine Frau trat durch eine Tür hinter ihm in den Raum und grummelte: »Das blöde Internet funktioniert schon wieder nicht.« Sie hielt inne, als sie Lars sah, und musterte ihn gleich zweimal. Er war daran gewöhnt. Sein ganzes Leben lang hatten Frauen zweimal hingesehen. Dann wandte sie nervös den Blick ab.
»Das ist meine Frau«, erklärte der Gutsbesitzer stolz. »Wir haben gerade über deinen Lieblings-Semillon gesprochen, Schatz – den Seidenbettwäsche-Semillon.«
Sie errötete. »Ich wäre dir dankbar, wenn du das den Leuten nicht unbedingt auf die Nase binden würdest.«
Ihr Mann schien verwirrt. »Das binde ich den Leuten immer auf die Nase.«
»Ich nehme eine Kiste davon.« Lars sah zu, wie die Frau ihrem Mann auf den Rücken klopfte, als sie an ihm vorbeiging, und fügte hinzu: »Machen Sie zwei draus.« Er verbrachte seine Tage mit den Scherbenhaufen zerbrochener Ehen und wurde beim Anblick einer glücklichen Beziehung immer schwach.
Lars lächelte die Frau an. Sie richtete sich mit flatternden Händen die Frisur, während ihr nichts ahnender Ehemann einen alten, abgegriffenen Bestellblock hervorzog, an dem ein Stift baumelte, sich schwerfällig auf den Tresen lehnte und das Formular auf eine Art betrachtete, die sagte, dass das hier eine Weile dauern würde. »Name?«
»Lars Lee.« Lars’ Handy piepte. Er tippte auf den Bildschirm.
Kannst du wenigstens darüber nachdenken? Xx
Sein Herz zuckte zusammen, als hätte er gerade eine haarige schwarze Spinne gesehen. Verflucht noch mal. Er hatte gedacht, das Thema wäre durch. Sein Daumen schwebte nachdenklich über der Nachricht. Dieses passiv-aggressive »wenigstens«. Der zuckertriefende doppelte Kuss. Außerdem ärgerte es ihn, dass der erste Kuss groß- und der zweite kleingeschrieben war. Und es ärgerte ihn, dass es ihn überhaupt ärgerte. Das war schon leicht zwangsgestört.
Er tippte eine grobe, unhöfliche Antwort: NEIN. KANN ICH NICHT.
Doch dann löschte er sie wieder und steckte das Handy zurück in seine Jeans.
»Ich würde doch auch noch den Pinot grigio probieren.«
4
Frances
Sie holperte zwanzig Minuten lang über eine staubige Buckelpiste, die ihr Auto so sehr durchschüttelte, dass ihre Knochen klapperten und ihr Kreuz aufschrie.
Endlich kam sie vor einem verriegelten und verrammelten Tor mit Gegensprechanlage zum Stehen. Ein hässlicher Stacheldrahtzaun erstreckte sich endlos in beide Richtungen. Das Ganze erinnerte entfernt an eine Art Gefängnis.
Frances hatte sich vorgestellt, eine stattliche Allee zum »historischen« Gebäude hinaufzufahren, wo jemand sie mit einem grünen Smoothie begrüßte. Das hier fühlte sich jetzt nicht besonders wohltuend an, wenn sie ehrlich war.
Hör auf damit, schalt sie sich. Wenn sie in diesen Unzufriedener-Gast-Modus abglitt, würde sie sich bald über alles ärgern, und sie hatte ganze zehn Tage hier vor sich. Sie musste offen und anpassungsfähig sein. Ein Besuch im Wellnessresort war wie Urlaub in einem fremden Land: Man musste tolerant gegenüber anderen Kulturen sein und kleinere Unannehmlichkeiten langmütig verzeihen.
Frances ließ das Fenster hinunter, und augenblicklich erfüllte heiße Luft ihre Kehle wie Rauch. Sie lehnte sich hinaus und drückte mit dem Daumen auf den Knopf der Sprechanlage. Der Knopf war knallheiß, und der Schnitt an ihrem Finger schmerzte.
Mit dem Daumen im Mund wartete sie darauf, dass eine körperlose Stimme sie willkommen hieß oder sich das gusseiserne Tor wie von Geisterhand öffnete.
Nichts.
Noch einmal betrachtete sie die Gegensprechanlage und sah einen handgeschriebenen Zettel, der neben dem Knopf klebte. Die Schrift war so klein, dass sie nur das wichtige Wort »Anleitung« ausmachen konnte, sonst nichts.
Herrgott noch mal, dachte sie, während sie in ihrer Handtasche nach der Lesebrille suchte. Ein Großteil der Gäste hier war doch sicherlich über vierzig.
Sie fand die Brille, setzte sie auf und starrte auf den Zettel, den sie immernochnicht entziffern konnte. Genervt stieg sie aus. Die Hitze legte sich um sie wie ein schwerer Mantel, und kleine Schweißperlen stiegen aus jeder Pore ihrer Kopfhaut.
Sie beugte sich hinunter und las den Zettel, den jemand mit sorgfältigen kleinen Druckbuchstaben geschrieben hatte, als käme er von der Zahnfee.
NAMASTE UND WILLKOMMEN IN TRANQUILLUM HOUSE, WO IHR NEUES ICH AUF SIE WARTET. BITTE GEBEN SIE DEN SICHERHEITSCODE 564-312 EIN UND DRÜCKEN SIE DEN GRÜNEN KNOPF.
Sie gab den Code ein, drückte den grünen Knopf und wartete. Schweiß rann ihr den Rücken hinunter. Sie würde sich noch mal umziehen müssen. Eine Schmeißfliege brummte an ihrem Mund. Ihre Nase tropfte.
»Ach komm schon!«, rief sie in einem plötzlichen Wutanfall in Richtung Gegensprechanlage und fragte sich, ob ihr aufgebrachtes, verschwitztes Gesicht jetzt drinnen auf einem Bildschirm auftauchte, damit irgend so ein Experte leidenschaftslos ihre Symptome und ihre aus der Balance geratenen Chakren analysieren konnte.
Bei der hier müssen wir ran. Guck dir das mal an, die flippt schon bei so einem geringen Stressfaktor wie Warten aus.
Hatte sie den verdammten Code falsch eingegeben?
Noch einmal tippte sie die Zahlen gewissenhaft ab, wobei sie jede einzelne laut und möglichst sarkastisch vor sich hin sagte, um es wem auch immer zu zeigen, dann drückte sie langsam und sorgfältig den heißen grünen Knopf und hielt ihn sicherheitshalber fünf Sekunden lang gedrückt.
Bitte schön. Und jetzt lasst mich gefälligst rein.
Sie nahm die Lesebrille ab und ließ sie an einem Finger baumeln.
In der drückenden Hitze schmolz ihre Kopfhaut dahin wie Schokolade in der Sonne. Wieder Stille. Frances starrte die Gegensprechanlage vorwurfsvoll an, als ließe die sich durch ein schlechtes Gewissen zum Handeln antreiben.
Immerhin würde diese Situation eine lustige Geschichte für Paul abgeben. Sie fragte sich, ob er je ein Wellnessresort besucht hatte. Vermutlich wäre er da eher skeptisch. Sie selbst war schließlich …
Ihr wurde eng um die Brust. Das hier würde keine gute Geschichte für Paul abgeben. Paul war nicht mehr da. Wie peinlich, dass er sich so in ihre Gedanken geschlichen hatte. Sie hätte sich gewünscht, eine glühende Wut in sich aufsteigen zu spüren statt dieser absoluten Traurigkeit, dieser falschen Trauer um etwas, das es ohnehin nie gegeben hatte.
Hör auf damit. Nicht dran denken. Konzentrier dich auf das Problem direkt vor deiner Nase.
Die Lösung lag auf der Hand. Sie würde bei Tranquillum House anrufen! Dort würde man bestürzt darüber sein, dass die Gegensprechanlage kaputt war, und Frances würde ganz ruhig und verständnisvoll bleiben und alle Entschuldigungen abtun. »So was kommt vor«, würde sie sagen. »Namaste.«
Sie stieg wieder ins Auto und drehte die Klimaanlage hoch. Dann wählte sie die in ihren Buchungsdetails angegebene Nummer. Bisher hatte sie nur per E-Mail kommuniziert, und so hörte sie die Tonband-Ansage, die augenblicklich abgespielt wurde, zum ersten Mal.
»Vielen Dank für Ihren Anruf im Tranquillum House Gesundheits- und Wellnessresort, wo Ihr neues Ich auf Sie wartet. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig, ebenso wie Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden, doch derzeit haben wir ein besonders hohes Anruferaufkommen. Uns ist bewusst, wie kostbar Ihre Zeit ist, deshalb hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht nach dem Signalton, wir rufen Sie umgehend zurück. Vielen Dank für Ihre Geduld. Namaste.«
Frances räusperte sich, während das nervige Geklimper eines Windspiels an ihrem Ohr ertönte.
»Ja, hallo, mein Name ist …«
Wieder das Windspiel. Sie hielt inne, wartete, setzte erneut zum Reden an und verstummte wieder. Es war eine ganze Windspiel-Symphonie.
Endlich war es still.
»Hallo, hier ist Frances Welty.« Sie zog die Nase hoch. »Entschuldigung. Ich bin etwas erkältet. Jedenfalls, wie gesagt, ich bin Frances Welty. Ich bin ein Gast.«
Gast? War das das richtige Wort? Patientin? Insassin?
»Ich versuche gerade einzuchecken, und das Tor geht nicht auf. Es ist … ähm … zwanzig nach drei, fünfundzwanzig nach drei, und ich bin … da! Die Gegensprechanlage scheint nicht zu funktionieren, obwohl ich mich an die Anleitung gehalten habe. Die winzig, winzig kleine Anleitung. Könnten Sie jetzt freundlicherweise das Tor aufmachen? Und mich reinlassen?« Ihre Nachricht endete mit einem etwas hysterischen Anstieg ihrer Stimme, den sie bereute. Sie legte das Handy auf den Beifahrersitz und betrachtete das Tor.
Nichts. Sie würde ihnen zwanzig Minuten geben und dann das Handtuch werfen.
Ihr Handy klingelte, und sie griff danach, ohne aufs Display zu schauen.
»Hey!«, sagte sie fröhlich, um zu zeigen, wie verständnisvoll und geduldig sie eigentlich war, und sich für die »winzig, winzig klein«-Spitze zu entschuldigen.
»Frances?« Es war Alain, ihr Agent. »Du klingst gar nicht wie du.«
Frances seufzte. »Ich hatte mit jemand anderem gerechnet. Ich bin bei dieser Gesundheitsfarm, von der ich dir erzählt habe, aber ich schaffe es noch nicht mal durchs Tor. Die Gegensprechanlage ist kaputt.«
»Wie unprofessionell! So was geht gar nicht!« Alain regte sich schnell und häufig über schlechten Service auf. »Du solltest umdrehen und wieder nach Hause kommen. Das ist doch hoffentlich nicht so ein alternatives Ding, oder? Denk an die armen Menschen, die in dieser Saunahütte gestorben sind! Die haben alle gedacht, ihnen steht die Erleuchtung bevor, und in Wahrheit wurden sie gebraten.«
»Nein, das hier ist ziemlich mainstream. Heiße Quellen, Massagen und Kunsttherapie. Vielleicht ein bisschen leichtes Fasten.«
»Leichtes Fasten.« Alain schnaubte. »Wenn man Hunger hat, soll man essen. Es ist immerhin ein Privileg, essen zu können, wenn einem danach ist. Andere Menschen auf dieser Welt müssen hungern!«
»Nun, das ist ja genau der Punkt. Wir hier in diesen Breitengraden hungern eben nicht mehr«, sagte Frances. Ihr Blick fiel auf eine leere KitKat-Verpackung im Ablagefach ihres Autos. »Wir essen zu viel industriell verarbeitetes Zeug. Deshalb müssen wir Überprivilegierten detoxen …«
»Ach herrje, sie ist drauf reingefallen. Sie hat von dem Nektar gekostet. Detox ist ein Mythos, Liebes, der wurde längst entlarvt. Deine Leber erledigt das für dich. Oder deine Nieren oder so. Jedenfalls passiert das alles irgendwie automatisch.«
»Ist ja auch egal.« Frances hatte das Gefühl, dass er Zeit schinden wollte.
»Jedenfalls«, sagte Alain, »du klingst erkältet, Frances.« Er schien wahrlich bestürzt zu sein über ihre Erkältung.
»Ich habe wirklich eine sehr schlimme, lang anhaltende, vermutlich chronische Erkältung«, erklärte Frances und hustete zum Beweis. »Du wärst stolz auf mich. Ich habe furchtbar viele sehr starke Medikamente eingeworfen. Mein Puls liegt bei einer Million.«
»So ist’s richtig«, bestätigte Alain.
Dann folgte eine Pause.
»Alain?«, fragte Frances, doch sie wusste es schon, sie wusste ganz genau, was er jetzt sagen würde.
»Leider habe ich keine guten Neuigkeiten für dich«, sagte Alain.
»Aha.«
Sie spannte den Bauch an, bereit, den Schlag wie ein Mann zu nehmen oder zumindest wie eine Liebesromanautorin, die ihre Absatzzahlen lesen konnte.
»Nun, wie du weißt, Liebes …«, setzte Alain an.
Doch Frances ertrug es nicht, dass er um den heißen Brei herumredete und die Erschütterung mit Komplimenten abmildern wollte.
»Sie wollen das neue Buch nicht, oder?«, fragte sie.
»Sie wollen das neue Buch nicht«, sagte er traurig. »Es tut mir so leid. Ich finde, es ist ein schönes Buch, das tue ich wirklich, es ist die derzeitige Marktlage, und Liebesromane hat es am schlimmsten erwischt, das Ganze wird nicht ewig dauern, Liebesromane kommen immer wieder zurück, das ist nur eine Phase, aber …«
»Dann verkaufst du es eben an jemand anderen«, unterbrach Frances ihn. »Verkauf es an Timmy.«
Wieder Stille.
»Die Sache ist die«, sagte Alain. »Ich habe dir nichts davon gesagt, aber ich habe Timmy das Manuskript schon zugespielt, weil ich die klitzekleine Befürchtung hatte, dass das passieren könnte, und natürlich wäre ein Angebot von ihm in den Verhandlungen ein strategischer Vorteil gewesen, deshalb …«
»Timmy hat abgelehnt?« Frances konnte es nicht glauben. In ihrem Kleiderschrank hing eine Designerrobe, die sie nie wieder würde tragen können, da sich darauf ein Fleck von Timmys Piña Colada befand. Auf dem Melbourne Writers Festival hatte er sie einmal so sehr in eine Ecke gedrängt, dass sein Drink übergeschwappt war. Mit hastiger, drängender Stimme und einem Blick über die Schulter, als wäre er ein Spion, hatte er ihr erzählt, wie sehr er sich wünsche, ihr Verleger zu werden, ja dass es sein Schicksal sei, ihr Verleger zu sein, dass niemand in der gesamten Verlagsindustrie sie so verlegen könne wie er, dass ihre Loyalität gegenüber Jo zwar bewundernswert sei, aber völlig deplatziert, weil Jo denke, sie verstehe das Liebesromansegment, doch das tue sie nicht, nur Timmy verstehe es, und nur Timmy werde Frances sicher »auf das nächste Level« bringen und so weiter und so fort, bis Jo aufgetaucht war und sie gerettet hatte.
»Hey, lass meine Autorin in Ruhe.«
Wie lange war das her? Sicher nicht so lange. Vielleicht neun, zehn Jahre. Ein Jahrzehnt. Mittlerweile verflog die Zeit so schnell. Irgendetwas stimmte nicht mit der Drehzahl der Erde. Jahrzehnte vergingen so schnell, wie früher Jahre vergangen waren.
»Timmy liebt das Buch«, sagte Alain. »Er findet es fabelhaft. Er hätte beinahe geheult. Aber er hat es beim Einkauf nicht durchbekommen. Die machen sich da gerade alle ins Hemd. War ein übles Jahr. Die Anweisung von oben lautet Psychothriller.«
»Ich kann keine Thriller schreiben!«, rief Frances. Sie mochte es nicht, Figuren zu töten. Manchmal verpasste sie ihnen einen Arm- oder Beinbruch, und selbst dabei fühlte sie sich schon schrecklich genug.
»Natürlich kannst du das nicht!«, antwortete Alain etwas zu schnell für Frances’ Geschmack.
»Pass auf, ich muss zugeben, dass ich mir ein wenig Sorgen gemacht habe, als Jo weg war und dein Vertrag ausgelaufen ist«, sagte Alain. »Aber ich dachte wirklich, Ashlee wäre ein Fan von dir.«
Alain redete weiter, doch Frances’ Aufmerksamkeit schwand. Sie beobachtete das geschlossene Tor und bohrte die Knöchel ihrer linken Hand in ihr Kreuz.
Was würde Jo sagen, wenn sie hörte, dass Frances abgelehnt worden war? Oder hätte sie dasselbe tun müssen? Frances war immer davon ausgegangen, dass Jo für immer ihre Lektorin bleiben würde. Sie hatte sich gerne vorgestellt, wie sie beide gleichzeitig ihr Arbeitsleben beendeten, vielleicht mit einem ausschweifenden Doppellunch zu Rentenbeginn, doch Ende vergangenen Jahres hatte Jo angekündigt, dass für sie nun Schluss sei. Rente! Als wäre sie eine alte Oma! Jo hatte tatsächlich bereits Enkel, aber mein Gott, das war doch kein Grund aufzuhören. Frances hatte das Gefühl, gerade erst den Dreh rauszuhaben, und plötzlich verhielten sich die Menschen in ihrem Umfeld wie alte Leute: Sie bekamen Enkelkinder, gingen in Rente, traten kürzer, starben – und zwar nicht bei Autounfällen oder Flugzeugabstürzen, nein, friedlich im Schlaf. Das würde sie Gillian nie verzeihen. Gillian hatte sich auf Partys immer schon heimlich davongeschlichen, ohne sich zu verabschieden.
Dass Jos Nachfolgerin ein Kind war, hätte sie nicht überraschen sollen, denn Kinder übernahmen gerade die Welt. Frances sah sie überall: Kinder, die mit ernster Miene hinter nagelneuen Schreibtischen saßen, den Verkehr kontrollierten, Literaturfestivals organisierten, ihren Blutdruck maßen, ihre Steuererklärung machten und ihr BHs in der richtigen Größe brachten. Als Frances Ashlee zum ersten Mal begegnet war, hatte sie ehrlich geglaubt, eine Praktikantin vor sich zu haben. Sie wollte gerade sagen: »Ein Cappuccino wäre wunderbar, Schätzchen«, als das Kind um Jos alten Schreibtisch herumgegangen war und sich gesetzt hatte.
»Frances«, hatte sie gesagt, »das hier ist so ein Fan-Girl-Moment für mich! Ich habe deine Bücher gelesen, als ich ungefähr elf war! Ich meine, ich habe meine Mum angebettelt: Mum, du musst mich Nathaniels Kuss lesen lassen! Und sie dann so: Auf keinen Fall, Ashlee, da kommt viel zu viel Sex drin vor!«
Woraufhin Ashlee Frances eröffnet hatte, in ihrem nächsten Roman müsse definitiv mehr Sex vorkommen, viel mehr Sex, aber sie habe vollstes Vertrauen in Frances! Ashlee war sicher, dass Frances wusste, wie sehr sich der Markt gerade veränderte, und: »Wenn du dir bitte mal diese Grafik ansehen könntest, Frances – nein, diese hier, da siehst du es –, deine Absatzzahlen waren ein wenig, also, tut mir leid, aber man muss das schon fast einen Abwärtstrend nennen. Und noch etwas …« Ashlee sah aus, als müsse sie ein ekliges medizinisches Leiden ansprechen. »Dein Social-Media-Auftritt? Ich habe schon gehört, dass du dich nicht sonderlich für die sozialen Medien interessierst. Tut meine Mum auch nicht! Aber für den heutigen Markt ist das von zentraler Bedeutung. Deine Fans müssen dich auf jeden Fall auf Twitter und Instagram und Facebook sehen – und das ist das absolute Minimum. Und es wäre toll, wenn du ein Blog schreiben könntest, und einen Newsletter, und vielleicht könntest du regelmäßige Vlogs machen? Das wäre doch ein riesengroßer Spaß! Das sind quasi kleine Filme über dich!«
»Ich habe eine Homepage«, erwiderte Frances.
»Ja«, sagte Ashlee sanft. »Ja, das hast du, Frances. Aber niemand interessiert sich mehr für Homepages.«
Und dann hatte sie ihren Computerbildschirm umgedreht, um ihr beispielhaft ein paar wesentlich wohlerzogenere Autoren mit »aktiver« Social-Media-Präsenz zu zeigen, und Frances hatte irgendwann nicht mehr zugehört und nur noch darauf gewartet, dass der Spuk vorbei war, wie bei einem Zahnarzttermin. (Sie konnte den Bildschirm ohnehin nicht sehen. Sie hatte ihre Brille vergessen.) Doch das Ganze hatte ihr keine Sorgen bereitet, denn sie war damals gerade dabei gewesen, sich in Paul Drabble zu verlieben, und wenn sie sich verliebte, schrieb sie immer ihre besten Bücher. Davon abgesehen, hatte sie die liebste, loyalste Leserschaft der Welt. Vielleicht gingen ihre Verkaufszahlen ein wenig zurück, aber sie würde immer veröffentlicht werden.
»Ich werde das richtige Zuhause für deinen Roman finden«, erklärte Alain. »Es kann nur ein wenig dauern. Der Liebesroman ist nicht tot!«
»Sicher?«, fragte Frances.
»Nicht mal annähernd«, erklärte Alain.
Sie nahm die KitKat-Verpackung und leckte sie ab in der Hoffnung auf ein paar Schokokrümel. Wie sollte sie diesen Rückschlag ohne Zucker ertragen?
»Frances?«
»Mein Rücken tut ziemlich weh«, sagte sie und putzte sich lautstark die Nase. »Und dann musste ich noch mitten auf der Straße anhalten, weil ich Hitzewallungen hatte.«
»Das klingt wirklich furchtbar«, sagte Alain gefühlvoll. »Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss.«
»Nein, kannst du nicht. Ein Mann hat angehalten, um nach mir zu sehen, weil ich geschrien habe.«
»Du hast geschrien?«
»Mir war nach Schreien zumute.«
»Natürlich, natürlich«, sagte Alain schnell. »Ich verstehe. Mir ist auch oft danach zu schreien.«
Wie tief konnte man sinken. Sie hatte gerade eine KitKat-Verpackung abgelutscht.
»Oje, Frances, das alles tut mir so leid, vor allem nach dieser Geschichte mit dem fürchterlichen Mann. Hast du schon etwas von der Polizei gehört?«
»Nein«, sagte sie. »Nichts Neues.«
»Liebes, mein Herz blutet für dich.«
»Das ist nicht notwendig«, schniefte Frances.
»Du hast aber im Moment auch wirklich eine Pechsträhne, Liebes – ach ja, ich wollte dir übrigens noch sagen, dass diese Rezension rein gar nichts mit der Entscheidung des Verlags zu tun hatte.«
»Was für eine Rezension?«, fragte Frances.
Stille. Sie wusste, dass Alain sich gerade mit der flachen Hand gegen die Stirn schlug.
»Alain?«
»O Gott«, sagte er. »O Gott, o Gott, o Gott.«
»Ich habe seit 1998 keine Rezension mehr gelesen. Das weißt du.«
»Das stimmt, das weiß ich«, sagte Alain. »Ich bin ein Idiot. Ich bin so dumm.«
»Warum gibt es eine Rezension, wenn ich überhaupt kein neues Buch draußen habe?« Frances setzte sich auf. Ihr Rücken tat so weh, dass sie glaubte, sich übergeben zu müssen.
»Irgend so eine blöde Schlampe hat Was das Herz will am Flughafen gekauft und eine Stellungnahme über, ähm, deine Bücher im Allgemeinen geschrieben, eine fiese Abrechnung. Sie hat das Ganze mit der #MeToo-Debatte in Verbindung gebracht, als Clickbait für mehr Traffic. Einfach lächerlich – als wären Liebesromane schuld an sexuell übergriffigen Männern!«
»Was?«
»Keiner hat die Rezension überhaupt gelesen. Ich weiß nicht, warum ich das erwähnt habe. Vielleicht werde ich dement.«
»Du hast gesagt, dass sie viel Traffic hatte!«
Alle hatten die Rezension gelesen. Alle.
»Schick mir den Link«, befahl Frances.
»So schlimm ist es gar nicht«, sagte Alain. »Nur die alten Vorurteile gegen dein Genre …«
»Schick ihn mir!«
»Nein«, sagte er. »Das werde ich nicht tun. All die Jahre hast du keine Rezensionen gelesen – werd jetzt nicht schwach!«
»Sofort!«, forderte Frances in ihrer Drohstimme. Sie bediente sich ihrer nur selten. Während ihrer Scheidungen zum Beispiel.
»Ich schick ihn dir«, versprach Alain kleinlaut. »Es tut mir so leid, Frances. Dieser ganze Anruf tut mir wahnsinnig leid.«
Er legte auf, und Frances sah sofort in ihre Inbox. Ihr blieb nicht viel Zeit. Sobald sie erst einmal Tranquillum House betreten hatte, würde sie ihre »elektronischen Geräte aushändigen« müssen, denn neben allem anderen würde auch eine digitale Detoxkur stattfinden. Für eine Weile würde sie buchstäblich abschalten.
ES TUT MIR SO LEID!, stand in Alains Mail.
Sie klickte den Link zu der Rezension an.
Verfasst hatte den Artikel eine gewisse Helen Ihnat. Der Name sagte Frances nichts, und ein Foto gab es auch nicht. Sie las schnell, mit einem schiefen, würdevollen Lächeln, als würde die Verfasserin ihr all das geradewegs ins Gesicht sagen. Die Rezension war furchtbar: bösartig, sarkastisch und überheblich, doch interessanterweise tat es nicht weh. Die Worte – Vorhersehbar. Trash. Gefasel. Langweilig – prallten einfach an ihr ab.
Es ging ihr gut! Man konnte es schließlich nicht jedem recht machen. Berufsrisiko.
Doch dann fühlte sie es.
Es war wie der Moment, wenn man sich an einer Herdplatte verbrannte und dachte: Huch, ich hatte mit Schlimmerem gerechnet, und dann tat es tatsächlich weh, und plötzlich hatte man höllische Schmerzen.
Ein ganz außergewöhnlicher Schmerz strahlte von ihrem Herzen aus in ihren gesamten Körper. Ein weiteres spaßiges Symptom ihrer Wechseljahre? Vielleicht ein Herzinfarkt. Auch Frauen bekamen Herzinfarkte. Sicher waren es nicht nur verletzte Gefühle. Das hier, genau das war überhaupt der Grund dafür gewesen, dass sie aufgehört hatte, Rezensionen zu lesen. Sie war zu dünnhäutig. »Das war die beste Entscheidung meines Lebens«, hatte sie dem Publikum auf der »Romance Writers of Australia«-Konferenz in ihrem Key-Note-Vortrag im letzten Jahr gesagt. Vermutlich hatten alle gedacht: Tja, Frances, möglicherweise solltest du mal die ein oder andere Rezension lesen, dann verkaufen sich deine Bücher vielleicht auch wieder.
Wieso nur hatte sie es für eine gute Idee gehalten, direkt nachdem zum ersten Mal in dreißig Jahren eines ihrer Manuskripte abgelehnt worden war, einen Verriss zu lesen?
Und nun passierte noch etwas anderes. Offenbar – und bei Gott, das war ja so faszinierend – löste sich gerade ihr komplettes Selbstbild in Luft auf.
Komm schon, Frances, reiß dich zusammen, du bist zu alt für eine Existenzkrise.
Doch offenbar war sie es nicht.