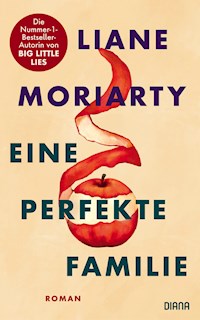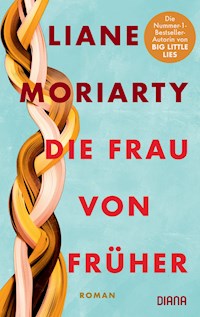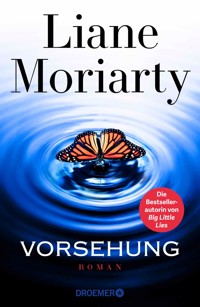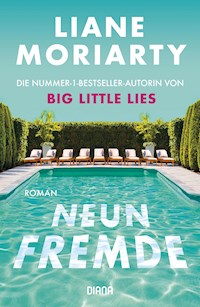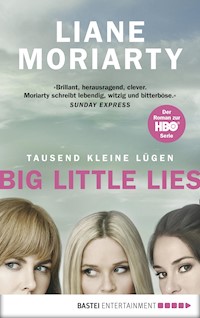
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jane flieht vor ihrer Vergangenheit. Sie hat es seit der Geburt ihres Sohnes vor fünf Jahren nirgendwo länger ausgehalten. Nun ist sie im idyllischen australischen Küstenstädtchen Pirriwee gestrandet und hat das Gefühl, endlich angekommen zu sein. Schnell schließt sie Freundschaft mit der lebhaften Madeline und der wunderschönen Celeste. Doch plötzlich geraten die drei Frauen in den Strudel von dunklen Geheimnissen, Lügen und Intrigen. Als dann bei einem Elternschulfest ein Mann tödlich verunglückt, stellt sich die Frage: War es ein wirklich nur ein Unfall?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Pirriwee Public School
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Danksagung
Über die Autorin
Liane Moriarty ist freischaffende Werbetexterin und wurde für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Ihr Debütroman Drei Wünsche frei stieg auf Anhieb in die Top Ten der australischen Bestsellerliste ein. Auch ihre weiteren Romane Ein Geschenk des Himmels, Vergiss ihn nicht, Alles aus Liebe und Das Geheimnis meines Mannes waren große Erfolge. Liane Moriarty lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Sydney.
Liane Moriarty
Tausend kleine Lügen
Roman
Aus dem australischen Englisch von Sylvia Strasser
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright Liane Moriarty, 2014
First published as »Big Little Lies« in Australia
and the United States of America 2014
First published as »Little Lies« in Great Britain by Michael Joseph 2014
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille
Motiv: Cover Art © 2017 Home Box Office, Inc.
All Rights Reserved.
HBO© is a service mark of Home Box Office Inc.
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1478-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
In Liebe
Wer mich haut, muss mich auch küssen,das sollt ihr alle, alle wissen!
Pirriwee Public School… hier lernen wir direkt am Meer!
Die Pirriwee-Schule ist eine mobbingfreie Zone!
Wir schikanieren niemanden.
Wir lassen uns von niemandem schikanieren.
Wir sehen nicht weg, wenn jemand schikaniert wird.
Wir haben den Mut, den Mund aufzumachen,
wenn unsere Freunde schikaniert werden.
Wir sagen NEIN zu Leuten, die andere schikanieren!
1
»Das hört sich drüben bei der Schule aber gar nicht nach einem Quizabend an«, sagte Mrs. Patty Ponder zu Marie Antoinette. »Das klingt eher nach einer Prügelei.«
Die Katze antwortete nicht. Sie döste auf dem Sofa, weil ihr Quizabende völlig gleichgültig waren.
»Das interessiert dich wohl nicht, hm? Es ist dir völlig egal, was? Sollen sie doch Kuchen essen! Ist es das, was du denkst? Sie essen wirklich eine Menge Kuchen, nicht wahr? Diese ganzen Kuchenstände! Du meine Güte! Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass eine von den Müttern tatsächlich Kuchen isst. Sie sind alle so rank und schlank, findest du nicht? Genau wie du.«
Marie Antoinette quittierte das Kompliment mit einem höhnischen Grinsen. Diese »Sollen-sie-doch-Kuchen-essen«-Geschichte hatte einen ziemlichen Bart, und sie hatte kürzlich erst eines von Mrs. Ponders Enkelkindern sagen hören, dass es eigentlich heißen müsste: »Sollen sie doch Brioche essen!«, und dass die historische Marie Antoinette es vor allem nie gesagt hatte.
Mrs. Ponder griff nach der Fernbedienung und stellte den Ton von Dancing with the Stars leiser. Sie hatte die Lautstärke fast voll aufgedreht gehabt, um das Rauschen des sintflutartigen Regens zu übertönen, aber der hatte jetzt nachgelassen.
Sie konnte laute Stimmen hören. Aufgebrachtes Geschrei dröhnte durch die stille, kalte Nacht. Es tat Mrs. Ponder weh, als wäre die Wut gegen sie gerichtet. (Mrs. Ponder war mit einer zornigen Mutter aufgewachsen.)
»Du meine Güte! Glaubst du, sie haben sich wegen der Hauptstadt von Guatemala in die Wolle gekriegt? Weißt du, wie die Hauptstadt von Guatemala heißt? Nein? Ich auch nicht. Das sollten wir mal googeln. Sieh mich nicht so verächtlich an!«
Marie Antoinette rümpfte die Nase.
»Schauen wir mal, was da los ist«, sagte Mrs. Ponder energisch.
Sie war nervös, deshalb gab sie sich vor der Katze betont resolut, so wie früher vor ihren Kindern, wenn ihr Mann nicht da gewesen war und sie nachts seltsame Geräusche aufgeschreckt hatten.
Mrs. Ponder stemmte sich mithilfe ihres Gehgestells aus dem Sessel hoch. Marie Antoinette (die nicht auf das selbstbewusste Gehabe hereinfiel) schlüpfte mit ihrem geschmeidigen Körper zwischen Mrs. Ponders Beine, als sie ihr Gehgestell durch den Flur zum rückwärtigen Teil des Hauses schob.
Von ihrem Nähzimmer aus konnte man direkt auf den Hof der Pirriwee-Schule blicken.
»Spinnst du, Mum? Du kannst doch nicht so nahe an einer Grundschule wohnen«, hatte ihre Tochter gesagt, als Mrs. Ponder davon sprach, das Haus kaufen zu wollen.
Sie aber liebte es, den ganzen Tag immer wieder das wilde Geplapper von Kindern zu hören, und da sie nicht mehr Auto fuhr, störte es sie nicht im Geringsten, dass die Straße mit diesen riesigen Autos verstopft war, die ein bisschen wie Lastwagen aussahen und die heutzutage anscheinend alle fuhren. Die Frauen hinter dem Lenkrad trugen große Sonnenbrillen und beugten sich aus dem Fenster und riefen einander schrecklich wichtige Informationen über Harriettes Ballettstunden und Charlies Sprachtherapie zu.
Die Mütter nahmen das Muttersein in der heutigen Zeit so furchtbar ernst. Ihre angespannten Gesichter. Ihre geschäftigen kleinen Hinterteile, die sie in knackiger Sportkleidung in die Schule trugen. Ihre wippenden Pferdeschwänze. Ihr Blick, der starr auf das Handy gerichtet war, das sie vor sich hertrugen wie einen Kompass. Mrs. Ponder konnte nur darüber lachen. Aber es war ein liebevolles Lachen. Ihre drei Töchter waren ja genauso. Und wie hübsch sie alle waren!
»Wie geht’s denn so heute Morgen?«, rief Mrs. Ponder den Müttern jedes Mal zu, wenn sie mit einer Tasse Tee auf der Veranda saß oder sich im Garten aufhielt, um zu gießen.
»Wir sind furchtbar in Eile, Mrs. Ponder! So viel zu tun!«, riefen sie zurück, ohne innezuhalten, während sie ihre Kinder am Arm hinter sich herzogen. Sie waren nett und freundlich und nur eine Spur herablassend, weil sie ja nichts dafürkonnten. Sie war eben so schrecklich alt! Und sie hatten eben so schrecklich viel zu tun!
Die Väter, von denen immer mehr den Gang zur Schule übernahmen, waren ganz anders. Sie hatten es fast nie eilig, sondern schlenderten betont lässig vorbei. Keine große Sache. Alles unter Kontrolle. Das war die Botschaft. Mrs. Ponder lachte genauso gutmütig über sie wie über die Mütter.
Aber jetzt hörte es sich an, als würden sich die Eltern der Pirriwee-Schule gehörig danebenbenehmen. Mrs. Ponder schob die Spitzengardine zurück. Sie hatte seit Kurzem ein Schutzgitter vor dem Fenster. Die Schule hatte es bezahlt, nachdem ein Kricketball durch die Scheibe geflogen war und um ein Haar Marie Antoinette k. o. geschlagen hätte. (Ein paar Jungs aus der dritten Klasse hatten ihr eine handbemalte Karte mit einer Entschuldigung überreicht, die jetzt aufgeklappt auf dem Kühlschrank stand.)
Das mehrstöckige Sandsteingebäude auf der anderen Seite des Hofs verfügte über einen Veranstaltungssaal im oberen Stock und einen großen Balkon mit Blick aufs Meer. Mrs. Ponder war einige Male dort gewesen, um eine Veranstaltung zu besuchen: einen Vortrag eines hiesigen Historikers, ein Essen, zu dem der Verein »Freunde der Bibliothek« geladen hatte. Es war ein wunderschöner Saal. Manchmal gaben ehemalige Schüler dort ihren Hochzeitsempfang. Sicher fand auch der Quizabend dort statt. Von den an diesem Abend eingenommenen Spenden sollten Smartboards gekauft werden, was auch immer das sein mochte. Mrs. Ponder konnte sich unter »schlauen Tafeln« nichts vorstellen.
Sie war übrigens auch eingeladen worden. Obwohl nie eines ihrer Kinder oder Enkelkinder die Pirriwee-Schule besucht hatte, hatte ihre unmittelbare Nachbarschaft zur Schule ihr so etwas wie einen Promi-Status verliehen. Sie hatte die Einladung dankend abgelehnt. Was machte es für einen Sinn, eine Schulveranstaltung zu besuchen, wenn man keine Kinder an der betreffenden Schule hatte?
Die wöchentliche Schulversammlung wurde ebenfalls im Veranstaltungssaal abgehalten. Jeden Freitagmorgen richtete sich Mrs. Ponder mit einer Tasse English-Breakfast-Tee und einem Ingwerplätzchen in ihrem Nähzimmer ein. Ihr kamen jedes Mal die Tränen, wenn der Gesang der Kinder aus dem zweiten Stock der Schule zu ihr herunterdrang. Nur wenn sie Kinder singen hörte, glaubte sie an Gott.
Aber was sie jetzt vernahm, war kein Kindergesang.
Derbe Kraftausdrücke fielen, eine ganze Menge sogar. Sie war nicht prüde, was das betraf (ihre älteste Tochter fluchte wie ein Bierkutscher), doch es war beunruhigend und äußerst verstörend, jemanden dieses spezielle vulgäre Wort wie wahnsinnig an einem Ort kreischen zu hören, der normalerweise von Kinderlachen und übermütigem Geschrei widerhallte.
»Habt ihr alle zu tief ins Glas geschaut?«, murmelte Mrs. Ponder vor sich hin.
Ihr regennasses Fenster befand sich auf gleicher Höhe mit dem Eingang des Schulgebäudes. Plötzlich wurden die Türen aufgestoßen, Leute strömten heraus. Die Beleuchtung rings um den gepflasterten Eingangsbereich schaltete sich ein und leuchtete die Szene aus wie eine Theaterbühne. Nebelschwaden verstärkten den Effekt noch.
Es war ein sonderbarer Anblick.
Die Eltern der Schüler der Pirriwee-Schule hatten eine er-staunliche Vorliebe für Kostümfeste. Ein gewöhnlicher Quizabend genügte ihnen nicht. Mrs. Ponder wusste von der Einladung, dass irgendein Genie auf den Gedanken gekommen war, einen »Audrey-und-Elvis-Quizabend« daraus zu machen, was bedeutete, dass die Frauen sich als Audrey Hepburn und die Männer sich als Elvis Presley verkleiden mussten. (Das war mit ein Grund, weshalb Mrs. Ponder die Einladung ausgeschlagen hatte. Kostümfeste waren ihr immer schon ein Gräuel gewesen.) Die Audrey Hepburn aus Frühstück bei Tiffany war allem Anschein nach die beliebteste Vorlage. Die Frauen trugen lange schwarze Kleider, weiße Handschuhe und Perlenketten. Die Männer hingegen hatten sich größtenteils für eine Interpretation des späten Elvis entschieden und waren in glänzenden weißen Jumpsuits erschienen, die bis zur Brust aufgeknöpft und mit Glitzersteinen besetzt waren. Die Frauen sahen bezaubernd aus, die armen Männer einfach nur lächerlich.
Mrs. Ponder beobachtete, wie ein Elvis einem anderen einen Kinnhaken verpasste. Der Geschlagene taumelte rückwärts und rempelte eine Audrey an. Zwei Elvisse packten ihn von hinten und zerrten ihn weg. Eine Audrey schlug die Hände vors Gesicht und wandte sich ab, als könnte sie nicht mehr hinsehen. Jemand rief: »Aufhören! Hört endlich auf!«
Ganz recht. Was würden eure wunderschönen Kinder denken, wenn sie euch so sähen?
»Ob ich die Polizei rufen soll?«, überlegte Mrs. Ponder laut.
Doch dann hörte sie schon das Heulen einer Polizeisirene in der Ferne. Im gleichen Augenblick begann eine Frau auf dem Balkon wie von Sinnen zu kreischen.
*
Gabrielle: Es waren ja nicht bloß die Mütter, wissen Sie. Ohne die Väter wäre das alles nicht passiert. Es hat mit den Müttern angefangen. Wir waren sozusagen die Schlüsselfiguren. Wir Mummys. Ich hasse dieses Wort. Es ist so altbacken, finden Sie nicht auch? Mom ist besser. So wie die Amerikaner sagen. Das klingt dünner. Ich habe eine Körperbildstörung, wissen Sie. Aber wer hat die nicht?
Bonnie: Es war alles ein schreckliches Missverständnis. Gefühle wurden verletzt, und dann gerieten die Dinge immer mehr außer Kontrolle. Wie das eben so passiert. Jeder Konflikt geht letztendlich auf verletzte Gefühle zurück, sehen Sie das nicht auch so? Scheidungen. Weltkriege. Prozesse. Na ja, vielleicht nicht jeder Prozess. Darf ich Ihnen einen Kräutertee anbieten?
Stu: Ich kann Ihnen genau sagen, wie es so weit kommen konnte. Frauen schaffen es einfach nicht, etwas auf sich beruhen zu lassen. Ich will damit nicht sagen, dass die Jungs keine Schuld trifft. Aber wenn die Mädels nicht so ausgerastet wären, und das klingt jetzt vielleicht sexistisch, ist es aber nicht, es ist eine schlichte Tatsache, da können Sie jeden Mann fragen, nicht so einen von der neuen Sorte, so einen Ich-benutze-Feuchtigkeitscreme-Lackaffen, nein, ich meine einen richtigen Mann, also da können Sie jeden Mann fragen, er wird Ihnen bestätigen, dass Frauen im Nachtragendsein die Goldmedaille verdient hätten. Sie sollten mal meine Frau in Aktion erleben. Und dabei ist sie noch nicht einmal die Schlimmste von allen.
Miss Barnes: Helikoptereltern. Bevor ich an der Pirriwee-Schule anfing, habe ich das mit den überfürsorglichen Eltern für eine maßlose Übertreibung gehalten. Ich meine, ich bin in den Neunzigerjahren aufgewachsen, und meine Mum und mein Dad liebten mich, sie zeigten Interesse für mich, aber sie waren nicht besessen von mir.
Mrs. Lipmann: Das ist eine Tragödie, die wir alle zutiefst bedauern, aber wir müssen nach vorn blicken. Mehr habe ich nicht dazu zu sagen.
Carol: Meiner Ansicht nach ist nur der Erotikleseklub schuld daran. Aber das ist, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung.
Jonathan: Es war überhaupt nichts Erotisches am Erotikleseklub, das dürfen Sie mir glauben.
Jackie: Wissen Sie, was ich denke? Für mich ist das eine feministische Angelegenheit.
Harper: Eine feministische Angelegenheit? Wer kommt denn auf so einen Blödsinn? Ich werde Ihnen sagen, womit alles angefangen hat. Mit dem Vorfall am Infotag für Vorschulkinder.
Graeme: So, wie ich es verstanden habe, läuft das Ganze doch auf einen Wettkampf zwischen den Frauen, die nur Hausfrau und Mutter sind, und den berufstätigen Müttern hinaus. Wie nennen sie es doch gleich? Den ›Mummy-Krieg‹. Meine Frau war übrigens nicht beteiligt. Sie hat keine Zeit für so was.
Thea: Ihr Journalisten seid doch bloß wegen des französischen Kindermädchens so heiß auf die Story. Das interessiert euch am meisten. Ich habe heute im Radio gehört, wie jemand von einem »französischen Dienstmädchen« gesprochen hat, was Juliette sicherlich nicht war. Renata hatte nämlich auch noch eine Haushälterin. Wie schön für sie! Ich habe vier Kinder und niemanden, der mir hilft! Nicht, dass ich ein Problem mit berufstätigen Müttern an sich hätte, aber ich frage mich, warum sie dann überhaupt Kinder in die Welt gesetzt haben.
Melissa: Wissen Sie, warum sich die Sache so hochgeschaukelt hat? Wegen der Kopfläuse. Oh, du meine Güte, ich darf gar nicht daran denken!
Samantha: Die Kopfläuse? Was haben die denn damit zu tun? Wer hat Ihnen das erzählt? Das war Melissa, stimmt’s? Die Ärmste litt an einem posttraumatischen Stresssyndrom, weil ihre Kinder diese Viecher einfach nicht losgeworden sind. Entschuldigung. Das ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig.
Detective Sergeant Adrian Quinlan: Ich möchte eines klarstellen. Das ist kein Affenzirkus hier. Wir ermitteln in einem Mordfall.
2
Sechs Monate vor dem Quizabend
Vierzig. Madeline Martha Mackenzie wurde heute vierzig Jahre alt.
»Ich bin vierzig«, sagte sie laut am Steuer ihres Autos. Sie sprach das Wort gedehnt aus, wie einen besonderen Klangeffekt. »Viiiierzig.«
Im Rückspiegel fing sie den Blick ihrer Tochter auf.
Chloe grinste und äffte ihre Mutter nach: »Ich bin fünf. Füüüünf!«
»Vierzig!«, trällerte Madeline wie eine Opernsängerin. »Tralalala!«
»Fünf!«, sang Chloe.
Madeline versuchte es mit einer Rap-Version, wobei sie mit den Fingern im Takt auf das Lenkrad trommelte. »Ich bin vierzig, yeah, vierzig …«
»Das reicht jetzt, Mummy«, sagte Chloe mit fester Stimme.
»Entschuldige.«
Madeline fuhr ihre Tochter zum Infotag ihrer Vorschule (»Auf die Plätze – fertig – Vorschule!«). Nicht, dass Chloe vor ihrer Einschulung im kommenden Januar irgendwelche Informationen benötigt hätte. Sie kannte sich in den Gepflogenheiten an der Pirriwee-Schule bereits bestens aus. Als Madeline ihren Sohn Fred an diesem Morgen zur Schule gebracht hatte, hatte Chloe ihren zwei Jahre älteren Bruder unter ihre Fittiche genommen. Manchmal schien es, als wäre er der Jüngere von beiden. »Fred, du hast vergessen, deine Schultasche in den Korb zu tun! Da hinein. So ist es gut. Braver Junge.«
Fred hatte seine Schultasche gehorsam in den dafür vorgesehenen Korb plumpsen lassen und war dann losgestürmt, um Jackson in den Schwitzkasten zu nehmen. Madeline tat so, als sähe sie es nicht. Jackson hatte es wahrscheinlich verdient. Jacksons Mutter, Renata, bemerkte nicht, dass ihr Sohn gerade ein kleines Problem hatte, weil sie in eine Unterhaltung mit Harper vertieft war. Ihre ernsten, besorgten Gesichter zeugten von der enormen Belastung, ihre begabten Kinder großzuziehen. Renata und Harper besuchten dieselbe wöchentliche Selbsthilfegruppe für Eltern hochbegabter Kinder. Madeline stellte sich vor, wie sie alle im Kreis saßen und händeringend jammerten, während ihre Augen vor Stolz glänzten.
Während Chloe damit beschäftigt wäre, am Infotag die anderen Kinder herumzukommandieren (ihre Begabung lag im Herumkommandieren – eines Tages würde sie ein großes Unternehmen leiten), würde sich Madeline zu Kaffee und Kuchen mit ihrer Freundin Celeste treffen. Celestes Söhne – Zwillinge – würden ebenfalls im kommenden Jahr eingeschult werden und am Infotag garantiert Amok laufen (ihre Begabung lag im Krachmachen – fünf Minuten in ihrer Gegenwart und Madeline bekam Kopfschmerzen). Celeste kaufte immer erlesene und sündhaft teure Geburtstagsgeschenke, deshalb freute sich Madeline schon auf ihre Verabredung. Anschließend würde sie Chloe zu ihrer Schwiegermutter bringen, sich dann mit ein paar Freunden zum Lunch treffen, und danach würden alle ihre Kinder von der Schule abholen. Die Sonne schien. Sie trug ihre traumhaft schönen neuen Stilettos von Dolce & Gabbana (sie hatte sie online bestellt, dreißig Prozent günstiger). Es würde ein ganz bezaubernder Tag werden.
»Hiermit ist das Madeline-Festival eröffnet!«, hatte ihr Mann Ed an diesem Morgen gesagt, als er ihr den Kaffee ans Bett gebracht hatte.
Madeline war berühmt für ihre Vorliebe für Geburtstage und Feste aller Art. Jeder Vorwand für Champagner war willkommen.
Trotzdem. Vierzig.
Als sie den vertrauten Weg zur Schule fuhr, dachte sie über ihr wunderbares neues Alter nach. Vierzig. Sie konnte sich gut daran erinnern, wie sich »vierzig« angefühlt hatte, als sie fünfzehn gewesen war. Ein total farbloses Alter. Man steckte in der Mitte seines Lebens fest. Mit vierzig war im Grunde nichts mehr von großer Bedeutung. Man würde keine richtigen Gefühle mehr haben, weil man bequem in seinen angestaubten Vierziger-Polstern versank.
»Vierzigjährige tot aufgefunden!« Ach herrje.
»Einundzwanzigjährige tot aufgefunden!« Eine Tragödie! Ein Schock! Findet den Mörder!
Madeline musste jedes Mal, wenn sie in den Nachrichten von einer Vierzigjährigen hörte, die zu Tode gekommen war, eine kleine Korrektur im Kopf vornehmen. He, warte mal, das könnte ja ich sein! Das wäre traurig! Die Leute wären traurig, wenn ich tot wäre. Am Boden zerstört. Da hast du es, Welt im Jugendwahn: Ich bin vielleicht vierzig, aber ich werde geliebt.
Andererseits war es wahrscheinlich normal, dass man den Tod einer Einundzwanzigjährigen mehr bedauerte als den Tod einer Vierzigjährigen. Letztere hatte ja zwanzig Jahre länger gelebt. Falls also ein Killer frei herumliefe und wahllos um sich schösse, würde sich Madeline verpflichtet fühlen, sich schützend vor eine Einundzwanzigjährige zu werfen. Sich für die Jugend zu opfern. Das war nur gerecht.
Und sie würde es auch tun, wenn sie sich sicher sein könnte, dass es eine nette junge Person war. Nicht so eine unerträgliche wie diese Kleine in dem kleinen blauen Mitsubishi unmittelbar vor ihr. Sie benutzte während des Fahrens ihr Handy und machte sich nicht einmal die Mühe, es unauffällig zu tun. Wahrscheinlich schrieb sie eine SMS oder änderte ihren Facebook-Status.
Da sieht man es wieder! Die Kleine hätte den frei herumlaufenden Killer nicht einmal bemerkt! Sie hätte auf ihr Handy gestiert, während Madeline ihr Leben für sie geopfert hätte! Das war doch zum Aus-der-Haut-Fahren!
Das kleine Auto mit dem schiefen Fahranfänger-Aufkleber an der Heckscheibe war offenbar voll besetzt mit jungen Leuten. Mindestens drei saßen hinten – Madeline konnte wippende Köpfe, gestikulierende Hände sehen. War das etwa ein Fuß, der herumgeschwenkt wurde? Das würde früher oder später ein Unglück geben. Sie sollten sich lieber konzentrieren. Erst letzte Woche, als Madeline nach ihrer Stoßwellentherapie noch schnell einen Kaffee getrunken hatte, hatte sie in der Zeitung gelesen, dass so viele junge Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben waren, weil sie während des Fahrens eine SMS geschrieben hatten. Bin unterwegs. Bin gleich da! Das waren ihre letzten, törichten (und oft auch noch falsch geschriebenen) Worte gewesen. Madeline waren die Tränen gekommen beim Anblick des Fotos einer gramgebeugten Mutter, die das Handy ihrer verunglückten Tochter gleichsam als Warnung in die Kamera hielt.
»Diese kleinen Idioten«, schimpfte sie laut, als das Auto vor ihr gefährlich nahe an die andere Fahrspur geriet.
»Wer ist ein Idiot?«, fragte Chloe.
»Das Mädchen am Steuer des Wagens vor uns, weil sie beim Fahren telefoniert.«
»So wie du, wenn du Daddy anrufen musst, weil wir zu spät dran sind«, sagte Chloe.
»Das habe ich nur ein einziges Mal gemacht!«, protestierte Madeline. »Und ich war sehr vorsichtig und habe mich beeilt! Und ich bin vierzig Jahre alt!«
»Seit heute«, bemerkte Chloe altklug. »Du bist seit heute vierzig Jahre alt.«
»Ja! Außerdem habe ich nur schnell telefoniert und keine SMS geschrieben. Wenn man eine Nachricht schreibt, guckt man nicht auf die Straße. Deshalb ist das verboten, und es ist ungezogen, und du musst mir versprechen, das nie, nie, nie zu machen, wenn du erst einmal Auto fahren kannst.« Ihre Stimme bebte beim bloßen Gedanken daran, dass Chloe irgendwann ein Teenager sein und Auto fahren würde.
»Aber man darf schnell mal telefonieren?«, hakte Chloe nach.
»Nein! Das ist auch verboten.«
»Dann hast du also gegen das Gesetz verstoßen«, sagte Chloe voller Genugtuung. »Genau wie ein Räuber.«
Räuber hatten es ihr zurzeit besonders angetan. Eines Tages würde sie sich bestimmt mit bösen Jungs verabreden. Bösen Jungs auf Motorrädern.
»Halt dich an die netten Jungs, Chloe!«, sagte Madeline nach einem Augenblick. »Solche wie Daddy. Böse Jungs bringen dir deinen Kaffee nicht ans Bett, das darfst du mir glauben.«
»Wovon in aller Welt faselst du denn jetzt schon wieder, Frau?«, seufzte Chloe.
Sie hatte diesen Satz von ihrem Vater aufgeschnappt und konnte Eds erschöpften Tonfall einwandfrei nachahmen.
Beim ersten Mal hatten Madeline und Ed den Fehler gemacht, darüber zu lachen, daher brachte ihre Tochter den Satz immer wieder und mit perfektem Timing, und sie konnten einfach nicht anders, als sich jedes Mal köstlich darüber zu amüsieren.
Aber dieses Mal beherrschte sich Madeline und lachte nicht. Chloe wandelte zurzeit auf einem sehr schmalen Grat zwischen süßem Fratz und bockiger Göre. Madeline wandelte vermutlich auf dem gleichen Grat.
Sie musste an einer roten Ampel anhalten. Die junge Fahrerin in dem kleinen blauen Mitsubishi vor ihr hatte den Blick immer noch auf ihr Handy gerichtet. Madeline schlug mit der flachen Hand auf die Hupe. Sie sah, wie die Fahrerin in den Rückspiegel schaute und alle anderen im Auto sich zu Madeline umdrehten.
»Telefon weg!«, brüllte sie und tat so, als schriebe sie eine SMS, indem sie mit dem Zeigefinger auf ihre Handfläche tippte. »Das ist verboten! Und gefährlich!«
Das Mädchen zeigte ihr den Mittelfinger – die klassische »Du-mich-auch«-Geste.
»Alles klar!«
Madeline zog die Handbremse an und schaltete die Warnblinkanlage ein.
»Was hast du denn vor?«, fragte Chloe.
Madeline schnallte sich ab und stieß die Wagentür auf.
»Wir müssen doch zur Schule!« Chloes Stimme klang panisch. »Wir werden zu spät kommen! Oh, Elend!«
Der Ausruf: »Oh, Elend!« stammte aus einem Kinderbuch, aus dem sie Fred vorgelesen hatten, als er noch klein gewesen war. Die ganze Familie, sogar Madelines Eltern und einige von Madelines Freunden hatten ihn mittlerweile übernommen. Es war ein hochgradig ansteckender Spruch.
»Keine Sorge«, sagte Madeline. »Dauert nur eine Sekunde. Ich rette ein paar junge Leben.«
Sie stolzierte auf ihren neuen Stilettos zu dem blauen Mitsubishi und klopfte an das Fenster auf der Fahrerseite.
Die Scheibe glitt herunter, und die Fahrerin verwandelte sich von einer schemenhaften Gestalt in ein reales junges Mädchen mit weißer Haut, einem funkelnden Nasenring und schlampig aufgetragener, verklumpter Wimperntusche.
Die junge Frau sah mit einer Mischung aus Aggressivität und Furcht zu Madeline auf und fragte: »Was haben Sie für ein Problem?«
Sie hielt ihr Handy immer noch lässig in der linken Hand.
»Weg mit dem Handy! Sie könnten sich und Ihre Freundinnen umbringen!« Im gleichen Ton redete Madeline mit Chloe, wenn diese sehr ungezogen war. Sie langte durch das Fenster, griff nach dem Handy und warf es dem Mädchen auf dem Beifahrersitz zu, das sie mit offenem Mund anstarrte. »Okay? Lassen Sie es einfach sein!«
Sie konnte das schallende Gelächter der jungen Leute hören, als sie zu ihrem Auto zurückstöckelte. Es war ihr egal. Sie fühlte sich auf angenehme Weise lebendig. Ein Auto fuhr heran und hielt hinter ihrem. Madeline hob entschuldigend die Hand und ging schnell weiter. Die Ampel würde sicher gleich auf Grün schalten.
Dann knickte sie um. Im einen Moment tat ihr Knöchel, was von ihm erwartet wurde, und im nächsten stand er in einem widerlich falschen Winkel nach außen. Sie fiel zur Seite und schlug ungebremst auf dem Boden auf. Oh, Elend!
*
Das war mit großer Wahrscheinlichkeit der Augenblick, in dem die Geschichte ihren Anfang nahm.
Mit einem wenig graziösen Sturz infolge eines umgeknickten Knöchels.
3
Jane musste an einer roten Ampel hinter einem großen, glänzenden Geländewagen halten, dessen Warnblinkanlage eingeschaltet war. Eine dunkelhaarige Frau eilte am Straßenrand zurück zu dem Auto. Sie trug ein luftiges blaues Sommerkleid und hochhackige Riemchensandalen, und sie lächelte Jane zu und hob mit einer entschuldigenden, charmanten Geste die Hand. Einer ihrer Ohrringe funkelte in der Morgensonne so hell, als hätte eine höhere Macht sie berührt.
Ein Glitzermädchen. Älter als Jane, aber immer noch eine von der glitzernden Sorte. Jane hatte Mädchen wie sie ihr Leben lang mit wissenschaftlichem Interesse beobachtet. Vielleicht auch mit ein wenig Ehrfurcht. Und nicht ohne Neid. Sie waren nicht unbedingt die Hübschesten, aber sie schmückten sich überaus liebevoll, so wie man einen Christbaum schmückt, mit baumelnden Ohrringen, klirrenden Armreifen und hauchdünnen, nutzlosen Halstüchern. Beim Reden berührten sie einen häufig am Arm. Janes beste Freundin in der Schule war auch ein Glitzermädchen gewesen. Jane hatte eine Schwäche für diesen Mädchentyp.
Und dann stürzte die Frau, als hätte man ihr plötzlich den Boden unter den Füßen weggezogen.
»Autsch«, sagte Jane und sah schnell weg, um die Würde der Frau nicht zu verletzen.
»Hast du dir wehgetan, Mummy?«, fragte Ziggy, der auf der Rückbank saß.
Das war stets seine größte Sorge – dass sie sich verletzen könnte.
»Nein«, antwortete Jane. »Ich nicht, aber die Frau dort drüben. Sie ist gestolpert und hingefallen.«
Sie wartete darauf, dass die Frau wieder aufstand und in ihr Auto einstieg, aber sie lag immer noch auf dem Asphalt. Sie hatte den Kopf in den Nacken gelegt, und ihr Gesicht hatte den verkniffenen Ausdruck eines Menschen angenommen, der große Schmerzen hat. Die Ampel sprang auf Grün, und ein kleines Auto mit einem Fahranfänger-Aufkleber, das vor dem Geländewagen gestanden hatte, fuhr mit quietschenden Reifen an und schoss davon.
Jane setzte den Blinker und wollte um den Geländewagen herumfahren. Ziggy und sie waren unterwegs zur neuen Schule ihres Sohnes, wo eine Infoveranstaltung stattfinden sollte, und Jane kannte den Weg nicht. Sie waren beide aufgeregt, taten jedoch so, als wären sie es nicht. Jane wollte nicht auf den letzten Drücker dort ankommen.
»Ist mit der Dame alles in Ordnung?«, fragte Ziggy.
Ein Ruck ging durch Jane. Das geschah manchmal, wenn sie von ihrem Leben abgelenkt und durch etwas oder jemanden (nicht selten Ziggy) gerade noch rechtzeitig daran erinnert wurde, wie sich eine nette, normale, gut erzogene Erwachsene benahm.
Wenn Ziggy nicht gewesen wäre, wäre sie einfach weitergefahren. Sie hatte sich so sehr darauf konzentriert, ihn pünktlich zu seiner Schule zu bringen, dass sie beinahe eine verletzte Frau hilflos am Straßenrand zurückgelassen hätte.
»Ich seh mal nach«, sagte Jane, als hätte sie das die ganze Zeit beabsichtigt.
Sie schaltete ebenfalls die Warnblinkanlage ein und öffnete die Autotür, wobei sie einen inneren Widerstand verspürte, der ziemlich egoistisch war.
Du kommst ganz schön ungelegen, Glitzerlady!
»Alles in Ordnung?«, rief sie.
»Ja, ja, alles bestens!« Die Frau lächelte und versuchte, sich aufzusetzen, griff sich aber sofort an ihren Knöchel und wimmerte vor Schmerz. »Au! Mist! Ich bin umgeknickt, das ist alles. Ich bin so ein Idiot! Ich bin ausgestiegen, um der Fahrerin vor mir zu sagen, sie soll ihr Handy weglegen. Geschieht mir ganz recht. Warum benehme ich mich auch wie eine Oberlehrerin?!«
Jane ging neben ihr in die Hocke.
Das schulterlange dunkle Haar der Frau war gut geschnitten, und sie hatte ganz zarte Sommersprossen auf der Nase. Diese Sommersprossen waren auf seltsame Weise ästhetisch ansprechend, so wie eine Kindheitserinnerung an den Sommer, und wurden perfekt ergänzt durch die feinen Linien rings um ihre Augen und die absurd baumelnden Ohrringe.
Janes innerer Widerstand verflüchtigte sich.
Die Frau war ihr sympathisch. Sie wollte ihr helfen.
(Und was genau besagte das? Dass sie sich weiter über sie geärgert hätte, wenn sie eine zahnlose alte Hexe mit Warzen auf der Nase gewesen wäre? Wie ungerecht! Wie grausam! Sie war einfach nur deshalb so nett zu dieser Frau, weil sie ihre Sommersprossen mochte.)
Der Ausschnitt ihres Sommerkleids war mit einer Bordüre, einem Blumenmuster in wunderschöner Lochstickerei, besetzt. Gebräunte, sommersprossige Haut schimmerte hindurch.
»Da muss Eis drauf, so schnell wie möglich«, sagte Jane. Sie kannte sich aus ihren Netball-Tagen mit Knöchelverletzungen aus, und sie sah, dass der Knöchel der Frau bereits anzuschwellen begann. »Und er muss hochgelagert werden.«
Sie nagte an ihrer Unterlippe und schaute sich hoffnungsvoll um, ob irgendjemand in der Nähe war. Sie hatte keine Ahnung, wie sie ihre Ratschläge in die Tat umsetzen sollte.
»Ich habe heute Geburtstag«, sagte die Frau traurig. »Ich werde vierzig.«
»Herzlichen Glückwunsch.«
Jane fand es irgendwie süß, dass eine Vierzigjährige es für erwähnenswert hielt, dass sie Geburtstag hatte.
Sie betrachtete die Riemchensandaletten der Frau. Ihre Fußnägel waren in einem leuchtenden Türkis lackiert. Die Absätze ihrer Stilettos waren so dünn wie Zahnstocher und gefährlich hoch.
»Kein Wunder, dass Sie umgeknickt sind«, sagte Jane. »In diesen Schuhen kann doch kein Mensch laufen!«
»Ich weiß, aber sind sie nicht todschick?« Die Frau drehte ihren Fuß, damit sie die Schuhe besser bewundern konnte. »Au! Verdammt noch mal, tut das weh! Entschuldigung«, fügte sie zerknirscht hinzu.
»Mummy!« Ein kleines Mädchen mit dunklen Locken, in denen ein funkelndes Diadem steckte, streckte den Kopf zum Autofenster hinaus. »Was machst du denn da? Steh endlich auf! Wir kommen noch zu spät!«
Glitzermutter, Glitzertochter.
»Danke für dein Mitgefühl, Schatz!«, erwiderte die Frau. Sie lächelte Jane kläglich zu. »Wir sind auf dem Weg zu ihrer Schule. Heute ist Infotag. Sie ist schon ganz aufgeregt.«
»Sie sprechen nicht zufällig von der Pirriwee-Schule, oder?«, fragte Jane verdutzt. »Da wollen wir nämlich auch hin. Mein Sohn Ziggy wird nächstes Jahr eingeschult. Wir ziehen im Dezember hierher.«
Es kam ihr schlicht unmöglich vor, dass diese Frau und sie etwas gemeinsam hatten oder dass ihre Lebenswege sich irgendwo kreuzen könnten.
»Ziggy? Wie Ziggy Stardust? Was für ein toller Name!«, sagte die Frau und streckte die Hand aus. »Ich bin übrigens Madeline. Madeline Martha Mackenzie. Ich weiß auch nicht, warum ich meinen zweiten Vornamen jedes Mal erwähne.«
»Jane«, stellte sie sich vor. »Jane Kein-zweiter-Vorname Chapman.«
*
Gabrielle: Zu guter Letzt war die Schule in zwei Lager gespalten. Es war wie … ich weiß nicht … wie in einem Bürgerkrieg. Entweder man gehörte zu Madelines oder zu Renatas Lager.
Bonnie: Nein, nein, das ist ja furchtbar. So war das nicht. Es gab keine Lager. Wir sind eine sehr enge Gemeinschaft. Alle hatten zu viel getrunken. Außerdem war Vollmond. Bei Vollmond spielen die Leute ein bisschen verrückt. Das ist mein Ernst. Das ist ein nachprüfbares Phänomen.
Samantha: Wir hatten Vollmond? Ich weiß nur, dass es in Strömen geregnet hat. Meine Haare waren richtig aufgequollen.
Mrs. Lipmann: Das ist lächerlich und in höchstem Grad verleumderisch. Mehr habe ich nicht dazu zu sagen.
Carol: Ich weiß, ich reite die ganze Zeit auf dem Erotikleseklub herum, aber ich bin davon überzeugt, dass auf einem ihrer kleinen – in Anführungszeichen – »Treffen« etwas passiert ist.
Harper: Hören Sie, ich habe geweint, als wir erfuhren, dass Emily hochbegabt ist. Ich dachte: Nicht schon wieder! Ich hatte das alles schon einmal mit Sophia durchgemacht, ich wusste genau, was mich erwartete. Renata ging es ganz genauso. Zwei hochbegabte Kinder. Kein Mensch kann sich vorstellen, was das für eine Belastung ist. Renata machte sich Gedanken, ob Amabella sich in der Schule einleben würde, ob sie genug gefordert würde und so weiter. Und als dann dieser Junge mit dem lächerlichen Namen, dieser Ziggy, das tat, was er tat – und das am Infotag –, nun, da war sie verständlicherweise völlig durch den Wind. Und damit fing alles an.
4
Jane hatte ein Buch mitgenommen, das sie im Auto lesen wollte, während Ziggy in der Schule war, doch stattdessen begleitete sie jetzt Madeline Martha Mackenzie (das hätte der Name eines drallen kleinen Mädchens aus einem Kinderbuch sein können) in ein Café am Strand, das Blue Blues hieß.
Das Café war ein lustiges kleines, verunstaltetes, irgendwie höhlenartiges Gebäude direkt an der Strandpromenade von Pirriwee.
Madeline humpelte barfuß neben Jane her und stützte sich schwer und ganz selbstverständlich, als wären sie alte Freundinnen, auf ihren Arm. Es fühlte sich sehr vertraulich an. Sie konnte Madelines Parfüm riechen, einen köstlichen Zitronenduft. Jane war in den vergangenen fünfeinhalb Jahren nicht oft von Erwachsenen berührt worden.
Als sie die Tür zum Café öffneten, kam ein jüngerer Mann mit ausgestreckten Armen hinter der Theke hervor auf sie zu. Er war ganz in Schwarz gekleidet, hatte blonde Surferlocken und in einem Nasenflügel ein Piercing, einen Stecker.
»Madeline! Was ist denn passiert?«
»Ich bin schwer verletzt, Tom«, antwortete sie. »Und dabei habe ich heute Geburtstag!«
»Oh, Elend!«, sagte Tom und zwinkerte Jane zu.
Er führte Madeline an einen Tisch in einer Ecke, wickelte Eiswürfel in ein Geschirrtuch, brachte ihr die Eispackung und rückte ihr dann einen Stuhl mit einem Kissen darauf zurecht, sodass sie ihren Fuß hochlagern konnte.
Jane blickte sich unterdessen im Café um. Es war »durch und durch bezaubernd«, wie ihre Mutter es ausgedrückt hätte. An den leuchtend blauen, ungleichmäßigen Wänden waren wacklige Borde angebracht, auf denen alte Bücher standen. Der Holzfußboden glänzte wie Gold in der Morgensonne, und Jane atmete eine berauschende Mischung aus Kaffee, frischen Backwaren, Meeresluft und altem Papier ein. Die Vorderseite des Cafés bestand aus Glas, und von jedem Platz aus konnte man den Strand sehen, als wäre man gekommen, um eine Vorstellung des Meeres zu erleben. Während Jane sich umschaute, verspürte sie eine Unzufriedenheit, die sie oft überkam, wenn sie das erste Mal an einem reizenden, behaglichen Ort war. Sie konnte dieses Gefühl am besten mit den Worten wenn ich doch nur dort wäre umschreiben. Dieses kleine Strandcafé war so entzückend, dass sie sich danach sehnte, wirklich dort zu sein – was allerdings keinen Sinn machte, da sie ja schon dort war.
»Jane? Was darf ich Ihnen bestellen?«, fragte Madeline. »Kaffee und etwas Süßes? Ich möchte mich doch bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken.« Sie wandte sich dem eifrigen Barista zu. »Tom! Das ist Jane! Sie ist mein Ritter in der glänzenden Rüstung. Meine Ritterin, besser gesagt.«
Jane hatte erst Madelines schweren Wagen nervös in einer Seitenstraße geparkt, aus dessen Kofferraum einen Kindersitz für Chloe geholt und ihn hinten in ihrem eigenen kleinen Kombi neben Ziggys Sitz befestigt. Dann hatte sie Madeline und ihre Tochter zur Schule gefahren.
Das war ein Projekt gewesen. Eine kleine Krise, die sie bewältigt hatte.
Es war ein Armutszeugnis für Janes soziales Leben, dass sie den Zwischenfall ein ganz klein wenig aufregend fand.
Auch für Ziggy war es etwas völlig Neues gewesen, ein anderes Kind auf der Rückbank neben sich zu haben, und dann noch ein so quirliges und charismatisches wie Chloe. Mit großen Augen und eingeschüchtert saß er da, während das kleine Mädchen ununterbrochen plapperte, bis sie ihr Ziel erreicht hatten.
Chloe erklärte Ziggy alles, was er über die Schule wissen musste, wer die Lehrer seien und dass sie sich vor dem Betreten des Klassenzimmers die Hände waschen müssten und nur ein einziges Papierhandtuch zum Abtrocknen benutzen dürften und wo sie ihr Mittagessen einnehmen würden und dass Erdnussbutter verboten sei, weil manche Leute allergisch darauf reagierten und sterben konnten, und sie habe ihre Lunchbox schon, mit einem Bild von Dora, der Zeichentrickfigur, darauf. Was sei denn auf Ziggys Lunchbox?
»Buzz Lightyear«, antwortete er prompt und höflich und absolut nicht wahrheitsgemäß, weil Jane ihm noch keine Lunchbox gekauft hatte.
Sie hatten noch nicht einmal über den Kauf einer Lunchbox gesprochen. Im Augenblick war er drei Tage die Woche in einer Kindertagesstätte untergebracht, wo die Mahlzeiten gestellt wurden. Eine Lunchbox zu packen würde für Jane eine völlig neue Erfahrung sein.
Madeline hatte im Auto gewartet, während Jane die beiden Kinder ins Schulhaus begleitete. Streng genommen war es Chloe, die die Führung übernahm. Sie marschierte mit funkelndem Diadem voraus. Ziggy und Jane wechselten einen Blick, als fragten sie sich: »Wer sind nur diese wunderbaren Leute?«
Jane war ein wenig nervös gewesen wegen des Infotags, hatte sich aber bemüht, sich nichts anmerken zu lassen, weil sie wusste, dass Ziggy dazu neigte, sich Sorgen zu machen. Es war ein Gefühl, als hätte sie eine neue Stelle angetreten – die Stelle als Mutter eines zukünftigen Vorschulkindes. Es gab neue Vorschriften und Verhaltensregeln zu lernen, Papierkram, der erledigt werden musste.
Doch beim Betreten der Schule stellte sich heraus, dass Chloe so eine Art goldene Eintrittskarte war.
Sofort eilten zwei andere Mütter auf sie zu und riefen: »Chloe! Wo ist denn deine Mum?«
Sie stellten sich Jane vor, und diese musste die Geschichte von Madelines Knöchel erzählen, und dann kam die Lehrerin, Miss Barnes, und wollte ebenfalls wissen, was passiert war, und so stand Jane plötzlich im Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit, was, wenn sie ehrlich war, ein recht angenehmes Gefühl war.
Das Schulhaus selbst war wunderschön. Es lag ganz am Ende der Landzunge, sodass das blaue Meer immer irgendwo am Rand von Janes Blickfeld zu funkeln schien. Die Klassenzimmer befanden sich in langen, niedrigen Sandsteingebäuden, und der von Laubbäumen beschattete Schulhof wies eine ganze Reihe bezaubernder, lauschiger Fleckchen auf, die die Fantasie anregten: versteckte Winkel zwischen den Bäumen, geschützte Wege, ein winziges, kindgerechtes Labyrinth.
Als Jane sich von Ziggy verabschiedet hatte, marschierte er Hand in Hand mit Chloe in eines der Klassenzimmer, sein kleines Gesicht erhitzt und glücklich.
Jane ging gut gelaunt und ebenfalls mit geröteten Wangen zum Auto zurück, wo Madeline ihr vom Beifahrersitz zuwinkte und sie anstrahlte, als wäre sie ihre beste Freundin, und Jane hatte gespürt, wie etwas nachließ, schwächer wurde, sich löste.
Jetzt saß sie neben Madeline im Blue Blues, und während sie auf ihren Kaffee wartete, schaute sie aufs Meer hinaus und genoss den Sonnenschein auf ihrem Gesicht.
Vielleicht würde der Umzug auf diese Halbinsel der Anfang – oder besser noch das Ende – von etwas sein.
»Meine Freundin Celeste wird bald kommen«, sagte Madeline. »Vielleicht haben Sie sie in der Schule gesehen, sie hat zwei Jungs, zwei kleine blonde Bengel. Sie ist groß, blond, wunderschön und nervös.«
»Ich glaube nicht, dass sie mir begegnet ist«, erwiderte Jane. »Wieso ist sie nervös, wenn sie groß, blond und wunderschön ist?«
»Ganz genau«, sagte Madeline, als beantwortete das die Frage. »Sie hat außerdem einen unglaublich attraktiven, reichen Mann. Die beiden halten immer noch Händchen. Und nett ist er auch. Er kauft Geschenke für mich. Ehrlich, ich weiß wirklich nicht, warum ich ihr nicht längst die Freundschaft gekündigt habe.« Sie schaute auf ihre Uhr. »Sie ist ein hoffnungsloser Fall. Nie pünktlich! Egal, dann werde ich Sie eben so lange ausquetschen.« Sie beugte sich vor und wandte ihre ganze Aufmerksamkeit Jane zu. »Sie sind neu in der Gegend, oder? Ich kann mich nicht erinnern, Sie jemals gesehen zu haben. Unsere Kinder sind im gleichen Alter, da sollte man doch denken, wir wären uns in der Mutter-Kind-Spielgruppe oder bei der Lesestunde für Kinder oder sonst wo mal über den Weg gelaufen.«
»Wir ziehen im Dezember hierher«, erwiderte Jane. Offenbar hatte Madeline das eben nicht mitbekommen. »Im Moment wohnen wir in Newtown, aber ich dachte, es wäre sicher schön, mal eine Weile am Meer zu leben. Ich habe mich … na ja … aus einer Laune heraus dazu entschlossen, könnte man sagen.«
Dieses »aus einer Laune heraus« war ihr urplötzlich in den Sinn gekommen. Es war ihr unangenehm und verschaffte ihr gleichzeitig ein befriedigendes Gefühl. Sie wollte den Umzug als spontane Eingebung hinstellen, so als wäre sie tatsächlich eine spontane junge Frau. Sie erzählte Madeline, dass sie ein paar Monate zuvor mit Ziggy an den Strand gefahren sei, an einem Mehrfamilienhaus ein Zu-vermieten-Schild entdeckt und gedacht habe: »Warum nicht in Strandnähe wohnen?«
Das war schließlich nicht gelogen. Jedenfalls nicht ganz.
Nur ein Ausflug an den Strand, hatte sie sich immer und immer wieder während der Fahrt auf der langen, kurvenreichen Straße gesagt, als belauschte jemand ihre Gedanken und hinterfragte ihre Beweggründe.
Pirriwee Beach zählte zu den zehn schönsten Stränden der Welt. Das hatte sie irgendwo gelesen. Ihr Sohn hatte es verdient, einen der zehn schönsten Strände der Welt zu sehen.
Ihr wunderschöner, außergewöhnlicher Sohn. Sie verspürte ein schmerzliches Ziehen in der Brust, sooft sie ihn im Rückspiegel des Wagens anschaute.
Was sie Madeline nicht erzählte, war, dass eine Stimme in ihrem Kopf lautlos um Hilfe schrie, als Ziggy und sie Hand in Hand, verschwitzt und voller Sand, zum Auto zurückgingen. Es war, als flehte sie im Stillen um etwas – eine Lösung, ein Heilmittel, eine Schonfrist. Eine Schonfrist wovor? Ein Heilmittel wofür? Eine Lösung wofür? Ihr Atem wurde flach. Sie konnte Schweißperlen am Haaransatz spüren.
Dann sah sie das Zu-vermieten-Schild. Ihr Mietvertrag für ihre Wohnung in Newtown war abgelaufen. Diese Zwei-Zimmer-Wohnung lag zwar in einem hässlichen, seelenlosen Wohnblock aus rotem Backstein, aber nur fünf Minuten zu Fuß vom Strand entfernt.
»Was würdest du davon halten, wenn wir hierherzögen?«, fragte sie Ziggy.
Seine Augen leuchteten auf, und plötzlich schien diese Wohnung die Lösung für alles zu sein, was mit ihr nicht stimmte. Sprach man nicht von »Tapetenwechsel«? Vielleicht wäre ein Tapetenwechsel genau das Richtige für Ziggy und sie.
Sie erzählte Madeline auch nicht, dass sie, seit Ziggy ein Baby gewesen war, alle sechs Monate innerhalb von Sydney umzogen war, immer auf der Suche nach einem Leben, das funktionierte. Sie erzählte ihr nicht, dass sie möglicherweise in all den Jahren mit jedem Umzug ein Stück näher an Pirriwee Beach herangerückt war.
Und sie erzählte Madeline auch nicht, dass ihr, nachdem sie im Maklerbüro den Mietvertrag unterschrieben und wieder auf der Straße gestanden hatte, zum ersten Mal aufgefallen war, was für Menschen auf der Halbinsel wohnten – Menschen mit golden schimmernder Haut und mit Strandhaaren –, und sie hatte an ihre eigenen käsigen Beine unter der Jeans gedacht, und dann hatte sie an ihre Eltern gedacht und daran, wie nervös sie sein würden, wenn sie auf dieser kurvenreichen Straße zu ihr fahren müssten. Ihr Dad würde das Lenkrad so fest umklammert halten, dass seine Knöchel weiß hervortreten würden, aber die beiden würden die Reise dennoch klaglos auf sich nehmen. Und in diesem Moment war Jane plötzlich überzeugt gewesen, einen wirklich schweren, verurteilenswerten Fehler begangen zu haben. Aber jetzt war es zu spät.
»Tja, und da bin ich nun«, endete sie lahm.
»Es wird Ihnen hier bestimmt gefallen«, versicherte Madeline voller Begeisterung. Sie schob die Eispackung auf ihrem Knöchel ein wenig hin und her und zuckte zusammen. »Au. Surfen Sie? Und Ihr Mann? Oder Partner, sollte ich wohl besser sagen. Oder Freund? Freundin? Ich bin für alles offen.«
»Kein Mann«, erwiderte Jane. »Kein Partner. Nur ich. Ich bin eine alleinerziehende Mum.«
»Tatsächlich?«, sagte Madeline in einem Ton, als hätte Jane gerade etwas unglaublich Verwegenes und Aufregendes verkündet.
»Ja, tatsächlich.« Jane lächelte dümmlich, zumindest kam es ihr selbst so vor.
»Wissen Sie, die Leute vergessen das immer, aber ich war auch eine alleinerziehende Mutter.« Madeline setzte sich aufrecht hin und reckte das Kinn, als spräche sie zu einer Menschenmenge, die nicht ihrer Meinung war. »Mein Mann hat mich verlassen, als meine älteste Tochter ein Baby war. Abigail. Sie ist vierzehn. Ich war damals noch ziemlich jung, so wie Sie. Erst sechsundzwanzig. Und trotzdem dachte ich, ich hätte meine besten Jahre hinter mir. Das war ganz schön hart. Es ist hart, eine alleinerziehende Mutter zu sein.«
»Na ja, ich habe meine Mum und …«
»Ja, ja, natürlich. Ich hatte auch Hilfe, so ist es nicht. Ich hatte meine Eltern, die mir unter die Arme griffen. Aber, großer Gott, es gab Nächte, als Abigail krank war oder als es mir nicht gut ging, oder, schlimmer noch, als wir beide krank waren, da … Na, egal.« Madeline verstummte abrupt und lächelte strahlend. »Mein Ex hat wieder geheiratet. Die beiden haben ein Mädchen ungefähr in Chloes Alter, und Nathan ist Vater des Jahres geworden. Das gibt es oft bei Männern, wenn sie eine zweite Chance bekommen. Abigail hält ihren Vater für einen wundervollen Menschen. Ich bin die Einzige, die noch einen Groll auf ihn hat. Es heißt, man soll seine negativen Gefühle loslassen, aber … ich weiß auch nicht, ich liebe meinen Groll. Ich pflege ihn wie ein kleines Haustier.«
»Ich hab’s auch nicht so mit dem Vergeben«, sagte Jane.
Madeline grinste und zeigte mit ihrem Teelöffel auf sie: »Gut für Sie. Vergiss nichts, vergib nichts. Das ist mein Motto.«
Jane war sich nicht sicher, ob sie einen Witz machte.
»Und was ist mit Ziggys Dad?«, fuhr Madeline fort. »Gibt es den irgendwo?«
Jane zuckte nicht einmal mit der Wimper. Sie hatte mehr als fünf Jahre Zeit gehabt, sie war richtig gut darin geworden. Sie spürte, wie sie zu völliger Regungslosigkeit erstarrte.
»Nein. Wir waren eigentlich nicht zusammen.« Der Satz ging ihr einwandfrei über die Lippen. »Ich kannte nicht mal seinen Namen. Es war eine …« Stopp. Pause. Den Blick abwenden, als könnte man dem anderen nicht in die Augen sehen. »Na ja, eine einmalige Angelegenheit.«
»Sie meinen, ein One-Night-Stand?«, fragte Madeline mitfühlend.
Jane hätte vor lauter Verblüffung fast laut aufgelacht. Die meisten Leute, vor allem jene in Madelines Alter, reagierten mit einem feinen, leicht angewiderten Gesichtsausdruck, der besagen wollte: »Ich verstehe, und ich finde das total cool, aber jetzt muss ich Sie in eine andere Schublade stecken.« Diese Abneigung kränkte Jane nicht im Mindesten. Sie fand es ja selbst widerlich. Sie wollte nur, dass das Thema damit ein für alle Mal abgeschlossen war, und meistens war das auch der Fall. Ziggy war Ziggy. Es gab keinen Dad. Können wir jetzt weitermachen?
»Warum sagst du nicht einfach, du hast dich von seinem Vater getrennt?«, hatte ihre Mutter früher gefragt.
»Lügen machen die Geschichte nur komplizierter«, hatte Jane geantwortet. Ihre Mutter hatte keine Erfahrung im Lügen. »Doch auf diese Weise ist die Unterhaltung beendet.«
»Ich erinnere mich gut an One-Night-Stands«, murmelte Madeline wehmütig. »Was ich in den Neunzigerjahren so alles angestellt habe! Du meine Güte! Hoffentlich findet Chloe das nie heraus! Oh, Elend! Hat’s denn wenigstens Spaß gemacht?«
Jane verstand die Frage im ersten Moment nicht. Dann begriff sie: Madeline wollte wissen, ob ihr One-Night-Stand Spaß gemacht habe.
Einen Augenblick lang war sie wieder in diesem gläsernen Lift, der lautlos im Inneren des Hotels nach oben glitt. In der einen Hand hielt er den Hals einer Champagnerflasche. Die andere lag auf Janes Kreuz, sie spürte den Druck seiner Finger, als er sie näher an sich presste. Sie lachten beide wie verrückt. Tiefe Falten rings um seine Augen. Sie hatte weiche Knie vor lauter Lachen und Begierde. Teure Düfte.
Jane räusperte sich, bevor sie antwortete: »Ja, ich glaube schon, dass es Spaß gemacht hat.«
»Entschuldigung«, sagte Madeline. »Das war eine dumme Frage. Das kommt daher, dass ich an meine eigene vergeudete Jugend gedacht habe. Oder vielleicht, weil Sie so jung sind und ich so alt bin und cool sein will. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?«
»Vierundzwanzig«, antwortete Jane.
»Vierundzwanzig«, hauchte Madeline. »Ich werde heute vierzig. Aber das habe ich Ihnen schon erzählt, nicht wahr? Sie denken wahrscheinlich, Sie werden nie vierzig werden, stimmt’s?«
»Na ja, ich hoffe, dass ich die vierzig erreichen werde«, erwiderte Jane.
Ihr fiel nicht zum ersten Mal auf, wie besessen Frauen mittleren Alters von diesem Thema waren. Sie lachten über das Älterwerden, stöhnten darüber, redeten ständig darüber, als wäre der Prozess des Alterns ein schwieriges Rätsel, das sie zu lösen versuchten. Was faszinierte sie nur so sehr daran? Die Freundinnen ihrer Mutter schienen kein anderes Gesprächsthema zu haben – jedenfalls nicht in Janes Gegenwart. »Ach, du bist so jung und wunderschön, Jane!« Das stimmte eindeutig nicht, aber anscheinend dachten sie, das eine ziehe das andere nach sich: Wer jung war, war automatisch wunderschön. »Ach, du bist so jung, Jane, du kannst mein Telefon/meinen Computer/meinen Fotoapparat bestimmt reparieren!« Dabei waren viele der Freundinnen ihrer Mutter technisch begabter als Jane. »Ach, du bist so jung, Jane, du hast so viel Energie!« In Wirklichkeit war sie so müde, so unglaublich müde.
»Und wovon leben Sie?«, fragte Madeline besorgt und setzte sich kerzengerade hin, als wäre das ein Problem, das sie auf der Stelle lösen musste. »Arbeiten Sie?«
Jane lächelte ihr zu. »Ich bin Buchhalterin und selbstständig. Ich habe mittlerweile einen guten Kundenstamm, viele Kleinunternehmer. Ich bin schnell, die Buchhaltung ist im Handumdrehen erledigt. Davon kann man leben.«
»Kluges Mädchen«, sagte Madeline anerkennend. »Als Abigail klein war, habe ich auch für unseren Lebensunterhalt gearbeitet. Meistens jedenfalls. Ab und zu hat Nathan sich aufgerafft und einen Scheck geschickt. Es war nicht immer einfach, für mich und meine Tochter zu sorgen, aber andererseits auch irgendwie befriedigend. Man hat dann so eine ›Leck-mich-doch‹-Haltung. Sie wissen schon, was ich meine.«
»Klar«, sagte Jane.
Es gab allerdings niemanden, den sie als alleinerziehende Mutter mit einer »Leck-mich-doch«-Haltung hätte beeindrucken können. Jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie Madeline es meinte.
»Sie werden eine von den ganz jungen Vorschulmüttern sein, das steht fest«, murmelte Madeline nachdenklich. Sie nippte an ihrem Kaffee und grinste boshaft. »Sie sind sogar jünger als die reizende neue Frau meines Exmannes. Sie müssen mir versprechen, dass Sie sich nicht mit ihr anfreunden! Ich hab Sie zuerst entdeckt.«
»Ich glaube kaum, dass ich ihr begegnen werde«, erwiderte Jane verwirrt.
»Oh doch, das werden Sie.« Madeline verzog das Gesicht. »Ihre Tochter wird zur gleichen Zeit eingeschult wie Chloe. Können Sie sich das vorstellen?«
Nein, das konnte Jane sich nicht vorstellen.
»Alle Vorschulmütter werden sich zum Kaffee treffen, und die Frau meines Ex wird mir gegenübersitzen und ihren Kräutertee schlürfen. Keine Bange, wir werden uns nicht an die Gurgel gehen. Es geht alles furchtbar langweilig und gesittet und schrecklich erwachsen zu. Bonnie gibt mir zur Begrüßung sogar einen Kuss auf die Wange. Sie steht auf Yoga und Chakras und solchen Mist. Sie kennen doch diese Geschichten von den Kindern, die ihre böse Stiefmutter hassen? Meine Tochter liebt ihre Stiefmutter. Bonnie ist so ruhig und gelassen, wissen Sie. Das Gegenteil von mir. Sie spricht mit sanfter … leiser … melodischer … Stimme. Wenn ich das höre, könnte ich glatt die Wände hochgehen!«
Jane musste über Madelines Imitation einer sanften, leisen, melodischen Stimme lachen.
»Ich denke, Sie werden sich mit Bonnie anfreunden«, fuhr Madeline fort. »Man kann sie einfach nicht hassen. Ich bin wirklich gut darin, andere zu hassen, aber sogar mir fällt es schwer. Ich muss mich richtig anstrengen!«
Sie legte die Eispackung auf ihrem Knöchel noch einmal anders hin.
»Wenn Bonnie erfährt, dass ich mit dem Fuß umgeknickt bin, wird sie mir was zu essen vorbeibringen. Ihr ist jeder Vorwand recht, um mir eine selbst gekochte Mahlzeit zu bringen. Wahrscheinlich, weil Nathan ihr erzählt hat, dass ich eine lausige Köchin war, und jetzt will sie auftrumpfen. Andererseits ist das Schlimmste an ihr, dass das vielleicht nicht einmal ihre Absicht ist. Sie ist einfach grauenvoll nett. Am liebsten würde ich ihre Mahlzeiten postwendend in den Müll werfen, doch sie schmecken einfach viel zu gut. Mein Mann und meine Kinder würden mich umbringen.« Madeline blickte auf. Ihr Gesichtsausdruck änderte sich. Sie strahlte und winkte. »Da ist sie ja endlich! Celeste! Hier bin ich! Guck mal, was ich angestellt habe!«
Jane schaute ebenfalls auf, und sofort rutschte ihr das Herz in die Hose.
Es sollte eigentlich keine Rolle spielen. Sie wusste, dass es keine Rolle spielen sollte. Aber Tatsache war, dass manche Menschen so unakzeptabel, so schmerzlich schön waren, dass man sich regelrecht für seine offenkundige Minderwertigkeit schämte. So sollte eine Frau aussehen. Genau so. Sie hatte recht und Jane unrecht.
»Du bist ein richtig fettes, hässliches, kleines Mädchen«, flüsterte ihr eine Stimme in ihrem Inneren zu. Sie konnte ihren heißen, fauligen Atem spüren.
Jane schauderte und versuchte dann zu lächeln, als die entsetzlich attraktive Frau auf ihren Tisch zusteuerte.
*
Thea: Sie wissen inzwischen wahrscheinlich schon, dass Bonnie mit Madelines Exmann Nathan verheiratet ist. Das macht die Sache kompliziert. Vielleicht sollten Sie da mal nachhaken. Ich möchte Ihnen natürlich nicht vorschreiben, wie Sie Ihren Job zu machen haben.
Bonnie: Das hatte nicht das Geringste mit der Sache zu tun. Unsere Beziehung war durch und durch freundschaftlich. Ich habe erst heute Morgen eine vegetarische Lasagne für ihren armen Mann auf die Türschwelle gestellt.
Gabrielle: Ich war vorher noch nie in der Schule gewesen. Ich kannte niemanden. »Das Gemeinschaftsgefühl wird bei uns großgeschrieben«, sagte die Schulleiterin zu mir. Bla, bla, bla. Wissen Sie, was ich dachte, als ich am Infotag das Schulgelände betrat? Cliquenwirtschaft. Das dachte ich. Überall Gruppenbildung. Es wundert mich überhaupt nicht, dass es am Schluss einen Toten gab. Na ja, das ist vielleicht übertrieben. Ein klein wenig überrascht mich das schon.
5
Celeste stieß die Glastür des Blue Blues auf und sah Madeline sofort. An ihrem Tisch saß ein kleines, dünnes, junges Mädchen in einem blauen Jeansrock und einem schlichten weißen T-Shirt mit V-Ausschnitt. Celeste kannte die junge Frau nicht. Die Enttäuschung darüber, dass Madeline nicht allein war, versetzte ihr einen Stich. »Nur wir beide«, hatte Madeline gesagt.
Celeste korrigierte ihre Erwartungen an diesen Vormittag. Sie holte tief Luft. In letzter Zeit fiel ihr etwas Seltsames auf, wenn sie sich in Gegenwart mehrerer Personen befand: Sie wusste nicht mehr so genau, wie es ging, sie selbst zu sein. Sie ertappte sich dabei, dass sie dachte: Habe ich gerade zu laut gelacht? Habe ich vergessen zu lachen? Habe ich mich wiederholt?
War sie jedoch nur mit Madeline zusammen, war alles in Ordnung. Ihre Persönlichkeit fühlte sich intakt an, wenn es nur sie beide waren. Das lag daran, dass sie Madeline schon seit langer Zeit kannte.
Vielleicht brauchte sie ein Stärkungsmittel. Das hätte ihre Großmutter ihr geraten. Was war ein Stärkungsmittel?
Celeste schlängelte sich zwischen den Tischen hindurch. Die beiden Frauen hatten sie noch nicht bemerkt. Sie unterhielten sich angeregt. Celeste konnte das Profil des Mädchens sehen. Sie war zu jung, um die Mutter eines Schulkindes zu sein. Wahrscheinlich war sie ein Kindermädchen oder ein Au-pair. Sicher ein Au-pair. Vielleicht aus Europa? Mit wenig Englischkenntnissen? Das würde erklären, warum sie ein wenig steif und angespannt dasaß, als müsste sie sich konzentrieren. Aber es konnte natürlich auch gut sein, dass sie gar nichts mit der Schule zu tun hatte. Madeline bewegte sich mit Leichtigkeit durch mehrere Dutzend sich überlappender gesellschaftlicher Kreise, wobei sie sich nicht nur Freunde, sondern auch Feinde fürs Leben machte – wahrscheinlich mehr von Letzteren. Konflikte waren Madelines Lebenselixier; sie war nur glücklich, wenn sie sich aufregen konnte.
Als Madeline Celeste sah, strahlte sie. Das war eins der schönsten Dinge an ihrer Freundin: die Art und Weise, wie ihr Gesicht sich veränderte, wenn sie einen erblickte, so als gäbe es niemanden auf der Welt, den sie lieber sähe.
»Hallo, Geburtstagskind!«, rief Celeste.
Madelines Begleiterin fuhr herum. Sie hatte braune Haare, die sie schmerzlich straff aus der Stirn gekämmt hatte, als wäre sie beim Militär oder bei der Polizei.
»Was ist denn mit dir passiert, Madeline?«, fragte Celeste, als sie näher kam und sah, dass ihre Freundin das eine Bein hochgelegt hatte.
Sie lächelte dem Mädchen höflich zu, und die Kleine schien zusammenzuzucken, als hätte Celeste nicht gelächelt, sondern höhnisch gegrinst. (Oh Gott, sie hatte doch gelächelt, oder etwa nicht?)
»Das ist Jane«, sagte Madeline. »Sie ist mir am Straßenrand zu Hilfe gekommen, als ich mir bei dem Versuch, junges Leben zu retten, den Knöchel verknackst habe. Jane, das ist Celeste.«
»Hi«, sagte Jane.
Ihr Gesicht wirkte seltsam nackt, empfindlich, als wäre es zu kräftig geschrubbt worden. Sie kaute Kaugummi, aber ihre Kiefer bewegten sich ganz verhalten, als sollte niemand es sehen.
»Jane ist eine neue Vorschulmutter«, erklärte Madeline, als Celeste sich setzte. »Genau wie du. Deshalb betrachte ich es als meine Pflicht, euch beide über die Schulpolitik an der Pirriwee Public aufzuklären. Das ist ein Minenfeld, Mädels. Ein Minenfeld, das kann ich euch sagen.«
»Schulpolitik?« Jane runzelte die Stirn und griff sich mit beiden Händen an den Pferdeschwanz, um ihn noch straffer zu ziehen. »Ich werde mich ganz bestimmt nicht in die Schulpolitik einmischen.«
»Ich auch nicht«, pflichtete Celeste ihr bei.
*
Jane sollte nie vergessen, wie leichtsinnig sie das Schicksal an jenem Tag herausgefordert hatte. »Ich werde mich ganz bestimmt nicht in die Schulpolitik einmischen«, hatte sie gesagt, und irgendjemand dort oben musste es gehört haben. Und ihre Einstellung gefiel diesem Jemand gar nicht. Viel zu selbstbewusst. »Abwarten«, hatte er gesagt, sich zurückgelehnt und sich köstlich auf ihre Kosten amüsiert.
*
Celeste schenkte Madeline ein Set Champagnergläser aus Waterford-Kristall zum Geburtstag.
»Oh mein Gott, die sind ja wundervoll! Ich liebe diese Kristallgläser.« Madeline nahm vorsichtig eins aus dem Karton, hielt es gegen das Licht und bewunderte das exquisite Muster – Reihen winziger Monde. »Die müssen ja ein kleines Vermögen gekostet haben.«
Sie hätte fast hinzugefügt: »Ein Glück, dass du so reich bist, Liebes!«, konnte sich aber gerade noch bremsen. Wären sie beide allein gewesen, hätte sie es gesagt, doch Jane ging es als alleinerziehender junger Mutter finanziell sicher nicht besonders gut, und außerdem gehörte es sich nicht, in Gegenwart Dritter über Geld zu sprechen. Das wusste sie sehr wohl. (Letzteres sagte sie im Stillen zu ihrem Mann, trotzig, weil er sie ständig an die gesellschaftlichen Konventionen erinnerte, über die sie sich so beharrlich hinwegsetzte.)
Warum mussten sie einen solchen Eiertanz vollführen, wenn es um Celestes Geld ging? Als wäre Reichtum eine peinliche Krankheit. Mit Celestes Schönheit war es genau das Gleiche. Fremde warfen Celeste die gleichen verstohlenen Blicke zu wie Menschen, denen ein Arm oder ein Bein fehlte. Sooft Madeline eine Bemerkung über Celestes Aussehen machte, reagierte diese fast beschämt. »Sch!«, machte sie jedes Mal und schaute sich ängstlich um, ob irgendjemand sie möglicherweise belauscht hatte. Alle wollten reich und schön sein, aber die wahrhaft Reichen und Schönen mussten so tun, als wären sie nicht anders als alle anderen. Oh, es war schon eine komische alte Welt!
»Also, Mädels, zurück zur Schulpolitik«, sagte Madeline und packte das Glas behutsam wieder in den Karton. »Fangen wir ganz oben an, mit den Blonden Bobs.«
»Blonde Bobs?«, wiederholte Celeste verwirrt, als ginge es darum, anschließend einen Test zu absolvieren.
»Ganz genau. Die Blonden Bobs regieren die Schule. Wenn du der Schulpflegschaft angehören willst, um mitreden zu können, musst du einen blonden Bob haben.« Madeline demonstrierte mit einer Handbewegung, wie die erforderliche Frisur auszusehen hatte. »Das ist ein ungeschriebenes Gesetz.«
Jane lachte auf, kurz und trocken, und Madeline wünschte sich sehnlichst, sie noch einmal zum Lachen zu bringen.
»Und, sind sie nett, diese Frauen?«, fragte Celeste. »Oder sollten wir lieber einen Bogen um sie machen?«
»Na ja, sie meinen es gut«, antwortete Madeline. »Sie meinen es sogar sehr gut. Sie sind wie … hm … tja … wie sind sie eigentlich? Sie sind so was wie Aufsichtsmütter. Sie nehmen ihre Rolle als Mütter von Schulkindern sehr ernst. Es ist ihre Religion, könnte man sagen. Es sind fundamentalistische Mütter.«
»Gibt es unter den Vorschulmüttern Blonde Bobs?«, fragte Jane.
»Lassen Sie mich überlegen«, sagte Madeline. »Ja, Harper. Sie ist der Blonde Bob schlechthin. Sie gehört der Schulpflegschaft an, und sie hat eine unglaublich begabte Tochter mit einer leichten Nussallergie. So liegt sie also voll im Trend, die Glückliche.«
»Jetzt hör aber auf, Madeline!«, sagte Celeste tadelnd. »Ein Kind mit einer Nussallergie zu haben ist nicht lustig.«
»Du hast recht«, räumte Madeline ein. Sie übertrieb gewaltig, weil sie Jane zum Lachen bringen wollte. »Ich mach ja nur Spaß. Okay, wer noch? Carol Quigley. Sie hat einen Sauberkeitsfimmel. Sie rennt ständig mit einer Sprühflasche Putzmittel und einem Lappen ins Klassenzimmer.«
»Das ist nicht wahr«, widersprach Celeste.
»Und ob das wahr ist!«
»Und was ist mit den Vätern?«, fragte Jane, riss ein Päckchen Kaugummi auf und schob sich einen unauffällig, als wäre es verboten, in den Mund.
Sie schien regelrecht süchtig nach Kaugummi zu sein, aber sie kaute so dezent darauf herum, dass man es eigentlich nicht bemerkte.
Sie hatte Madeline nicht angesehen, als sie die Frage stellte. Hoffte sie vielleicht, einen alleinerziehenden Vater kennenzulernen?
»Na ja, ich hab gehört, dass wir dieses Jahr mindestens einen Vorschulvater haben, der zu Hause bleibt und sich um Kinder und Haushalt kümmert«, sagte Madeline. »Seine Frau ist ein hohes Tier in der Geschäftswelt. Jackie irgendwas. Ich glaube, sie ist Vorstandsvorsitzende einer Bank.«
»Doch nicht etwa Jackie Montgomery?«, warf Celeste ein.